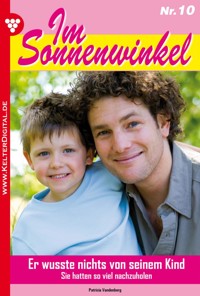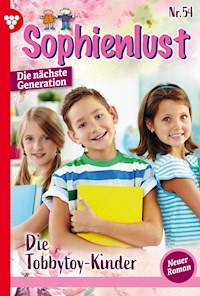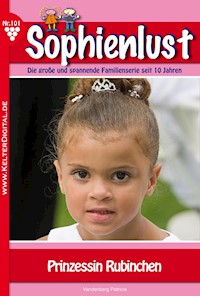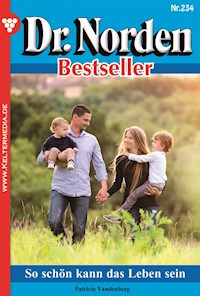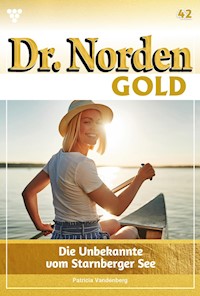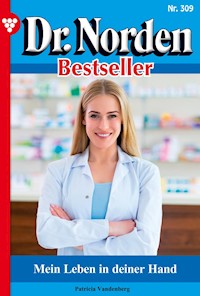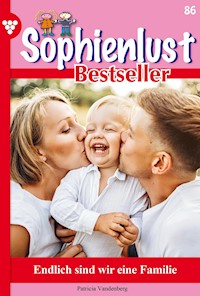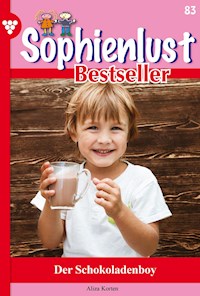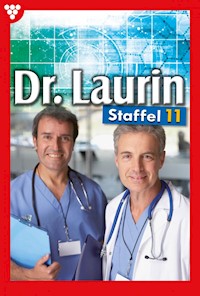
30,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dr. Laurin Staffel
- Sprache: Deutsch
Dr. Laurin ist ein beliebter Allgemeinmediziner und Gynäkologe. Bereits in jungen Jahren besitzt er eine umfassende chirurgische Erfahrung. Darüber hinaus ist er auf ganz natürliche Weise ein Seelenarzt für seine Patienten. Die großartige Schriftstellerin Patricia Vandenberg, die schon den berühmten Dr. Norden verfasste, hat mit den 200 Romanen Dr. Laurin ihr Meisterstück geschaffen. Patricia Vandenberg ist die Begründerin von "Dr. Norden", der erfolgreichsten Arztromanserie deutscher Sprache, von "Dr. Laurin", "Sophienlust" und "Im Sonnenwinkel". Sie hat allein im Martin Kelter Verlag fast 1.300 Romane veröffentlicht, Hunderte Millionen Exemplare wurden bereits verkauft. In allen Romangenres ist sie zu Hause, ob es um Arzt, Adel, Familie oder auch Romantic Thriller geht. Ihre breitgefächerten, virtuosen Einfälle begeistern ihre Leser. Geniales Einfühlungsvermögen, der Blick in die Herzen der Menschen zeichnet Patricia Vandenberg aus. Sie kennt die Sorgen und Sehnsüchte ihrer Leser und beeindruckt immer wieder mit ihrer unnachahmlichen Erzählweise. Ohne ihre Pionierarbeit wäre der Roman nicht das geworden, was er heute ist. E-Book 101: Wie ein Lied in meinem Herzen E-Book 102: Was hat mein Bruder dir angetan? E-Book 103: Eine Begegnung, die alles verändert E-Book 104: Filmsternchen Nathalie – nicht traurig sein E-Book 105: Warum habe ich ihm vertraut? E-Book 106: Zur Lüge gezwungen E-Book 107: Gefangen in tiefster Nacht E-Book 108: Eine falsche Diagnose brachte es ans Licht E-Book 109: Ein Skandal in der Prof.-Kayser-Klinik? E-Book 110: Steht es bedenklich um unseren Chef? E-Book 1: Wie ein Lied in meinem Herzen E-Book 2: Was hat mein Bruder dir angetan? E-Book 3: Eine Begegnung, die alles verändert E-Book 4: Filmsternchen Nathalie – nicht traurig sein E-Book 5: Warum habe ich ihm vertraut? E-Book 6: Zur Lüge gezwungen E-Book 7: Gefangen in tiefster Nacht E-Book 8: Eine falsche Diagnose brachte es ans Licht E-Book 9: Ein Skandal in der Prof.-Kayser-Klinik? E-Book 10: Steht es bedenklich um unseren Chef?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1271
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Wie ein Lied in meinem Herzen
Was hat mein Bruder dir angetan?
Eine Begegnung, die alles verändert
Filmsternchen Nathalie – nicht traurig sein
Warum habe ich ihm vertraut?
Zur Lüge gezwungen
Gefangen in tiefster Nacht
Eine falsche Diagnose brachte es ans Licht
Ein Skandal in der Prof.-Kayser-Klinik?
Steht es bedenklich um unseren Chef?
Dr. Laurin – Staffel 11 –E-Book 101-110
Patricia Vandenberg
Wie ein Lied in meinem Herzen
Roman von Vandenberg, Patricia
»Sieh nur!« Antonia Laurin zog ihren Mann ans Fenster und deutete hinaus. »Konstantin und Kaja haben für mich eingekauft.«
Dr. Leon Laurin beobachtete die Zwillinge, die mit Plastiktüten beladen auf das Haus zukamen. Der Arzt legte den Arm um die Schultern seiner Frau und sagte lakonisch: »Und wie immer sind sie geteilter Meinung.«
Gleich darauf flog die Tür auf, und Kaja rief vorwurfsvoll: »Du hättest ja Papiertüten verlangen können. Außerdem sind sie billiger!«
»Warum denn immer ich?«, maulte Konstantin. »Du hast ja eingekauft. Ich durfte es nur nach Hause tragen. Außerdem wollte ich dir mit meinen Worten klarmachen, dass Papiertüten umweltfreundlicher sind als dieses Plastikzeug.«
Die Zwillinge begrüßten ihre Eltern mit einem lässigen »Hallo«, und Kaja begann sofort, sich über ihren Bruder zu beschweren.
»Den ganzen Weg über motzt er schon. Bloß wegen der paar albernen Tüten.«
»Ist doch auch wahr!«, wehrte sich Konstantin. »Jeder redet von Umweltschutz, und dann verlangt sie das Zeug hier.« Damit warf er einen abfälligen Blick auf die Tüten.
»Was würdet ihr davon halten, wenn ihr in Zukunft eine der Einkaufstaschen nehmen würdet, die in der Küche stehen?«, fragte Antonia Laurin.
»Die haben wir vergessen«, antworteten die Zwillinge wie aus einem Mund und brachten die Lebensmittel in die Küche.
»Na, wenigstens sind sie sich in diesem Punkt einig«, lachte Leon Laurin. »Eigentlich wollte ich dir gerade erzählen …«
»Was ist denn das?« Konstantin war zurückgekommen und hob lauschend den Kopf.
Hinter ihm tauchte nun auch Kaja auf. »Kyra übt«, stellte sie fest.
»Freiwillig?« Konstantin schaute seine Eltern überrascht an.
Auch Antonia und Leon Laurin hörten das Klavierspiel, das aus dem Obergeschoss kam und das von der zarten Stimme ihrer jüngsten Tochter begleitet wurde.
»Warum sollte sie nicht freiwillig üben?«, fragte Leon Laurin. »Schließlich war sie es, die Klavierunterricht haben wollte.«
»Seit wann singt man zu Sonaten?«, wollte Konstantin wissen.
Bevor die Eltern etwas erwidern konnten, brachen Gesang und Klavierspiel ab. Man hörte lautes Klatschen, dann Kyras empörte Stimme. Gleich darauf schlug eine Tür, und die Kleine kam mit hochrotem Kopf zu ihren Eltern ins Wohnzimmer gelaufen.
»Kevin soll gefälligst in seinem Zimmer bleiben, wenn ich übe!«, rief sie empört aus. »Es geht ihn überhaupt nichts an, ob ich dazu singe oder nicht.«
»Das hört er aber auch in seinem Zimmer«, gab Konstantin zu bedenken. »Wieso willst du ihn eigentlich um diesen Genuss bringen?« Er beugte sich zu seiner kleinen Schwester hinunter und frotzelte: »Du bist also entschlossen, Sängerin zu werden?«
»Lass die Kleine doch in Ruhe!«, rief Kaja, worauf sich Kyra zu ihr umdrehte und rief: »Ich bin gar nicht mehr so klein! Saskia Neumann ist so alt wie ich und hat sogar schon einmal vorsingen dürfen.«
In diesem Augenblick erscholl von der Tür her ein recht flegelhaftes Lachen, und Kyra stürzte sich mit geballten Fäusten auf ihren älteren Bruder Kevin, der ihre Arme in der Luft auffing und sich dann mit ihr herumbalgte.
»Ich habe unsere kleine Diva gestört, und jetzt ist sie sauer«, sagte er. »Dabei habe ich sogar applaudiert.«
»Ich glaube, es reicht jetzt.« Leon Laurin nahm Kyra tröstend in die Arme.
»Kevin soll nur nicht denken, dass er mich auslachen kann!«, rief die Kleine leidenschaftlich. »Er darf sich nicht alles erlauben, nur, weil er zwei Jahre älter ist als ich.«
»Aber wir wollten Kyra doch bloß ein bisschen hochnehmen«, sagte Kaja entschuldigend.
»Ist ja schon gut.« Antonia Laurin legte versöhnlich den Arm um ihre Große. »Es gefällt uns nur nicht, wenn ihr euch immer die Kleinste dazu aussucht. Was ist schon dabei, wenn sich Kyra an der kleinen Saskia Neumann ein Vorbild nimmt?«
»Ich habe dir vorhin übrigens auch zugehört.« Leon Laurin streichelte zärtlich über die Wange seiner Tochter. »Und ich muss sagen, dass es mir gefallen hat.«
»Aber die anderen haben mich ausgelacht«, beharrte Kyra schmollend.
»Hast du nicht gehört, was Kaja sagte?«, fragte ihre Mutter. »Sie wollten dich ja nur hochnehmen. Ich meine jedenfalls, du solltest weiterüben und auch dazu singen, wenn dir danach zumute ist.«
Leon Laurin fuhr Kevin durch das wirre Haar. Dann wandte er sich wieder an seine Frau. »Eigentlich hatte ich vor, dir schon vor einer halben Stunde von Saskia Neumann zu erzählen.«
»Die kleine Sängerin?« Kyra fuhr wie elektrisiert auf. »Hast du sie seit dem Liederabend wieder einmal gesehen?«
»Ja. Heute wurde sie zu uns in die Klinik gebracht«, antwortete ihr Vater und schaute seine Frau an. »Appendizitis.«
»Akut?«, fragte Antonia Laurin besorgt.
»Ich fürchte, ja. Wir werden schon bald operieren müssen.«
»Hat sie schon mal gesungen?«, fragte Kyra.
»Das kann ich mir nicht vorstellen«, meinte Kevin. »Wenn sie Schmerzen hat, wird ihr das Singen vergangen sein.«
»Aber wenn Vati sie behandelt, kann er ihr doch eine Spritze geben«, gab Kyra mit kindlicher Logik zu bedenken. »Dann hat sie keine Schmerzen mehr.«
»So einfach ist das nicht«, antwortete Dr. Laurin seiner Jüngsten ernsthaft. »Außerdem sind ihre Eltern gerade auf Reisen. Ausgerechnet jetzt, wo das Kind sie dringend bräuchte«, fügte er gedankenvoll hinzu. »Saskia lebt während der Abwesenheit ihrer Eltern bei Bekannten – und nun ist das passiert.«
»Wenn ich irgendwie helfen kann«, Antonia schaute ihren Mann fragend an. »Ich meine, wenn sie so gar niemanden hat, der sich um sie kümmert, bin ich gern bereit, sie zu besuchen.«
»Das ist lieb von dir.« Dr. Laurin warf seiner Frau einen dankbaren Blick zu. »Aber das wird nicht nötig sein. Du kennst doch Schwester Marie. Sie arbeitet zwar normalerweise auf der Frauenstation, aber seit Saskia bei uns ist, hält sie sich oft in der Pädiatrie auf. Und die anderen Schwestern bemühen sich auch ganz besonders um das Kind.«
»Müsste man nicht die Eltern benachrichtigen?«, fragte Antonia.
»Das haben wir bereits getan.« Leon Laurin zuckte die Schultern. »Wir haben sie zwar nicht persönlich erreicht, aber ich hoffe, dass man ihnen unsere Nachricht überbringen wird. Mach dir keine Gedanken.« Liebevoll schaute er seine Frau an. »Saskia ist bei uns gut aufgehoben.«
»Das weiß ich, Leon.«
»Können Mami und ich sie vielleicht später mal besuchen?«, fragte Kyra. »Ich meine, wenn sie ihren Blinddarm heraus hat.«
»Dagegen ist nichts einzuwenden.« Dr. Laurin schaute auf die Uhr. »Ich werde noch einmal in die Klinik fahren.« Fragend schaute er seine Tochter an. »Soll ich Saskia etwas von dir ausrichten?«
»Ja. Sag’ ihr, dass wir alle bei ihrem Liederabend waren, und dass sie wunderschön gesungen hat. Vielleicht werde ich jetzt auch Sängerin.« Erwartungsvoll schaute sie von einem zum anderen, und während ihr Vater sich erhob, ohne etwas zu erwidern, meinte Antonia Laurin ernsthaft: »Warum nicht? Aber ich möchte dich nur daran erinnern, dass du letzte Woche noch Lehrerin werden wolltest …«
*
Schwester Marie wies der neuen Patientin ein Bett zu. »Haben Sie noch einen Wunsch?«, fragte sie und sah zur Uhr. »Ich möchte nämlich nur kurz zur Pädiatrie hinüber.
»Nein, danke. Ich richte mir schon alles ein.« Eliette Padburg lächelte der freundlichen Schwester zu. »Außerdem habe ich mir genügend Lesestoff mitgebracht. Vielleicht werde ich auch noch einen Spaziergang durch die Klinik machen. Schließlich muss ich ja nicht im Bett bleiben.«
»Noch nicht«, verbesserte Schwester Marie sie. »Nach Ihrer Operation sieht das allerdings anders aus.«
»Ich wünschte, sie wäre schon vorüber«, seufzte Eliette.
»Aber, Frau Padburg! Die Entfernung eines Myoms ist heutzutage für die Chirurgie Routine. Außerdem ist ein Myom eine gutartige Geschwulst, und für unseren Chef ist die Operation eine Kleinigkeit. Ungefähr wie eine Blinddarmoperation.« Aufmunternd lächelte sie der jungen Frau zu. Dann wandte sie sich um. »Bis später dann. Wenn etwas sein sollte, dann wenden Sie sich an Schwester Monika.«
Eliette Padburg räumte ihre Sachen in den Schrank und ging nachdenklich in dem kleinen Krankenzimmer auf und ab. Sie dachte an ihre Arbeit in einem Rechtsanwaltsbüro und an ihre Freundin Ruth, die sie beschworen hatte, nach der Erkennung des Myoms gleich in die Klinik zu gehen und die Sache nicht anstehen zu lassen.
Nachdenklich blieb die junge Frau am Fenster stehen und beobachtete den Sonnenuntergang. Eigentlich hatte sie in diesem Jahr ja nach Spanien fahren wollen. Aber wozu? Um allein am Strand zu liegen? Um abends allein essen zu gehen oder beim Tanzen männliche Blicke oder Berührungen zu fühlen, die sie kalt ließen?
Eliette seufzte. Seit sie die Liebe ihres Lebens geopfert hatte, wollte sie nichts mehr von Männern wissen. Das war jetzt zehn Jahre her. Sie hatte seither zwar einige Männer kennengelernt, doch die Beziehungen waren jedes Mal nur flüchtig gewesen, weil sie sie immer wieder abgebrochen hatte, noch ehe sie richtig begannen.
Entschlossen nahm sie eine Zeitschrift und blätterte darin. Dann legte sie sie wieder zur Seite und warf ihren Morgenmantel über. Plötzlich fiel ihr ein, dass Schwester Marie etwas von einer Kinderabteilung gesagt hatte. Entschlossen verließ sie ihr Zimmer.
Als ihr Schwester Monika begegnete, die sich ihr vorhin bereits vorgestellt hatte, fragte Eliette: »Spricht etwas dagegen, wenn ich mich ein bisschen umsehe?«
»Aber nein. Nur sollten Sie zum Fieber messen wieder hier sein.« Ein freundliches Lächeln, dann ging Eliette den Krankenhausflur entlang und stieß die Tür mit dem Schild »Pädiatrie« auf. Rechterhand lag die Säuglingsstation, die sie sehr interessierte. Als sie neugierig hineinsah, entdeckte sie zwei Reihen mit kleinen Bettchen, in denen die Neugeborenen lagen. Ganz andächtig schaute sie in die rosigen Gesichter, sah, wie sich die Händchen zu Fäusten ballten, kleine Münder nach der Nahrungsquelle suchten und heftig protestierten, als sie sie nicht fanden.
Eliette glaubte plötzlich, die Zeit würde sich zurückdrehen. Sie meinte, so ein kleines Wesen in ihren Armen zu halten, es zu wiegen und dennoch zu wissen, dass es keine glückliche Zukunft geben konnte. Sie merkte gar nicht, wie ihr die Tränen über die Wangen rollten.
Erst als sie eine Bewegung neben sich wahrnahm, schien sie wieder in die Gegenwart zurückzukehren. Ein kleines Mädchen stand neben ihr und schaute sie forschend an.
»Ob ich auch mal so klein war?«
Endlich fand Eliette ihre Sprache wieder. »Ganz bestimmt.« Sie lächelte der Kleinen zu und schaute in ein Paar blaue Kinderaugen, die sie ernsthaft anblickten. »Wie heißt du denn?«, fragte sie.
»Saskia«, antwortete das Kind, und seine Stimme klang ziemlich bedrückt, als es fortfuhr: »Morgen soll ich operiert werden. Dabei habe ich kaum noch Schmerzen.« Hoffnungsvoll schaute Saskia die junge Frau an und fragte: »Glaubst du, dass mir der Doktor trotzdem den Blinddarm herausnimmt?«
»Ich weiß nicht«, antwortete Eliette. »Das kann nur ein Arzt entscheiden.« Sie warf noch einen letzten Blick auf die Babys und ging dann neben Saskia her.
»Dort ist mein Zimmer.« Das Mädchen deutete auf eine der Türen und sagte: »Ich habe eine Puppe, die sieht genauso aus wie die Babys. Meine Mami hat sie mir zu meinem zehnten Geburtstag geschenkt. Willst du sie sehen?«
Eliette nickte zustimmend und sah nachdenklich auf das Kind nieder. Sie überlegte, warum die Kleine ihr so bekannt und vertraut vorkam.
Als sie das Zimmer betraten, rief sie spontan: »Hast du aber viele Spielsachen!« Sie beugte sich zu einem Teddybären hinunter, der ziemlich groß war und auf dem Stuhl saß. Dann zeigte ihr Saskia stolz ihre Babypuppe. Ihre Augen leuchteten, als sie sich vergewisserte:
»Sie sieht doch aus wie ein richtiges Baby, oder? Willst du sie einmal nehmen?« Aufmerksam besann sie sich und verbesserte sich schnell: »Ich meine, wollen Sie …«
»Du kannst ruhig ›Du‹ zu mir sagen«, unterbrach Eliette sie und nannte ihren Namen.
Saskia strahlte sie daraufhin an. Man sah förmlich, wie sie sich darüber freute. Dann reichte sie Eliette die Puppe.
»Sie heißt Rosi, und sie kann auch ›Mama‹ sagen und sogar ›schlafen‹.« Plötzlich zog ein Schatten über das Kindergesicht. »Meine Mami und mein Papi wissen gar nicht, dass ich hier bin. Sie sind verreist und ganz weit weg.«
Eliette beobachtete, dass Saskia plötzlich einen Schmollmund zog und mit den Tränen kämpfte.
»Aber sie kommen doch bestimmt bald zurück«, sagte sie schnell.
Daraufhin zuckte das Kind mit den Schultern und meinte: »Dr. Laurin hat gesagt, dass er mit ihnen telefonieren wollte, aber sie waren nicht da.«
»Aber dann wird man es deinen Eltern doch sicherlich ausrichten, dass du im Krankenhaus bist«, versuchte Eliette die Kleine zu trösten.
»Weiß nicht«, schluchzte Saskia, und schon kullerten die ersten Tränen über ihre Wangen. Spontan beugte sich Eliette zu der Kleinen hinunter und nahm sie in die Arme.
»Da bin ich ganz sicher«, sagte sie beruhigend. »Du wirst sehen, dass deine Mami und dein Papi dann gleich zurückkommen werden.«
»Das hat Schwester Marie auch gesagt. Aber wenn sie nun nicht da sind, und ich werde doch operiert?«
Eliette sah die Angst in den Kinderaugen, und sie streichelte immer wieder beruhigend Saskias Wange und sprach tröstend auf das Kind ein, bis es etwas ruhiger wurde.
»Wirst du auch operiert?«, fragte Saskia nach einer Weile. Als Eliette nickte, kam auch schon die nächste Frage: »Auch am Blinddarm?«
»Nein, aber so etwas Ähnliches«, antwortete Eliette. »Und ich bin auch ganz allein hier«, fügte sie hinzu und hoffte damit das Kind zu trösten.
»Hast du keine Mami und keinen Papi?«
»Nein.«
»Na ja, du bist auch schon groß und hast bestimmt keine Angst«, sagte Saskia und schaute sie grübelnd an. »Hast du auch keine Kinder?«, war ihre nächste Frage.
Eliette schüttelte nach kurzem Zögern den Kopf. Dann erhob sie sich.
»Jetzt muss ich aber gehen. Ich habe den Schwestern nämlich versprochen, zum Fieber messen zurück zu sein.« Ihr Blick fiel auf die aufgeschlagene Zeitung, die auf dem Nachttisch lag, und plötzlich wusste sie, woher sie das Kind kannte. »Bist du Saskia Neumann?«, fragte sie überrascht und betrachtete Saskias Foto. »Ich habe dich kürzlich bei dem Liederabend in der Stadthalle gehört. Du bist sehr begabt und hast eine wunderbare Stimme.«
Die blauen Augen des Kindes strahlten sie an, und Eliette fragte, ob sie ihr einmal etwas vorsingen würde. »Weißt du«, sagte sie, »als ich so alt war wie du, hatte ich auch den Wunsch, Sängerin zu werden. Aber dann hat es sich immer wieder zerschlagen.«
»Ich bekomme schon seit ein paar Jahren Gesangsunterricht«, erzählte Saskia und trällerte mühelos die Tonleiter rauf und runter. »Und neulich durfte ich zum ersten Mal auf einer richtigen Bühne stehen. Das war toll! Und die Leute haben ganz doll geklatscht …«
»Ich weiß, ich war ja ebenfalls da.« Eliette lächelte dem Kind zu und erschrak. Das eben noch lächelnde Gesicht hatte plötzlich einen gequälten Ausdruck angenommen, und ein Schmerzenslaut kam über Saskias Lippen, während sie ihre Hand auf den Leib presste.
Eliette drückte sie auf einen Stuhl und lief hinaus, um Hilfe zu holen. »Bitte, kommen Sie!«, rief sie einer Schwester zu. »Ich glaube, Saskia hat Schmerzen.«
Danach ging alles sehr schnell. Plötzlich waren Dr. Sternberg und Dr. Laurin da und untersuchten Saskia. Dann verabreichte eine Schwester dem ängstlichen Kind eine Beruhigungsspritze, und man bettete es auf eine Trage. Eine junge Pflegerin sprach beruhigend auf Saskia ein und erklärte ihr, dass die Ärzte jetzt gleich operieren wollten. Auch Dr. Laurin beugte sich über die kleine Patientin.
»Du brauchst gar keine Angst zu haben. Du wirst gleich müde werden und eine Weile schlafen. Du wirst überhaupt nichts spüren, und wenn du wieder aufwachst, dann ist alles vorbei.«
Eliette beobachtete gerührt, wie er Saskia väterlich das Haar aus der Stirn strich und ihr zuversichtlich zunickte.
Als das Kind etwas erwiderte, beugte er sich zu ihm hinunter, um es besser zu verstehen.
»Tante Eliette soll bei mir bleiben«, wisperte das Mädchen und drehte sich nach Eliette um, die unschlüssig an der Tür stand.
»Du hast dich also schon mit Frau Padburg angefreundet«, stellte Dr. Laurin fest und wandte sich an Eliette. »Würden Sie …«
»Selbstverständlich.« Die junge Frau nahm Saskias Hand, die die ihre umklammerte, und ging neben der Trage her. Vor dem Operationssaal versuchte Dr. Laurin der Kleinen zu erklären, dass Eliette nicht mitkommen dürfe. Doch Saskia hielt die schmale Frauenhand immer noch fest, und obwohl sie bereits schläfrig war, hielt sie mühsam die Augen offen und schüttelte nun den Kopf.
»Tante Eliette soll dableiben«, murmelte sie. »Bitte …«
»Gut, dann kommen Sie mit«, ordnete Dr. Laurin an, worauf eine Schwester Eliette einen Arztkittel reichte, den sie überzog. Als sie Saskia zunickte, sah sie die Erleichterung in den Augen des Kindes.
Die Anästhesistin wartete bereits, und als sie Eliette sah, schaute sie fragend auf Dr. Laurin.
Dieser nickte und flüsterte ihr zu, dass alles seine Ordnung habe. Daraufhin begann die Narkoseärztin mit ihrer Arbeit. Eliette lenkte das Kind ab, indem sie es wieder an jenen Liederabend erinnerte, auf den es so stolz war.
»Hattest du eigentlich vor deinem Auftritt Lampenfieber?«, fragte sie.
Die Antwort war nur ein Hauch von Zustimmung, und Eliette beobachtete aus den Augenwinkeln, wie die Anästhesistin ruhig und sicher die Spritze ansetzte. Sie sah, wie die Lider des Kindes zu flattern begannen und zwang sich zur Ruhe.
»Siehst du, jetzt ist es auch nicht anders. Was du empfindest, könnte man auch so bezeichnen. Und wenn du aufwachst, dann ist alles vorüber.«
»Aber meine Mami …«, flüsterte Saskia und versuchte, gegen die Müdigkeit anzukämpfen.
»Sie kommt ja wieder«, beruhigte Eliette sie und fuhr mit einer zärtlichen Handbewegung über ihre Wange. Doch die Narkosespritze zeigte bereits ihre Wirkung. Dr. Laurin nickte ihr freundlich zu und bat sie, den Operationssaal jetzt zu verlassen.
Langsam ging Eliette zurück zur Frauenstation. Schwester Marie kam ihr schon entgegen.
»Ich weiß schon, was geschehen ist«, rief sie ihr zu. »Wir sind alle sehr froh, dass Sie sich mit Saskia angefreundet haben und bei ihr geblieben sind. Ich hätte jetzt gar keine Zeit dafür gehabt.« Sie unterbrach sich und schaute Eliette forschend an. Dann nahm sie ihre Hand. »Mein Gott, Sie zittern ja«, stellte sie fest. »Hat Sie das Ganze denn so mitgenommen?«
Erst jetzt bemerkte Eliette, dass ihre Handflächen feucht waren. Schwester Marie begleitete sie in ihr Zimmer und öffnete das Fenster. Dann brachte sie ihr ein Glas Wasser und setzte sich einen Moment zu ihr.
»Weiß man etwas von Saskias Eltern?«, fragte Eliette. »Bevor die Narkose gewirkt hat, fragte die Kleine noch nach ihrer Mutter.
»Nun, da kann ich Sie beruhigen.« Schwester Marie lächelte vor Erleichterung. »Die Neumanns haben zurückgerufen und sind bereits auf dem Nachhauseweg. Aber trotzdem werden sie nicht vor morgen früh hier sein können. Wenn Saskia später wieder nach ihnen fragen sollte, können wir sie wenigstens beruhigen. Machen Sie sich also keine unnötigen Gedanken.« Aufmunternd nickte sie Eliette zu. Dann erhob sie sich und ging zur Tür. »Leider kann ich Ihnen heute Abend kein richtiges Essen bringen, denn Sie sollen ja morgen operiert werden. Aber eine Kleinigkeit kann ich Ihnen erlauben.«
»Danke, Schwester, ich habe eigentlich gar keinen Hunger«, erwiderte Eliette.
Als sie später zu Bett ging, legte ihr Schwester Marie fürsorglich eine leichte Schlaftablette auf den Nachttisch. Sie kannte die Angst der Patienten vor jeder Operation.
Doch Eliette konnte trotzdem nicht einschlafen. Sie wusste nicht, warum sie immer wieder an dieses Kind denken musste, und plötzlich war ihre eigene Kindheit wieder gegenwärtig. Ihrem Wunsch, ihre Stimme ausbilden zu lassen, hatten ihre Eltern nicht entsprechen können. Da war kein Platz für so etwas Luxuriöses wie eine Gesangsausbildung.
Eliette seufzte und warf sich unruhig im Bett hin und her. Sie dachte wieder an ihre Freundin Ruth und nahm sich vor, sie so bald wie möglich anzurufen und ihr von Saskia zu erzählen. Ob die Blinddarm-Operation gut verlaufen war?
Plötzlich wurde Eliette von einer unerklärlichen Angst gepackt. Man hatte schon häufig gehört, dass bei den einfachsten Eingriffen Kunstfehler passierten, die dem Patienten das Leben kosteten. Sollte sie vielleicht mal nachfragen, ob alles in Ordnung war? Wie würde ihre eigene Operation ausgehen?
»Du liebe Güte, ich sehe schon Gespenster«, murmelte sie ärgerlich und knipste das Licht an. Sie sprang aus dem Bett und warf sich ihren Morgenmantel über. Dann verließ sie das Zimmer.
Auf dem Flur brannte die Notbeleuchtung, und im matten Licht kam Schwester Marie der jungen Frau entgegen.
»Können Sie nicht schlafen?«, erkundigte sich die Schwester freundlich.
»Ich wollte eigentlich wissen, wie es Saskia geht.«
Noch bevor Marie antworten konnte, öffnete sich die Tür des Schwesternzimmers.
Schwester Monika winkte heftig in ihre Richtung. »Schwester Marie, schnell, Telefon!«, rief sie.
Als Schwester Marie zum Schwesternzimmer ging, hörte Eliette noch den Namen »Saskia Neumann«.
In diesem Moment kam es ihr vor, als schnüre ihr eine unsichtbare Kraft die Kehle zu. Eine Vorahnung schien sie zu befallen, und als Schwester Marie hinter der Tür verschwunden war, setzte sie sich auf einen der Stühle im Flur und wartete. Sie musste wissen, was geschehen war. Und wenn sie bis morgen früh warten musste, bis die Schwester wieder herauskam.
Doch dann hielt sie es nicht mehr aus. Als nach einer Weile auch noch Dr. Laurin an ihr vorbeieilte und im Schwesternzimmer verschwand, ging sie unruhig auf und ab. Schließlich hielt sie es nicht mehr länger aus und klopfte zaghaft an die Tür.
Schwester Monika öffnete sie einen Spaltbreit, und Eliette konnte einen Blick ins Innere des Zimmers werfen. Sie sah Schwester Marie, die mit dem Rücken zur Tür stand und angestrengt aus dem Fenster schaute, sodass sich Eliette fragte, was sie da draußen in der Dunkelheit wohl sah.
Dr. Laurin hatte den Telefonhörer in der Hand und legte ihn nun langsam zurück. Eine andere Schwester schaute ihn entsetzt an, während er sich gegen den Arzneischrank lehnte, als suche er dort Halt. Sein Blick nahm sie gar nicht wahr. Er schien ins Leere zu gehen.
»Ja?«
»Ich wollte nur fragen, wie es Saskia geht.« Eliette hatte ihre Stimme gedämpft und schaute beklommen auf den Arzt und die Schwestern, die sich nun nach ihr umwandten. Instinktiv fühlte sie, dass etwas geschehen war.
»Saskia geht es gut«, antwortete Schwester Marie nach einer Weile. Dann versuchte sie ihrer Stimme einen zuversichtlichen Klang zu geben, als sie hinzufügte: »Sie hat die Operation gut überstanden. Machen Sie sich also keine Sorgen.«
»Und ihre Eltern?«, fragte Eliette. »Werden sie kommen?«
»Bitte, Frau Padburg, ich meine, Sie sollten jetzt wieder ins Bett gehen«, antwortete Schwester Marie. »Sie haben Ihre Operation schließlich noch vor sich …«
Eliette reagierte nicht darauf. Ihr Blick hing an Dr. Laurins Lippen und wanderte dann weiter zu seinen Augen. An seiner Miene erkannte sie, dass etwas Furchtbares geschehen war.
»Sie brauchen jetzt wirklich Ihre Ruhe, Frau Padburg«, sagte auch der Arzt, während Schwester Monika sich immer wieder über die Augen fuhr.
»Ja, natürlich.« Eliette wandte sich um. »Es tut mir leid, wenn ich Sie gestört habe. Aber ich dachte, dass mit Saskia etwas ist.« Noch im Hinausgehen sah sie den besorgten Blick des Arztes, mit dem er ihr hinterherschaute. Sie hätte schwören können, dass man ihr etwas Wichtiges verschwieg, das mit Saskia zusammenhing. Dann wiederum sagte sie sich, dass sie das eigentlich wirklich nichts anging. Schließlich hatte Schwester Marie gesagt, dass Saskia die Operation gut überstanden hätte. Und das war ja die Hauptsache.
Beinahe wäre sie mit Frau Dr. Kellberg zusammengestoßen, die ebenfalls im Schwesternzimmer verschwand. Die merkwürdigsten Dinge spukten in Eliettes Kopf herum, während sie zu ihrem Zimmer zurückging. Sie kannte zwar die Gepflogenheiten der Schwestern und Ärzte nicht, aber sie fragte sich, warum sie sich zu dieser nächtlichen Stunde im Schwesternzimmer einfanden – und warum die Stimmung so eigenartig bedrückt gewesen war.
Abrupt kehrte sie um und konnte sich selbst keine Rechenschaft darüber ablegen, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben etwas tat, das sie noch nie getan hatte. Sie blieb vor dem Schwesternzimmer stehen und lauschte.
»So reden Sie doch!«, hörte sie die Anästhesistin sagen. »Stimmt es, was Schwester Otti mir eben sagte? Saskias Eltern sollen einen Unfall gehabt haben?«
»Es stimmt. Leider«, erklang Schwester Maries verhaltene Stimme. »Dr. Laurin hat eben noch einmal mit der Polizei telefoniert.«
»Ich hatte immer noch die Hoffnung, dass es nicht so endgültig ist«, hörte Eliette den Arzt mit mühsam beherrschter Stimme sagen. »Dass sie vielleicht noch eine Chance hätten. Aber Tatsache ist nun, dass Saskias Eltern diesen schweren Autounfall nicht überlebt haben.« Er seufzte und fügte so leise, dass es Eliette kaum verstehen konnte, hinzu: »Beide sind tot.«
Eliette glaubte, der Boden würde unter ihren Füßen nachgeben. Sie lehnte sich einen Moment gegen die Wand und fühlte ihr Herz bis zum Hals schlagen. Das war es also gewesen, was sie vor ihr verheimlicht hatten.
»Das Kind darf es auf keinen Fall erfahren, bevor es sich nicht einigermaßen erholt hat«, vernahm sie Dr. Laurins Anordnung.
Eliette wankte in ihr Zimmer und warf sich über ihr Bett. Plötzlich meinte sie wieder, Saskia vor sich zu sehen, als sie darum gebeten hatte, sie möge bei ihr bleiben.
»Die arme Kleine«, flüsterte Eliette mit erstickter Stimme. »Wenn ich ihr doch helfen könnte.«
Erst gegen Morgen tat die Tablette ihre Wirkung, und Eliette fiel in einen bleiernen Schlaf. Sie wurde von Schwester Marie geweckt.
»Es ist so weit, Frau Padburg. Bald werden Sie’s überstanden haben.«
Dann bereitete sie die Patientin auf die Operation vor und plauderte mit ihr, als wäre nichts geschehen.
Eliette ließ alles über sich ergehen und wunderte sich über die Aktivität der Schwester.
»Haben Sie denn überhaupt geschlafen?«, fragte sie aus ihren Gedanken heraus.
»Selbstverständlich. Wir haben alle geschlafen«, antwortete Schwester Marie. »Wissen Sie, wir haben die Möglichkeit, in Ausnahmefällen hier zu übernachten«, fügte sie erklärend hinzu, verstummte aber sogleich wieder, als sie Eliettes fragenden Blick sah.
»Und – war heute Nacht so ein Ausnahmefall?«, fragte Eliette.
»Ja«, erwiderte die Schwester kurz angebunden. Dann setzte sie ein freundliches Lächeln auf. »Aber Sie sollten jetzt nicht weiter darüber nachgrübeln, sondern sich entspannen. Man wird Sie gleich in den OP bringen, und wenn Sie wieder aufwachen, haben Sie alles hinter sich.«
Zuversichtlich nickte sie ihrer Patientin zu, und Eliette dachte, dass sie dieselben Worte gestern zu Saskia gesagt hatte. Müde schloss sie die Augen und merkte, dass die Beruhigungsspritze, die sie bekommen hatte, bereits ihre Wirkung tat.
Als sich später Dr. Laurin über sie beugte und ein paar freundliche Worte mit ihr sprach, sagte sie nur noch: »Wir müssen uns unbedingt um das Kind kümmern.« Dann schlug die Narkose wie eine Welle über ihr zusammen.
*
»Frau Padburg!« Schwester Marie tätschelte ihre Wange und rief immer wieder ihren Namen.
Nur langsam kam Eliette in die Wirklichkeit zurück. »Ist die Operation denn schon vorbei?«, fragte sie, als sie feststellte, dass sie in ihrem Bett lag.
»Ja, und alles ist in Ordnung. Sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Allerdings sollten Sie noch ruhig im Bett liegenbleiben.«
»Wie geht es Saskia?«, fragte Eliette. »Haben Sie es ihr schon gesagt?«
»Dass Sie operiert wurden? Nein, noch nicht. Wenn Sie wollen, können Sie es ihr morgen oder übermorgen selbst sagen.«
»Nein, das meinte ich eigentlich nicht.« Als sich ihr Blick mit dem von Schwester Marie traf, las sie darin Maries Sorgen um das Kind. »Ich habe gehört, wie Sie über den Unfall sprachen«, gestand Eliette. »Ich fühlte genau, dass etwas geschehen war und hatte Angst, dass etwas mit Saskia ist. Da ging ich gestern Abend noch einmal zurück zum Schwesternzimmer.« Abrupft schwieg sie.
»Das hätten Sie nicht tun sollen«, sagte Schwester Marie leise, deren Schweigepflicht es ihr verbot, mit Patienten über andere Patienten zu sprechen.
»Sie weiß es also noch nicht?«, fragte Eliette.
»Nein. Das Kind braucht erst einmal Ruhe.«
»Sind Sie deshalb gestern hiergeblieben?«, fragte Eliette.
Schwester Marie nickte. »Man konnte nicht wissen, ob es nicht doch durchsickert«, sagte sie. »Wenn nur eine von uns Schwestern eine unbedachte Bemerkung gemacht hätte, dann wäre das Kind hellhörig geworden.« Sie machte eine bedauernde Handbewegung, und Eliette beobachtete, wie sie zum Fenster ging und hinausschaute. »Bitte, sagen Sie ihr noch nichts davon«, bat sie schließlich und kam zu Eliette ans Bett. Die junge Frau sah die Tränen in ihren Augen und griff spontan nach Maries Hand.
»Natürlich nicht«, murmelte sie.
»Sie mögen die Kleine wohl auch sehr.« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage.
Eliette nickte. Dann sagte sie: »Eigentlich ist es seltsam, wie einem ein Kind in so kurzer Zeit ans Herz wachsen kann. Ich mochte Saskia schon, bevor ich von dem Unglück wusste.«
»Das ist gut so.« Schwester Marie lächelte schmerzlich. »Vielleicht können Sie sie einmal besuchen und ein wenig aufmuntern, wenn wir es ihr gesagt haben. Sie hat übrigens schon nach Ihnen gefragt.« Damit nickte sie ihr noch einmal zu und verließ dann das Zimmer.
Am Nachmittag kam Ruth zu Besuch und lenkte Eliette von ihren trüben Gedanken ab. Ruth war immer guter Laune und genau wie die Freundin alleinstehend. Sie kannten sich schon lange; bereits seit jener Zeit, als Eliette die schwärzeste Stunde ihres Lebens erlebt hatte. Doch noch nicht einmal Ruth hatte sie von ihrem Geheimnis erzählt. Sie waren oft zusammen in Urlaub gewesen, und Eliette war es gewesen, die Ruth getröstet hatte, als deren Beziehung zu einem Mann zerbrach, den sie sehr geliebt hatte. Doch im Gegensatz zu Eliette war Ruth nicht allein geblieben, sondern hatte sich bald wieder jemandem angeschlossen.
»Lass dich anschauen.« Ruth legte die Blumen, die sie mitgebracht hatte, auf den Nachttisch und zog sich einen Stuhl ans Bett. »War es schlimm?«
Eliette schüttelte den Kopf. »Eigentlich ging alles schneller vorbei, als ich dachte.«
»Dann frage ich mich, warum du so traurig wirkst. Du könntest doch eigentlich froh sein.«
»Das bin ich auch, und die Ärzte und Schwestern hier sind nett.«
»Aber?« Aufmerksam schaute Ruth ihre Freundin an.
»Ich habe hier ein kleines Mädchen kennengelernt, das mir nicht mehr aus dem Sinn geht. Du kennst sie übrigens. Es ist Saskia Neumann, die kleine Nachtigall, wie die Zeitungen schreiben. Wir haben sie neulich bei diesem Liederabend gehört. Erinnerst du dich noch?«
»Ja, natürlich. Und die Kleine liegt hier in dieser Klinik?«, fragte Ruth interessiert.
»Ja. Sie musste am Blinddarm operiert werden und hatte solche Angst, weil sie allein war«, berichtete Eliette. »Sie bat mich, bei ihr zu bleiben, als man sie in den Operationssaal brachte. Weißt du, ihre Eltern waren auf Reisen und hatten keine Ahnung, dass Saskia mit Blinddarmentzündung in die Klinik kam.
»Aber inzwischen wissen sie es doch, nicht wahr?«
»Ach, Ruth, es ist alles so schrecklich.« Eliette berichtete nun, was geschehen war.
»Das ist wirklich tragisch. Meinst du, wir könnten etwas für das Kind tun?«
»Daran habe ich auch schon gedacht. Es ist zwar kein Trost, aber vielleicht könntest du etwas für sie besorgen? Ich dachte an ein Spiel oder Süßigkeiten. Ich weiß es auch nicht.« Sie schaute ihre Freundin an und fragte: »Womit kann man ein knapp zehnjähriges Mädchen über den Verlust seiner Eltern hinwegtrösten?«
»Wenn ich das wüsste, Eliette«, antwortete Ruth nachdenklich. Dann versuchte sie, ihre Freundin aufzumuntern. »Du darfst dich nicht allzu sehr mit diesem Unglück identifizieren. Dass dir das nahegeht, ist begreiflich. Aber du solltest nicht allzu stark mitleiden. Das macht dich kaputt. Du musst auch an dich denken. Ich weiß, es klingt egoistisch«, schränkte sie ein, »aber deine Gesundheit sollte dir jetzt wichtig sein. Das Leben geht weiter«, sagte sie eindringlich, als sie Eliettes Gesichtsausdruck bemerkte. »Und bald wirst du wieder entlassen.«
»Und dann?« Eliette schaute sie gequält an. »Dann gehe ich wieder nach Hause und zur Arbeit. Wer wartet denn schon auf mich?« Sie machte eine vage Handbewegung.
»Ich meine jedenfalls, dass du dich nicht zu sehr verausgaben solltest.« Ruth erhob sich. Sie wagte nicht, der Freundin jetzt von Robert zu erzählen, der ihr vor ein paar Tagen einen Heiratsantrag gemacht hatte. »Ich gehe jetzt und kaufe eine Kleinigkeit für die Kleine«, versprach sie, als sie sich verabschiedete.
Am nächsten Tag durfte Eliette aufstehen. Auf dem Flur traf sie mit Schwester Marie zusammen, die ihr ein Briefchen von Saskia überreichte. Gerührt betrachtete Eliette die kindliche Schrift, mit der sich das Mädchen für das Spiel und die Schokolade bedankte, die Ruth gebracht hatte.
Ich hoffe, es geht Dir gut, schrieb sie in einem Nachsatz.
Ich darf schon aufstehen, Dich aber noch nicht besuchen. Meine Eltern sind immer noch unterwegs. Es grüßt Dich Deine Saskia.
»Sie haben es ihr also noch nicht gesagt«, stellte Eliette fest.
»Nein. Vielleicht werde ich morgen mit ihr sprechen«, antwortete Schwester Marie. »Dr. Laurin meinte, ich sei außer Ihnen die Einzige, zu der das Kind Vertrauen hat.« Abrupt brach sie ab. »Ich habe schon viel erlebt und kann mit Menschen umgehen«, fuhr sie dann fort. »Aber in einer solchen Situation war ich noch nie.«
»Ich kann mir gut vorstellen, wie schwer das ist«, pflichtete Eliette ihr bei. »Ich glaube, ich brächte es auch nicht fertig, dem Kind die Wahrheit zu sagen.«
Schwester Marie nickte. »Übrigens hat Ihre Freundin noch ein Spiel besorgt und für Sie abgeben lassen. Auf diese Idee hätte ich auch kommen können«, murmelte sie und bat Eliette ins Schwesternzimmer, wo sie ihr ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel überreichte. »Es ist zwar schon ein sehr unmodernes Spiel, aber ich glaube, immer noch beliebt.«
»Danke.« Eliette betrachtete es nachdenklich. Dann bat sie: »Würden Sie mir Bescheid sagen, wenn Sie Saskia die traurige Wahrheit mitgeteilt haben?«
»Natürlich. Aber ich möchte noch warten, denn morgen ist die Beerdigung, und die Schwester von Saskias Mutter hat sich angesagt. Sie kommt eigens aus Amerika und will bei dieser Gelegenheit Saskia besuchen. Vielleicht hat sie mehr Kontakt zu dem Kind.«
Aus Schwester Maries Worten sprach die Hoffnung, dass diese Frau mit Saskia sprechen würde, und Eliette konnte sie nur allzugut verstehen.
»Wir wollen es hoffen«, antwortete sie und ging zur Tür. Doch Schwester Maries Stimme hielt sie auf.
»Glauben Sie nicht, dass ich mich jemals im Leben vor etwas gedrückt hätte«, sagte sie. »Aber dieses Mal ist es so. Ich bringe es einfach nicht übers Herz, dem Kind die Wahrheit zu sagen – und Dr. Laurin wohl auch nicht.«
*
Am nächsten Tag ging Ines Baker direkt nach der Beerdigung von Saskias Eltern in die Prof.-Kayser-Klinik und bat um ein Gespräch mit Dr. Laurin.
Nachdem er ihr sein Beileid ausgesprochen hatte, bot der Klinikchef ihr Platz an.
»Der Anlass unseres Kennenlernens ist leider sehr traurig«, begann er. »Ich habe Saskias Eltern zwar nicht gekannt, aber das Kind tut mir von Herzen leid.«
»Ich wollte meine Schwester in diesem Jahr besuchen, und jetzt ist sie tot.« Man sah Frau Baker an, wie sehr sie diese Tatsache mitgenommen hatte. »Mein einziger Trost ist, dass alles sehr schnell gegangen sein muss und sie und Rolf keine lange Leidenszeit hatten.« Sie seufzte und nippte an dem Kaffee, den Moni Hillenberg für sie gebracht hatte. »Es ist alles so schrecklich.« Sie wischte sich die Tränen aus den Augen und sah Dr. Laurin an. »Marion hatte sich seinerzeit so sehr auf ihr Kind gefreut. Und auch Rolf … Wenn ich nur daran denke, wie sie alles vorbereitet hatten!« Sie lächelte wehmütig, als sie fortfuhr: »Marion benahm sich fast so, als würde sie das Kind selbst zur Welt bringen. Und dann holten sie es direkt von der Klinik ab, und es kam mir immer vor, als sei Saskia das erste Baby, das jemals geboren wurde.«
»Ich verstehe nicht ganz«, warf Dr. Laurin ein. »Sie sagten, Ihre Schwester benahm sich, als würde sie das Kind selbst zur Welt bringen?« Fragend schaute er Frau Baker an.
»Ja, wissen Sie denn nicht, dass meine Schwester und ihr Mann Saskia adoptiert haben?«
»Nein, das ist mir neu.« Dr. Laurin war ehrlich überrascht.
»Saskia war ein Wunschkind, und meine Schwester und Rolf mussten viel über sich ergehen lassen und viel Geduld aufbringen, bis sie die Genehmigung zur Adoption eines Kindes bekamen. Und nun musste dieses Unglück geschehen.«
Ines Baker erhob sich und ging mit einer Entschuldigung zum Fenster. Ihre Schultern zuckten, und Dr. Laurin ließ ihr Zeit. Dass Saskia ein adoptiertes Kind war, hatte er nicht gewusst. Aber es beeindruckte ihn, dass sich wieder einmal Eltern gefunden hatten, die sich eines Kindes angenommen hatten, um ihm ein Zuhause zu geben. Um so schmerzlicher war nun die Tatsache, dass diese Leute so früh ums Leben gekommen waren.
»Wie nimmt es Saskia denn auf?«, fragte in diesem Augenblick Frau Baker und wandte sich wieder nach ihm um.
»Sie weiß es noch nicht«, antwortete Dr. Laurin. »Ich hielt es für richtig, in Anbetracht ihrer geschwächten Konstitution dieses Gespräch noch ein wenig hinauszuschieben.«
»Aber sie ist doch nicht krank?«, fuhr Ines Baker auf.
»Nein. Saskia ist nur durch den Eingriff noch etwas schwach. Außerdem ist es vielleicht besser, wenn wir uns vorher darüber unterhalten, was jetzt geschehen soll.« Während Ines wieder Platz nahm, fuhr Leon Laurin fort: »Soviel ich weiß, sind Sie und Ihr Mann die einzigen Verwandten. Werden Sie sich um das Kind kümmern, wenn es entlassen wird?«
»Ausgeschlossen«, entfuhr es Ines, und als sie das befremdete Gesicht des Arztes bemerkte, fühlte sie sich zu einer Erklärung verpflichtet. »Sie müssen wissen, dass mein Mann Manager einer großen Autofirma ist und ich ihn auf allen seinen Reisen begleite. Nicht aus Abenteuerlust, sondern aus Sorge.« Sie seufzte. »Es ist so, dass mein Mann herzkrank ist und regelmäßig seine Medikamente braucht. Wenn er einmal allein unterwegs ist, bekomme ich schon Zustände, weil ich weiß, dass er alles wieder vergisst, wenn er in geschäftlichen Besprechungen ist. Ich müsste außer einer Sekretärin noch eine Krankenschwester mitschicken, wenn ich zu Hause bleiben würde.«
»Ich verstehe.« Dr. Laurin hatte darauf gehofft, dass diese Frau sich bereiterklären würde, Saskia zu sich zu nehmen, um ihr eine neue Heimat zu geben. »Sie haben keine Kinder?«, fragte er aus diesen Gedanken heraus.
»Nein, und ich wüsste auch – offengestanden – nicht, was ich mit einem Kind anfangen sollte. Hoffentlich halten Sie mich jetzt nicht für herzlos, aber das ist nun mal so. Mein Mann und ich sind im Laufe der Zeit so zusammengewachsen, dass jede dritte Person nur stören würde; selbst wenn dies ein Kind wäre.«
Wenn Dr. Laurin auch anderer Meinung war, so war er doch für die Offenheit, mit der Ines sprach, dankbar. Es war ihm lieber, wenn man von vornherein Klarheit hatte.
Ines Baker erhob sich. »Ich habe draußen im Auto einige Geschenke für Saskia«, sagte sie. »Vielleicht kann mir jemand helfen, sie hineinzutragen.«
»Selbstverständlich.« Dr. Laurin begleitete sie zur Tür. »Trauen Sie es sich zu, Saskia über den Tod ihrer Eltern zu informieren?«, fragte er, bevor sie hinausging.
Doch Ines Baker schaute ihn an, als hätte er etwas völlig Unmögliches von ihr verlangt.
»Ich?«, fragte sie entsetzt und schüttelte den Kopf. »Nein, das kann ich nicht. Außerdem habe ich so gut wie gar keinen Kontakt zu dem Kind. Ich habe es mindestens drei Jahre nicht mehr gesehen.« Sie sah zu Dr. Laurin auf und meinte: »Ich tue alles für sie. Ich meine, wenn sie etwas braucht, dann lassen Sie es mich wissen. Aber das können Sie nicht von mir verlangen, Herr Doktor.«
Mit zusammengekniffenen Augen sah ihr Dr. Laurin nach, als sie zusammen mit Schwester Monika Spielsachen aus ihrem Auto in die Klinik schleppte. Dann setzte er sich an seinen Schreibtisch und stützte müde den Kopf in die Hände.
Plötzlich fiel ihm Eliette Padburg ein – und das Vertrauen, das Saskia ihr entgegenbrachte. Diese Frau hatte ein ähnliches Wesen wie Antonia. Sie wäre dazu geeignet, dem Kind die bittere Wahrheit beizubringen. Er dachte an Schwester Maries Worte, dass Frau Padburg alles wusste. Doch dann erschrak er vor seinen eigenen Gedanken. Niemals würde er das einer seiner Patientinnen zumuten.
So nahm er sich vor, nach Frau Bakers Besuch selbst zu Saskia zu gehen und mit ihr zu reden.
Ines Baker saß unterdessen bei ihrer Nichte, die die Geschenke auspackte, mit denen die Tante sie überhäuft hatte – und mit denen sie wohl ihr schlechtes Gewissen beruhigen wollte.
»Aber Tante Ines, du hast mir doch zum Geburtstag diesen großen Teddy geschickt«, meinte Saskia überrascht. Mit so vielen Geschenken hatte sie nicht gerechnet.
»Ja, aber jetzt bin ich nach Deutschland gekommen und dachte, dass ich dir etwas mitbringe«, antwortete Ines. »Außerdem hast du gerade eine schwere Operation hinter dir, und da muss man deine Genesung doch gebührend feiern. Meinst du nicht auch?«
»Ja, aber schwer war die Operation nicht«, widersprach Saskia. »Trotzdem hatte ich große Angst. Aber Tante Eliette ist bei mir geblieben, bis ich eingeschlafen bin. Und als ich aufwachte, war alles vorbei, und Schwester Marie hat die ganze Nacht an meinem Bett gesessen.«
»Wer ist denn Tante Eliette?«, fragte Ines überrascht.
»Sie liegt auch hier und musste operiert werden. Genauso wie ich. Und sie ist ganz lieb. Fast so wie Mami.« Mit großen Augen schaute das kleine Mädchen die Tante an und fragte: »Weißt du, wann Mami und Papi endlich kommen? Ich muss ihnen doch meine vielen Geschenke zeigen, die du mir mitgebracht hast.«
»Nein, das weiß ich nicht«, antwortete Ines und räusperte sich verlegen. Dann lenkte sie schnell ab: »Wie gefällt dir das Puppenkleidchen eigentlich?«
»Es ist sehr schön. Danke, Tante Ines.« Damit beugte sich Saskia zu ihr und küsste sie auf die Wange.
Ines Baker erhob sich und verbarg ihre Rührung. Sie reichte Saskia die Hand. »Gute Besserung, Kleines. Ich muss jetzt gehen.«
»Kommst du uns besuchen, wenn ich wieder zu Hause bin?«, fragte Saskia, als Ines schon an der Tür war. »Mami und Papi möchten dich und Onkel John doch auch sehen.«
Ines konnte nicht antworten. Sie presste ihr Taschentuch vor den Mund und verließ fast fluchtartig das Zimmer. Sie dachte daran, dass sie als Nächstes die Wohnung ihrer Schwester und ihres Schwagers auflösen musste. Sie war froh, dass John wenigstens die Angelegenheit mit dem Jugendamt regeln würde. Dies alles hier ging über ihre Kräfte, und sie rechtfertigte sich mit dem Wissen, dass Saskia später einmal keine finanzielle Not leiden würde. Aber dennoch konnte sie dieser Gedanke nicht so recht trösten.
Sie verabschiedete sich von Dr. Laurin ziemlich abrupt. Dann stieg sie in ihr Auto und vermied es, zu der Fensterfront der Klinik hinaufzusehen.
Saskia winkte ihrer Tante nach und wunderte sich, dass sie nicht mehr zu ihr heraufschaute.
»Schwester Marie!«, rief Saskia der eintretenden Schwester entgegen. »Tante Ines war hier. Sieh nur, was sie mir alles mitgebracht hat.«
»Das sind aber schöne Dinge.« Schwester Marie betrachtete jedes einzelne Stück und dachte, dass Saskias Tante wohl etwas übertrieben hatte. Der Geschenkberg würde für mehrere Kinder gereicht haben.
»Aber sie hat gar nicht mehr zu mir heraufgeschaut«, beklagte sich das Kind. »Und richtig verabschiedet hat sie sich auch nicht.«
»Sie wird wohl in Eile gewesen sein.« Schwester Maries Herz zog sich schmerzhaft zusammen, als sie daran dachte, dass Dr. Laurin dem Kind heute die Wahrheit sagen wollte.
»Nachher besucht dich Herr Dr. Laurin und möchte sich mit dir unterhalten«, sagte sie deshalb.
»Glaubst du, dass Tante Ines gleich wieder nach Amerika fliegt und gar nicht zu uns nach Hause kommt?«, fragte Saskia.
»Das weiß ich nicht.« Schwester Marie fuhr der Kleinen wehmütig über das lange blonde Haar, und als Saskia sie forschend anschaute, glaubte die alte Pflegerin, diese intensivblauen Augen schon einmal gesehen zu haben.
»Hast du mir zugehört?«, fragte sie. »Herr Dr. Laurin kommt nachher zu dir.«
In diesem Augenblick klopfte es etwas zaghaft an die Tür, und gleich darauf schaute Eliette herein.
»Darf ich reinkommen?«, fragte sie.
»Tante Eliette!«, rief Saskia und lief ihr entgegen. »Hast du meinen Brief bekommen? Bist du wieder gesund? Bleibst du jetzt ein bisschen bei mir? Es ist so langweilig, weil die anderen Kinder alle noch so klein sind«, sprudelte sie hervor.
»Ich bin ja so froh, dass es dir wieder gutgeht«, sagte Eliette und warf Schwester Marie einen fragenden Blick zu.
Doch die schüttelte nur stumm den Kopf und ging zur Tür. Dort blieb sie stehen und schaute auf die junge Frau und das Kind, die sich immer noch umarmt hielten und sich offensichtlich sehr viel zu erzählen hatten. Mit einem langen nachdenklichen Blick betrachtete die Schwester die beiden, dann schloss sie leise die Tür.
*
Saskia zog unter den vielen Spielsachen, die sich seit dem Besuch ihrer Tante in ihrem Zimmer türmten, das Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel hervor, das Eliette ihr geschenkt hatte.
»Hast du Lust zum Spielen?«, fragte sie, indem sie das Spiel bereits auf dem Tisch ausbreitete. »Das habe ich oft mit Mami und Papi gespielt«, erzählte sie eifrig. »Und die roten Hütchen gehören immer mir.« Fragend schaute sie Eliette an, die lächelnd nickte und am Tisch Platz nahm.
»Dann nehme ich die blauen«, sagte sie.
»Nein, die blauen gehören Mami, und die grünen Vati«, belehrte Saskia sie. »Du kannst die gelben nehmen.«
Wortlos stellte Eliette die gelben Holzhütchen auf. Dann fragte sie: »Hat deine Tante dich besucht?«
»Ja. Sie hat mir das alles mitgebracht. Aber sie war so komisch. Ich glaube, sie hat geweint. Ob Onkel John krank ist? Er ist nämlich nicht mitgekommen.«
Eliette beobachtete, wie sie würfelte und dann eines ihrer Hütchen aufs Spielfeld setzte. Danach würfelte sie noch einmal und setzte eines der blauen auf die Unterlage.
»Das ist für Mami«, erklärte sie. »Würfelst du für Vati?« Als Eliette nicht antwortete, schaute das kleine Mädchen sie forschend an. »Jetzt weinst du ja auch«, stellte sie bestürzt fest und kam um den Tisch herum. »Wenn ich weine, dann nimmt Mami mich immer ganz fest in die Arme, und ich erzähle ihr, was mich bedrückt. Und dann ist es gar nicht mehr so schlimm.«
Damit schlang sie die Arme um Eliettes Nacken und fragte: »Willst du mir nicht sagen, was du hast?« Nachdenklich betrachtete sie Eliette, dann fragte sie etwas kleinlaut: »Hast du gemerkt, dass ich eben geschummelt habe, als ich Mamis Hütchen auf das nächste Feld gesetzt habe? Ist es wegen Mamis Hütchen?«
»Nein, es ist nicht wegen des Hütchens«, würgte Eliette hervor.
»Wegen Mami?« Das Kind schaute sie an und trat einen Schritt zurück. »Weißt du, wann sie und Papi endlich kommen oder ob sie geschrieben haben?«
»Nein, sie haben nicht geschrieben, und sie können auch nicht mehr kommen«, antwortete Eliette und nahm nun ihre ganze Kraft zusammen. Plötzlich wusste sie, dass sie dem Kind die Wahrheit sagen musste. Sie konnte nicht länger verantworten, dass man Saskia etwas vormachte und ihr eine heile Welt vorgaukelte.
Wie gern hätte sie Saskia gesagt, dass ihre Eltern bald wieder bei ihr sein würden. Doch stattdessen nahm sie das Kind ganz fest in ihre Arme und fragte: »Hat dich deine Mami immer so gehalten, wenn du einen Kummer hattest?«
Saskia nickte, doch sie ließ keinen Blick von ihr.
»Deine Mami und dein Papi wollten gleich kommen, als sie hörten, dass du hier bist«, fuhr Eliette so behutsam wie möglich fort. »Aber unterwegs ist etwas Schreckliches geschehen. Sie hatten einen Unfall …«
Sie sah, wie Saskia erschrak und hörte sie dann leise fragen: »Sind sie jetzt auch im Krankenhaus?«
»Nein. Es war ein sehr schwerer Unfall, weißt du.«
Eliette hatte das Gefühl, dass die Augen des Kindes bis auf den Grund ihrer Seele schauten. Vielleicht lag es auch an ihrem Gesichtsausdruck und an den Tränen, die sie kaum noch zurückhalten konnte, dass Saskia die Wahrheit erriet.
»Sind sie gestorben?«, flüsterte das Kind mit ganz leiser kleiner Stimme.
Eliette konnte später nicht sagen, was sie in diesem Augenblick empfand.
Auf Saskias Frage hin konnte sie nur nicken. Dann wiegte sie das Kind wie ein Baby in ihren Armen.
»Deine Mami und dein Papi sind jetzt im Himmel und sehen auf dich herab. Sie haben dich noch genauso lieb wie bisher. Daran musst du immer denken, meine Kleine.«
»Und sie kommen nie wieder?« Saskia schien die grausame Wahrheit nicht begriffen zu haben.
»Sie werden immer um dich sein und dich beschützen«, antwortete Eliette. »Auch, wenn du sie nicht sehen kannst.«
Plötzlich befreite sich Saskia fast gewaltsam aus der Umarmung. Vorwurfsvoll schaute sie Eliette an. Dann schrie sie plötzlich los: »Du lügst, du lügst! Meine Mami kommt bestimmt wieder, und ich kann sie dann auch sehen – und meinen Papi auch!«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und Dr. Laurin schaute herein. Saskia stürzte auf ihn zu, als wolle sie sich zu ihm flüchten. Dann deutete sie auf Eliette und rief immer wieder: »Sie hat gesagt, dass meine Mami und mein Papi im Himmel sind und mich von da aus beschützen würden. Das ist doch nicht wahr! Sie kommen wieder! Ich glaube ihr kein Wort!«
Dr. Laurin nahm die Kleine in den Arm und führte sie zurück zum Tisch. Er nahm Platz und rückte Saskia einen Stuhl zurecht.
»Es ist schlimm, was mit deinen Eltern passiert ist«, sagte er, »aber wir müssen das akzeptieren. Und wenn Frau Padburg sagte, dass sie jetzt im Himmel sind und dich beschützen, dann ist das ganz gewiss so.« Damit warf er Eliette einen zustimmenden Blick zu, während das Kind ihn mit angstvoll geweiteten Augen anschaute.
Plötzlich begann Saskia zu weinen. Sie verschränkte die Arme vor dem Gesicht und stützte sich auf dem Tisch ab, sodass einige der Hütchen hinunterfielen.
Als Eliette sie berührte, wehrte sie fast wütend ab. Dr. Laurin gab ihr ein Zeichen, Saskia gewähren zu lassen. Er wusste aus Erfahrung, dass Tränen oft hilfreich waren.
»Entschuldigen Sie, Herr Doktor«, rechtfertigte sich Eliette. »Ich musste es ihr einfach sagen. Sie fragte ständig nach ihren Eltern, und ich konnte es kaum noch ertragen.«
»Sie haben genau das Richtige getan«, erwiderte der Arzt. »Und ich danke Ihnen dafür«, erwiderte er leise. »Ich selbst hatte große Angst vor der Wahrheit«, gestand er und griff automatisch nach Eliettes Puls, denn er sah, in welcher Aufregung sich die junge Frau befand.
»Glaubst du, dass Mami und Papi wirklich im Himmel sind und auf mich herunterschauen?«, fragte Saskia plötzlich mit ganz kleiner Stimme.
»Ja, das glaube ich«, antwortete Eliette, und die Tränen schnürten ihr die Kehle zu, als sie das Kind so hilflos sah. »Und du hast jetzt gleich zwei Schutzengel«, fügte sie hinzu und bückte sich nach einem blauen Hütchen, das hinuntergefallen war.
Saskia nahm es ihr aus der Hand und stellte es wieder auf. Ihre Augen schwammen in Tränen, als sie Eliette anschaute. Dann warf sie sich plötzlich in die Arme der jungen Frau und schmiegte sich an sie. Ihr zarter Körper wurde von einem Weinkrampf geschüttelt, während sie immer wieder hervorstieß: »Meine Mami und mein Papi sind im Himmel.« Es hörte sich an, als wolle sie sich diese Wahrheit gewaltsam einhämmern.
»Ja, das sind sie, mein Schätzchen«, erwiderte Eliette und hielt das Kind zärtlich fest.
Dr. Laurin erhob sich und ging leise hinaus. Er kam mit zwei Tabletten zurück und löste die eine, die er in der Mitte durchbrach, in Wasser auf. Gehorsam trank Saskia das Glas aus. Danach bat der Arzt Eliette, die andere Tablette einzunehmen.
Als sie zum Waschbecken ging, fragte Saskia bedrückt: »Gehst du jetzt wieder?«
»Nein, ich bleibe noch eine Weile bei dir«, antwortete die junge Frau.
»Und nachher?«, fragte das Kind ängstlich.
Unschlüssig schaute Eliette zu Dr. Laurin hinüber.
»Wenn du möchtest, dann lasse ich noch ein zweites Bett hier hereinstellen, und Tante Eliette kann bei dir bleiben«, antwortete er und wandte sich an Eliette. »Das heißt, wenn Sie einverstanden sind.«
»Natürlich. Vielen Dank, Herr Doktor.« Eliette war grenzenlos erleichtert. Sie wusste, dass dies eine Ausnahmeregelung war. Doch sie hätte Saskia in diesem Zustand jetzt nicht allein lassen können. Kaum hatte sie wieder Platz genommen, als das kleine Mädchen wieder ihre Nähe suchte. Eliette nahm Saskia in die Arme und streichelte sie immer wieder.
Bald merkte sie, dass das Kind eingeschlafen war.
Dr. Laurin nahm den leichten Körper des Kindes hoch und legte Saskia auf das Bett. Dann bat er Eliette, mit ihm zu kommen.
»Ich möchte noch einmal Ihren Blutdruck messen«, erklärte er. »Inzwischen kann man das zweite Bett in Saskias Zimmer stellen. Ich habe bereits Anweisungen gegeben.«
»Aber was wird mit Saskia?«, fragte Eliette beklommen. »Wenn sie aufwacht und ist allein …«
»Sie wird jetzt fest schlafen«, antwortete der Klinikchef. »Ich habe ihr ein leichtes Beruhigungsmittel gegeben. Das gleiche übrigens wie Ihnen«, fügte er mit einem kleinen Lächeln hinzu. »Eigentlich könnte sie die Nacht über auch allein sein, aber es ist besser, wenn jemand da ist, wenn sie morgen früh aufwacht.«
Damit öffnete er das Arztzimmer und ließ Eliette eintreten. »Ich bin wirklich sehr froh und dankbar, dass Sie sich um das Kind kümmern«, versicherte er. »Im Übrigen finde ich es großartig, was Sie getan haben.«
»Ich mag Saskia sehr, das ist alles«, antwortete Eliette. »Und manchmal kommt es mir vor, als würde ich sie schon jahrelang kennen.« Dann zuckte sie die Schultern und suchte nach einer Erklärung. »Vielleicht kommt das auch daher, weil ich sie bei dem Liederabend gesehen habe – oder aber weil sie mich an meine eigene Kindheit erinnert. Ihre ganze Art und ihr Hang zum Musischen …«
»Vielleicht könnten wir sie damit etwas ablenken«, meinte Dr. Laurin, während er die Anzeigen des Blutdruckmessgerätes aufmerksam verfolgte. Dann schaute er Eliette an. »Das Ganze hat Sie sehr mitgenommen.«
»Das kann man wohl sagen. Es ist, als beträfe es mich selbst.«
»Trotzdem sollten Sie etwas Abstand gewinnen«, riet der Arzt und überlegte weiter: »Vielleicht sollte ich morgen eine der Schwestern zu Saskia schicken.«
»Nein, Herr Doktor, bitte, lassen Sie mich so lange bei ihr bleiben, bis sie diesen Schock überwunden hat.«
Eliette unterdrückte ein Gähnen.
»Ich will erst einmal prüfen, wie es Ihnen und Saskia morgen geht. Dann sehen wir weiter. Ich muss schließlich auf das Wohl aller Patienten achten, und Sie sind nicht hier, um sich für das Kind aufzuopfern, selbst wenn es noch so tragisch ist, was die Kleine jetzt durchmachen muss.« Er erhob sich und reichte Eliette die Hand. »Ich glaube, die Tablette wirkt bereits. Legen Sie sich schlafen. Ihre Sachen sind inzwischen in Saskias Zimmer gebracht worden. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Frau Padburg.«
»Gute Nacht, Herr Doktor.« Eliette war auf einmal recht zuversichtlich. Sie konnte zwar nichts rückgängig machen, aber sie konnte vielleicht mit ihrer Kraft einem Kind über die schlimmste Zeit seines Lebens hinweghelfen.
Und was sie für Saskia tun konnte, sollte geschehen!
*
Als Dr. Laurin an diesem Abend später heimkehrte, kam ihm Kyra schon durch den Garten entgegengelaufen.
»Darf ich jetzt bald Saskia besuchen? Du hast doch gesagt, dass es ihr bessergeht und sie schon aufstehen darf. Der Appendings ist doch raus.«
»Appendix heißt das«, verbesserte Kevin seine kleine Schwester. Dann rief er seinem Vater zu: »Tag, Vati. Ich gehe noch zu Jörg wegen dem Pfadfindertreffen am Wochenende. Mutti weiß Bescheid«, fügte er schnell hinzu, als er sah, dass sein Vater auf die Uhr schaute.
»In Ordnung.« Leon Laurin winkte seinem Sohn zu und nahm seine Jüngste bei der Hand. Während er mit ihr zum Haus ging, fragte er: »Haben wir uns eigentlich schon guten Abend gesagt?«
Er schmunzelte, als seine Kleine sich daraufhin auf die Zehenspitzen stellte und den Mund spitzte. Er beugte sich zu ihr nieder und ließ sich einen Kuss auf die Wange geben.
»Hast du eigentlich an mein Fahrrad gedacht?«, fragte Kyra. »Du hast doch versprochen, mir den Sattel niedriger zu machen.«
»Das habe ich nicht vergessen«, antwortete Leon Laurin. »Soll ich dir erzählen, warum ich später nach Hause kam? Da gibt es nämlich ein kleines Mädchen, das in unserer Klinik liegt und seine Eltern durch einen schlimmen Unfall verloren hat. Und heute hat dies das Kind erfahren.«
»Du hast es ihr gesagt?«, fragte seine Frau atemlos.
»Nicht ich, sondern die Patientin, von der ich dir erzählt habe«, antwortete Leon. Dann wandte er sich wieder an seine Tochter. »Das Mädchen bekam einen Nervenzusammenbruch, als es davon erfuhr. Es wollte nicht glauben, dass seine Eltern tot sind. Hätte ich da sagen sollen, dass ich nach Hause muss, um das Fahrrad meiner Tochter zu reparieren? Was meinst du?« Er beugte sich zu Kyra, die ihm aufmerksam zugehört hatte.
»Das arme Kind«, murmelte Antonia still. »Vielleicht sollten wir es einmal zu uns einladen?«
»Es muss erst mit der Realität fertig werden«, entgegnete Leon. »Aber deinen Vorschlag werde ich bei Gelegenheit gern aufgreifen.« Er warf ihr einen liebevollen Blick zu. Dann seufzte er und meinte: »Ich hatte so sehr gehofft, dass sich Saskias Tante um sie kümmert.«
»Ist das Mädchen etwa Saskia Neumann?«, fuhr Kyra auf.
»Ja, sie hat ihre Eltern verloren, und deshalb kannst du sie auch noch nicht besuchen.«
Kyra schaute ihren Vater erschrocken an. Dann lief sie davon, und ihre Mutter rief ihr nach: »Wohin gehst du denn jetzt?«
»Ich pflücke einen Strauß Blumen für Saskia«, antwortete Kyra rasch.
»Es wird doch bereits dunkel«, gab Antonia Laurin zu bedenken, doch ihre Tochter meinte, dass sie noch genügend sehen würde. Sie wollte Saskia durchaus eine Freude bereiten.
Als sie später mit den Blumen zurückkam, stellte sie sie in eine Vase und bat ihren Vater, sie morgen mit in die Klinik zu nehmen.
»Eigentlich brauchst du das Fahrrad heute nicht mehr zu reparieren. Das hat noch Zeit bis morgen. Vielleicht kann es auch Kevin oder Konstantin machen.«
»Das ist sehr großzügig von dir, Kyra«, entgegnete ihr Vater. »Aber versprochen ist versprochen.«
Damit ging er zu der Garage, in der Kyras Fahrrad stand.
Plötzlich tauchte seine Frau hinter ihm auf.
»Was geschieht jetzt mit der kleinen Saskia?«, fragte sie besorgt.
»Sie wird wohl in ein Kinderheim kommen«, antwortete Leon Laurin bedrückt. »Das Jugendamt wird sich um sie kümmern und ihr Vermögen verwalten, bis sie volljährig ist. Eine Sozialarbeiterin hat sich heute bereits angemeldet und sich für morgen einen Termin geben lassen.«
»Aber was hast du damit zu tun?«
»Das weiß ich auch nicht. Vielleicht wollen die Behörden nur wissen, wann Saskia entlassen wird, damit sie die nötigen Vorbereitungen treffen können.«
»Das alles ist wirklich schrecklich«, sagte Antonia und seufzte.
Kyra, die alles mitbekommen hatte, fragte: »Könnten wir Saskia nicht ganz zu uns nehmen? Ich meine jetzt, wo sie doch keine Eltern mehr hat. Sicher würde sie sich freuen. Und dann könnten wir zusammen singen.«
»Mäuschen, deine Beweggründe sind wieder einmal rein egoistisch«, wies Antonia Laurin ihre kleine Tochter zurecht.
Schuldbewusst schlug Kyra die Augen nieder und beteuerte, dass sie es nicht so gemeint hätte.
»Wir sollten erst einmal abwarten, wie sich alles weiterentwickelt«, meinte ihr Vater. »Ich hoffe nur, dass sich das Kind mit der Realität abfinden wird.«
»Ich war noch nie in einem Kinderheim«, sagte Kyra. »Ist es dort schlimm?«
»Es gibt gute und weniger gute«, antwortete ihre Mutter.
»Dann musst du dafür sorgen, dass sie in ein gutes Kinderheim kommt, Vati«, sagte Kyra, worauf sich Leon nach ihr umwandte und ernst sagte: »Das verspreche ich dir, Kyra.«
Als er später mit seiner Frau allein war, meinte Antonia nachdenklich: »Dieses Kind geht mir einfach nicht aus dem Sinn. Ich wollte nicht vor Kyra davon sprechen, aber eigentlich hat sie recht.«
»Womit?«
»Dass wir es uns überlegen sollten, ob wir der kleinen Saskia nicht helfen können.«
»Du meinst, indem wir sie zu uns nehmen?« Dr. Laurin legte die Arme um die Schultern seiner Frau und küsste sie zärtlich auf die Wange. »Weißt du, dass ich mich sehr über deinen Vorschlag freue? Ich muss nämlich gestehen, dass ich auch schon daran gedacht habe. Aber wir sollten nichts übers Knie brechen und erst einmal abwarten.«
»Du hast ja recht. Aber es ist gut zu wissen, dass wir uns einig sind.« Zufrieden schaute Antonia ihren Mann an und war froh, dass sie den gleichen Gedanken gehabt hatten.
*
Als Eliette am nächsten Morgen erwachte, stellte sie fest, dass Saskia neben ihr lag und fest schlief. Sie musste in der Nacht in ihr Bett geschlüpft sein. Zärtlich zog die junge Frau die Decke über die Schultern des Mädchens und streichelte ihm über das Haar. Sie stellte fest, dass es dieselbe Farbe hatte wie das ihre und dachte wieder einmal daran, wie alles gekommen wäre, wenn Nikolaus Tschechow frei gewesen wäre und sie ihn damals geheiratet hätte. Zum ersten Mal nach langer Zeit ließ sie ihren Gedanken freien Lauf, während sich der zarte Körper des Kindes im Schlaf Schutz suchend an sie schmiegte.
Sie hatte von Anfang an gewusst, dass er verheiratet war. Aber Nikolaus hatte seine Frau nicht geliebt. Trotzdem wollte er sie nicht verlassen, weil sie an einer unheilbaren Krankheit litt. Nikolaus, mittlerweile ein berühmter Pianist, war regelrecht vor dieser Frau geflüchtet, indem er immer wieder neue Gastspiele gab und in der Welt umherreiste, nur, um nicht nach Hause zu müssen. Wie schön wäre es gewesen, Nikolaus’ Frau und Mutter seines Kindes sein zu dürfen.
Eliette seufzte, und als sie eine Bewegung neben sich bemerkte, blickte sie auf das Kind, das jetzt die Augen aufschlug. Sie erlebte mit, wie die Erinnerung Stück für Stück zurückkam, wie das Mädchen die Arme um sie schlang.
»Glaubst du, dass meine Eltern jetzt Engel sind?«, fragte es leise.