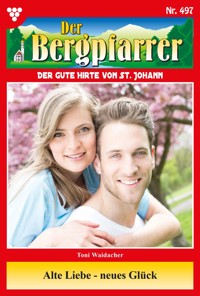156,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Bergpfarrer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Mit dem Bergpfarrer hat der bekannte Heimatromanautor Toni Waidacher einen wahrhaft unverwechselbaren Charakter geschaffen. Die Romanserie läuft seit über 13 Jahren, hat sich in ihren Themen stets weiterentwickelt und ist interessant für Jung und Alt! Toni Waidacher versteht es meisterhaft, die Welt um seinen Bergpfarrer herum lebendig, eben lebenswirklich zu gestalten. Er vermittelt heimatliche Gefühle, Sinn, Orientierung, Bodenständigkeit. Zugleich ist er ein Genie der Vielseitigkeit, wovon seine bereits weit über 400 Romane zeugen. Diese Serie enthält alles, was die Leserinnen und Leser von Heimatromanen interessiert. E-Book 1: Mein Herz gehört Nathalie E-Book 2: Die Liebe macht dich stark … E-Book 3: Philipps dunkles Geheimnis E-Book 4: Leg die Karten auf den Tisch, Philipp E-Book 5: Sehnsucht, die nie vergeht E-Book 6: Ein gewagtes Spiel E-Book 7: Wie sich das Blatt doch wenden kann… E-Book 8: Wo das Edelweiß blüht… E-Book 9: Rivalen um Franziskas Liebe E-Book 10: Er kannte nur ihren Namen E-Book 11: Mit dir kam das Glück zu mir E-Book 12: Ein junger Arzt in Nöten E-Book 13: Wenn das Herz spricht E-Book 14: Wie könnte ich jemals von dir lassen E-Book 15: Da war nur einer, der sie liebte E-Book 16: Alle waren gegen sie E-Book 17: Der lange Weg zum Glück E-Book 18: Die geborgte Braut E-Book 19: Ein Madl aus dem Wachnertal E-Book 20: Sie war nur eine Magd E-Book 21: Das Schicksal reist immer mit E-Book 22: Schau nicht zurück, Christine E-Book 23: Liebe für ein ganzes Leben... E-Book 24: Eine Lüge kann ich nicht verzeihen E-Book 25: Wen das Schicksal straft E-Book 26: Ewiger Streit im Wachnertal E-Book 27: Und immer wieder Chantal E-Book 28: Nur durch deine Liebe E-Book 29: Weil ich zu dir gehör'! E-Book 30: Ein ungeliebtes Erbe E-Book 31: Unter falschem Verdacht E-Book 32: Alles Glück der Erde E-Book 33: So hart kann ein Herz nicht sein E-Book 34: Stunden der Glückseligkeit E-Book 35: Gefangene der Liebe E-Book 36: Wenn zwei Herzen sich finden E-Book 37: Vroni muss sich entscheiden E-Book 38: Wir glauben an das Glück! E-Book 39: Liebe, die der Himmel schenkt E-Book 40: Ich klage Sie an, Sebastian Trenker! E-Book 41: Der Tag an dem ich zu dir fand E-Book 42: Das erste Busserl... E-Book 43: Der Liebe wegen nach St. Johann E-Book 44: Ich glaube an dich! E-Book 45: Macht des Schicksals E-Book 46: Tina geht ihren Weg E-Book 47: Neue Heimat, neues Glück? E-Book 48: Unnahbare Schönheit E-Book 49: Angst um den kleinen Sebastian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 5609
Ähnliche
Inhalt
Mein Herz gehört Nathalie
Die Liebe macht dich stark …
Philipps dunkles Geheimnis
Leg die Karten auf den Tisch, Philipp
Sehnsucht, die nie vergeht
Ein gewagtes Spiel
Wie sich das Blatt doch wenden kann…
Wo das Edelweiß blüht…
Rivalen um Franziskas Liebe
Er kannte nur ihren Namen
Mit dir kam das Glück zu mir
Ein junger Arzt in Nöten
Wenn das Herz spricht
Wie könnte ich jemals von dir lassen
Da war nur einer, der sie liebte
Alle waren gegen sie
Der lange Weg zum Glück
Die geborgte Braut
Ein Madl aus dem Wachnertal
Sie war nur eine Magd
Das Schicksal reist immer mit
Schau nicht zurück, Christine
Liebe für ein ganzes Leben...
Eine Lüge kann ich nicht verzeihen
Wen das Schicksal straft
Ewiger Streit im Wachnertal
Und immer wieder Chantal
Nur durch deine Liebe
Weil ich zu dir gehör’!
Ein ungeliebtes Erbe
Unter falschem Verdacht
Alles Glück der Erde
So hart kann ein Herz nicht sein
Stunden der Glückseligkeit
Gefangene der Liebe
Wenn zwei Herzen sich finden
Vroni muss sich entscheiden
Wir glauben an das Glück!
Liebe, die der Himmel schenkt
Ich klage Sie an, Sebastian Trenker!
Der Tag an dem ich zu dir fand
Das erste Busserl...
Der Liebe wegen nach St. Johann
Ich glaube an dich!
Macht des Schicksals
Tina geht ihren Weg
Neue Heimat, neues Glück?
Unnahbare Schönheit
Angst um den kleinen Sebastian
Der Bergpfarrer – Paket 8 –
E-Book 351-400
Toni Waidacher
Mein Herz gehört Nathalie
Unveröffentlichter Roman
Roman von Waidacher, Toni
Am 22. Dezember, punkt zehn Uhr, läuteten die Kirchenglocken von St. Johann die kirchliche Trauung Gregg Powells und Corinnas ein. Vor zwei Tagen hatten sie sich das Ja-Wort in einem Standesamt in London gegeben, nun sollte ihr Bund fürs Leben auch vor Gott besiegelt werden.
Der Bergpfarrer war sehr gerührt, dass die beiden dafür extra nach St. Johann gekommen waren, um sich von ihm trauen zu lassen. Es waren etwa fünfzehn Leute, die als Gäste der Zeremonie beiwohnten. Unter ihnen waren Max Trenker mit seiner Familie und Markus Bruckner mit Ehefrau. Auch Monika Heinold und Ulrike Scharl, die beiden jungen Frauen, die den Bergpfarrer in seinem Bemühen unterstützt hatten, Gregg Powell zu überzeugen, dass die Freilichtbühne dem Wachnertal irreparablen Schaden bringen würde, sowie deren Freunde Thomas Demmel und Alexander Gärtner gehörten zu den Gästen.
Die Trauung fand in angenehm lockerer Atmosphäre statt, später, vor der Kirche, gratulierten die Gäste und auch einige St. Johanner dem Paar und wünschten ihm alles Gute für die Zukunft. Danach ging es zum Hotel, wo Sepp Reisinger einen Sektempfang vorbereitet hatte. Er und seine Familie beglückwünschten das Brautpaar, dann führte Sepp die Hochzeitsgesellschaft ins Nebenzimmer, das liebevoll mit Blumengebinden und Kerzen dekoriert worden war.
Die Tische waren in Hufeisenform zusammengestellt, das frisch getraute Ehepaar hatte den Ehrenplatz an der Tafel inne. Rechts neben Gregg war der Platz des Bergpfarrers. Neben Sebastian saß Bürgermeister Markus Bruckner und neben diesem seine Gattin. Gitti und Heidi Reisinger hatten alle Hände voll zu tun, die Getränkewünsche der Gäste zu erfüllen. Das Mittagessen sollte erst in etwa einer halben Stunde beginnen.
Aus dem Stimmenwirrwarr stieg hin und wieder schallendes Gelächter. Die Stimmung war ausgelassen, und sogar das Gemeindeoberhaupt zeigte sich von seiner vollkommen gelösten Seite. Er stupste Sebastian leicht mit dem Ellenbogen an, und als sich der Pfarrer ihm zuwandte, sagte er gerade so laut, dass ihn Sebastian trotz der Geräuschkulisse in dem Raum verstehen konnte: »Der Herr Powell hat der Gemeindekasse einen ziemlich großen Betrag gespendet. Ich weiß net, ob er Ihnen das erzählt hat, Hochwürden. Mich hat er gebeten, kein großes Aufhebens deswegen zu machen.«
»Er hat angedeutet, dass er spenden will«, nickte Sebastian. »Aber ich habe keine Ahnung, wie hoch die Spende ausgefallen ist.«
Mit verschwörerischer Miene nannte Bruckner die Summe.
»Donnerwetter«, entfuhr es Sebastian, »das ist ja ein beträchtlicher Batzen Geld. Das, denk’ ich, ist Trostpflaster genug für dich Markus. Jetzt weinst du der Freilichtbühne gewiss nimmer hinterher.«
»Nein, ich glaub’, jetzt hab’ ich die Sach’ endgültig verschmerzt. Das Gemeindesäckel kann die Spende ganz gut gebrauchen.«
»Wenn ich mich net irr’, Markus, dann hat der Herr Powell unter der Voraussetzung gespendet, dass die Gemeinde das Geld für den Naturschutz verwendet.«
»Ja, ja.« Das Lächeln, das Markus gezeigt hatte, wirkte jetzt wie eingefroren. »Natürlich werden wir die Spende nur zweckentsprechend einsetzen. Natürlich immer unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes. Auf eine andere Idee wär’ ich nie gekommen, Hochwürden.«
»Was anderes hab’ ich von dir auch gar net erwartet, Markus. Weiß ich doch, wie sehr dir die Natur des Wachnertals am Herzen liegt.«
Misstrauisch forschte der Bürgermeister im Gesicht des Pfarrers. Wie war das jetzt gemeint? Etwa ironisch? Doch das Lächeln des Bergpfarrers war unergründlich. »Ach, Sie …«, brabbelte Bruckner vor sich hin.
Sebastian spürte Gregg Powells Hand auf seinem Arm. »Reden wir ein anderes Mal weiter, Markus«, sagte er und wandte sich dem Engländer zu.
»Ich hatte Gelegenheit, mich ein bisschen intensiver in Ihrer Kirche umzusehen, Herr Pfarrer. Dabei ist mir aufgefallen, dass viele der Fresken ziemlich verblichen sind. Auf den ersten Blick fällt es nicht auf, bei näherer Betrachtung, aber schon. Meinen Sie nicht auch, dass die Fresken ein wenig aufgemöbelt werden sollten?«
»Das ist mir schon seit längerer Zeit bewusst«, erwiderte Sebastian. »Aber das würde ziemlich viel Geld kosten, Geld, das wir net haben. Und die Diözese schiebt die Renovierung immer wieder auf die lange Bank. Ich meine, man vertröstet mich ein um das andere Mal.«
»Darüber müssen wir reden«, sagte Gregg lächelnd. »Im Einvernehmen mit meiner lieben Gattin habe ich mich nämlich entschlossen, Ihrer Kirche auch einen gewissen Betrag zu spenden, mit dem Sie ihren wunderschönen Fresken einen neuen Glanz verleihen können.«
»Aber, das ist doch net notwendig, Herr Powell. Sie haben doch schon der Gemeinde …«
»Die Spende an die Gemeinde sollte ursprünglich höher ausfallen. Aber dann hat mich Corinna auf die Idee gebracht, dass man das Geld aufteilen könnte. Und nachdem ich heute bemerkt habe, dass in Ihrer Kirche einiges der Restaurierung bedarf, war mir klar, wem ich die andere Hälfte der Spende zur Verfügung stelle.«
Sebastian war baff. »Ich weiß net, was ich sagen soll, Herr Powell …«
»Sagen Sie Gregg zu mir, Herr Pfarrer. Beauftragen Sie einen Kirchenmaler mit den Renovierungsarbeiten. Die Mittel, die ich Ihnen dafür zur Verfügung stelle, dürfte ausreichend sein. Und der Zweck ist ein guter, denke ich.«
Spontan reichte Sebastian dem Engländer die Hand. »Ich weiß net, was ich sagen soll, Gregg«, erklärte er, noch immer völlig überwältigt von so viel Großzügigkeit. »Außer danke zu sagen, fällt mir im Moment nix ein.«
»Das ist auch nicht nötig«, versetzte Powell. »Wir haben Ihnen doch schon erzählt, dass wir vorhaben, uns in St. Johann ein Anwesen zu kaufen, um hier, so oft es möglich ist, zu erholen und uns einen späteren Alterssitz zu schaffen.«
»Haben Sie denn schon etwas in Aussicht?«
»Nein. Aber ich werde einen Makler damit beauftragen. Und vielleicht können auch Sie sich ein wenig umhören. Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass gute Objekte oft ohne Makler angeboten werden. Sie haben Ihr Ohr gewissermaßen am Pulsschlag des Wachnertals. Sollte Ihnen etwas zu Gehör kommen, dann wissen Sie ja, an wen Sie denken müssen.«
»Darauf können S’ sich verlassen, Gregg. Sie haben schon recht. Oft gehen solche Transaktionen unter der Hand vonstatten.«
»Darum hab’ ich auch Herrn Bruckner gebeten, sich für mich ein wenig umzuhören, denn Corinna und mir wäre viel daran gelegen, hier eine schöne Bleibe zu finden. Es kann auch etwas Renovierungsbedürftiges sein, unter Umständen auch ein Bauernhof, der aus irgendeinem Grund aufgegeben wird.«
»Wenn ich was hör’, kriegen S’ Bescheid, Gregg«, versicherte Sebastian.
»Was die Spende anbetrifft, komme ich morgen oder übermorgen zu Ihnen ins Pfarrhaus«, gab Powell zu verstehen. »Dann machen wir die Sache perfekt. Heute reden wir nicht mehr über Geld«, setzte er lächelnd hinzu. »Heute wollen wir nur noch feiern.« Er nahm sein Bierglas und hob es: »Cheers, Herr Pfarrer.«
Auch Sebastian hob sein Bierglas. »Auf Ihr Wohl und das Ihrer Gattin, Gregg.«
Der Engländer, den Sebastian ursprünglich für rücksichtslos gehalten und als eiskalten Geschäftsmann eingestuft hatte, und er, der Pfarrer, waren auf dem besten Weg, gute Freunde zu werden.
»Darf ich auch mit anstoßen?«, fragte der Bürgermeister und zeigte sein breitestes Grinsen. Er hatte zwar die Ohren aufgesperrt und sich bemüht, etwas von dem Gespräch zwischen dem Pfarrer und Powell mitzubekommen, doch ihre Stimmen waren in dem übrigen Lärm untergegangen. Jetzt aber wollte sich Bruckner wieder einbringen … Er hielt sein Glas hoch, Sebastian und Gregg Powell stießen mit ihm an.
*
Am folgenden Morgen setzte sich Sebastian nach der Morgenmesse an den Frühstückstisch.
Sophie Tappert brachte frisch gebackenes Brot, Wurst und Käse, auch Butter und selbst eingekochte Marmelade, sowie eine Thermoskanne mit Kaffee. »Na, hat’s lang gedauert heut’ Nacht?«, fragte sie. Begrüßt hatten sie und der Pfarrer sich bereits vor der Andacht.
»Ich bin um elf Uhr nach Haus’ gegangen«, antwortete Sebastian. »Es war eine angenehme Feier. Ich denk’, dass der Gregg und die Corinna sehr gut miteinander harmonieren werden. Den beiden gefällt’s bei uns. Sie planen sogar, hier ein Haus zu kaufen, damit sie, so oft es möglich ist, ins Wachnertal kommen und ein paar Tage entspannen können. Und wenn Gregg in den Ruhestand geht, wollen s’ ganz herziehen.«
»Der weiß aber schon, was bei uns so ein Häusl kostet?«, fragte Sophie.
Sebastian winkte ab. »Geld spielt bei ihm keine Rolle. Er hat der Gemeinde einen ansehnlichen Betrag für den Naturschutz gespendet, und der Pfarrei will er die Restaurierung der Kirche bezahlen.«
»Sagen S’ bloß«, rief Sophie erstaunt und fixierte den Pfarrer geradezu ungläubig.
»Ja, er hat es mir gestern zugesichert. Nachdem er sich ein wenig intensiver in unserer Kirche umgeschaut hat, hat er bemerkt, dass einige der Fresken im Laufe der Zeit gelitten haben. Jetzt bin ich am Überlegen, wen ich mit der Restaurierung beauftragen soll. Ich muss mal schauen, ob’s in Garmisch einen Kirchenmaler gibt. Mir wär’ viel dran gelegen, dass den Auftrag jemand aus unserer Region erledigt.«
»Da denk’ ich sofort an den Lukas Baumann, Hochwürden. Der ist doch vor einigen Jahren nach München gegangen, um eine Ausbildung als Kirchenmaler zu absolvieren. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist er inzwischen selbständig.«
»Richtig«, stieß Sebastian hervor. »Es ist acht Jahr’ her, dass er weggegangen ist. Das ist eine gute Idee, Frau Tappert. Ich werd’ mich gleich im Internet kundig machen und ihn anrufen.«
»Wie viel Geld hat der Powell denn gespendet?«, fragte Sophie, während Sebastian sein Stück Brot mit Käsescheiben belegte. Es war natürlich Bergkäse aus der Produktion des alten Thurecker-Franz, von der Kandereralm.
Sebastian nannte den Betrag und Sophie hielt den Atem an. »Der Powell muss aber sehr reich sein«, murmelte sie dann, nickte mehrere Male und fügte hinzu: »Mit der Summe können S’ was anfangen, Hochwürden. Himmel, da wird unser Kircherl bald in einem neuen Glanz erstrahlen. Was für eine Freud’!«
»Ja, das ist in der Tat erfreulich, Frau Tappert. Wer hätte das gedacht, als es vor einiger Zeit noch darum gegangen ist, den Bau der Open-Air-Arena zu verhindern. Beim Gregg hat sich’s wieder mal bewiesen, dass man einen Menschen net nach dem ersten Eindruck beurteilen sollt’. Und ich hab’ immer gedacht, ich verfüg’ über Menschenkenntnis. Beim Gregg hat mich sie mich vollkommen im Stich gelassen.«
»Sie haben sich ja auch unter Voraussetzungen kennengelernt, unter denen Sympathie zweitrangig war«, versetzte Sophie und schenkte dem Pfarrer Kaffee ein. »Sind wir dankbar, dass alles so gekommen ist. Lassen S’ Ihnen das Frühstück schmecken, Hochwürden.«
»Danke. Setzen S’ sich doch ein bissel zu mir und trinken S’ mit mir ein Tasserl Kaffee, Frau Tappert. Gegessen werden S’ schon was haben. Wenn net …« Er wies auf den reichlich gedeckten Frühstückstisch.
»Ein Tasserl Kaffee trink’ ich gern mit Ihnen, Hochwürden. Dann können S’ mir ein bissel was von der Hochzeit erzählen.« Sophie holte sich eine Tasse, setzte sich an den Tisch und schenkte sich ein. »Ihr Bruder war ja auch eingeladen. Ich hoff’, er hat kein Problem mehr mit seinem Knöchel.«
»Der rennt wieder wie ein Wiesel. Aber davon können S’ sich ja morgen Mittag mit eigenen Augen überzeugen, wenn er zum Essen kommt.«
»Ich werd’ für Sie Rumpsteaks braten, Hochwürden. Dazu gibt es grüne Stangenbohnen mit Speck und Zwiebelwürfeln, Kräuterbutter und Folienkartoffeln. Meinen S’, ihm dass das schmeckt?«
»Mit Sicherheit. Mich fragen S’ wohl schon gar nimmer, wie?«
»Ich bitt’ Sie, Hochwürden …« Sophie blickte geradezu erschreckt drein.
»Entschuldigen S’, dass ich …«
Sebastian lachte amüsiert auf. »Ich hab’ nur einen Spaß gemacht, Frau Tappert. Sie wissen doch, dass ich auf gebratenes Fleisch steh’. Und der Max ebenso. Ich soll Sie übrigens von der Claudia schön grüßen.«
»Dankschön. Jetzt erzählen S’ mir doch bitte ein bissel was von der Hochzeit. Der Bürgermeister war ja auch eingeladen. Hat er seinen Groll gegen den Mister Powell endlich begraben?«
»Da gibt’s net viel zu erzählen, Frau Tappert. Der Corinna haben vor Glück die Augen gestrahlt, und der weltmännische Gregg war anfangs nervös wie ein kleiner Bub am Heiligen Abend vor der Bescherung. Er ist bis über beide Ohren verliebt. Jeder Blick, jede Geste, jedes Wort hat das deutlich zum Ausdruck gebracht. Ein schönes Paar, das muss ich sagen. Was den Bruckner betrifft …« Sebastian wurde nachdenklich. »Der war mehr als freundlich zum Gregg«, fuhr er dann fort. »Schon beim ersten Treffen vorgestern hat er sich sehr versöhnlich gegeben, als hätt’s nie irgendeine Diskrepanz zwischen ihm und Gregg gegeben. ›Vergessen wir, was einmal war‹, hat er getönt. ›Schauen wir hoffnungsvoll in die Zukunft und blicken wir net im Zorn zurück … Die Hauptsach’ ist, dass wir uns vertragen und ein Leben in Frieden führen‹. Ich war ganz schön verwundert, kann ich Ihnen sagen.«
»Und jetzt fragen S’ sich, Hochwürden, was für Hintergedanken er hat, stimmt’s?«
»Das tät sicherlich jeder an meiner Stell’«, gab Sebastian zu.
»Ja, ein solches Verhalten ist verdächtig. Ich würd’ ihn einfach fragen, Hochwürden. Er ist ein schlechter Lügner, und wenn er irgendeine Absicht mit seinem übertrieben freundlichem Getue verfolgt, dann wird er sich irgendwann verraten.« Plötzlich glitt der Schimmer des Begreifens über Sophies Gesicht. »Ich denk’, es ist wegen der Wette. Vielleicht meint er, Sie erlassen ihm seine Wettschuld, wenn er Ihnen den Gefallen erweist und dem Powell gegenüber mit ausgesuchter Höflichkeit auftritt.«
Sebastian grinste. »Da haben S’ vielleicht sogar recht, Frau Tappert. Wenn’s so ist, dann rückt er bald raus mit der Sprache. Irgendetwas rechnet er sich jedenfalls aus. Der Spende wegen kann’s net sein, denn von der hat er vorgestern, als er ins Pfarrhaus gekommen ist, noch nix gewusst.«
»Dass das alte Schlitzohr net ohne Grund dermaßen freundlich zum Powell ist, dürft jedenfalls so sicher sein wie das Amen in der Kirch’«, vermutete Sophie
»Ich werd’s herausfinden«, zeigte sich der Bergpfarrer zuversichtlich. »Und jetzt will ich Ihnen erzählen, was sich die Irma Reisinger alles einfallen hat lassen, um die Gaumen des Brautpaars und seiner Gäste zu verwöhnen ... «
*
Sebastian Trenker fand die Telefonnummer Lukas Baumanns heraus und rief sofort in München an. Obwohl Sonntag war und Sebastian bezweifelt hatte, dass er den Kunstmaler erreichen würde, hob jemand ab. »Baumann«, erklang eine dunkle, sympathische Stimme.
»Sprech’ ich mit Lukas Baumann?«, fragte Sebastian.
»Ja. Und mit wem sprech’ ich?«
»Pfarrer Trenker aus St. Johann. Du erinnerst dich sicher an mich, Lukas.«
»Ja, so etwas, sind Sie’s wirklich, Herr Pfarrer?« Die Stimme klang freudig erregt. »Natürlich erinner’ ich mich an Sie. Was für eine Überraschung.«
»Wie geht’s dir denn, Lukas? Ich hab’ festgestellt, dass du einen eigenen Betrieb gegründet hast. Du firmierst, unter anderem, als Kirchenrestaurator, und das ist genau das, was ich such’.«
»Möchten S’ etwa unserer schönes Kircherl restaurieren, Herr Pfarrer? Ich seh’ die wunderbaren Fresken regelrecht vor mir. Sie waren damals eigentlich der Grund, der mich bewogen hat, Kirchenmaler zu werden. Ich hab’ schon als kleiner Bub den Wunsch gehabt, derart schöne Bilder zu malen. Na ja, diesen Wunsch hab’ ich schließlich auch in die Tat umgesetzt.«
»Und das ist gut so. Denn St. Johann braucht deine Fähigkeiten, Lukas. Es ist in der Tat das Innere unserer Kirche, das einer Überholung bedarf. Hättest du Interesse daran, die Arbeiten durchzuführen?«
»Natürlich! Das wär’ ja eine Art Ritterschlag für mich, wenn Sie mir einen solchen Auftrag zukommen lassen. Meinen Lebensunterhalt verdien’ ich nämlich net mit der Restaurierung von Kirchen, sondern mit ganz profanen Malerarbeiten. An die großen Aufträge kommen ja meist nur die Betriebe ran, die sich schon einen Namen auf diesem Gebiet gemacht haben.«
»Dann kommt dir ja mein Anruf sicher gelegen«, konstatierte der Pfarrer.
»Das will ich meinen, Herr Pfarrer. Allerdings müsst’ ich mir die Kirche erst mal anschauen, damit ich beurteilen kann, was gemacht werden muss. Sie werden ja sicherlich einen Kostenvoranschlag haben wollen.«
»Natürlich, Lukas. Die Pfarrei erhält die Renovierungskosten als Spende, aber ich will sicherstellen, dass ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis gegeben ist. Du verstehst, was ich meine?«
»Natürlich versteh’ ich das, Hochwürden. Wie eilig ist der Auftrag? Wenn S’ möchten, dann komm’ ich gleich nach Weihnachten nach St. Johann und schau mir die Sach’ an.«
»Das wär’ super, Lukas. Der großzügige Spender will nämlich nach Drei König’ wieder nach England zurückkehren. Und mir wär’ schon viel daran gelegen, dass er dabei sein kann, wenn du dir die Fresken anschaust und den Aufwand beurteilst.«
»In Ordnung, Herr Pfarrer. Ich komm’ am Siebenundzwanzigsten im Lauf’ des Vormittags zu Ihnen. Wie geht’s sonst so im Wachnertal, speziell in St. Johann? Ist der Bruckner noch Bürgermeister? Was treibt die Annika? Ist sie in der Zwischenzeit verheiratet? Wahrscheinlich. Sie war ja ein blitzsauberes Dirndl, und wenn’s mich damals net nach München verschlagen hätt’, würd’ sie wohl längst meinen Familiennamen tragen.«
»Du sprichst sicher von der Annika Lang«, sagte Sebastian.
»Klar. Wir waren doch ziemlich fest miteinander verbandelt. Allerdings war ich gerade mal neunzehn Jahr’ alt, die Annika war achtzehn. Die Sach’ ist damals schnell auseinandergegangen. Sie wissen schon, Herr Pfarrer: Aus den Augen, aus dem Sinn. Wir waren eben jung, und ich hab’ mich entschlossen, in München zu bleiben.«
»Die Annika ist net verheiratet«, erklärte Sebastian. »Sie arbeitet nach wie vor im Büro beim Forstamt. Ja, ja, ich kann mich schon noch erinnern, dass damals was zwischen dir und der Annika war. Aber das ist lang her. Was ist mit dir, Lukas? Bist du verheiratet?«
»Nein. Ich hab’ noch net die richtige Frau gefunden, Herr Pfarrer. Aber ich bin guter Dinge. Ich hab’ eine Kirchenmalerin eingestellt, ihr Name ist Nathalie. Das Madel gefällt mir, und wenn ich mich net irr’, dann bin auch ich ihr net zuwider. Vielleicht tut sich was zwischen uns. Mal schauen.«
»Dann bleib’ nur am Ball, Lukas«, lachte der Pfarrer. »Das würd’ ja passen: Der Kirchenmaler und die Kirchenmalerin; wenn das keine perfekte Konstellation ist!«
Lukas lachte. »Na ja, wie gesagt, Herr Pfarrer. Es ist noch im Anfangsstadium. Vielleicht ist die Nathalie auch bloß deshalb recht freundlich zu mir, weil ich ihr Chef bin.«
»Den Chef darfst du natürlich net raushängen lassen. Du musst halt deutlich zeigen, dass sie dir mehr bedeutet, als nur eine sympathische Beschäftigte. Aber ich denk’, du bist alt genug, um zu wissen, wie man das macht.«
»Ich denk’, sie merkt’s schon. Ich bin mir ihrer Gefühle halt net so sicher. Allerdings hab’ ich auf diesem Gebiet kaum Erfahrung. Erst hab’ ich mich auf meine Ausbildung konzentriert und dann auf den Aufbau meines Geschäfts. Ich hab’ da ziemlich ranklotzen müssen. Jetzt läuft’s einigermaßen, und ich kann mich auch den schönen Dingen des Lebens zuwenden.«
»Na dann, viel Glück, Lukas. Wir sehen uns nach Weihnachten. Allzu viel Arbeit dürft’ die Restaurierung net erfordern. Die Farben der Fresken sind halt ein bissel verblasst, hier und dort sind sie vielleicht auch ein klein wenig abgeblättert. Nix Großes, denk’ ich. Aber ich kann das sicher net so fachmännisch beurteilen wie du.«
»Ich werd’ nach Weihnachten bei Ihnen auf der Matte stehen, Herr Pfarrer. Vielen Dank dafür, dass Sie an mich gedacht haben. Ich darf Ihnen auch gleich ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen.«
»Das gleiche wünsch’ ich dir auch, Lukas. Wir sehen uns also am Siebenundzwanzigsten. Bis dahin servus.«
»Pfüat Ihnen, Herr Pfarrer.«
Sebastian legte auf, überlegte kurz und rief bei Markus Bruckner an. Er wählte die private Handynummer des Bürgermeisters, denn es war Sonntag und das Rathaus hatte geschlossen. Sebastian hatte sich vorgenommen, dem Gemeindeoberhaupt ein wenig auf den Zahn zu fühlen.
*
»Habe die Ehre, Hochwürden!«, hörte er gleich darauf Bruckners joviale Stimme. »Ich hoff’, Sie waren zufrieden mit mir, bin ich doch dem Gregg Powell und seiner Angetrauten ausgesprochen zuvorkommend und höflich begegnet.«
»Viel zu zuvorkommend und viel zu höflich, Markus«, wandte Sebastian ein. »So viel Freundlichkeit deinerseits, hat meinen Argwohn erregt.«
»Ich werd’ närrisch«, stieß der Bürgermeister hervor. »Kann ich Ihnen denn gar nix recht machen?«
»Hand aufs Herz, Markus, was führst du im Schilde?«
»Jetzt hören S’ aber auf, Hochwürden«, erregte sich Bruckner. »Sie haben mich gebeten, das Kriegsbeil zu begraben, und das hab’ ich getan. Vor allem die Spende Powells hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass er ein absoluter Ehrenmann ist. Warum sollt’ ich einem Menschen wie ihm net überaus freundlich entgegentreten?«
»Als du bei mir im Pfarrhaus warst und das erste Treffen mit dem Gregg hattest, hast du noch gar nix von der Spende gewusst. Erinnerst du dich, Markus? Vorher wolltest du noch Wachposten aufstellen, die dem Gregg den Zutritt nach St. Johann verweigern sollten. Dann, auf einmal, klang es völlig anders. Was stimmt da net, Markus?«
»Sie sind eine Nervensäge, Hochwürden. Das muss mal gesagt werden. Gut. Ich bin Ihnen entgegengekommen, als ich mich dem Powell gegenüber freundlich gezeigt hab’. Aufgrund seiner noblen Spende könnt’ ich ihm gar nimmer bös’ sein. Aber daran, dass er gespendet hat, können S’ ermessen, dass er sich schuldig fühlt. Ich denk’, Hochwürden, die Spende ist eine reine Wiedergutmachung. Das schlechte Gewissen … Hätt’ ich auch gehabt – an seiner Stelle.«
»Das kann ich mir net vorstellen, Markus. Aber darüber zu debattieren ist müßig. Was erwartest du denn von mir für dein – hm, Entgegenkommen?«
»Jetzt unterstellen S’ mir schon wieder einen Hintergedanken.«
»Natürlich«, gab Sebastian unumwunden zu.
»Das ist ja allerhand«, stieß Bruckner hervor.
»Ich bitt’ dich, Markus«, sagte Sebastian geduldig. »Halt’ mich net für dümmer, als ich vielleicht ausschau’. Dein Stimmungswandel, den Gregg Powell betreffend, ist net von ungefähr gekommen.«
»Wenn ich’s Ihnen aber sag’, Hochwürden …«
»Dann lügst du mich an. Also raus mit der Sprache, Markus! Was hat dich bewogen, dem Gregg dein freundlichstes Gesicht zu zeigen, obwohl du ihn am liebsten auf den Mond geschossen hättest?« Sebastian wartete auf eine Antwort, als diese aber nicht kam, brachte er seinen Verdacht auf den Punkt: »Fällt dir keine Ausrede mehr ein, Markus? Na schön, dann sag’ ich dir, was dich leitet. Du möchtest erreichen, dass ich dir die Wettschuld erlass’, gell?«
»Ich werd’ nimmer! Können S’ jetzt etwa auch schon Gedanken lesen, Hochwürden?«
»Das war ein Geständnis, Markus.«
»Na ja, ein bissel hab’ ich schon gehofft, dass Sie auch mir entgegenkommen, Hochwürden. Sie wissen ja selbst, dass ich net der Gesündeste bin. Einen derart weiten Marsch werd’ ich kaum schaffen. Die Bandscheibe, außerdem hat mir der Arzt …«
»Gar nix hat dir der Arzt gesagt, Markus. Du lügst ja schon wieder. Dein Sündenregister wächst.«
»Damals, als ich gemustert worden bin«, kam es fast kläglich vom Bürgermeister, »hat mir der Arzt Senk-, Platt- und Spreizfüße bescheinigt. Ich glaub’ net, dass so eine Krankheit mit dem Alter vergeht. Und wenn wir schon beim Alter sind, Hochwürden. Der Jüngste bin ich ja schließlich auch nimmer.«
»Ich nehm’ dir das mit den Füßen net ab«, erklärte Sebastian.
»Ihr Chef da oben, hinter den Wolken, ist mein Zeuge, Hochwürden. Das war ja auch der Grund, weshalb ich dienstuntauglich war.«
»Sei’s wie’s sein mag, Markus. Ich weiß net, ob ich dir die Wettschuld erlassen soll. Man könnt’ vielleicht darüber reden, wenn du mir versprichst, nichts mehr ins Auge zu fassen, was Flora und Fauna rund um St. Johann gefährden könnt’. Es wär’ gewissermaßen ein Erlass der Wettschuld auf Bewährung.«
»Das wär’ doch was!«, zeigte sich der Bürgermeister begeistert. »Sie erlassen mir die Wettschuld auf Bewährung. Was Ihnen alles so einfällt, Hochwürden. Allerdings …«
Bruckner zögerte kurz, fuhr aber schließlich fort: »… birgt so ein Deal auch Gefahren – Gefahren für mich.«
»Von welchen Gefahren redest du?«, erkundigte sich der Pfarrer.
»Na ja, es ist doch so, dass ich immer drauf bedacht bin, Entscheidungen des Gemeinderats zum Wohl der Gemeinde zu erwirken. Ausschließlich zum Wohl St. Johanns und seiner Bewohner. Wenn irgendein Projekt an mich herangetragen wird, das dem Gemeinwohl dienen könnt und ich es befürwort’, können Sie sagen, dass die Natur gefährdet wird und meine Bewährung wär’ hin. Sie hätten mich gewissermaßen in der Hand, Hochwürden. Aber ich muss frei und ohne irgendein Damoklesschwert über dem Kopf entscheiden können. Ihr Vorschlag würd’ mich einschränken und ich lauf’ Gefahr, dass er sogar mein ganzes Handeln bestimmen tät’.«
»Wenn du das so siehst, dann wird’s wohl nix aus dem Deal, Markus«, gab Sebastian zu verstehen.
»Jetzt geben S’ sich doch einen Ruck, Hochwürden, und sagen S’ einfach ›okay, Markus, ich erlass’ dir die Wettschuld‹. Ist denn das so schwer? Den Leuten könnt’ man ja verklickern, dass ich die Fußwallfahrt aus gesundheitlichen Gründen net mitmachen kann. Das wird jeder einsehen und verstehen.«
»Brütest du etwa schon wieder was aus, Markus, von dem du weißt, dass ich es net mittragen werd’, weil du so zurückhaltend auf meinen Vorschlag reagierst? Hättest du die Bewährung etwa schon verwirkt, ehe sie überhaupt richtig zum Tragen gekommen wär’?«
»Sie nehmen immer gleich das Schlechteste an, Hochwürden. Natürlich werden die verschiedensten Wünsche und Vorschläge an mich herangetragen. Ich muss dann genau abwägen, ob die Umsetzung dem Gemeinwohl dient. Das ist net immer ganz einfach, und ich übernehm’ oft große Verantwortung.«
»Du redest um den heißen Brei herum, Markus.«
Der Bürgermeister seufzte ergeben. »Ich wollt’ nur zum Ausdruck bringen, dass es für mich net einfach ist, nur Projekte zu unterstützen, die auch Ihnen genehm sind, Hochwürden. Ich muss vornehmlich an die Gemeinde denken. Würd’ ich Ihrem Vorschlag zustimmen, wär’ ich Ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und ich könnt’ nimmer frei entscheiden.«
»Um mir das zu sagen, hast du aber sehr viel geredet, Markus. Sei ehrlich: Gibt’s was, das ich wissen sollt’?«
»Wenn was in der Planung ist, Hochwürden, werden Sie’s auch erfahren. Oder haben S’ schon mal was net erfahren?«
»Deine ausweichenden Antworten gefallen mir net, Markus. Es bleibt also dabei: Wir beide marschieren zu Pfingsten von München nach Altötting, und sobald der Schnee auf den Bergen weggetaut ist, werden wir wieder jedes Wochenende trainieren. Ich will ja net, dass du dich blamierst.«
»Ha, ha«, machte der Bürgermeister. »Ihre Fürsorglichkeit rührt mich zu Tränen, Hochwürden.«
»Beenden wir das Gespräch, Markus, denn es führt zu nix.«
»Weil Sie so uneinsichtig sind, Hochwürden!«
»Das ist deine Meinung, Markus. Servus. Ich wünsch’ dir noch einen geruhsamen Sonntag.« Sebastian unterbrach die Verbindung, legte das Telefon weg und grinste dabei vor sich hin. ›Es ist immer das gleiche mit dem Markus‹, sinnierte er. ›Er und ich werden wohl nie einer Meinung sein.‹
*
Am Montag, es war der Heilige Abend, trat Max Trenker wieder seinen Dienst im Polizeirevier an. Dienstbeginn sollte um sieben Uhr sein, aber die brennende Ungeduld, endlich wieder den geliebten Job verrichten zu dürfen, trieb ihn schon eine halbe Stunde früher in die Wache.
Er öffnete die Fenster und ließ frische Luft in den großen Raum. Eine Art Glückgefühl stieg in ihm hoch. Nach sechs langen Wochen durfte er wieder an dem Ort agieren, der ihm zum zweiten Zuhause geworden war.
Er schaute in alle Schränke und fand alles genauso geordnet und aufgeräumt vor, wie er es am Tag vor seinem Unfall verlassen hatte. Am schwarzen Brett hingen einige neue Meldungen der Polizeiinspektion Garmisch sowie des Landeskriminalamts. Sogar zwei Steckbriefe waren während seiner Abwesenheit eingetrudelt, die Pilhofer pflichtgemäß durch Aushang der Öffentlichkeit zugängig gemacht hatte.
Kurz vor sieben Uhr erschien Martin Pilhofer. Er trug zivile Kleidung. Er gab Max die Hand und sagte: »Die Übergabe der Geschäfte haben wir ja schon erledigt, als Sie mich besucht haben, nachdem Ihnen der Gips abgenommen worden ist, Herr Trenker. Es bleibt mir nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden und Ihnen alles Gute zu wünschen.« Er grinste lausbubenhaft. »Nehmen S’ sich in Zukunft vor achtlos weggeworfenen Bananenschalen in Acht …«
»Es war ein Apfelbutzen«, sagte Max.
»Dann nehmen S’ sich eben vor Apfelbutzen in Acht«, grinste Martin und reichte Max die Hand. »Ich komm’ Sie vielleicht mal besuchen, Herr Trenker. Wie Sie wissen, hab’ ich mich in die Mareike verliebt, und sie bleibt in St. Johann, bis ich in Garmisch eine Wohnung für uns gefunden hab’. Ich werd’ also jedes Wochenende herkommen.«
»Vielen Dank für die erstklassige Vertretung, Martin«, sagte Max. »Machen S’ so weiter und …« Plötzlich stutzte er. »Warum sagen wir eigentlich immer noch Sie zueinander. Wenn du nix dagegen hast - ich bin der Max.«
»Meinen Namen muss ich dir net sagen«, versetzte Martin erfreut. »Es ist mir eine Ehre …«
»Schmarrn! Wir sind Kollegen. Da bedarf’s keiner großen Formalitäten. Also, Martin, mach’ weiter so, und ich garantier’ dir eine steile Karriere. Und vergiss net, dich bei meinem Bruder zu verabschieden. Bei dem hast du auch einen Stein im Brett.«
»Eigentlich schad’, dass ich gehen muss«, murmelte Martin. »Hier tät’s mir schon gefallen.« Plötzlich grinste er wieder. »Sag’ mir Bescheid, wenn du vorzeitig in den Ruhestand gehen solltest. Dann bewerb’ ich mich nach St. Johann.«
»Derweil bist du alt und grau«, versetzte Max lächelnd. »Da müsst’ ich schon mit dem Kopf unterm Arm daherkommen.«
»Dann geh’ ich jetzt. Mach’s gut, Max.«
»Mach’s besser«, rief Max.
Martin verließ schweren Herzens die Polizeistation.
Max ging zum Fenster und beobachtete, wie er in sein Auto einstieg und wegfuhr. Gedankenvoll kehrte Max zu seinem Schreibtisch zurück und setzte sich. Minutenlang saß er fast völlig regungslos da. Es war, als genieße er es, wieder die Luft an seinem Arbeitsplatz zu atmen. Er war ausgeruht und strotzte geradezu vor Energie. Die sechs Wochen Pause hatten ihm physisch gut getan, psychisch hatte er allerdings ein wenig gelitten. Aber das war jetzt vorbei und vergessen.
Er schüttelte seine Trägheit ab und erhob sich mit einem Ruck. Sein Arbeitsplatz war nicht nur hier innerhalb dieser vier Wände, er umfasste ganz St. Johann mit all seinen ausgelagerten Höfen und verstreut liegenden Anwesen.
Er ging nach draußen, setzte sich in den Dienstwagen und fuhr los. Die wenigen Menschen, die sich auf den Gehsteigen bewegten, winkten ihm freundlich zu, und er winkte zurück. Es war, als hätte es nie eine Unterbrechung gegeben.
Im Winter sagten sich in den Gemeinden des Wachnertals Fuchs und Hase gute Nacht. Viele Lokale und Imbisse hatten geschlossen. Wo im Sommer Stühle und Tische im Freien standen, erhoben sich jetzt wachsende Schneehaufen.
Max rollte mit seinem Dienstfahrzeug am Kirchplatz vorbei. Mitten auf dem Platz mit den alten Kastanien hatte Alois Kammeier, der Mesner von St. Johann, einen hohen Christbaum aufgestellt und mit einer elektrischen Beleuchtung versehen.
Max genoss es, seine Route zu fahren. Nichts erregte seine Aufmerksamkeit, St. Johann war ein Hort der Ruhe, des Friedens und der Beschaulichkeit.
Er rollte am verwahrlosten Grundstück des Brandhuber-Loisl vorüber und hielt Ausschau nach dem alten Sonderling. Als er sah, dass aus dem verrosteten Ofenrohr, das aus dem Dach der windschiefen Hütte ragte, schwarzer Rauch quoll, kehrte Max um, fuhr bis zum halb zerfallenen Gartentor, stieg aus und ging auf das Grundstück. Der Schnee war nicht hoch genug, um das Unkraut, das in dem Garten hüfthoch wuchs, zu bedecken.
Schnee knirschte unter den Sohlen des Polizisten. Er erreichte die Hütte und klopfte.
Sogleich wurde die Tür geöffnet und das bärtige Gesicht Loisls zeigte sich. Der alte Sonderling fixierte den Besucher mit wässrigen, blassblauen Augen. »Der Trenker-Max«, brummte er dann. »Sind S’ wieder im Amt? Sie sind ja ziemlich lang’ ausgefallen. Weshalb kommen S’ denn zu mir? Hab’ ich was angestellt, von dem ich selber nix weiß?«
Max musste grinsen. Immer, wenn er dem Loisl begegnete, konnte er sich des Eindrucks nicht erwehren, dass vor ihm das personifizierte schlechte Gewissen stand. »Ich wollt’ nur mal schauen, wie’s dir geht, Loisl«, antwortete er. »Was kommt denn da für ein seltsamer Geruch aus deiner Hütte? Braust du wieder irgendwelche Tinkturen zusammen?«
»Natürlich. Das ist meine Berufung. Meine Medizin heilt die Leut’ wenigstens. Was man ihnen in der Klinik auf der Nonnenhöhe verabreicht, macht sie höchstens noch kränker. Als ich gehört hab’, dass Sie sich den Knöchel gebrochen haben, war ich drauf und dran, zu Ihnen zu gehen und Ihnen einen Tee anzubieten, der sie mindestens zwei Wochen früher einsatzfähig gemacht hätt’, denn er hätt’ das Zusammenwachsen Ihres Knöchels deutlich beschleunigt.« Loisl zuckte mit den hageren Schultern und endete: »Ich hab’s unterlassen, weil ich mir gesagt hab’, dass Sie mir ja doch net glauben. Dafür hat schon der Wiesinger-Toni, dieser neunmal kluge Schulmediziner, gesorgt.«
»Na, na«, mahnte Max. »Lass das den Toni bloß net hören.«
»Aber es stimmt. Er macht mein Handwerk schlecht. Dabei kenn’ ich die Geheimnisse der Naturmedizin wie kein zweiter. Außer mir besitzt halt auch keiner das ›Sechste und siebte Buch Mose‹. Aus diesem Werk beziehe ich mein geheimes Wissen. Daher weiß ich, wovon ich red’. Die Schulmediziner tun nur so, als wüssten sie’s.«
»Heut’ gehst aber wieder hart mit den studierten Doktoren ins Gericht«, bemerkte Max nachsichtig lächelnd.
»Sie versuchen, mich zu ruinieren, indem s’ meine Reputation angreifen. Das ist Rufmord, und dafür wären eigentlich Sie zuständig.«
»Wo kein Kläger, da kein Richter, Loisl.«
Der alte Kauz winkte ab. »Egal. Haben Sie’s schon gehört vom Bundscherer-Xaver?« Blinzelnd musterte Loisl den Polisten.
»Was soll ich denn gehört haben? Was ist mit dem?«
Jetzt wurde der Blick des alten Sonderlings listig. »Ich darf’s Ihnen net sagen, Herr Trenker, weil ich dem Xaver versprochen hab’ den Mund zu halten.«
»Ich verrat’s net weiter, Loisl.«
Der Alte wiegte wichtigtuerisch den Kopf, tat, als würde er überlegen, dann stieß er hervor: »Tut mir leid, aber ich hab’ dem alten Bundscherer mein Wort gegeben. Darum werd’ ich schweigen wie ein Grab.«
»Ich kauf’ dir eine Flasche von deiner Mixtur ab, die die Knochen schnell zusammenwachsen lässt, wenn du’s mir verrätst.«
In den wässrigen Augen des Alten blitzte es auf. »Es ist ein Tee«, berichtigte er Max, »und die Zutaten waren ganz besonders schwer zu beschaffen«, klagte er. »Zum Teil hab’ ich unter Einsatz meines Lebens die Felsen hinauf gemusst und …«
»Schon gut, Loisl, du brauchst mir net zu erklären, weshalb der Tee ein bissel teuerer ist. Was kostet der Tee, ich kauf’ ihn dir ab, und du verrätst mir, was mit dem Bundscherer-Xaver los ist.«
»Zwanzig Euro, Herr Trenker. Das ist auf keinen Fall zu viel. Wie gesagt, ich hab’ die Kräuter unter Einsatz meines Lebens vom Berg geholt. Alles im Dienst der Naturheilkunde. Zeigen S’ mir mal einen Schulmediziner, der auf halsbrecherische Felsen klettert, um für seine Patienten wirksame Medizin zu beschaffen.«
»Dafür gibt’s die Apotheke, Loisl. Pass auf, ich geb’ dir zehn Euro für deinen Tee, und du spuckst aus, was du weißt. Okay?«
»Fünfzehn.«
Max atmete durch. Ihm war klar, dass er irgendwelche getrockneten Kräuter kaufte, die medizinisch so wertlos waren wie eine Handvoll Heu. Aber der Alte hatte seine Neugier geweckt, und er wollte wissen, was sich in St. Johann tat. »In Ordnung, fünfzehn. Hol’ das Zeug. Ich such’ das Geld raus.« Loisl beeilte sich.
Max hörte drinnen den alten Gauner hantieren. Zuletzt war lautes Rascheln zu vernehmen, dann erschien der Loisl.
Max hielt ihm die beiden Scheine hin und der Alte riss sie ihm regelrecht aus der Hand. »Da haben S’ Ihren Tee«, krächzte Loisl und hielt Max das Päckchen hin. Der nahm es und der Loisl sagte mit verschwörerischem Gesichtsausdruck: »Der Xaver und seine Frau haben doch keine Kinder. Jetzt sind s’ alt und krank und der Xaver will den Hof verkaufen. Mit dem Geld möcht’ er sich und die Maria in eine Seniorenwohnanlage einkaufen. Er hat mir erzählt, dass es schon einen Interessenten gäb’, einen Unternehmer, mit dem er sich allerdings wegen des Preises noch net einig ist.«
»Ist das alles?«, fragte Max.
»Das ist doch eine ganze Menge«, erwiderte der Loisl. »Ich sollt’ Ihnen sagen, was ich weiß, und das hab’ ich. Ich denk’, die fünfzehn Euro ist es wert.«
»Du bist ein Gauner, Loisl. Heut’ hast du sogar die Polizei über den Löffel balbiert. Alle Achtung.« Grinsend wandte sich Max ab. »Servus, Loisl, und frohe Weihnachten. Übertreib’s bloß net mit deinen Wunderheilmitteln. Net dass du mal jemand vergiftest. Dann hättest du ein Problem am Hals und dir würd’ selbst deine Schlitzohrigkeit nimmer helfen können.«
Wütend warf der alte Kauz hinter ihm die Tür zu.
*
Um zwölf Uhr läutete Max an der Tür des Pfarrhauses.
Mit lachendem Gesicht öffnete ihm gleich darauf Sophie. »Na, da ist’s aber Zeit geworden, Max«, freute sich die Haushälterin. »Grüaß Ihnen. Gut erholt sehen S’ aus. Ich hoff’, es geht Ihnen genauso gut, wie S’ ausschauen.«
»Liebe Frau Tappert!« Max nahm Sophie einfach in die Arme und deutete auf ihrer linken Wange einen Kuss an, dann auf ihrer rechten. »Alles ist gut«, sagte er dann, nachdem er sie wieder losgelassen hatte. »Der Knöchel ist wieder zusammengewachsen, ich hab’ kein Problem damit, und endlich, endlich darf ich wieder Ihr Essen genießen.«
»Ich denk’, die Marion hat Sie auch sehr gut bekocht«, wandte Sophie ein und vollführte eine einladende Handbewegung, worauf Max seine Mütze abnahm und an ihr vorbei ins Pfarrhaus ging.
»Natürlich, sie kocht vorzüglich und hat mich betreut wie eine Mutter. Aber es war eben net Ihre Küche, Frau Tappert. Ich denk’, Sie wissen, was ich mein’.«
»Ja, ja, jeder Koch hat seine eigenen Rezepte und – Geheimnisse.« Sophie lachte. »Ich hoff’, Sie mögen, was ich Ihnen heut’ servier’. Es gibt Rumpsteak mit Kräuterbutter, dazu grüne Bohnen mit Speck und Zwiebelwürfeln und Folienkartoffeln.«
Max lächelte verklärt. »Das ist eine meiner Lieblingsspeisen. Ich bin begeistert.« Max hängte seine Dienstmütze an einen Haken an der Garderobe und öffnete die Tür zum Esszimmer.
Sebastian saß schon am gedeckten Tisch und grinste. »Der Job hat dich wieder, Max, wie? Du siehst richtig glücklich aus.«
»Ich bin glücklich.«
Max setzte sich auf den Platz, den er schon einnahm, seit er während der Woche im Pfarrhaus zu Mittag aß. »Zu Haus’ wär’ ich langsam aber sicher verrückt geworden. Mir wird heut’ schon angst und bang, wenn ich an den Ruhestand denk’. Jetzt weiß ich, was die Leut’ meinen, wenn s’ berichten, dass sie in ein tiefes Loch gefallen sind. Aber Gott sei Dank ist’s da noch eine Weile hin.«
»Stimmt«, pflichtete Sebastian bei. »An den Ruhestand brauchst du wirklich noch net denken.«
Sophie brachte das Essen. Das gebratene Fleisch verströmte einen Geruch, der sowohl Sebastian als auch Max das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Ohne lange zu fackeln machten sie sich darüber her.
»Wie war der Abschied von deinem Vertreter?«, erkundigte sich Sebastian dazwischen einmal.
»Eigentlich kurz und schmerzlos. Der Bursch’ ist in Ordnung. Ich hab’ ihm eine steile Karriere vorausgesagt.«
»Ich hab’ mit dem Baumann-Lukas in München Verbindung aufgenommen«, erzählte Sebastian. »Er kommt am Siebenundzwanzigsten und schaut sich an, was in der Kirche restauriert werden muss.«
»Der Gregg Powell ist schon ein feiner Mensch«, murmelte Max kauend. »Und verdammt großzügig ist er auch. Bis die Diözese die Kosten für die Restaurierung übernommen hätt’, wärst du wahrscheinlich alt und grau geworden. Hast du eigentlich schon was davon gehört, dass der alte Bundscherer seinen Hof aufgeben möcht’?«
Überrascht schaute Sebastian seinen Bruder an. »Sag bloß«, entfuhr es ihm dann.
»Ja, er und seine Frau können den Hof nimmer bewirtschaften. Nun wollen s’ sich in eine Seniorenwohnanlage einkaufen, um dort ihren Lebensabend zu verbringen. Es soll sogar schon einen Interessenten für den Hof geben.«
»Das ist mir neu«, murmelte Sebastian. »Wo hast du das gehört?«
»Der Brandhuber-Loisl hat’s mir erzählt. Damit er mit der Sprache rausrückt, hab’ ich dem alten Haderlumpen sogar einen Tee für fünfzehn Euro abgekauft.«
Sebastian staunte. »Du hast dich von ihm über den Tisch ziehen lassen?«
»Na ja«, murmelte Max ein wenig verlegen, »er hat ein Mordsgeheimnis draus gemacht und so meine Neugier geweckt. Es soll ein Unternehmer sein, mit dem sich der Xaver nur wegen des Preises noch net einig ist.«
»Kein Landwirt?«, stieß Sebastian etwas verdutzt hervor. »Zu dem Hof gehören doch mindestens fünfundzwanzig Hektar Grund. Dabei handelt’s sich um Wald und landwirtschaftliche Nutzfläche. Was will ein Unternehmer damit?«
»Das hat mir der Loisl auch net sagen können. Frag’ doch mal den Bruckner«, schlug Max vor. »Vielleicht weiß der mehr. Die Gemeinde erfährt es doch in der Regel zu allererst, wenn große Landflächen oder ein ganzer Hof zum Kauf angeboten werden, denn sie hat ja in jedem Fall das Vorkaufsrecht.«
»Ja, den frag’ ich«, erklärte Sebastian und schüttelte den Kopf. »Ich weiß jetzt auch, warum der Markus so überaus freundlich zum Gregg und zur Corinna war. Er meint, mir damit einen Gefallen erwiesen zu haben und erwartet nun, dass ich ihn als Gegenleistung von seiner Wettschuld befrei’.«
»Typisch unser Bürgermeister«, stellte Max fest. »Wirst du ihm den Marsch nach Altötting erlassen?«
Sebastian erzählte von seinem Vorschlag, den er dem Bürgermeister unterbreitet hatte.
»Ein Wettschuld-Erlass auf Bewährung«, lächelte Max, nachdem Sebastian geendet hatte. »Du sagst, er hat darauf recht verhalten reagiert. Und jetzt denkst du, dass er vielleicht wieder was im Schilde führt, das auf keinen Fall deine Zustimmung findet.«
»Es ist nur so ein Bauchgefühl. Ich kenn’ doch meine Pappenheimer. Und dem Markus kann ich’s von der Nasenspitze ablesen, wenn was im Busch ist.«
»Er ist aber auch ein schlechter Lügner«, sagte Max. »Aber wie ich dich kenn’ wirst du ihm schon die Würmer aus der Nase ziehen. Was sagst du zu dieser Mahlzeit? Ist das Fleisch net göttlich? Man müsst’ der Frau Tappert mindestens einen Stern für ihre Kochkünste verleihen.«
»Sag’ ihr das, sie wird’s freuen«, versetzte der Bergpfarrer. »Aber lass’ es die Marion net hören. Sie denkt am End’, dass du mit ihrem Essen net zufrieden warst.«
»Man kann Äpfel net mit Birnen vergleichen«, murmelte Max. »Die Marion kocht hervorragend, es ist aber eine andere Küche. Aber um so etwas beurteilen zu können, muss man ein Gourmet sein. Das heißt, man braucht einen verwöhnten Gaumen.«
»Den kannst du mir net absprechen, Max, ess’ ich doch seit Jahren fünfmal in der Woche dasselbe wie du, und auch ich hab’ drei Wochen lang das Vergnügen mit Marions Kochkunst gehabt.«
»Ich hab’ mit der Frau Tappert schon darüber gesprochen, und sie hat’s auf den richtigen Nenner gebracht: Sie meint, dass jeder Koch seine eigenen Rezepte und Geheimnisse hat.«
»Ein Glück für Marion, dass der Breitmoser-Matthias sie als Hauswirtschafterin beschäftigt«, sagte Sebastian. »Ich glaub’ er ist froh, dass er sie bekommen hat, und die Marion hat ihr Auskommen. Beim Jonas und der Anna herrscht eitel Sonnenschein. Sie haben endlich, wenn auch mit Hindernissen, zueinander gefunden.«
»Und die Regie wirst wieder einmal du geführt haben«, bemerkte Max kauend.
»Na ja, ein bissel hab’ ich wieder nachhelfen müssen«, gab Sebastian zu und ein versonnenes Lächeln umspielte seinen Mund. »Manchmal muss man der Liebe eben auf die Sprüng’ helfen.«
»Darin bist du ja Meister«, grinste Max.
Nachdem sie gegessen hatten, verabschiedete sich Max.
Sophie begleitete ihn zur Haustür.
»Ihr Essen war wieder einmal einsame Spitze, Frau Tappert«, lobte er. »Egal, was sie servieren – es schmeckt fantastisch.«
»Am Donnerstag, nach den Weihnachtsfeiertagen, gibt’s wieder Hausmannskost«, erwiderte Sophie und fügte lachend hinzu: »Sind S’ dann auch so voll des Lobes?«
»Ganz gewiss. Hab’ ich’s net deutlich gesagt: Alles – ich betone, alles was Sie auf den Tisch bringen, schmeckt mir.«
»Dann freuen S’ sich auch auf eine Kartoffelsuppe?«
»Hervorragend.« Max stülpte sich die Dienstmütze auf den Kopf. »Bis zum Donnerstag also, planen S' für mich eine doppelte Portion ein!«
»Mach’ ich«, schmunzelte Sophie.
*
Weihnachten ging vorüber, und am ersten Werktag nach den Feiertagen kam Lukas Baumann nach St. Johann.
Lukas war ein siebenundzwanzigjähriger, dunkelhaariger Mann, etwa eins achtzig groß und schlank. Er wurde von Nathalie Greiner begleitet, einer hübschen, blonden Frau von fünfundzwanzig Jahren, die in seiner Firma als Kirchenmalerin angestellt war.
Er fuhr bis zum Kirchplatz und stellte das Auto am Straßenrand ab. Nachdem er und Nathalie ausgestiegen waren, schauten sie sich um. Es war ein sonniger Wintertag, der Himmel über dem Wachnertal war blau, auf den Bergen ringsum glitzerte der Schnee. Alles wirkte friedlich, einladend und freundlich.
»Es ist eine Ewigkeit her, seit ich das letzte Mal hier war«, sagte Lukas. »Aber St. Johann hat sich kein bissel verändert. Und die Menschen sind sicherlich auch die gleichen geblieben. Du musst wissen, Nathalie, hier ist die Welt noch in Ordnung. Dagegen ist München eine hektische und unpersönliche Tretmühle.«
»Wirklich ein schöner Ort«, erklärte Nathalie und ließ den Blick erneut in die Runde schweifen. Sie war mittelgroß und schlank, was die enge Jeans, die sie trug, betonte. Dazu war sie mit einem gefütterten, weißen Anorak bekleidet. »Hier könnt’ man es aushalten.«
Lukas deutete auf die Kirche. »Die Pfarrkirche St. Johann. Spätbarock, das Schmuckstück des ganzen Wachnertals. Die Fresken im Innern sind von einmaliger Schönheit.«
»Sie werden noch schöner sein«, lachte Nathalie unbekümmert, »wenn wir sie bearbeitet haben.«
Lukas grinste. »Komm, gehen wir zum Pfarrhaus. Er wartet sicherlich schon.«
Tatsächlich hatte der Pfarrer schon auf die Ankunft des Kirchenmalers gewartet. Sophie ließ den Besuch ins Haus, und gleich darauf hatten es sich Sebastian, Lukas und Nathalie im Wohnzimmer bequem gemacht.
»Sind S’ doch bitte so nett, Frau Tappert, und rufen S’ den Gregg Powell an. Sagen S’ ihm, dass der Lukas und die Frau Greiner eingetroffen sind.«
»Mach’ ich«, erwiderte Sophie und verließ das Wohnzimmer.
»Ich hoff’«, sagte der Pfarrer, »ihr seid gut durchgekommen auf der Autobahn. Viele, die zu Weihnachten Verwandte oder Bekannte besucht haben, fahren heut’ nach Hause zurück und die Autobahnen dürften ziemlich voll sein.«
»Es ist gegangen«, antwortete Lukas. »Stau’s hat’s zumindest net gegeben.« Er atmete durch. »Es ist schön, wieder einmal daheim zu sein, Herr Pfarrer. Ich soll Ihnen schöne Grüße von meinen Eltern ausrichten.«
»Haben s’ sich gut eingelebt in München?«, fragte Sebastian. »Es sind doch auch schon mehr als fünf Jahr’, dass sie aus St. Johann weggezogen sind.«
»Ja, sie wohnen in Gräfelfing. Der Papa arbeitet in meinem Betrieb als Maler. Die Mama erledigt die Buchhaltung.«
Sophie schaute zur Tür herein. »Der Herr Powell und seine Gattin werden gleich hier sein, Hochwürden.«
»Danke, Frau Tappert. – Ich hab’ völlig vergessen, zu fragen, ob ihr was trinken wollt’«, sagte Sebastian an seine Gäste gewandt. »Kaffee oder Tee vielleicht.«
»Machen S’ sich keine Mühe«, antwortete Lukas. »Zu einem Schluck Wasser würd’ ich allerdings net nein sagen.«
»Sie auch?«, fragte Sophie und schaute dabei Nathalie an.
»Ja, ein Glas Wasser wär’ net schlecht«, sagte die junge Kirchenmalerin lächelnd.
Sophie eilte in die Küche.
»Du hast mir erzählt, dass dein Betrieb auch Malerarbeiten und Gebäudesanierungen durchführt. Von der Kirchenmalerei allein könntest du wohl net existieren, wie?«
»So ist es«, bestätigte Lukas. »Eigentlich ist es ein ganz normaler Malerbetrieb, den ich gegründet hab’. Wir sanieren häufig Altbauten. Hin und wieder krieg’ ich einen Auftrag für eine Lüftlmalerei. Was die Kirchenmalerei anbetrifft, greifen die Diözesen und Pfarreien lieber auf die alteingesessenen und bekannten Betriebe zurück. Darum bin ich Ihnen ausgesprochen dankbar, Herr Pfarrer, dass Sie an mich gedacht haben.«
»Das ist doch selbstverständlich. Aber eigentlich war’s gar net ich, der dich vorgeschlagen hat. Es war die Frau Tappert …«
In dem Moment betrat Sophie Tappert mit einer Flasche Mineralwasser und zwei Gläsern das Wohnzimmer.
»Dann hab’ ich es Ihnen zu verdanken, Frau Tappert«, rief Lukas, »dass ich heut’ da sitz’.«
Sophie stellte die Flasche und die Gläser auf den Tisch.
»Es war doch naheliegend«, lächelte sie, »als Hochwürden davon gesprochen hat, dass er einen Kirchenmaler sucht.«
Da klingelte es.
»Ich geh’ schon«, sagte Sophie, machte kehrt und verließ das Wohnzimmer wieder. Gleich darauf geleitete sie Gregg und Corinna Powell herein.
Sebastian begrüßte die beiden, dann stellte er ihnen Lukas und Nathalie vor, und schon wenig später verließen sie das Pfarrhaus, um die Fresken in der Kirche zu begutachten.
Dem Pfarrer waren die verliebten Blicke, die Lukas seiner Begleiterin immer wieder zugeworfen hatte, nicht verborgen geblieben. Vielleicht hatte er auch nur deswegen darauf geachtet, weil Lukas ihm bei ihrem ersten Telefongespräch schon gestanden hatte, dass ihn Nathalie nicht nur als ausgebildete Kirchenmalerin interessierte.
Aber auch Nathalie hatte dieses besondere Strahlen in den Augen, wenn sie Lukas anschaute. Sie sah in Lukas wohl auch mehr, als nur ihren Brötchengeber. Sebastian sagte sich, dass die beiden ein schönes Paar abgeben würden.
Sie betraten wenig später die Kirche und Nathalie stieß nach einem schnellen Blick in die Runde begeistert hervor: »Herrlich! Das ist der Wahnsinn! Diese gekonnte Lichtführung, eine Harmonie der Farbigkeit und der Formen … Das ist geradezu himmlisch.«
»Na, hab’ ich dir zu viel versprochen?«, fragte Lukas lächelnd. »Dieses Kircherl ist das Schmuckstück schlechthin im Wachnertal. St. Anna in Engelsbach ist auch sehr schön, doch an St. Johann reicht’s net heran.«
»Meine Frau und mich hat die Kirche ebenso begeistert wie Sie«, erklärte Gregg Powell, an Nathalie gewandt. »Sie war auch einer der Gründe, weshalb wir unbedingt in St. Johann getraut werden wollten. Wobei ich das alles hier mit den Augen des Laien sehe, Sie hingegen mit denen des Fachmannes.« Jetzt heftete er den Blick auf Lukas, der den Kopf in den Nacken gelegt hatte und mit kritischem Blick die Fresken an der gewölbten Decke musterte. »Was sagen Sie nach dem ersten Augenschein, Herr Baumann? Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass diese Malereien einer Auffrischung bedürfen.«
Gespannt musterte auch Sebastian den jungen Kirchenmaler.
Lukas nickte und antwortete: »Ja, einige Farben sind ziemlich verblasst, hier und dort blättert die Farbe auch ab. Es stört zwar den Gesamteindruck, den die Bilder dem Betrachter vermitteln, net, aber wenn man nix dagegen unternimmt, können die Schäden enorm werden.«
Lukas setzte sich in Bewegung und schritt langsam den Mittelgang entlang in Richtung des Altars. Er begutachtete nicht nur die Deckenfresken, sondern auch die an den Seitenwänden.
Auch Nathalie unterzog Decke und Wände einer eingehenden Prüfung. Irgendwann sagte sie: »Auch die Goldfassung am Stuck bedarf stellenweise der Restaurierung. An den Ornamenten selbst kann ich nix Schadhaftes erkennen, aber das sieht man wahrscheinlich erst aus der Nähe, wenn mal das Gerüst steht.«
»Ja«, murmelte Lukas, »da gibt’s einiges zu tun. Die Nathalie und ich werden jetzt erst mal im Hotel einchecken und heut’ Nachmittag und morgen die Malerei und den Stuck einer eingehenden Begutachtung unterziehen und Fotos machen. Wir werden uns dann an einen Tisch setzen müssen, Hochwürden, und alles besprechen. Sie, Herr Powell, werden als der großzügige Spender, der die Restaurierung finanziert, an dem Gespräch teilnehmen wollen, schätz’ ich.«
Gregg Powell nickte. »Ja, ich wäre sehr erfreut, wenn ich dazu eingeladen werden würde.«
»Das ist doch keine Frage«, sagte Sebastian lächelnd.
Da entrang sich Nathalie ein Laut der Verzückung. Sie hatte die Madonna entdeckt. »Wunderbar«, geriet sie ins Schwärmen. »Diese Figur ist nicht von dieser Welt …«
»Diese Statue ist der wertvollste Schatz unserer Kirche«, erklärte der Pfarrer. »Die Madonna hat schon unzählige Besucher begeistert. Es ist ihre Einfachheit, die besticht. Es gibt niemand, der sich der Faszination dieser Schnitzerei entziehen kann.«
Geradezu andächtig betrachtete Nathalie die Figur; das filigrane Gesicht verstrahlte etwas, das den Betrachter verzauberte. Der Faltenwurf des Kleides, das Kopftuch, der goldene Strahlenkranz … Die junge Kirchenmalerin stand völlig im Banne dieser meisterlich geschnitzten Heiligenfigur.
Für kurze Zeit herrschte Schweigen in der kleinen Gruppe. Auch die Augen der anderen waren auf die wunderbare Skulptur gerichtet. Nathalie konnte ihren Blick kaum von der Madonnenfigur lösen.
Fast widerwillig folgte sie den anderen, um die Kirche weiter zu erkunden …
*
Lukas hatte für sich und Nathalie jeweils ein Zimmer im Hotel ›Zum Löwen‹ reserviert. Sie bezogen ihre Zimmer, dann begaben sie sich nach unten ins Restaurant, um ein Mittagessen zu sich zu nehmen.
»Was meinst du?«, fragte Lukas seine schöne Gesellin. »Kriegen wir das hin?«
Sie lachte ihn an, ihre Zähne blitzten, ihre tiefblauen Augen strahlten. »Wenn net’, dann müssen wir unser Lehrgeld zurückzahlen. Hast du etwa Befürchtungen, dass wir die Erwartungen des Pfarrers und Herrn Powells net erfüllen?«
»Das net gerade, aber ein bissel Bammel hab’ ich schon. So einen großen Auftrag hab’ ich noch nie gehabt. Wenn wir da was vermurksen, kann ich meinen Laden zusperren.«
Gitti Reisinger kam zum Tisch, brachte die bestellten Getränke und fragte, ob sie schon wüssten, was sie essen wollten.
Den Winter über hatte Irma Reisinger ihre Speisekarte ziemlich abgespeckt und bot nur fünf verschiedene Speisen an. Sowohl Lukas als auch Nathalie entschieden sich für ein Schnitzel Wiener Art mit Pommes frites und gemischtem Salat.
»Wenn du es dir net zutraust, den Auftrag zu erfüllen, solltest du es dem Pfarrer gleich sagen«, gab Nathalie zu bedenken.
»Natürlich trau’ ich mir das zu«, versetzte Lukas. »Ich hab’ schließlich den Beruf von der Pieke auf gelernt, und du doch auch. Wir zwei werden das schon schaffen.«
Sie schauten sich in die Augen, und für kurze Zeit versanken ihre Blicke regelrecht ineinander. Doch dann senkte Nathalie den Blick und auch aus Lukas Augen wich der verträumte Ausdruck.
Er war nahe daran, Nathalie zu sagen, dass er sehr viel für sie empfand.
Doch er war sich nicht sicher, ob sie seine Gefühle erwiderte. Und er befürchtete, mit seinem Geständnis dem guten, freundschaftlichen Verhältnis, das zwischen ihnen bestand, zu schaden.
Er nahm sich vor, es ihr bei der nächsten passenden Gelegenheit zu sagen, ahnte aber, dass es ihm letztendlich auch wieder an der nötigen Courage mangeln würde. Es war wohl so, dass seine Miene Spiegelbild seiner bedrückten Stimmung war, denn Nathalie, die den Blick wieder gehoben hatte und kurze Zeit in seinem Gesicht geforscht hatte, fragte:
»Du schaust plötzlich drein, als kämst du mit irgendetwas net ins Reine. Trägst du irgendein Problem mit dir herum? Wenn ja, dann mach’ aus deinem Herzen keine Mördergrube und vertrau’ dich mir an. Wir sind doch Freunde, und geteiltes Leid ist halbes Leid.«
Wieder tauchte Lukas’ Blick in den Nathalies, er seufzte und sagte mit etwas schwankender Stimme: »Wenn du wüsstest, was mich beschäftigt, Nathalie …«
Sie griff über den Tisch und legte ihre Hand auf die seine. Dabei hielt sie seinem Blick stand, und er sah auf dem Grund ihrer Augen nichts als Wärme. Er war wie elektrisiert, sein Herz begann zu rasen und jagte das Blut regelrecht durch seine Adern. ›Himmel, es kann doch net so schwer sein!‹, schrie eine Stimme in ihm. ›Sag’ es! Sag’, dass du in sie verliebt bist!‹
»Red’ dir von der Seele, was dich bedrückt«, forderte ihn Nathalie auf, zu sprechen. »Du kannst offen reden.«
Er gab sich einen Ruck und stieß hervor: »Du bist es, Nathalie, um die mein ganzes Denken kreist. Vielleicht hast du’s längst bemerkt. Ich seh’ in dir mehr als nur eine Mitarbeiterin und eine gute Freundin. Ich – ich hab’ mich in dich verliebt.«
Jetzt war es draußen. Aber Lukas verspürte keine Befreiung; im Gegenteil, voll Anspannung erwartete er Nathalies Antwort. Die Zeit schien stillzustehen. Lukas starrte in Nathalies Gesicht und versuchte darin zu lesen. »Warum sagt du nix?«, fragte er.
»Ich bin überwältigt«, flüsterte sie. »Ich – ich hab’ nämlich nimmer dran geglaubt, dass es irgendwann über deine Lippen kommt. Ich war mir über deine Gefühle nie vollkommen im Klaren. Manchmal, wenn du mich so intensiv angeschaut hast, war ich mir sicher, dass du sehr viel für mich empfindest. Im nächsten Moment aber warst du wieder der Kollege und Freund – und natürlich der Chef.«
»Eigentlich wollt’ ich hören, dass du für mich ähnlich empfindest, wie ich für dich«, quälte es sich über seine Lippen.
Ihre Hand umklammert die seine. »Mit geht’s genauso wie dir, Lukas, kein bissel anders. Ich war vom ersten Tag an, an dem ich dich kennengelernt hab’, in dich verliebt. Ich hab’ nur net gewagt, es so offen zu zeigen, weil ich befürchtet hab’, du könntest einen falschen Eindruck von mir gewinnen. Bist du doch der Chef, und ich arbeite in deiner Firma. Auch hab’ ich das Gerede der Kollegen befürchtet …«
»Ich glaub’ das net«, entrang es sich Lukas. Er war vollkommen perplex. Er hatte sich auf das Schlechteste eingestellt, nämlich eine Abfuhr zu erhalten, und nun gestand ihm Nathalie ihre Liebe. »Wenn wir jetzt alleine wären, würd ich dich auf der Stelle küssen«, murmelte er, als er ihr Geständnis verarbeitet hatte und sich sicher war, nicht zu träumen.
»Machen wir einen Spaziergang«, schlug Nathalie vor, »ehe wir uns die Kirche genauer anschauen. Irgendwo da draußen zwischen den verschneiten Wiesen und Feldern sind wir sicher allein. Und dann nehm’ ich dich beim Wort.« Das stille Glück leuchtete aus ihren Augen.
Lukas hingegen hätte am liebsten gejauchzt und die ganze Welt am Überschwang seiner Gefühle teilhaben lassen.
Wenig später kam das Essen. Sie aßen schweigend, doch ihre Blicke trafen sich immer wieder und ein jeder konnte in den Augen des anderen die tiefen Gefühle erkennen, die sie nicht mehr unterdrücken mussten.
Nach dem Essen verließen sie das Hotel und gingen langsam nebeneinander her in Richtung Ortsende. Wie selbstverständlich ertastete Lukas’ Rechte die linke Hand Nathalies und ihre Finger verschlangen sich ineinander. Auch ohne Worte spürten sie dieses Band aus Zuneigung und Zärtlichkeit, das nur die Liebe zwischen zwei Menschen knüpfen konnte.
Plötzlich stockte Lukas im Schritt und starrte die junge Frau an, die ihnen auf dem Gehsteig entgegenkam.
Unter einer gestrickten Mütze quollen lange, blonde Haare hervor. Sie war mittelgroß, und trotz der dick gefütterten Jacke, die sie trug, war zu erkennen, dass sie schlank war. »Das darf doch net wahr sein«, brach es über Lukas’ Lippen. »Das ist die Annika.«
Nathalie hatte ebenfalls angehalten. Sie hörte den Namen zum ersten Mal, aber sie zog sofort den richtigen Schluss und fragte: »Du kennst sie von früher, wie?«
»Ja.«
Die junge Frau kam näher. Sie hatte den Blick zu Boden gerichtet und schien völlig in Gedanken versunken zu sein. Als sie nur noch fünf Schritte von Lukas und Nathalie entfernt war, bemerkte sie, dass ihr zwei Personen den Weg versperrten. Sie hob das Gesicht, ihre Augen weiteten sich und sie hielt an, als wäre sie gegen eine unsichtbare Wand gelaufen. Ihr ungläubiger Blick hatte sich an Lukas’ Gesicht regelrecht verkrallt. »Lukas!« Wie ein Windhauch kam der Name über ihre bebenden Lippen.
Sie hatte ihn sofort wiedererkannt. Eine Reihe von Bildern stieg in ihrem Kopf in rasender Folge aus den Nebeln der Vergangenheit, ein Film aus verworrenen Szenen. Annika presste die linke Hand gegen ihren Halsansatz und war zu keiner Reaktion fähig.
»Was für ein Zufall!«, rief Lukas. »Ich glaub’s ja net! Neulich hab’ ich erst mit dem Pfarrer über dich gesprochen, Annika.« Er löste seine Hand aus der Nathalies, machte zwei lange Schritte und stand vor seiner Jugendliebe. »Servus, Annika«, grüßte er und reichte ihr die Hand.
Annika ergriff sie wie im Trance.
»Acht Jahre ist’s her, dass wir uns nimmer gesehen haben. Damals warst du ein junges Madel, jetzt bist du eine erwachsene Frau. Gut schaust du aus.«
Nun fiel von Annika der Bann ab, sie straffte die Schultern und sagte: »Richtig, acht Jahre. Wie die Zeit vergeht. Dass du wieder mal den Weg nach St. Johann gefunden hast? Hast du Sehnsucht nach der Heimat gehabt?«
Sie entzog ihm ihre Hand. Ihr Blick suchte Nathalie. »Ist das deine Frau?«
Jetzt wurde Lukas verlegen. »Nein. Nathalie arbeitet bei mir. Sie ist Kirchenmalerin. Wir sind hier, weil wir die Fresken und den Stuck in der Kirche restaurieren sollen. Pfarrer Trenker hat uns hergeholt. Nathalie und ich sind heut’ Vormittag erst angekommen. Jetzt machen wir einen kleinen Verdauungsspaziergang, dann sehen wir uns die Schäden in eurem Kircherl näher an, damit ich dem Pfarrer ein Angebot unterbreiten kann.«
»Dann sieht man sich vielleicht hin und wieder, wenn du längere Zeit hier bist«, sagte Annika. »Entschuldige mich jetzt, ich hab’ einen Termin beim Frisör, und bin eh schon spät dran.«
»Dann will ich dich net länger aufhalten, Annika. Denkst du eigentlich manchmal noch an die Zeit von damals?«
»Nein«, stieß Annika kurz angebunden hervor und ging weiter. Sie drehte sich nicht um.
*
Lukas schaute ihr nach und schien völlig vergessen zu haben, dass er nicht alleine war.
»Komm’ wieder zu dir!«, stieß Nathalie hervor und Lukas zuckte zusammen. »Diese Annika war ja recht komisch«, hörte er Nathalie sagen. »Und du stehst da wie vom Donner gerührt. War mal was zwischen ihr und dir?«