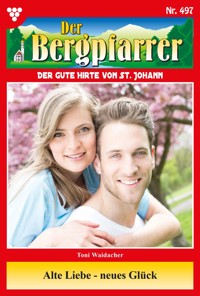14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Bergpfarrer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mit dem Bergpfarrer hat der bekannte Heimatromanautor Toni Waidacher einen wahrhaft unverwechselbaren Charakter geschaffen. Die Romanserie läuft seit über 13 Jahren, hat sich in ihren Themen stets weiterentwickelt und ist interessant für Jung und Alt! Toni Waidacher versteht es meisterhaft, die Welt um seinen Bergpfarrer herum lebendig, eben lebenswirklich zu gestalten. Er vermittelt heimatliche Gefühle, Sinn, Orientierung, Bodenständigkeit. Zugleich ist er ein Genie der Vielseitigkeit, wovon seine bereits weit über 400 Romane zeugen. Diese Serie enthält alles, was die Leserinnen und Leser von Heimatromanen interessiert. Keine Leseprobe vorhanden. E-Book 1: Liebesglück und Liebesleid E-Book 2: Eine Erbschaft für Sebastian E-Book 3: Auf der Suche nach dem Bergpfarrer E-Book 4: Die verheimlichte Entführung E-Book 5: Anna sucht nach ihren Wurzeln E-Book 6: Ein unglaublicher Verdacht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 717
Ähnliche
Inhalt
Liebesglück und Liebesleid
Eine Erbschaft für Sebastian
Auf der Suche nach dem Bergpfarrer
Die verheimlichte Entführung
Anna sucht nach ihren Wurzeln
Ein unglaublicher Verdacht
Der Bergpfarrer – Jubiläumsbox 2 –
E-Book 381-386
Toni Waidacher
Liebesglück und Liebesleid
Wessen Träume werden wahr?
Roman von Toni Waidacher
Toni Wiesinger drückte Claudia an sich und gab ihr einen freundschaftlichen Kuss auf die Wange.
»Gratuliere«, sagte der Arzt lächelnd, »du bist schwanger.«
»Nein!«
»Doch!«
Mit einem Jubelschrei hing die Schwägerin des Bergpfarrers an Tonis Hals.
»Na, bloß gut, dass unsre bessren Ehehälften uns net so seh’n …«, schmunzelte er.
Indes gab es keinen Grund zu Eifersüchteleien zwischen den beiden Paaren. Max Trenker, Claudias Mann, war mit dem Arzt befreundet, seit Toni sich in St. Johann niedergelassen hatte, und ebenso fest war die Freundschaft zwischen der Journalistin und Elena Wiesinger, die, zusammen mit einer anderen Freundin, die Tierarztpraxis im Dorf betrieb.
»Setz’ dich noch mal«, deutete Dr. Toni Wiesinger auf den Stuhl vor seinem Tisch und nahm selbst Platz, »ich stell’ dir eben noch den Mutterpass aus, und dann kannst’ Max von der Neuigkeit erzählen.«
Claudia nickte und wischte ein paar Freudentränen ab.
»Wie weit bin ich denn?«
»Noch ganz am Anfang, achte Woche.«
Also doch! Die Anzeichen waren dagewesen, aber Claudia hatte es nicht glauben wollen. Zu oft hatten sie und Max sich in den vergangenen Monaten auf ein weiteres Kind gefreut – und waren dann doch enttäuscht worden. Den Termin heute hatte sie gemacht, weil die morgendliche Übelkeit durchaus auch andere Ursachen haben konnte, als eine Schwangerschaft.
Claudia freute sich schon auf das Gesicht ihres Mannes, wenn sie ihm die freudige Nachricht überbrachte. Aber ganz gewiss würde sie es ihm nicht zwischen Tür und Angel sagen, sondern einen romantischen Zeitpunkt auswählen. Sie stellte sich eine Abendstunde vor, im Garten hinter dem Haus, wo sie Max ein Bier kredenzte und sie selbst würde, anstelle eines Glases Wein, einen Saft trinken …
Ob er wohl stutzig würde?
Und Sebastian erst! Der kleine Sebastian, wohlgemerkt, der nach seinem Onkel benannt worden war, was würde er wohl sagen, wenn er erfuhr, dass er ein Brüderchen oder Schwesterchen bekam?
Claudia wischte sich wieder über das Gesicht. Überhaupt, was würde es wohl sein?
Max und sie wünschten sich schon lange ein Madel, aber freilich wäre es auch kein Beinbruch, wenn noch ein Bub dazukäme.
»Alles in Ordnung?« Dr. Wiesinger schaute seine Patientin fragend an.
Sie nickte. »Ist bloß die Freude.«
Der Arzt lächelte. »Das kann ich versteh’n, Elena, und mir ging es net anders, als unsre Toni unterwegs war.«
Antonia Wiesinger war auf den Namen ihres Papas getauft worden und wurde genau wie er, nur Toni gerufen.
»So, da ist noch ein Rezept dabei. Folsäure solltest’ nehmen, zumindest in den ersten Monaten der Schwangerschaft.«
Der Arzt reichte Claudia ihren Mutterpass und das Rezept, dann brachte er sie zur Tür.
»In vier Wochen seh’n wir uns wieder, hier in der Praxis, mein’ ich, zum Kochen oder auf dem Tanzabend freilich schon eher.«
Ein kleiner Kreis hatte sich zusammengefunden, zu denen, neben den Wiesingers und Trenkers, inzwischen auch Laura Carpenter, wie sie seit ihrer Hochzeit hieß, und ihr Mann James, genannt Jimmy, gehörten. Und es kamen, – je nach Zeit, Lust und Laune, – die einen oder anderen Freunde und Bekannten dazu, und reihum wurde bei einer der Familien gemeinsam gekocht und gegessen. Dankbar nahmen die Hobbyköche dabei die Tipps und Ratschläge Sophie Tapperts entgegen, der Haushälterin des Bergpfarrers.
Gegenüber dem Sprechzimmer, in dem der Arzt seine Patienten empfing, lag das Wartezimmer, dessen Tür geöffnet war. Aus dem Augenwinkel heraus nahm Claudia Maria Erbling wahr, die neugierig den Hals reckte und förmlich die Ohren spitzte.
Maria war die Witwe des letzten Poststellenleiters in St. Johann und im Dorf als ärgste Klatschtante gefürchtet …
Die Schwägerin des Bergpfarrers atmete innerlich auf, zum Glück hatte sie den Mutterpass in ihre Handtasche gesteckt, ehe sie das Sprechzimmer verließ. Nicht auszudenken, wenn Maria Erbling das hellblaue Dokument in Claudias Hand gesehen hätte – ganz St. Johann hätte eher von ihrer Schwangerschaft gewusst, als sie es Max hätte sagen können!
Die Journalistin nickte der Witwe zu.
»Grüß dich, Maria.«
»Grüß dich, Claudia. Bist’ doch wohl net etwa krank?«, kam es zurück.
Claudia schüttelte den Kopf.
»Nein, nein, alles in Ordnung, reine Routine«, antwortete sie und machte, dass sie hinauskam.
Puh, gerade noch mal gut gegangen!
Die Journalistin eilte zum Polizeirevier, über dem sie wohnten, und holte ihren Wagen aus der Garage. Ein Segen, dass sie den frühen Arzttermin genommen hatte, so kam sie nicht ganz so spät in die Redaktion, aber bis nach Garmisch-Partenkirchen, wo der ›Kurier‹ entstand, war es doch noch ein gutes Stück zu fahren.
Max trat vor die Tür, als sie das Garagentor gerade geschlossen hatte und wieder eingestiegen war. Er eilte zu ihr. »Was sagt Toni?«
Claudia hatte die Seitenscheibe heruntergelassen und steckte den Kopf durch das Fenster.
»Alles in Ordnung«, antwortete sie lächelnd. »Ich erzähl’s dir heut’ Abend, jetzt muss ich los.«
Der Bruder des Bergpfarrers beugte sich zu ihr herunter und gab seiner Frau einen Kuss.
»Fahr’ vorsichtig, Spatzl!«
»Na klar«, antwortete sie und fuhr an.
›Ich fahr’ doch immer vorsichtig‹, dachte Claudia, als sie das Ortsschild passierte. ›Und – ab heute – noch viel vorsichtiger!‹
Gut gelaunt fuhr sie ins Büro und setzte sich an ihren Schreibtisch. Laufend kamen Meldungen von Nachrichtenagenturen, aus aller Welt, herein. Heinz, ein Kollege, hatte die ersten Agenturmeldungen bereits auf Claudias Schreibtisch gelegt. Sie hatte sich einen Tee aufgebrüht und schaute die Papiere durch. Beim letzten Blatt stutzte sie, las den Text noch einmal und griff zum Telefon.
»Max, du glaubst net, was gescheh’n ist«, sagte die Journalistin, als ihr Mann am anderen Ende abgenommen hatte.
»Was denn? Mach’s net so spannend.«
»Stell’ dir vor, Nathalie Baumann ist in England festgenommen worden!«, rief Claudia atemlos. »Sie sitzt in London in Untersuchungshaft, die Meldung kam über Reuters.«
»Was? Das gibt’s doch gar net!« Max war völlig aus dem Häuschen. »Hat das Theater mit dieser Frau endlich ein Ende? Das muss ich sofort Sebastian erzählen! Dank’ dir, Spatzl, für den Anruf.«
*
Für Nathalie Baumann war es ein wahr gewordener Alptraum. Die Französin saß in ihrer Zelle und starrte auf das vergitterte Fenster, ohne einen klaren Gedanken fassen zu können.
Jahrelang hatte sie, unter dem Namen Clarissa Belfort, in Freiheit gelebt und mehr oder minder schmutzige Geschäfte im Auftrag des steinreichen Amerikaners, George Whitaker, getätigt. Niemand hatte sie in dieser Zeit erkannt, und sie war von den Behörden unbehelligt geblieben.
Angefangen hatte ihr Pech erst, als Yvonne Metzler in St. Johann auftauchte, wo Nathalie unter ihrem falschen Namen angeblich eine Unternehmensberatungsfirma betrieb. Freilich war das nur eine Tarnung, unter der sie für den Boss, der zuweilen auch ins Wachnertal kam, daran arbeitete, den Diebstahl der Madonnenfigur aus der Kirche zu organisieren und dem Bergpfarrer dessen Jagdschloss abzujagen, das zu einer internationalen Begegnungsstätte für Jugendliche geworden war. Beides war ihr bisher nicht gelungen.
Die Madonna war wieder in den Schoß der Kirche zurückgekehrt, und das Schloss ›Hubertusbrunn‹ gehörte dem guten Hirten von St. Johann immer noch, trotz aller angezettelten Intrigen und Skandale.
Nathalie war indessen der Boden in St. Johann zu heiß geworden und sie hatte sich nach Salzburg abgesetzt, wo sich ein reicher Engländer, Sir Anthony Clifford, in sie verliebte – und sie sich in ihn!
Tony entstammte einer alten Adelsfamilie, deren ganzer Stolz der Besitz eines Zepters war, Heinrich der Achte hatte einst dem Urahn verliehen, als dieser in den Adelsstand erhoben wurde. Über die ›Verdienste‹ dieses Ahnen wurde indes heute eher diskret geschwiegen, der treue Vasall des Königs hatte einen Meineid geschworen, damit Heinrich sich scheiden lassen konnte …
Aber der eigentliche Grund für Nathalies Flucht aus St. Johann war die Schwester ihres ehemaligen Verlobten, Pascal Metzler. Pascal und sie hatten in derselben Bank gearbeitet, von dem Millionenbetrug, durch die Frau, die die Liebe seines Lebens war, erfuhr der Franzose erst, als er selber ins Visier der Ermittler geriet, die ihn verdächtigten, mit Nathalie gemeinsame Sache gemacht zu haben. Yvonne Metzler hatte die international gesuchte Betrügerin, trotz der Gesichtsoperation, die Nathalies Aussehen total verändert hatte, an deren Haltung und ihren Bewegungen wiedererkannt. Die Drohung, die Polizei einzuschalten, veranlasste die Französin schließlich zur Flucht nach Salzburg.
In Anthony Clifford glaubte sie den Mann fürs Leben gefunden zu haben, ein Leben, das mit dem, das sie jetzt führte, absolut nichts zu tun haben sollte. Zu gerne reiste sie mit ihm in sein Stammschloss, das Clifford-House. Dort sollte ihr neues Leben beginnen! Doch es kam alles ganz anders.
George Whitaker war nicht bereit, auf Nathalies Mitarbeit zu verzichten. Er war der einzige Mensch, der von ihrer wahren Identität wusste und drohte damit, Nathalie den Behörden auszuliefern, wenn sie sich weigerte, weiterhin für ihn zu arbeiten. Außerdem verlangte er von ihr, dass sie das Familienzepter der Cliffords für ihn stehlen solle!
Hin- und hergerissen, zwischen ihrer Liebe zu Tony und der Angst, Whitaker würde seine Drohung wahrmachen, hatte Nathalie das Zepter gestohlen und es, eines nachts, einem Unbekannten im Park von Clifford-House übergeben.
Wie im Fieber war sie in das Zimmer, das sie bewohnte, zurückgeschlichen und hatte bis zum Morgen wach gelegen. An Schlaf war überhaupt nicht zu denken gewesen. Schon gegen sieben Uhr klopfte es an der Tür, und Tony stürmte herein.
»Sorry, Darling«, sagte der Earl, der durch Erbfolge auch einen Sitz im englischen Oberhaus innehatte, und setzte sich auf ihr Bett, »sorry, dass ich dich so früh aufwecke. Aber es ist etwas ganz Furchtbares geschehen!«
Er nahm ihre Hände. Schon als sie seinen traurigen Gesichtsausdruck sah, bereute Nathalie ihre Tat.
Sie richtete sich auf und tat, als sei sie gerade erst erwacht. »Was ist denn los, Liebster?«
Tony sah ihr in die Augen. »Stell’ dir vor, das Zepter ist verschwunden! Jemand hat es in der Nacht gestohlen!«
»Was?« Sie spielte die Überraschte. »Wer macht denn so was?«
Der Engländer zuckte die Schultern. »Ich habe keine Ahnung, wir stehen alle vor einem Rätsel. Higgins hat den Diebstahl entdeckt.«
Er stand auf und wandte sich zur Tür.
»Darling«, sagte Tony, die Klinke schon in der Hand, »du solltest aufstehen, die Polizei wird gleich eintreffen und den Fall untersuchen.«
Es gelang ihr, ihren Schrecken zu verbergen. Sie war wieder ganz Clarissa Belfort, die gerissene Betrügerin und perfekte Schauspielerin. Den falschen Namen gab sie auch routiniert an, als der Polizist sie verhörte.
Inspektor Blade trug einen dunklen Anzug, die zwei Beamten, die ihn begleiteten, hatten Uniformen an. Kurz nach ihnen trafen die Experten der Spurensicherung ein und nahmen die Glasvitrine, in der sich das Zepter befunden hatte, in Augenschein.
Die Hausangestellten wurden derweil von den Polizisten vernommen, die Befragung des Earls und der Französin, die sich freilich als Belgierin ausgab, übernahm Blade persönlich.
»Sie wollten also ursprünglich zum Essen ins Dorf fahren«, fasste der Inspektor zusammen, »änderten aber Ihren Plan, weil Miss Belfort sich nicht wohl fühlte.«
Sie hatten sich in der Halle an den großen Tisch gesetzt, Tony hielt Nathalies Hand.
»Richtig«, bestätigte er. »Miss Belfort ist dann auch sehr bald auf ihr Zimmer gegangen.«
Die Französin nickte bestätigend.
»Und haben es nicht mehr verlassen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Wie gesagt, ich fühlte mich nicht wohl und habe ein Schlafmittel genommen. Aufgewacht bin ich erst heute Morgen, als Tony, ich meine, Sir Anthony, an meine Tür klopfte.«
»Verstehe.« Blade notiert etwas in sein schwarzes Büchlein, in das er schon die ganze Zeit geschrieben hatte, und schaute auf. »Es ist mir wirklich unangenehm«, entschuldigte er sich schon im Voraus, »aber ich muss Sie bitten, sich ihre Fingerabdrücke abnehmen zu lassen. Wir brauchen sie zum Vergleich mit denen, die wir an der Vitrine sichergestellt haben.«
Der Earl nickte. »Selbstverständlich. Glücklicherweise ist noch nicht geputzt worden.«
»Ja, das wäre fatal«, grinste der Inspektor.
Auf der anderen Seite der Halle wurden bereits bei den Hausangestellten die Fingerabdrücke genommen.
Nathalie überlegte fieberhaft. Hatte sie die Vitrine berührt, als sie das Zepter herausnahm? Als sie den Griff drückte, hatte sie den Ärmel ihres Pullovers über die Hand gezogen. In St. Johann war es ihr urplötzlich bewusst geworden – die Fingerabdrücke waren ihr wunder Punkt. Fast alles konnte der Mensch an sich verändern lassen, nur nicht die individuell verschiedenen Linien an den Spitzen seiner Finger.
Ihre Hand zitterte, als der Experte der Spurensicherung sie nahm und die einzelnen Finger sacht auf ein Gerät drückte. Mussten sie früher auf ein mit Tinte getränktes Kissen gedrückt werden, damit der Abdruck dann auf ein Papier ›gestempelt‹ werden konnte, wurden die Finger heutzutage eingescannt.
Sie brauchen sie ja nur zum Vergleich, versuchte Nathalie, sich zu beruhigen.
Sie war ganz sicher, an der Vitrine keine Spuren hinterlassen zu haben.
»Komm, Darling«, sagte Tony und reichte ihr eine Tasse Tee, »trink erst mal einen Schluck.«
Higgins, der Butler, reichte eine Platte mit Sandwiches herum.
Nathalie lehnte dankend ab. Vor lauter Anspannung hatte sie keinen Appetit.
Der Earl nahm sie an die Hand und führte sie an den Tisch zurück, an dem der Inspektor immer noch saß und vor sich hin grübelte.
»Was glauben Sie, was könnte hinter dem Diebstahl stecken?«, fragte Blade.
Clifford zuckte die Schultern.
Ich habe keine Ahnung«, gestand er. »Überhaupt ist es mir ein Rätsel, das Zepter ist doch nur für meine Familie von Wert.«
Blade zuckte die Schultern. »Nun, ich könnte mir vorstellen, dass ein Kunstsammler bereit wäre, einen guten Preis dafür zu zahlen«, erwiderte er. »Ich lasse gerade unsere ›Bekannten‹ checken. Wir überprüfen, wer von ihnen möglicherweise für den Diebstahl in Frage kommt. Seltsam ist allerdings, dass es keine Spuren eines Einbruchs gibt. Dabei waren doch Fenster und Türen geschlossen.«
»Was folgern Sie daraus?«
Blade schaute erst den Earl, dann Nathalie Baumann an. »Dass der Täter entweder einen Schlüssel hatte – oder sich aber bereits im Haus befand, als alles zugesperrt wurde.«
Nathalie spürte, wie ihr das Blut in den Kopf stieg, und gab sich Mühe, ihre Aufregung zu verbergen.
Tony war blass geworden.
»Sie meinen, es war jemand von den Angestellten?«, fragte er ungläubig. »Also, Inspektor, ich lege für jeden einzelnen meiner Leute die Hand ins Feuer!«
Einer der Männer der Spurensicherung trat an den Tisch und raunte dem Inspektor etwas ins Ohr. Blade hob den Kopf und schaute Nathalie an. Dann nickte er und erhob sich.
Der Beamte folgte dem Kollegen an den Tisch, an dem die Experten arbeiteten. Dank einer mobilen Internetverbindung waren die Fingerabdrücke gleich an den Zentralcomputer von Scotland Yard weitergeleitet worden, wo sie auch mit der riesigen Datei von Interpol verglichen wurden.
Nach ein paar Minuten kehrte Blade zurück, sein Gesicht war ernst, als er sich vor dem Tisch aufbaute.
»Miss Nathalie Baumann«, sagte er, mit fester Stimme, »gegen Sie liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Ich muss Sie bitten, mitzukommen, Sie sind vorläufig festgenommen.«
*
Nie würde sie seinen Blick vergessen!
Tony schaute sie ungläubig an.
»Sind Sie sicher? Inspektor, das kann doch nur ein Irrtum sein!«
Blade schüttelte den Kopf.
»Es tut mir leid, Sir«, entgegnete er, »die Fingerabdrücke lügen nicht. Diese Dame ist eine auf der ganzen Welt gesuchte Millionenbetrügerin. Das Geld hat sie in der Bank unterschlagen, bei der sie angestellt war. Und sie ist auch keine Belgierin, wie sie angegeben hat, sondern stammt aus dem Elsass, in Frankreich.«
Der Earl blickte sie immer noch an.
»Clarissa«, flehte er fast, »sag’, dass das nicht wahr ist, sag, dass …«
»Ihr Name ist Nathalie Baumann!«, unterbrach ihn der Beamte fast grob und winkte den Butler heran, der in der Nähe stand. »Mr. Higgins, bitte lassen Sie die Sachen der Lady zusammenpacken und herunterbringen.«
»Sehr wohl, Sir.«
Während der Butler einem Hausmädchen die entsprechende Anweisung gab, saß Nathalie bleich und erstarrt am Tisch. Sie war immer noch fassungslos.
Zum Verbleib des Zepters wurde sie überhaupt nicht befragt. Offenbar dachte Blade, zufällig einen international gesuchten ›Großen Fisch‹ gefangen zu haben, und hatte nicht den leisesten Verdacht, dass sie hinter dem Diebstahl stecken könne.
Umso schlimmer, dass sie dadurch doch aufgeflogen war!
Indes hütete sie sich, die Tat zuzugeben. Das würde sie auch nicht machen, wenn man sie später deswegen befragen würde. Und schon gar nicht würde sie verraten, in wessen Auftrag sie gehandelt hatte. Whitakers Arm war lang, reichte sogar bis hinter die Gefängnismauern. Nathalie war sich bewusst, dass eher ihr etwas ›zustoßen‹ würde, als dass der Amerikaner sich mit dem gestohlenen Zepter in Verbindung bringen ließe.
Indes baute sie aber auch auf ihn. Sie hatte seinem Befehl gehorcht, wie immer, wenn er einen Auftrag für sie hatte. Jetzt hegte Nathalie die Hoffnung, dass George Whitaker sie nicht fallen ließ, sondern aus dem Gefängnis holte.
Sie drehte sich um, als der Schlüssel in der Stahltür herumgedreht wurde. Ein Uniformierter schaute herein und trat dann zur Seite.
»Fünf Minuten«, sagte er.
Nathalie hielt die Luft an, als sie sah, wer die Zelle betrat. Tony!
Einem ersten Impuls folgend, wollte sie ihm um den Hals fallen, verzichtete aber, als sie seinen Blick sah. Der war nicht mehr traurig oder entsetzt, wie am Morgen, sondern abweisend.
»Tony, ich …«
Er hob die Hand und gebot ihr, zu schweigen.
»Ich bin hergekommen, weil ich etwas von dir wissen muss«, sagte er, mit heiserer Stimme. »Das in Salzburg, war das echt oder genauso falsch, wie dein Name? Hast du mich wirklich geliebt oder wolltest du in mir bloß ein neues Opfer finden?«
Der Earl atmete schwer. Nachdem die Polizei Nathalie Baumann abgeführt hatte, war er die Treppe hinaufgestürmt und hatte sich im Salon eingeschlossen. Den Whisky goss er gar nicht erst in ein Glas, sondern setzte gleich die Flasche an. Wie in einem Zeitraffer liefen die Bilder vor ihm ab.
Das Kennenlernen im Foyer des Hotels ›Sacher‹, wo er vor Clarissa …, nein, Nathalie …, stand und von ihr angerempelt wurde. Unabsichtlich, oder mit der Absicht, seine Bekanntschaft zu machen? Im Nachhinein konnte man es fast annehmen.
Dann die Premiere des ›Jedermann‹. Sie hatten einen wunderschönen Abend verbracht, mit einer Fahrt im Fiaker, Essen in einem erstklassigen Restaurant und später …
Die nächsten Tage waren wie ein Traum gewesen. Nie zuvor hatte Tony eine Frau kennengelernt, die ihn so faszinierte, wie diese, und schon nach einigen Tagen war ihm klar, dass er ohne ›Clarissa‹ nicht mehr würde leben können. Dass er sie nach England mitnahm, war nur eine logische Konsequenz.
Der Earl trank erneut, der Schnaps rann ihm brennend die Kehle hinunter, und in seinem Magen breitete sich ein flaues Gefühl aus. Angesichts des ungeheuren Verbrechens, das der Butler am Morgen entdeckt hatte, war es dem Engländer unmöglich gewesen, etwas zu essen, keinen Bissen hätte er herunterbekommen.
Dennoch trank er jetzt und merkte, dass der Alkohol sich auch in seinem Kopf ausbreitete. Der Salon schien sich um ihn herum zu drehen, die Gedanken wirbelten durcheinander, und immer wieder sah er ihr Gesicht.
Endlich ließ der Earl sich in einen Sessel fallen und schloss die Augen. Er wachte erst auf, als es heftig an der Tür klopfte.
»Sir, ist alles in Ordnung?«, hörte er Higgins besorgt rufen.
Es dauerte einen Moment, bis Tony sich gesammelt hatte, dann erhob er sich schwankend und öffnete. Der Butler schaute an ihm vorbei, sein Blick fiel auf die halbleere Whiskyflasche auf dem Tisch.
»Danke, Higgins«, sagte Tony. »alles okay.«
Er ging an dem Butler vorbei und öffnete die Tür zu dem Zimmer, in dem ›Clarissa‹ geschlafen hatte. Obwohl eines der Mädchen schon geputzt hatte und die Fenster geöffnet waren, hing noch immer der Duft ihres Parfums im Raum. Der Earl sog ihn tief ein, als wäre er ein Ertrinkender, der dringend Sauerstoff benötigte.
Später wusste er nicht mehr zu sagen, wie lange er dort gestanden hatte. Er drehte sich irgendwann um und ging wieder hinaus. Die Mittagszeit war längst vorüber, doch der Earl verzichtete auf den Lunch. Stattdessen stellte er sich unter die Dusche und ließ abwechselnd heißes und kaltes Wasser auf sich herunterprasseln. Nachdem er sich angezogen hatte, klingelte Tony nach dem Butler und bat um ein Sandwich und Kaffee.
So gestärkt, fühlte er sich in der Lage, in die Stadt zu fahren, zum Gerichtsgebäude, in dem auch das Gefängnis untergebracht war.
Ein Gedanke beschäftigte ihn die ganze Zeit, ließ ihn nicht mehr los.
Die Zeit in Salzburg – hatte ›Clarissa‹ es da ernst gemeint, als sie sagte, sie würde ihn mehr lieben, als je einen anderen Mann zuvor, oder war es nichts weiter, als eine faustdicke Lüge gewesen, und sie hatte in ihm, dem reichen Earl, nichts weiter, als ein potentielles Opfer gesehen?
Nathalie schüttelte entsetzt den Kopf.
»Nein, Tony«, rief sie, »ganz sicher nicht! Ich liebe dich, wie ich …«
»… noch nie einen anderen Mann geliebt habe«, vollendete er den Satz und nickte. »Ja, das waren deine Worte, ich höre sie ständig. Aber wenn du mich so liebst, warum hast du mir dann nicht gesagt, wer du wirklich bist? Wieso muss ich durch die Polizei erfahren, dass Clarissa Belfort gar nicht existiert?«
Hilflos hob sie die Schultern und ließ sie wieder sinken.
»Ich wollte mein Leben ändern«, sagte sie leise. »Mit dir wollte ich glücklich werden, Tony. Mit deinem Namen, den ich getragen hätte, wäre Clarissa Belfort gestorben, für alle Ewigkeit!«
Er schaute sie einen Moment an.
»Bist du vernommen worden?«, fragte der Engländer. »Soll ich dir einen Anwalt besorgen?«
Ja, man hatte sie vernommen, allerdings verweigerte Nathalie die Aussage. Nein, einen Anwalt brauche sie nicht. Den würde sie bekommen, wenn man sie nach Frankreich ausgeliefert hatte und ihr dort den Prozess machte.
Sir Anthony Clifford nickte.
»Gut, dann kann ich nichts mehr für dich tun«, sagte er und klopfte an die Tür.
Als die Tür sich hinter ihm schloss, sank Nathalie auf die Pritsche und schlug die Hände vor das Gesicht.
*
Die Nachricht von der Festnahme Nathalie Baumanns, durch die britischen Behörden, schlug in St. Johann wie eine Bombe ein. Nicht Wenige waren durch die Machenschaften der Französin unmittelbar betroffen gewesen.
»Am Ende siegt doch immer die Gerechtigkeit«, meinte Sebastian Trenker, als sein Bruder ihm die Neuigkeit ins Pfarrhaus brachte.
Zwar hatte sich Nathalie in der Zeit nicht in St. Johann befunden, doch der Verdacht, dass sie hinter dem Raub der Madonnenfigur steckte, ließ sich nicht ganz von der Hand weisen. Immerhin gab es die Aussage eines Tatbeteiligten, der von einer Frau mit französischem Akzent gesprochen hatte, von der er seine Anweisungen erhalten habe.
»Aber nachweisen können wir’s ihr net«, setzte der Bergpfarrer hinzu. »Dennoch wird sie ihrer Strafe net entgeh’n.«
Dieser Meinung konnte sich der Polizist nur anschließen.
»Umso weniger kann ich versteh’n, dass sie die Aussage verweigert«, sagte Max. »Ich denk’, wir sind uns einig, dass die Baumann das alles net allein’ ausgeheckt hat sondern, dass es da noch jemanden geben muss, der im Hintergrund die Strippen zieht.«
Sebastian nickte. »Richtig.«
»Warum liefert sie den net ans Messer?«, fragte sein Bruder.
Der Geistliche zuckte die Schultern.
»Das kann man nur mutmaßen«, antwortete er. »Entweder ist dieser Unbekannte so mächtig, dass sie es net wagt, gegen ihn auszusagen, oder Nathalie Baumann verspricht sich etwas davon, dass sie ihren Auftraggeber oder die Auftraggeberin deckt.«
Neben dem guten Hirten von St. Johann, interessierte es auch Adrian Keller, dass die Millionenbetrügerin hinter Schloss und Riegel saß. Er hatte sie, unter ihrem falschen Namen, auf dem Flug von Boston nach München kennengelernt, nicht ahnend, dass die angebliche Belgierin auf ihn angesetzt worden war. Der erfolgreiche Arzt, der lange Jahre in den Staaten gelebt hatte, war ein letztes Mal dorthin geflogen, um sein Vermögen nach Deutschland zu transferieren. Indes kam das Geld nie hier an, sondern verschwand in irgendwelchen dunklen Kanälen.
Steckte die Belfort – oder Baumann – dahinter?
Selbstverständlich erstattete Adrian Anzeige, doch die Ermittlungen verliefen im Sande. Weder auf deutscher, noch auf amerikanischer Seite, konnten die Behörden den Verbleib des Geldes klären.
Dadurch war auch der Umbau des Schirmerhofes zu einer Landklinik in Gefahr gebracht worden. Seltsam war, dass ›Clarissa Belfort‹ dem Arzt zeitgleich das Angebot eines Investors unterbreitete, der bereit wäre, den Umbau zu finanzieren – indes sollte Adrian dafür dem unbekannten Geldgeber das Konzept überlassen, was er freilich ablehnte. Er wollte seinen Lebenstraum nicht verkaufen, entweder würde er es alleine schaffen, oder eben nicht! Inzwischen war die Landklinik in Betrieb und hatte mittlerweile mehr Patienten auf der Warteliste, als sie aufnehmen konnte.
Einer, der das Glück gehabt hatte, einen Platz zu bekommen, sollte heute Mittag eintreffen. Es handelte sich um Pascal Metzler, den ehemaligen Verlobten der Frau, die jetzt in England im Gefängnis saß und darauf wartete, nach Frankreich ausgeliefert zu werden.
Vielleicht war diese Neuigkeit dort noch gar nicht in Umlauf gebracht worden, deshalb hatte Adrian den Bergpfarrer, als Sebastian ihm die Festnahme Nathalies berichtete, gebeten, auf den Schirmerhof zu kommen.
»Möglicherweise brauche ich Ihre Hilfe, Hochwürden«, hatte der Arzt gesagt. »Wir werden Herrn Metzler wohl auch darüber aufklären müssen, dass diese skrupellose Frau vermutlich auch hinter dem Mordanschlag auf ihn steckt.«
Eine Vermutung, die nicht von der Hand zu weisen war und aus der Tatsache resultierte, dass Yvonne Metzler der Betrügerin damit gedroht hatte, ihren Bruder nach St. Johann zu holen, damit dieser seine ehemalige Verlobte identifizierte. Nur ein paar Tage später wurde der Franzose in Kolmar von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Wagens, den man später ausgebrannt in einem Waldstück fand, floh unerkannt.
»Selbstverständlich komm’ ich zu euch«, hatte der Geistliche versprochen und sich gleich nach dem Essen auf den Weg gemacht.
Lena Brock hatte einen Marillenkuchen gebacken und Kaffee gekocht. Sie kannte die Yvonne, die ebenfalls Heilpraktikerin war, von einem Kongress, wo die beiden sich angefreundet hatten. Dass diese Begegnung einmal eine derart dramatische Wendung haben würde, hätte damals keine von ihnen gedacht.
»Ich glaub’, da kommen sie!« Die Kräuterpädagogin deutete auf ein Auto, das in die Einfahrt bog.
Es war ein Wagen mit französischem Kennzeichen, der auf der gekennzeichneten Parkfläche anhielt.
Yvonne stieg aus und winkte. »Da sind wir!«
Lena lief ihr entgegen und umarmte sie. »Schön, dass ihr da seid.«
Sie schaute auf den Mann, der auf der anderen Seite ausgestiegen war. Pascal Metzler schien sich gut erholt zu haben, aber Lena wusste, dass das Trauma des Unfalls noch lange nicht überwunden war. Sie begrüßte Yvonnes Bruder. »Herzlich willkommen.«
Er lächelte scheu und reichte ihr die Hand. Pascal war gut eins achtzig groß und von schlanker Gestalt. Sein Gesicht war gut geschnitten und ähnelte dem seiner Schwester.
»Vielen Dank«, antwortete er auf ihre Begrüßung und strahlte Lena an.
Yvonne, die das beobachtete, schmunzelte in sich hinein …
»Kommt erst mal mit.« Lena hatte den Tisch hinter dem Haus gedeckt.
Adrian und Pfarrer Trenker erhoben sich, um Bruder und Schwester zu begrüßen.
»Wie geht’s?«, fragte Adrian, der Yvonne umarmte. »Hattet ihr eine gute Fahrt?«
Sie nickte und schaute zu Sebastian.
»Hochwürden, schön, Sie zu sehen.«
Sie stellte ihren Bruder vor.
»Setzt euch«, bat Lena und begann, den Kuchen zu verteilen.
Das Gespräch drehte sich erst einmal um allgemeine Dinge, wie das Wetter und den Verkehr auf der Herfahrt.
Schließlich räusperte sich Adrian.
»Pascal«, wandte er sich an den Elsässer, »früher oder später werden Sie es ohnehin erfahren, und mir ist es lieber, wir sagen es Ihnen, als dass sie es in der Zeitung lesen …«
Die Geschwister schauten den Arzt neugierig an.
»Was ist denn los?«, fragte Yvonne.
»Nun, die Nachricht ist noch ganz frisch«, erklärte Sebastian. »Die Zeitungsredaktionen haben sie erst heut’ Morgen erhalten. Du weißt ja, dass meine Schwägerin in Garmisch beim ›Kurier‹ arbeitet. Claudia hat sofort Max angerufen und ihm die Neuigkeit mitgeteilt: Nathalie Baumann ist in England festgenommen worden und sitzt dort in Untersuchungshaft.«
»Nein!« Yvonne war aufgesprungen. »Ist man ihr doch auf die Spur gekommen? Wie ist das denn geschehen?«
Sebastian blickte zu Pascal, der still und blass auf seinem Stuhl saß, seine Hand, die die Kaffeetasse hielt, zitterte leicht. Aber man merkte deutlich, dass der Elsässer sich bemühte, ruhig zu bleiben.
»Über die genauen Umstände der Festnahme wissen wir noch nix«, antwortete der gute Hirte von St. Johann. »Jedenfalls wartet Nathalie auf ihre Auslieferung nach Frankreich.«
Yvonne klatschte in die Hände.
»Es gibt also doch noch Gerechtigkeit auf dieser Erde«, rief sie und schaute ihren Bruder an. »Pascal, hast du das gehört? Jetzt bekommt sie ihre Strafe!«
Pascal Metzler antwortete nicht. Er saß da, nagte an der Unterlippe und nickte nur.
*
Nina Hollmann hatte sich an das reichhaltige Frühstück gewöhnt, dass ihr in der Pension Stubler serviert wurde. Indes hatte sie am ersten Morgen ungläubig gestaunt, als die Wirtin das große Tablett auf den Tisch stellte, auf dem Schüsselchen mit Marmelade, Joghurt, Kräuterquark und frischem Obst standen. Außerdem gab es eine Aufschnittplatte, auf der Schinken, Wurst und Bergkäse angerichtet und liebevoll garniert waren. Der Korb quoll über von frischen Semmeln und Laugenbrezeln, dazu gab es ein Ei, genau auf den Punkt gekocht, wie die Ärztin es am liebsten mochte.
»Soll das etwa alles für mich allein sein?«, hatte sie ungläubig gefragt.
Ria Stubler lachte.
»Langen S’ nur tüchtig zu«, sagte sie. »Unsre gute Bergluft macht hungrig. Außerdem können S’ sich gern’ noch eine Vesper für später einpacken, dann brauchen S’ net so oft ins Wirtshaus geh’n und schonen die Reisekasse.«
An diesem Morgen hatte Nina allerdings keinen großen Appetit – es war der Tag, an dem sie das Vorstellungsgespräch in der Bergklinik ›Nonnenhöhe‹ führen sollte, in der sie sich auf eine Stelle in der Herzchirurgie beworben hatte.
Freilich war sie aufgeregt, auch wenn sie gute Zeugnisse hatte und ein Empfehlungsschreiben ihres letzten Chefs vorweisen konnte. Professor Hartmann hatte sie denn auch nur ungern gehen lassen.
»Aber umstimmen kann ich Sie wohl net«, seufzte er, bei ihrem letzten Gespräch. »Immerhin weiß ich Sie beim Bernhard in den besten Händen.«
Professor Ulrich Bernhard war der Leiter der Bergklinik und ein alter Bekannter Hartmanns.
Nein, umstimmen konnte er Nina nicht, genauso wenig, wie Bernd Keppler, der Mann, den sie eigentlich eines Tages hatte heiraten wollen …
Sie hatte München und ihn verlassen, ohne wirklich eine Zusage der Bergklinik zu haben, aber das wusste außer ihr sonst niemand.
»Also, Nina, so geht das aber net!«, tadelte die Wirtin. »Sie haben ja net einmal das Ei gegessen.« Sie deutete auf den Brotkorb. »Und grade mal eine halbe Semmel.«
Die Ärztin lächelte.
»Seien S’ mir net bös’, Ria«, bat sie. »Aber ich bekomm’ wirklich nix herunter.«
Ria Stubler schlug sich gegen die Stirn.
»Ach, heut’ ist ja der große Tag«, rief sie. »Na, da drück’ ich Ihnen aber ganz fest die Daumen.«
»Danke«, nickte Nina. »Aber ob’s wirklich so ein großer Tag wird, das muss sich erst noch herausstellen.«
Die Wirtin winkte ab. »Ach, da bin ich ganz sicher. Die wären ja schön dumm, wenn sie Sie net nehmen täten.«
Nina trank ihre Tasse leer und stand auf.
»Wie seh’ ich aus?«, fragte sie und strich ihren Rock glatt. Sie trug ein dunkelblaues Kostüm, mit einer cremefarbenen Bluse, im Haar hatte sie ein passendes Band.
»Perfekt!«, kommentierte Ria Stubler. »Genau richtig für so einen Anlass.«
Nina zuckte zusammen, als ihr Handy sich bemerkbar machte. Um später im Gespräch nicht durch einen Anruf gestört zu werden, hatte sie den Klingelton aus lautlos gestellt und die Vibration eingeschaltet.
Aber wer wollte denn jetzt etwas von ihr?
Bernd konnte es wohl kaum sein, seit ihrer Trennung hatte sie nichts wieder von ihm gehört, da war er stur, wie ein Esel.
›Unbekannter Anrufer‹, stand auf dem Display, die Ärztin wischte darüber, um das Gespräch entgegenzunehmen.
»Hollmann …«, meldete sie sich.
»Hallo, Nina, ich wollte dir nur rasch viel Glück für deinen Termin heut’ wünschen«, hörte sie die Stimme der jungen Frau, deren Bekanntschaft sie in der vergangenen Woche gemacht hatte.
»Henrike!«, rief sie überrascht. »Ach, das ist aber lieb von dir. Ich bin ganz schön aufgeregt, muss ich zugeben.«
»Das wird schon«, lachte die Anruferin. »Thomas lässt dich übrigens auch grüßen und drückt die Daumen.«
»Toll! Dann kann ja nix mehr schiefgeh’n.«
Nina hatte Henrike Vollmers während einer Wanderung zur Landklinik Schirmerhof hinauf kennengelernt. Die Ärztin war neugierig geworden, als sie hörte, wer die Traumaklinik gegründet hatte – kein Geringerer, als der international bekannte Arzt und Autor von Fachbüchern, Dr. Adrian Keller.
Dass sie dabei mit einem tragischen Schicksal konfrontiert werden würde, ahnte Nina freilich nicht, als sie die junge Frau ansprach, die am Rande einer Bergwiese auf einer Bank saß.
Henrike war in der Bergklinik operiert worden und körperlich längst wieder gesund, indes hatte ihre Seele gelitten, denn der Mann, den sie liebte, hatte ihr den Laufpass gegeben.
Scheinbar nur, denn die junge Frau war das Opfer einer Intrige geworden! Dass ganz andere Menschen an dieser Trennung schuld waren, stellte sich erst später heraus – als es fast schon zu spät war.
»Kommst du nachher ins Pfarrhaus«, fragte Henrike, »und erzählst uns, wie’s gelaufen ist?«
Freilich gab es einen Grund, warum Henrike, nach ihrer Entlassung aus der Landklinik, im Pfarrhaus von St. Johann wohnte. Pfarrer Trenker hatte sich des Schicksals des jungen Paares angenommen und dafür gesorgt, dass Henrike und ihr Thomas wieder zueinanderfanden.
»Mach’ ich«, versprach die Ärztin. »Aber jetzt muss ich erst mal los.«
»Also, noch einmal, viel Glück!«
Das wünschte auch die Pensionswirtin erneut, ehe Nina Hollmann sich mit klopfendem Herzen auf den Weg machte.
Die Bergklinik ›Nonnenhöhe‹ war ein riesiger Komplex, mitten in die Wachnertaler Alpen hineingebaut. Ursprünglich war sie als Schönheitsklinik für eine gut betuchte Klientel konzipiert gewesen, doch die Frau, die hinter dem Projekt stand, hatte es sich mit der Justiz verscherzt und suchte kurzerhand das Weite, und von heute auf morgen standen Hunderte, Ärzte, Pflegepersonal und andere Angestellten, auf der Straße.
Eine Katastrophe für sie und ihre Familien!
Dem guten Hirten von St. Johann gelang es, seinen guten Freund, den berühmten Arzt, Professor Dr. Ulrich Bernhard, dafür zu gewinnen, dass die Klinik weiterbetrieben wurde, wenn auch gänzlich anders, als zuvor. Bernhard, in Fachkreisen fast so berühmt, wie seinerzeit der legendäre Ferdinand Sauerbruch an der Berliner Charité, brachte ein Konsortium von Ärzten zusammen, das die ›Nonnenhöhe‹ übernahm und als ›normales‹ Krankenhaus weiterführte.
Allerdings – normal war hier gar nichts, die Bergklinik war mit anderen Maßstäben zu messen! In kürzester Zeit gelang es den Ärzten, sich einen hervorragenden Ruf zu erarbeiten, der weit über die Grenzen Deutschlands hinausging. Mediziner aus aller Welt bewarben sich um eine Anstellung, und besonders begehrt war die ›Nonnenhöhe‹ bei den ›Ärzten im Praktikum‹, die hofften, hier einen Platz zu bekommen, um in der Bergklinik ihre Ausbildung zu vervollkommnen.
Nina Hollmann fuhr die Zufahrtsstraße hinauf, wobei sie in Gedanken immer wieder durchging, was sie auf mögliche Fragen antworten würde. Allerdings war ihr auch klar, dass sie es nur tat, um sich von ihrer Nervosität abzulenken, kein Mensch konnte den Verlauf eines Bewerbungsgespräches vorher sagen.
Die Ärztin bog um eine Kurve und sah erst im letzten Moment die Gestalt auf der Straße gehen. Sie trat auf die Bremse und hupte. Es war ein junger Mann, mit einem Rucksack, der stehenblieb und sie anschaute.
Nina fuhr langsam weiter und ließ die Seitenscheibe herunter.
»Wenn S’ unbedingt ins Krankenhaus woll’n, dann bleiben S’ ruhig auf der Straße«, sagte sie, mit einem sarkastischen Unterton. »Allerdings dürften S’ dann wohl eher als Patient eingeliefert werden …«
*
Der Mann, er mochte wohl Mitte zwanzig sein, war stehengeblieben und lächelte sie an.
»Du hast völlig recht«, gab er zu, »leider hab’ ich deinen Wagen nicht gehört. Fährst du zufällig zur ›Nonnenhöhe‹? Ich muss da nämlich hin, in einer Stunde habe ich ein Vorstellungsgespräch, und mein Auto hat seinen Geist aufgegeben.«
Drei Dinge fielen Nina auf: Er duzte sie einfach und wenn er auch deutsch redete, hatte seine Stimme doch einen merkwürdigen Akzent und – er hatte, genau wie sie, ein Vorstellungsgespräch in der Bergklinik!
Ein Konkurrent?
Ohne lange Nachzudenken, nickte sie und ließ ihn einsteigen. Er ließ sich auf den Sitz neben sie sinken, stellte den Rucksack zu seinen Füßen und japste.
»Puh, ganz schön anstrengend, so ein Fußmarsch. Vielen Dank, dass du mich mitnimmst.«
Irgendwas an ihrem Gesichtsausdruck schien ihn stutzig zu machen, er sah sie forschend an und schlug sich gegen die Stirn.
»Oh, sorry, dass ich einfach Du sage«, rief er aus. »Ich heiße Jonas Bergström, und bei uns in Schweden gibt es kein ›Sie‹. Nur der König wird nicht geduzt.«
Ein Schwede also!
»Ist schon in Ordnung«, lächelte sie. »Bleiben wir dabei, ich bin Nina, Nina Hollmann.«
Sie hatte ihn verstohlen gemustert. Gut schaute er aus, groß und blond, erinnerte er tatsächlich ein bissel an einen Wikinger.
Aber war er tatsächlich schon ein richtiger Arzt? Irgendwie schien er dafür noch zu jung – es sei denn, er hatte ein Turbo-Studium gemacht.
»Auf was für eine Stelle hast du dich denn beworben?«, fragte sie, mit einem Kloß im Hals.
»Herzchirurgie«, lautete die Antwort, die ihr einen gehörigen Schrecken einjagte.
Also doch! Und sie fuhr ihn auch noch zu seinem Termin!
»Ich suche einen Praktikumsplatz, verstehst du?«, setzte Jonas hinzu.
Ach,so! Nina hätte am liebsten vor Freude aufgeschrien, riss sich aber zusammen. Was sollte er denn von ihr denken!
»Und du? Arbeitest du in der Bergklinik?«, wollte er wissen.
Die Ärztin schüttelte den Kopf.
»Noch net«, antwortete sie. »Aber hoffentlich bald, ich hab’ nämlich auch ein Vorstellungsgespräch.«
Jonas lachte ein sehr sympathisches Lachen, das ansteckend wirkte.
»Und ich dachte schon, du hättest dich auf dieselbe Stelle beworben, wie ich.«
»Nein, nein, ich habe erst vor einem halben Jahr das Studium hinter mich gebracht.«
Sie runzelte die Stirn. »Und dann kümmerst dich erst jetzt um einen Praktikumsplatz? Ist das net ein bissel spät?«
»Ich war Famulant in Göteborg«, erzählte er, »aber dann habe ich mich mit meinem Vater überworfen und …«
Wie sich herausstellte, war Carl Bergström der Direktor des Göteborger Krankenhauses, in dem Jonas dann nach dem Studium angefangen hatte.
»Allerdings hätte ich vorher wissen müssen, dass das schiefgeht«, meinte er, mit einem Schulterzucken. »Vater und ich haben seit Jahren unsere Probleme.«
Welcher Art diese waren, erzählte der Schwede aber nicht.
»Ich glaube, wir sind da.« Nina deutete nach vorne.
Die Straße teilte sich vor ihnen, rechts zeigte ein Schild in die Richtung des Besucherparkplatzes, links ging es zu den Stellplätzen für die Ärzte und Angestellten, die auf der Rückseite der Bergklinik lagen.
»Ganz schön imposant«, sagte Jonas, beim Anblick des riesigen Gebäudes. »Sieht auf den ersten Blick aus wie ein Hotel.«
Die Ärztin folgte dem linken Wegweiser und stellte den Wagen ab.
»Tja, dann viel Glück«, sagte sie, als sie vor der Tür mit der Aufschrift ›Personaleingang‹ standen.
Jonas nickte. »Das wünsche ich dir auf.« Er hielt ihr die Tür auf. »Fährst du nachher wieder nach St. Johann zurück?«
Nina nickte. »Ja. Warum?«
Der Schwede grinste verlegen. »Könnte ich dann vielleicht wieder mitfahren …?«
»Na klar«, lächelte sie.
Über einen Flur gelangten sie in die große Halle, die tatsächlich eher dem Foyer eines Grandhotels glich, als dem eines Krankenhauses.
»Wo musst du denn hin?«
Jonas schaute auf einen Brief, den er aus der Tasche gezogen hatte. »Personalbüro, dritter Stock.«
»Da muss ich auch hin – allerdings direkt zum Chef.«
Gemeinsam fuhren sie mit dem Lift in die dritte Etage. Die Tür öffnete sich lautlos, und sie traten auf einen repräsentativen Flur. Hier oben war noch weniger von der Atmosphäre einer Klinik zu spüren. Flauschiger Teppichboden schluckte die Geräusche ihrer Schritte, Grünpflanzen standen in großen Kübeln, und gerahmte Bilder hingen an den Wänden.
»Da!« Nina deutete auf eine braune Tür. »Personalbüro.«
Jonas holte tief Luft und klopfte an.
»Wir treffen uns nachher in der Cafeteria«, raunte die Ärztin.
Er nickte und drückte die Klinke herunter.
›Na, hoffentlich klappt’s‹, dachte Nina und ging weiter. Dann blieb auch sie vor einer Tür, mit der Aufschrift ›Klinikleitung‹, stehen und holte zweimal tief Luft, ehe sie anklopfte.
Auf ein freundliches ›Herein‹, betrat Nina das Büro – das Vorzimmer des Professors, wie sich herausstellte.
An einem Schreibtisch saß eine Frau in den Vierzigern, die der Eintretenden freundlich entgegenblickte. »Grüß Gott. Frau Hollmann, net wahr?«
»Ja, grüß Gott, ich hab’ einen Termin …«
»Ich weiß«, nickte die Sekretärin, »und sind pünktlich wie die Maurer. Ich bin Elisabeth Bergmoser. Kommen S’ gleich mit durch.«
Nina blickte sich rasch um. Ein großer Schreibtisch, Telefon, Fax und Computer. Aktenschränke an den Wänden und gerahmte Fotos, auf einem erkannte sie die Kirche von St. Johann, eine Sitzecke, mit bequemen Polstermöbeln, auf einer Anrichte eine Kaffeemaschine und Geschirr, ein Wasserkocher, der Boden war mit demselben Teppich ausgelegt, wie der Flur.
Frau Bergmoser trat an die gegenüberliegende Tür, klopfte kurz an und öffnete sie.
»Frau Hollmann, Herr Professor«, kündigte sie die Besucherin an.
»Nur herein!«, ertönte es von drinnen, und die Sekretärin ließ Nina eintreten.
*
Ulrich Bernhard war groß und beeindruckte durch seine imposante Erscheinung, die sympathisch und vertrauenerweckend wirkte. Er erhob sich aus seinem Sessel, kam Nina entgegen und knöpfte dabei sein Jackett zu.
»Frau Bergmoser«, sagte er, wobei er gleichzeitig die Rechte ausstreckte, »bitte seien Sie so lieb, uns mit Kaffee zu versorgen und bitten Sie Dr. Carpenter her.«
Seine Sekretärin lächelte ihn derart an, dass Nina sogleich vermutete, dass sie in ihren Chef verliebt war – was, angesichts seiner grauen Schläfen und dem markanten Gesicht, auch nicht verwunderte. Allerdings würde es wohl eher eine einseitige Liebe sein. Männer, die so gradlinig durchs Leben gingen, wie Ulrich Bernhard, wurden zwar von der Damenwelt umschwärmt, betrogen aber in den seltensten Fällen ihre Frauen – sie genossen es stattdessen im Stillen, so angehimmelt zu werden …
»Sofort, Herr Professor«, antwortete Elisabeth Bergmoser geflissentlich und eilte hinaus.
Bernhard schüttelte Nina die Hand.
»Herzlich willkommen auf der ›Nonnenhöhe‹«, begrüßte er sie und deutete auf die Sitzecke am Fenster seines Büros. »Setzen Sie sich.«
Während die junge Ärztin Platz nahm, ging der Klinikchef zu seinem Schreibtisch und nahm einen Aktenordner in die Hand, mit dem er zurückkam und sich ebenfalls setzte.
Hatte eben noch ihr Herz vor Aufregung geklopft, so war Nina jetzt die Ruhe selbst. Es schien, als übertrage sich die Gelassenheit des Professors auf sie.
Was sollte jetzt noch schiefgehen?
Wollte man ihre Bewerbung ablehnen, so hätte man ihr vermutlich ein entsprechendes Schreiben geschickt.
Nina wunderte sich, dass sie nicht schon eher diesen Gedanken gehabt hatte, der im nächsten Moment von Ulrich Bernhard bestätigt wurde.
»Wir haben Sie hierher gebeten, um Sie persönlich kennenzulernen«, sagte der Leiter der Bergklinik. »Ihre Zeugnisse und nicht zuletzt die Empfehlung, durch meinen alten Studienfreund, Professor Hartmann, qualifizieren Sie ja geradezu für diese Stelle bei uns.«
Nina lächelte.
Es klopfte kurz an der Tür, und die Sekretärin trat ein, ein Tablett mit Kaffee und Tassen in den Händen. Hinter ihr betrat ein großer schlanker Mann das Büro. Er trug einen Arztkittel und lächelte freundlich.
»Ach, Herr Kollege, schön, dass Sie einen Moment Zeit haben«, sagte der Professor und deutete auf die Ärztin. »Unsere neue Kollegin, Frau Nina Hollmann.«
Der Arzt reichte ihr die Hand.
»James Carpenter«, stellte er sich vor. »Willkommen im Team.«
Nina war aufgestanden. Das war er also, der bekannte Herzchirurg, Lehrer an der ›Bostoner Medical School‹, an der er mit Dr. Adrian Keller zusammengearbeitet hatte.
»Vielen Dank«, erwiderte sie. »Ich freue mich, bei so einem berühmten Kollegen, meine Kenntnisse vertiefen zu dürfen.«
Jimmy winkte ab.
»Na ja, mit der Berühmtheit ist das so eine Sache …«, meinte er und setzte sich.
Die Sekretärin verteilte Kaffee und schmunzelte, als sie die enttäuschte Miene des Professors sah.
»Keine Nussplätzchen?«
»Kommen sofort«, antwortete Elisabeth Bergmoser und lief hinaus, um gleich darauf zurückzukommen. In der Hand hielt sie einen großen Teller, darauf lag ein Berg Plätzchen. »Frisch gebacken.«
Bernhard strahlte.
»Ich bin richtig süchtig nach den Dingern«, lachte er und griff zu.
Was sich dann entspann, war kein richtiges Vorstellungsgespräch, sondern eher ein gemütlicher Kaffeeklatsch. Nina erfuhr etwas über die Abläufe auf der Station, die Dr. Carpenter ihr später noch zeigte, und bekam eine Mappe ausgehändigt, in der, neben vielen Infos zur ›Nonnenhöhe‹, auch ein Plan lag, anhand dessen man sich orientieren konnte, um sich in dem riesigen Komplex der Klinik und des umliegenden Geländes nicht zu verlaufen.
Danach nahm der Amerikaner Nina mit auf die Station, wo er ihr die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen vorstellte und sich längere Zeit mit der Ärztin unterhielt. Dabei ging es nicht nur um Ninas Werdegang und die Krankenhäuser, in denen sie bisher gearbeitet hatte, eine Frage drehte sich auch im ihren familiären Hintergrund. Dabei war es nicht Neugier, die Jimmy zu diesen Fragen veranlasste, sie dienten dazu, Nina Hollmann besser kennenzulernen.
Als die junge Frau zwei Stunden später die Station verließ, schwirrte ihr der Kopf. Anhand des Plans, den man ihr gegeben hatte, fand sie rasch den Weg in die Cafeteria, wo Jonas Brandström bereits an einem Tisch saß und ihr zuwinkte.
Nina kaufte sich ein Glas Saft und setzte sich zu ihm.
»Na, wie ist es gelaufen?«, erkundigte sich der Schwede.
»Gut, am nächsten Ersten fange ich hier an.«
»Glückwunsch!«
»Und wie war’s bei dir?«
Jonas grinste. »Hätte nicht besser laufen können«, antwortete er. »Ab nächsten Monat sind wir Kollegen.«
»Hey, das ist doch toll! Ich gratuliere dir auch.«
Er hob sein Glas. »Dann lass uns mal anstoßen.«
»Sag’ mal, wo wohnst du eigentlich?«, fragte Nina, als sie sich zugetrunken hatten. »Ich hatte Mühe, ein Pensionszimmer zu finden.«
Jonas wischte sich über die Lippen.
»Dann werde ich wohl unter freiem Himmel schlafen müssen«, meinte er und zuckte die Schultern. »Ein Zimmer bekomme ich hier im Haus erst, wenn ich die Stelle als ›AiPler‹ antrete.«
Die Ärztin nickte verstehend, bei ihr war es nicht anders. Auch sie würde in der Bergklinik wohnen, wenn sie erst einmal hier arbeitete. Indes war Nina entsetzt, dass Jonas unter freiem Himmel schlafen wollte, und überlegte, ob und wie sie ihm helfen konnte.
»Ich hab’ da eine Idee, wie du vielleicht darum herum kommst, draußen nächtigen zu müssen«, sagte sie, nach einer Weile. »Tagsüber ist es zwar schön warm, nachts allerdings dafür schon ziemlich kalt.«
Der Schwede schaute sie neugierig an.
»Weißt du etwa, wo doch noch ein Zimmer frei ist?«, fragte er hoffnungsvoll.
Die Ärztin wiegte den Kopf.
»Ich will nix versprechen«, antwortete sie vage. »Aber ich kenn’ da jemanden, der dir vielleicht helfen kann.«
*
Sebastian Trenker saß in seinem Arbeitszimmer, als Sophie Tappert hereinkam und Besuch ankündigte.
»Wer ist’s denn?«
Die Haushälterin schob die Tür so weit zu, dass nur ein schmaler Spalt offenblieb.
»Zwei Ehepaare«, antwortete sie. »Die Eltern von der Henrike und vom jungen Grafen.«
Der Geistliche lächelte.
»Dann hat sich mein Ausflug in den Bayrischen Wald ja doch gelohnt«, meinte er und nickte. »Die Herrschaften können sich vielleicht auf die Terrasse setzen, und Sie machen uns, bitt’ schön, Kaffee.«
»Ist recht«, antwortete die Haushälterin und ging wieder hinaus.
Sebastian lehnte sich einen Moment zurück. Dass die Eltern von Thomas so rasch herkommen würden, hatte er nicht geglaubt. Schade nur, dass die jungen Leute gar nicht in St. Johann waren. Der junge Graf war mit seiner Verlobten – Thomas hatte darauf bestanden, dass Henrike den Ring, den er ihr geschenkt hatte, wieder trug – an den Achsteinsee gefahren. Aber vielleicht, überlegte der gute Hirte von St. Johann, war das sogar ein glücklicher Umstand, denn noch immer weigerte sich Thomas von Darrenberg, sich mit seinen Eltern auszusöhnen.
Das war auch der Grund, warum Sebastian Trenker, innerhalb kurzer Zeit, zweimal in den Bayrischen Wald gefahren war …
»Nein, das kann ich ihnen nicht verzeihen«, hatte der Grafensohn gesagt, als der Bergpfarrer ihn fragte, ob er sich nicht wieder mit den Eltern versöhnen wolle.
»Vater nicht«, erklärte Thomas, »weil er einfach nur zugeschaut hat und nicht auf meiner Seite stand, obwohl er wissen musste, wer diese infame Intrige gegen Henrike und mich geschmiedet hat. Und mit meiner Mutter bin ich genau aus diesem Grund fertig. Ich werde keinen Fuß mehr in das Schloss setzen!«
Sebastian hatte es sich angehört, aber nichts weiter dazu gesagt. Zu frisch waren noch die Verletzungen, die die Verlobten hatten erleiden müssen, zu tief saßen die Kränkungen.
Indes machte sich der Geistliche seine Gedanken. Für Thomas von Darrenberg stand mehr auf dem Spiel, als der ›Verlust‹ der Eltern – genau betrachtet, ging es um seine Existenz. Als Sohn des Grafen wurde es ihm schon bei der Geburt ins Stammbuch geschrieben, dass er einmal das Schloss, den Titel, das Gestüt und sämtliche Ländereien erben würde und bewahren musste. Seine ganze Erziehung und Ausbildung war auf dieses eine Ziel ausgerichtet. Was wollte er anfangen, wenn er wirklich so konsequent blieb?
Seinen Titel hatte er bereits abgelegt und sich als Thomas Darrenberg ins Gästebuch der Pension ›Edelweiß‹ eingetragen …
Abgesehen davon war Sebastian sicher, dass der junge Adlige mit Leib und Seele an der Heimat hing. Thomas ging vollkommen in seiner Arbeit auf dem gräflichen Gestüt auf, und ganz sicher würde sein Vater große Probleme haben, einen ebenbürtigen Nachfolger zu finden.
Das war der Grund, weshalb der Geistliche vor ein paar Tagen noch einmal Schloss Darrenberg aufgesucht hatte – wenn der Sohn nicht den ersten Schritt machen wollte, dann mussten die Eltern ihn tun.
Gräfin Ursula war sichtlich erleichtert, ihn zu sehen, ohne zu zögern hatte Thomas’ Mutter den Besucher aus St. Johann empfangen.
»Ich bin wirklich froh, Sie zu sehen, Hochwürden«, sagte sie, nachdem der Butler Sebastian in den Salon geführt hatte. »Wie geht es meinem Sohn?«
Sebastian stutzte einen Moment.
»Sie wissen, dass Thomas bei uns im Wachnertal ist?«, fragte er erstaunt.
Ursula von Darrenberg breitete die Arme aus. »Wo sonst sollte er sein, wenn nicht bei Henrike?« Die Gräfin deutete auf ein kleines Sofa. »Aber bitte, nehmen Sie erst einmal Platz. Kaffee?«
»Ja, vielen Dank.«
Sebastian setzte sich, während die Gastgeberin nach dem Mädchen klingelte und Kaffee bestellte.
»Thomas geht es gut«, berichtete der Geistliche. »Zwischen ihm und Henrike ist alles geklärt, die Irrtümer, die auf beiden Seiten herrschten, sind beseitigt.«
Gräfin Ursula senkte den Kopf.
»An denen ich nicht ganz unschuldig bin …«, gab sie unumwunden zu.
»Ich bin froh, dass Sie das einsehen. Thomas hat sich von Ihnen losgesagt, und ich bin jetzt zu Ihnen gekommen, um zu schauen, ob wir gemeinsam die Sache wieder geraderücken können.«
Das Mädchen hatte Kaffee gebracht und wollte einschenken.
»Lassen Sie nur«, sagte die Gräfin, »ich mach’ das schon. Bitte rufen Sie drüben, auf dem Gestüt, an und bitten meinen Mann, er möge gleich herüberkommen. Sagen Sie ihm, es gäbe Neuigkeiten von Thomas.«
Das Mädchen knickste und eilte hinaus.
Dankbar nahm der Bergpfarrer die Kaffeetasse entgegen.
»Leider ist Ihr Sohn net bereit, auf Sie zuzugehen«, bemerkte er. »Er hat seinen Adelstitel abgelegt und sich als Thomas Darrenberg in einer Pension eingemietet.«
Die Gräfin nickte. »Und es ist meine Schuld!« Sie wischte sich über die Augen und setzte sich aufrecht.
»Hochwürden, ich möchte Ihnen gerne erklären, was mich zu diesem …, dieser … Inszenierung veranlasst hat«, versuchte sie, sich zu rechtfertigen.
»Nennen Sie es ruhig Intrige«, warf Sebastian ein. »Denn das war es ja wohl.«
»Ja, Sie haben vollkommen recht, es war eine Intrige, aber einzig dazu in die Welt gesetzt, um unseren Namen hochzuhalten.«
»Wäre er denn so tief gefallen, wenn Thomas Henrike geheiratet hätte?«
»Sehen Sie«, sagte die Gräfin, ohne weiter darauf einzugehen, »wir, mein Mann und ich, legen sehr großen Wert auf die Tradition und das Festhalten an alten Regeln, wie sie in unseren Kreisen nun einmal üblich sind. Dass Thomas einmal eine Bürgerliche würde heiraten wollen, war in unseren Plänen für vorgesehen. Ganz im Gegenteil, uns schwebte immer vor, dass Bianca von Wollenstedt eines Tages unsere Schwiegertochter sein würde …«
Sie hielt einen Moment inne.
»Ich will ehrlich sein«, fuhr Thomas’ Mutter fort, »ich habe sehr bereut, das Ehepaar Vollmer seinerzeit eingestellt zu haben, ich hätte wissen müssen, dass aus einem niedlichen, jungen Madel eines Tages eine schöne, junge Frau werden würde, und ich hätte die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sehen müssen.«
Gräfin Ursula hob die Hände und ließ sie wieder fallen, eine Geste, die etwas Resignierendes hatte.
»Aber die Würfel sind gefallen«, setzte sie hinzu. »Innerlich habe ich mich damit abgefunden, dass Thomas die Tochter unseres Chauffeurs heiraten wird, dass unsere Haushälterin die Schwiegermutter unseres Sohnes wird …« Sie hob den Kopf. »Aber, dass Thomas mit uns gebrochen hat«, sagte sie leise, »damit kann ich mich nicht abfinden. Ich würde alles tun, um mich mit ihm auszusöhnen!«
Sebastian lächelte.
»Dann werde ich alles unternehmen, damit es zu dieser Aussöhnung kommt«, versprach er.
Die Tür wurde geöffnet und Graf Joachim betrat den Salon.
»Hochwürden, schön Sie zu sehen«, begrüßte er den Besucher.
»Pfarrer Trenker ist extra aus St. Johann hergekommen, um mit uns zu besprechen, wie wir uns mit Thomas und Henrike verständigen können.«
Der Graf hatte sich neben seine Frau gesetzt, er nickte.
»Gut. Ich denke, es ist an uns, auf die beiden zuzugehen«, sagte er und blickte den Geistlichen an. »Wie am besten?«
Sebastian lächelte und erklärte Thomas’ Eltern, was er sich überlegt hatte.
*
Sophie Tappert hatte Kaffee serviert und einen Sandkuchen aufgeschnitten und dazugestellt.
Anna Vollmers saß auf ihrem Stuhl, neben Gräfin Ursula, und schaute ein wenig bedrückt aus, sie lächelte aber, als Sebastian auf die Terrasse trat.
Graf Joachim und sein Chauffeur, hingegen, spazierten über den Rasen und plauderten ungezwungen über die blühende Pracht im Pfarrgarten.
»Grüß Gott, Hochwürden«, begrüßte Henrikes Vater den Geistlichen. »Wie geht’s unserer Tochter?«
Henrikes Mutter schüttelte unmerklich den Kopf und wollte wohl damit ausdrücken, dass ihr Mann sich zuerst nach Graf Thomas hätte erkundigen müssen. Anna war durch ihre jahrzehntelange Arbeit im Schloss sehr geprägt und legte Wert auf Etikette. Es war ihr schon unangenehm gewesen, zusammen mit den Herrschaften in einem Wagen zu fahren.
»Ich kann doch unser Auto nehmen«, hatte sie noch am Morgen gesagt.
»Unsinn!«, schüttelte daraufhin der Graf den Kopf. »Unser Wagen ist doch groß genug. Nein, nein, wir fahren alle zusammen.«
Der gute Hirte von St. Johann hieß die Besucher willkommen und bat die Herren, sich ebenfalls zu setzen.
»Thomas und Henrike sind an den Achsteinsee gefahren«, erklärte er. »Ich rechne net damit, dass sie vor dem Abend zurück sind. Hat’s denn mit dem Hotel geklappt?«
Graf Joachim nickte.
»Ja, es war nicht ganz leicht«, antwortete er, »aber dann konnten wir doch noch zwei Suiten im ›Ransingerhof‹ bekommen.«
»Prima. Dann schlage ich vor, dass wir es genauso machen, wie wir es auf Darrenberg besprochen haben.« Der Geistliche schaute Henrikes Eltern an. »Sie sind informiert?«
Karl Vollmers nickte. »Ja, der Herr Graf hat uns unterwegs in Kenntnis gesetzt.«
Joachim von Darrenberg schüttelte den Kopf.
»Jetzt lassen Sie endlich den Herrn Graf und die Frau Gräfin«, sagte er bestimmend. »Spätestens an dem Tag, an dem unsere Kinder heiraten, sind wir auch miteinander verwandt und werden uns duzen. Also reden wir uns doch gleich mit den Vornamen an.«
Schmunzelnd beobachtete Sebastian, wie sowohl Henrikes Mutter, als auch Gräfin Ursula zusammenzuckten, während Karl Vollmers schluckte.
»Wenn Sie es wünschen, Graf …, äh, ich meine, Joachim …«
»Ja, ich wünsche. Jochen reicht im Übrigen vollkommen.«
Nachdem sie Kaffee getrunken und die Einzelheiten für den kommenden Tag besprochen hatten, verabschiedeten sich die beiden Elternpaare und fuhren in Richtung Engelsbach. Auf einer Anhöhe, kurz vor dem Dorf, lag das Fünf-Sterne-Hotel ›Ransingerhof‹, das einst zum Imperium von Patricia Vangaalen gehörte. Nachdem die ebenso schöne, wie reiche und skrupellose Unternehmerin auf mysteriöse Weise in den Ruin getrieben worden war, stand das Luxushotel vor einer ungewissen Zukunft. Wie schon im Fall der Bergklinik ›Nonnenhöhe‹, drohte auch hier fast einhundertfünfzig Angestellten der Weg in die Arbeitslosigkeit. Rettung kam erst, als sich, auf Initiative des Bergpfarrers, der ehemalige Direktor mit dem Küchenchef und weiteren leitenden Angestellten zusammentat und den ›Ransingerhof‹ aus der Konkursmasse ersteigerte. Jetzt wurde das Hotel quasi von den früheren Angestellten geleitet.
Sebastian war in sein Arbeitszimmer zurückgekehrt. Um sich für den morgigen Tag den Rücken freizuhalten, gab es noch einiges zu erledigen. Der Geistliche musste eine Rede zu einem Hundertsten Geburtstag schreiben, an einer Predigt, anlässlich einer Beerdigung, arbeiten und schließlich eine Sitzung des Kirchenvorstands vorbereiten, die für den Donnerstagabend anberaumt war.
Er war gerade damit fertig geworden, als seine Haushälterin erneut Besucher ankündigte.
»Nina, grüß dich«, sagte der gute Hirte von St. Johann und reichte der Ärztin die Hand. »Hattest’ net heut’ dein Vorstellungsgespräch auf der ›Nonnenhöhe‹?«
Sie nickte. »Ja, Sie sehen die neue Stationsärztin der Herzchirurgie in der Bergklinik vor sich.«
»Gratuliere!« Sebastian blickte freundlich lächelnd Ninas Begleiter an. »Und wer ist das?«
»Jonas Bergström«, antwortete der Schwede. »Neuer ›Arzt im Praktikum‹ in der Bergklinik.«
»Na, da gratuliere ich doch gleich noch einmal«, meinte der Geistliche und schüttelte ihm die Hand. »Dann wünsch’ ich euch beiden schon mal viel Glück für einen gelungenen Start.«
Nina Hollmann lächelte ein wenig verlegen.
»Das können wir wirklich brauchen«, entgegnete sie. »Vor allem Jonas. Er hatte ein bissel viel Pech in der letzten Zeit.«
»Was ist denn geschehen?«
Jonas winkte ab. »Ach, wenn es kommt, dann knüppeldick«, meinte er und berichtete, dass er sich mit seinem Vater überworfen hatte, und von dem Pech mit dem Auto.
»Und – zu allem Überfluss – hat er auch kein Dach über dem Kopf«, warf Nina ein. »In ganz St. Johann gibt’s kein einziges freies Zimmer mehr.«
»Na ja, außer im Pfarrhaus«, zwinkerte Sebastian. »du hast Glück, Jonas, eins unsrer Gästezimmer ist noch net belegt.«
Der junge Mann aus Schweden war sprachlos, nie hätte er damit gerechnet, so rasch und ohne große Fragerei hier aufgenommen zu werden.
Sebastian bot den beiden Besuchern einen Platz an und lud sie ein, zum Abendessen zu bleiben.
»Wo steht denn dein Auto?«, erkundigte er sich.
Jonas hatte es gerade noch bis auf den Parkplatz des Einkaufszentrums geschafft, ehe der Wagen endgültig streikte. Angefangen hatte es, kurz nachdem er von der Autobahn abgefahren war, nach gut zehn Kilometern hatte der Motor mehrfach Aussetzer. Es handelte sich um einen Oldtimer, und Jonas, der einiges von Autos verstand, hatte ihn schon mehrfach selbst wieder repariert, aber jetzt versagten seine Künste.
»Ich habe aber schon die Werkstatt, hier im Dorf, beauftragt, den Wagen abzuschleppen«, erzählte er und machte eine Grimasse. »Ich kann bloß hoffen, dass es nicht allzu teuer wird.«
»Na, vorläufig brauchst’ ja kein Auto«, meinte der Geistliche. »In St. Johann hat man keine großen Wege zu laufen.«
Kurz bevor die Haushälterin den Tisch für das Abendessen deckte, kamen Henrike Vollmers, die vorübergehend im Pfarrhaus untergekommen war, und Thomas von Darrenberg von ihrem Badeausflug zurück. Sie freuten sich, dass Nina jetzt die Zusage der Bergklinik erhalten hatte, und waren interessiert, ihren neuen Bekannten kennenzulernen.
Während des Essens erzählte der junge Arzt von seiner schwedischen Heimat. Geboren war er in Stockholm, wo er auch die ersten zehn Jahre gelebt hatte, bis die Familie nach Göteborg zog, wo sein Vater die Stelle als Direktor des Krankenhauses antrat. Da auch schon der Großvater, der ebenfalls Jonas geheißen hatte, Medizin studiert und sein halbes Leben in der schwedischen Hauptstadt eine eigene Praxis geführt hatte, war der Weg des Enkels quasi vorgezeichnet gewesen.
Indes wurde die Familiengeschichte nur kurz gestreift, Jonas schwärmte dafür umso mehr von den endlosen Wäldern, bis hinauf in den hohen Norden, den Menschen dort und den Tieren und Pflanzen.
»Schweden ist wirklich eine Reise wert«, schloss er. »Ich wünsche euch, dass ihr meine Heimat einmal kennenlernt.«
*
Am nächsten Morgen wurde Henrike schon zeitig geweckt. Die junge Frau, die nach den Sommerferien in München wieder ihr abgebrochenes Medizinstudium aufnehmen wollte, hatte Sophie Tappert darum gebeten.
»Ich fürchte, ich verschlafe sonst«, hatte sie gesagt.
Als sie in die Pfarrhausküche kam, saßen der Bergpfarrer und Thomas schon am Tisch.
Der junge Graf war noch früher aufgestanden und von der Pension zu Fuß hergekommen. Er begrüßte seine Verlobte mit einem Kuss und schob ihr den Stuhl zurecht.
Auch wenn es erst kurz nach halb sieben war, für den guten Hirten von St. Johann war es recht spät, zu einer Tour aufzubrechen. Allerdings ging es heute nicht zur Kandereralm hinauf, was für Henrike Vollmers wohl noch zu anstrengend gewesen wäre.
Sebastian hatte nur eine Wanderung zum Teglerjoch vorgesehen, was zwar auch ein paar Stunden in Anspruch nehmen würde, aber leicht zu bewältigen war. Vom Dorf aus ging es zunächst einmal zum ›Höllenbruch‹, jenem Ausläufer des Ainringer Waldes, dessen schauriger Name aus grauer Vorzeit herrührte, als dort von Schmugglern und Dieben nur so gewimmelt haben sollte. An der ›Hohen Riest‹, wo die einzelnen Wege zu den Almen abzweigten, stiegen sie dann zum Teglerjoch auf.
»Die Bezeichnung Joch bedeutet hier in den Alpen eine Einkerbung, die zwei Gipfel, in diesem Fall sind’s die Zwillingsgipfel ›Himmelsspitz‹ und ›Wintermaid‹, voneinander trennen«, erklärte die Geistliche seinen Begleitern. »Gleichzeitig wird ist’s auch der Name für den Weg, den wir geh’n. Er führt vom nördlichen Wachnertal in den südlichen Teil.«