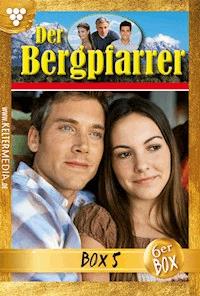
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Bergpfarrer (ab Nr. 375) Box
- Sprache: Deutsch
Mit dem Bergpfarrer hat der bekannte Heimatromanautor Toni Waidacher einen wahrhaft unverwechselbaren Charakter geschaffen. Die Romanserie läuft seit über 13 Jahren, hat sich in ihren Themen stets weiterentwickelt und ist interessant für Jung und Alt! Toni Waidacher versteht es meisterhaft, die Welt um seinen Bergpfarrer herum lebendig, eben lebenswirklich zu gestalten. Er vermittelt heimatliche Gefühle, Sinn, Orientierung, Bodenständigkeit. Zugleich ist er ein Genie der Vielseitigkeit, wovon seine bereits weit über 400 Romane zeugen. Diese Serie enthält alles, was die Leserinnen und Leser von Heimatromanen interessiert. E-Book 399: Unnahbare Schönheit E-Book 400: Angst um den kleinen Sebastian E-Book 401: Ewige Sehnsucht E-Book 402: Jenny will nur noch vergessen... E-Book 403: Schicksalssommer in St. Johann E-Book 404: Auf neuen Wegen? E-Book 1: Unnahbare Schönheit E-Book 2: Angst um den kleinen Sebastian E-Book 3: Ewige Sehnsucht E-Book 4: Jenny will nur noch vergessen... E-Book 5: Schicksalssommer in St. Johann E-Book 6: Auf neuen Wegen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Unnahbare Schönheit
Angst um den kleinen Sebastian
Ewige Sehnsucht
Jenny will nur noch vergessen...
Schicksalssommer in St. Johann
Auf neuen Wegen?
Der Bergpfarrer – Jubiläumsbox 5–
E-Book: 399 - 404
Toni Waidacher
Unnahbare Schönheit
Roman von Toni Waidacher
Isabell Bergierè schlug die Augen auf und brauchte erst einmal einen Moment, um sich zu orientieren. Das hier war zumindest nicht ihr Bett, in dem sie lag. Das stand nämlich daheim, in Marburg, in ihrem Zimmer. Dieses hier war hart und besaß keine Matratze, sondern nur einen mit Heu gefüllten, durchgelegenen Sack, auf dem es sich mehr schlecht als recht schlief.
Die junge Frau gähnte verhalten und zog den Reißverschluss des Schlafsacks auf, in den sie am Abend zuvor gekrochen war.
Fünf Uhr! Isabell zuckte unwillkürlich zusammen, als sie auf die Uhr an ihrem Handgelenk schaute. Das war nun ganz und gar nicht die Zeit, zu der sie für gewöhnlich aufstand – eher, dass sie sich noch einmal herumdrehte und in die warme Bettdecke kuschelte…
Immer noch verschlafen tappte sie zur Hüttentür und öffnete sie. Ein Schwall frischer Luft drang herein und ließ sie tief durchatmen. Es schmeckte nach Gras und wilden Kräutern, ein üppiger Duft von Blumen stieg ihr in die Nase und verscheuchte augenblicklich die Müdigkeit.
Isabell trat vor die Tür und blinzelte in die Helligkeit. Im Osten stand die Sonne am Himmel und schickte ihre warmen Strahlen auf die Erde, Vögel zwitscherten ihr Morgenlied, und ein lauer Wind wiegte die Wipfel der Bäume.
Isabell, die immer noch den flauschigen Pyjama trug, ging zu dem ausgehöhlten Baumstamm, der als Brunnen diente. Der Brunnen war so ziemlich das einzige, was hier oben auf der Brandner-Hütte noch intakt war. Er wurde von einer Rohrleitung gespeist, die vom Gipfel herunterführte und der Jenner-Alm frisches Wasser herunterbrachte. Es war eiskalt und kristallklar.
Isabell steckte eine Hand hinein und riss sie mit einem erschreckten Aufschrei wieder zurück. Rasch trocknete sie die Hand am Pyjamaoberteil ab und knetete die Finger, die anscheinend gefroren waren.
Es kostete sie schon einige Überwindung, einen zweiten Versuch zu unternehmen, doch dann ignorierte sie die beißende Kälte, schob die Ärmel nach oben und tauchte die Arme bis zu den Ellenbogen in den Brunnen hinein. Und lachend und prustend ließ sie sich das eisige Wasser über Gesicht und Haare laufen. Dann reckte sie ihr Gesicht der aufgehenden Sonne entgegen. Isabell breitete anmutig die Arme aus, als wolle sie diesen neuen Tag umarmen, und ging, genauso anmutig, in die Hütte zurück.
Eine Viertelstunde später saß sie auf einem klapprigen Stuhl in der Sonne und ließ die Haare trocknen. Den Pyjama hatte die junge Frau gegen eine karierte Hemdbluse und bequeme Jeans eingetauscht, ihre Füße steckten in leichten Mokkasinns, auf Strümpfe hatte sie verzichtet.
Auf dem Tisch vor ihr, der nicht weniger wackelig war, als der Stuhl, stand ein Becher mit dampfenden Kaffee. Isabell hatte das Wasser dafür auf einem Campingkocher heiß gemacht. Ihr war von Anfang an klar gewesen, dass ihr Leben hier oben ein anderes sein würde, als daheim, und hatte sich darauf eingerichtet.
In der Kreisstadt hatte sie einen Großeinkauf gemacht, nachdem der zunächst störrische Bauer endlich den Schlüssel für die Hütte herausgerückt hatte. Danach hatte Isabell festgestellt, dass die eine oder andere Kleinigkeit fehlte, und sie wohl oder übel ins Dorf hinunterfahren und den Rest besorgen würde müssen. Aus diesem Grund hielt sie auch den Block und den Stift in den Händen, um alles aufzuschreiben und hinterher nicht noch einmal fahren zu müssen.
Die junge Frau stöpselte das Ladekabel für ihr Smartphone in die Buchse des Zigarettenanzünders ihres Sportwagens und startete den Motor. Zwar war der Akku noch zu achtzig Prozent gefüllt, aber Isabell wusste nicht, wann sie wieder fahren würde und die Gelegenheit hatte, das Mobiltelefon aufzuladen.
Ihr war klar, dass das Auto einiges Aufsehen erregen würde, wenn sie damit durch St. Johann fuhr, deshalb wollte sie nicht so oft ins Dorf hinunter. Allerdings hoffte sie auch, dass man hier, im Wachnertal, nicht nach ihr suchte…
Jedenfalls würde man das Smartphone nicht orten können, vorsichtshalber hatte sie sich eine Prepaid-Karte gekauft und besaß nun eine andere Rufnummer. Zum Glück hatte sie oben auf der Hütte einen guten Empfang, so dass sie auch im Internet surfen und ihre E-Mails abrufen konnte.
Kaum zwanzig Minuten brauchte Isabell bis nach St. Johann. Wie sie es befürchtet hatte, starrten etliche Passanten dem roten Sportflitzer hinterher, als sie auf der Hauptstraße fuhr und das Auto schließlich auf den Parkplatz des Einkaufszentrums lenkte.
Sie stieg aus und ging zum Eingang der Passage. Trotz der legeren Kleidung, die sie trug, strahlte die attraktive Frau Eleganz aus. Ihr fast schon adlig wirkendes Gesicht wurde von einer dunklen Sonnenbrille verdeckt, das lange Haar war mit einem Tuch gebändigt. Groß und schlank, dennoch mit den richtigen Proportionen ausgestattet, folgten ihr die Blicke, als sie die Passage betrat.
Dort drinnen war es angenehm kühl. Isabell hatte einen kleinen Einkaufskorb in der Hand und ging in den Supermarkt, in der Hoffnung, dort alles zu finden, was sie auf ihrem Zettel notiert hatte. Sie schob die Sonnenbrille in die Stirn und blieb kurz stehen, um sich zu orientieren. Dann hatte sie das Regal entdeckt, in dem Drogerieartikel lagen.
Eine gute Sonnencreme wurde gebraucht, zwar hatte Isabell von Natur aus eine goldene Hautfarbe, und langes Sonnenbaden machte ihr nichts aus, indes musste man in den Bergen besonders vorsichtig sein. Auf andere Kosmetikartikel verzichtete sie, suchte stattdessen ein Päckchen mit Teebeuteln, sowie eine Büchse Kondensmilch zusammen. Frischmilch für den Kaffee wäre ihr zwar lieber gewesen, aber in der Hütte gab es keinen Kühlschrank.
Isabell bezahlte ihren Einkauf und verließ das Geschäft.
Schräg gegenüber entdeckte sie eine Boutique für Damenmode, doch sie widerstand der Versuchung und ging zum Auto, das zu ihrer Überraschung von mehreren Burschen umlagert war.
Gehörte die Aufmerksamkeit der jungen Männer eben noch dem Sportwagen, wandte sie sich nun der attraktiven Fahrerin zu.
Isabell hatte die Fernbedienung am Schlüssel gedrückt, und die Türschlösser öffneten sich mit einem Klicken.
Pfiffe gellten über den Parkplatz, als sie einstieg, und die eine oder andere freche Bemerkung fiel, begleitet von einem Augenzwinkern, aber keineswegs anzüglich.
Isabell, die solche bewundernde Bekundungen zur Genüge kannte, ignorierte die Burschen, indem sie in sich hineinlächelte und losfuhr.
»Wer war das denn?«, fragte Jonas Bruckner, der der Frau immer noch hinterher starrte.
»Keine Ahnung«, erwiderte Matthias Grassner und sprang auf sein Motorrad, »aber das find ich heraus!«
Sekunden später folgten vier Burschen auf ihren Maschinen dem roten Sportwagen, und einer wollte schneller sein, als der andere.
*
»Was wirst du denn jetzt tun?« Marion Keppler schaute Matthias Marner fragend an.
Der Vermessungsingenieur zuckte die Schultern. »Das, was Pfarrer Trenker mir gesagt hat, weitermachen. Das Vermessen des Geländes schadet ja noch nichts, und für unsere Firma ist dieser Auftrag wichtig.«
Die Firma hatte ihren Sitz in Hanau, Matthias führte sie gemeinsam mit seinem Vater. Dass eine auswärtige Firma gerade im Wachnertal tätig war, geschah freilich nicht ohne Grund.
»Ich habe Hochwürden gestern, als wir auf der Kandererhütte waren, davon erzählt«, setzte der Bursche hinzu. »Allerdings wusste er schon davon, dass ich da oben, am Teglerjoch gearbeitet habe.«
Pfarrer Trenker hatte ihm nämlich einen Papierfetzen präsentiert, den er am Joch gefunden hatte. Darauf standen der Firmenname und die Anschrift, sodass ein Leugnen zwecklos gewesen wäre.
Indes hatte Matthias gar nicht die Absicht, irgendetwas abzustreiten, ihm selbst waren während der Vermessungsarbeiten Zweifel gekommen, ob es wirklich sinnvoll war, nur des schnöden Mammons wegen, Felsen wegzusprengen und Straßen anzulegen, um in dieser Idylle, wie sie am Teglerjoch herrschte, Häuser und Eigentumswohnungen zu verkaufen.
Gewiss, der Gewinn der Investoren würde enorm sein, angesichts dieser exklusiven Lage, auch wenn nur wenige Leute es sich würden leisten können, hier zu wohnen.
Die hübsche Krankenschwester lächelte, als Ria Stubler an den Tisch kam, um frischen Kaffee zu bringen.
»Habt ihr euch von der Bergtour gestern erholt?«, erkundigte sich die Pensionswirtin schmunzelnd.
Die beiden bejahten. Da sie in der Nacht zuvor in aller Herrgottsfrühe hatten aufstehen müssen, war Ria einverstanden gewesen, dass sie heute etwas später zum Frühstück kamen. Die anderen Gäste waren längst fertig damit.
»Was unternehmen wir heut?«, fragte Marion.
Matthias blickte sie verliebt an. Als er ins Wachnertal gefahren war, hatte er sich nicht vorstellen können, sich dort spontan zu verlieben. Doch dann lernte er Marion Keppler kennen, und das Schicksal begann, seine Fäden zu weben und sie darin einzufangen.
»Ich muss noch mal zum Teglerjoch hinauf«, erklärte Matthias, »so ganz bin ich nicht fertig mit meiner Arbeit. Aber vorher will ich ins Pfarrhaus.« Er lächelte Marion an. »Aber ab Mittag habe ich frei.«
»Wie wäre es dann mit einem Ausflug?«, schlug sie vor.
»Wohin?«
»Ich würd mir gern einmal die Bergklinik ›Nonnenhöhe‹, anschauen«, antwortete die Krankenschwester.
Matthias zog die Stirn kraus. »Willst du dich dort bewerben?«
Sie schüttelte den Kopf. Ursprünglich hatte Marion Keppler tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, sich in dem renommierten Krankenhaus zu bewerben, schließlich war sie seit einer Ewigkeit arbeitslos und ohne Aussicht auf eine neue Stelle.
Doch dann hatte Matthias gemeint, in Frankfurt und Umgebung gäbe es auch Möglichkeiten, Arbeit zu finden.
Auch wenn es nicht durchklang, für Marion fühlte es sich fast wie ein Heiratsantrag an…
»Weißt du was? Komm doch mit«, schlug er vor. »Dann kann ich dir was von meiner Arbeit zeigen.«
Nur zu gerne willigte die Krankenschwester ein. Sie beendeten ihr Frühstück und machten sich auf den Weg zum Pfarrhaus.
Die Haushälterin des Bergpfarrers öffnete ihnen, und sie bedankten sich bei Sophie Tappert für die üppige Verpflegung gestern.
Sebastian saß in seinem Arbeitszimmer und bat die Besucher herein.
Seit gestern Abend recherchierte der gute Hirte von St. Johann über die ›Freienstein Invest‹, das Unternehmen, das, nach Matthias’ Worten, hinter dem Bauprojekt am Teglerjoch stand.
Zu seiner Verwunderung war es nämlich nicht Markus Bruckner, der dafür verantwortlich zeichnete, sondern eben jene Firma, deren Name bei Sebastian ungute Erinnerungen hervorrief.
Freienstein hieß nämlich auch eine bischöfliche Diözese und der dazugehörige Bischof war Caspar Brandstetter!
Durch Matthias Marners Geständnis alarmiert, hatte sich Sebastian gestern Abend noch mit Ottfried Meerbauer in Verbindung setzen wollen, musste allerdings von Pater Antonius, dem Sekretär des Bischofs, erfahren, dass Seine Exzellenz für längere Zeit zur Kur war.
Indes war auch der gute Pater alarmiert, als er den Namen Brandstetter hörte. Der Bischof von Freienstein hatte es vor geraumer Zeit darauf angelegt, Ottfried Meerbauer zum Rücktritt zu zwingen und sich aus diesem Grund zu kriminellen Machenschaften hinreißen lassen. Heimliches Abhören der Gespräche und Telefonate, sowie der Einbau von Überwachungskameras, waren nur ein kleiner Teil der Vergehen, deren Brandstetter sich schuldig gemacht hatte. Zwar war er, nachdem der Bergpfarrer und Pater Antonius seine Machenschaften aufgedeckt hatten, in ein Kloster, in Klausur verbannt worden, doch offenbar war der Bann inzwischen wieder aufgehoben worden.
»Was ich dringend wissen muss«, sagte Sebastian zu den beiden Besuchern, »ob unser Bürgermeister tatsächlich mit dem Ganzen nix zu tun hat.«
Markus Bruckner war berüchtigt dafür, dass er immer wieder irgendwelche, meist überflüssigen, wenn nicht gar unsinnigen Projekte anschob, um sich ein Denkmal zu setzen und seinen Namen unsterblich zu machen. Gott sei Dank gelang es ihm nie, denn Sebastian Trenker konnte bisher noch immer verhindern, dass die Umwelt durch Bruckners Pläne Schaden nahm.
»Ich kann’s mir eigentlich net vorstellen«, setzte der Geistliche hinzu, »schließlich braucht das Projekt einen Bebauungsplan und der muss vom Gemeinderat beschlossen werden.«
»Jedenfalls ist Ihr Bürgermeister nicht unser Auftraggeber«, bekräftigte Matthias.
Der Geistliche nickte. »Ich glaub dir ja«, versicherte er. »Wie auch immer, ich werde herausfinden, was es mit dieser ›Freienstein Invest‹ auf sich hat.«
*
Kurz nachdem das junge Paar gegangen war, meldete Sophie Tappert neue Besucher an.
»Ich hab sie auf die Terrasse gesetzt«, sagte die Haushälterin und eilte in die Küche, um einen großen Krug Saft zu holen.
Sebastian ging hinaus und lächelte, als er sah, wer da auf der Terrasse des Pfarrhauses saß.
»Ist’s also soweit«, meinte er, »heißt es jetzt Abschied nehmen?«
Thomas Duvall nickte, er und Jonas Bergmann waren aufgestanden und schüttelten den Bergpfarrer die Hand.
»Unsere Frauen werden auch jeden Moment da sein«, erklärte der Lehrer.
Im selben Augenblick klingelte es an der Haustür. Wenig später traten Anna Berthold und Steffi Fischer durch die Terrassentür.
Die Haushälterin brachte den Saft, stellte die Gläser auf den Tisch, und schenkte ein.
»Dann wollen wir mal anstoßen«, sagte der gute Hirte von St. Johann und hob sein Glas. »Auf ein gesundes Wiedersehen, im August!«
Das war der Monat, in dem Anna und Thomas heiraten wollten. Lange hatte es gebraucht, bis es endlich soweit war!
Vor einem Jahr hatten sich die Studentin und der berühmte Geigenvirtuose hier in St. Johann kennengelernt. War es bei Anna Berthold Liebe auf den ersten Blick, so hatte Thomas gar keinen Gedanken daran.
Wenige Wochen zuvor war seine Managerin, die auch die Frau war, die er hatte heiraten wollen, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Hier, im Wachnertal, versuchte der Künstler seine Trauer zu verarbeiten. Dennoch kamen er und die Studentin sich näher, wenngleich ihre Bekanntschaft auch mit Annas Urlaub endete.
›Eines Tages vielleicht…‹, lautete das vage Versprechen, das Thomas ihr gegeben hatte, und daran klammerte sich Anna Berthold.
Als sie nun in diesem Jahr wieder nach St. Johann kam, ahnte sie nicht, was für ein Wiedersehen ihr bevorstand.
Thomas hatte sich auf einer einsamen Insel in der Karibik verkrochen, und erst seine neue Managerin, Henrike Borg, konnte ihn überzeugen, wieder auf die Bühne zu gehen. Anlässlich einer großen Fernsehshow gelang das sensationelle Comeback.
Sebastian, der durch die berühmte Sängerin Maria Devei, die hier geboren war, von dem Auftritt erfahren hatte, fuhr nach München, um mit Thomas zu sprechen und ihn nach St. Johann einzuladen. Freilich mit dem Hintergedanken, dass es für Anna und Thomas endlich ein Happy End geben müsse. Dass es doch noch dauerte, lag daran, dass Henrike Borg in ihrer Eifersucht auf die Studentin, Anna des Diebstahls bezichtigte, obgleich sie selbst eine wertvolle Figur, die Thomas als Preis erhalten hatte, in dem Pensionszimmer der Studentin versteckte.
Zufällig wurde Steffi Fischer Zeugin, als die Managerin das Zimmer wieder verließ. Mit dem Vorwurf konfrontiert, Anna Berthold einen Diebstahl unterstellt zu haben, sowie mit Steffis Aussage, legte Henrike Borg ein Geständnis ab, und verließ noch am selben Abend sang und klanglos das Wachnertal.
Sebastian schaute nun die Zahntechnikerin und den Lehrer an. »Und was ist mit euch?«, wollte er wissen.
Dass Jonas Bergmann ein ähnliches Schicksal hatte, wie Thomas Duvall, ahnten die beiden Männer nicht, als sie sich kennen lernten. Karin Cordes, die Lebensgefährtin des Lehrers, starb durch einen Autounfall, und auch Jonas konnte den Tod der Frau, die er liebte, lange Zeit nicht verwinden. Indes war es auch hier der Bergpfarrer, der auf den Trauernden einwirkte, sich wieder dem Leben und der Liebe zuzuwenden.
Steffi schaute ihren Liebsten glücklich an. »Auch wir wollen heiraten«, antwortete sie, »und am liebsten hier, in Ihrer schönen Kirche, Hochwürden.«
Sebastian Trenker lächelte wieder. »Nun«, meinte er, »da hab ich ganz gewiss keine Einwände.«
Sie unterhielten sich noch eine ganze Weile, insbesondere über die Hochzeit von Anna und Thomas, die mit Sicherheit große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit hervorrufen würde. Das Medienecho würde gewaltig sein, und St. Johann konnte sich gewiss auf einen Ansturm von Pressevertretern, Funk und Fernsehen einstellen.
Schließlich war es an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Die beiden Paare verabschiedeten sich von Sophie Tappert, die die vier während ihres Aufenthalts mehr als einmal kulinarisch verwöhnt hatte. Dann brachte Sebastian sie zur Tür.
Schmunzelnd nahm er die Umarmungen, das Händeschütteln und guten Wünsche entgegen und wünschte ihnen eine gute Reise. Seine Gedanken wanderten zurück, und noch einmal rief er sich in Erinnerung, was er mit den sympathischen jungen Leuten alles unternommen hatte.
Noch einmal winkte er, als die Besucher den Kiesweg hinuntergegangen waren und wandte sich dann um, drinnen klingelte das Telefon.
Der Bergpfarrer eilte in sein Arbeitszimmer und nahm den Hörer ab. Wie er richtig vermutet hatte, war es Pater Antonius, der ihn anrief.
»Verzeihen Sie die frühe Störung«, bat der Sekretär Bischof Meerbauers, »aber ich bin da auf etwas gestoßen…«
»Sie werden es net glauben«, lachte Sebastian, »aber ich bin schon seit sieben Stunden auf den Beinen…«
Es war jetzt später Vormittag.
»Tatsächlich?«, staunte der Pater, der zugab, kein Frühaufsteher zu sein und deshalb insgeheim ganz froh sei, dass Seine Exzellenz die Diözese gerade mit seiner Abwesenheit beehrte. »Aber, ich will nicht abschweifen, ich habe herausgefunden wer K. Brandstetter ist…«
»Doch so rasch schon?«
Gestern Abend noch hatte Pater Antonius gemeint, dass seine Recherche einige Zeit in Anspruch nehmen würde.
»Ja, ich habe einen guten Bekannten in der Personalverwaltung des Bistums. Wie Sie sicher wissen, unterliegen diese Dinge dem Datenschutz, aber als mein Kontaktmann den Namen hörte, schien er irgendwie beunruhigt zu sein.«
»Aha. Inwiefern?«
»Insofern, als dass der Bischof ihn vor kurzer Zeit aufgesucht und verlangt hat, die Eintragung über die Klausur im Kloster Heuberg zu löschen.«
»Das ist dreist!«
Solche Eintragungen konnten sich, insbesondere, wenn sie negativ waren, nachteilig auf die Karriere des Betreffenden auswirken.
»Aber das ist nur ein Nebenschauplatz«, fuhr der Sekretär fort. »Was nun den Buchstaben K angeht, so steht der für Kreszentia. Sie ist die jüngere Schwester Brandstetters…«
Diese Nachricht war schon eine kleine Sensation, belegte sie doch, dass Sebastian mit seiner Vermutung, Caspar Brandstetter sei in das Bauprojekt am Teglerjoch involviert, recht hatte. Zwar trat der Bischof nicht selbst in Erscheinung, wohl aber seine Schwester, wenn auch nur mit abgekürztem Vornamen. Bezeichnend war auch, dass der Name Brandstetter zwar auf der Internetseite der ›Freienstein Invest‹ stand, als verantwortlicher Betreiber der Seite eine andere Person genannt wurde: Hubert Langner – ein Strohmann?
*
Isabell fuhr kreuz und quer, trotzdem gelang es ihr nicht, die Burschen auf ihren Motorrädern abzuschütteln. Längst hatte sie die Abzweigung zu der Bergstraße, die auf die Jenneralm führte, verpasst. Absichtlich! Denn sie wusste, dass sie in der Brandner-Hütte keine Ruhe vor ihren ›Verfolgern‹ haben würde, wenn die erst einmal herausgefunden hatten, dass sie dort oben ganz alleine lebte.
Die Vier auf ihren Maschinen überboten sich darin, der schönen, jungen Frau imponieren zu wollen. Waghalsige Überholmanöver, Kavalierstarts auf den Hinterrädern und freihändiges Fahren, waren nur ein paar Dinge ihres leichtsinnigen Balzverhaltens, mit dem sie Isabell beeindrucken wollten.
Kopfschüttelnd trat sie auf das Bremspedal, als einer der Dummköpfe sie überholte und unmittelbar vor dem Sportwagen einscherte, weil ihm auf der Gegenfahrbahn ein anderes Auto entgegenkam. Dessen Fahrer hupte und gestikulierte wild, über so viel Leichtsinn.
»Idiot«, schimpfte Isabell, »dir sollte man den Führerschein auf Lebenszeit entziehen!«
Freilich wusste sie, dass der Rüpel sie nicht hören konnte, es tat aber dennoch gut, dem Ärger Luft zu machen.
Sie atmete erleichtert auf, als Sekunden später ein Martinshorn ertönte und ein Polizeiauto mit Blaulicht an ihr vorbeischoss. Auf dem Dach des Streifenwagens lief ein Schriftband: ›Polizei! Rechts anhalten!‹
Isabell Bergierè setzte den Blinker und fuhr an den rechten Straßenrand. Sie stellte den Motor aus und suchte in ihrer Handtasche nach dem Führerschein und den Fahrzeugpapieren. Dabei wunderte sie sich ein wenig, dass die vier Verkehrsrowdys ebenfalls brav angehalten hatten.
Die Motorräder standen hinter dem Sportwagen, die Fahrer waren abgestiegen und wirkten jetzt eher kleinlaut, als der Polizist ausstieg, seine Dienstmütze aufsetzte und zu ihnen kam.
Isabell stieg ebenfalls aus und blickte den Beamten fragend an. »Ich habe nichts getan, Herr…«
Der Polizist tippte an den Schirm seiner Kopfbedeckung. »Polizeihauptkommissar Trenker, aus St. Johann«, stellte er sich vor und lächelte freundlich. »Sie hab ich auch gar net gemeint, mit der Aufforderung, anzuhalten, sondern die vier Chaoten dort.«
Er nickte ihr zu und ging weiter.
»Seid ihr eigentlich von allen guten Geistern verlassen?«, schimpfte der Bruder des Bergpfarrers. »So dumm benehmen sich ja net einmal kleine Kinder im Straßenverkehr. Am liebsten würd ich gleich eure Führerscheine einkassieren!«
Die Gescholtenen grinsten schief.
»Hallo, Max«, versuchte Matthias Grassner sich kumpelhaft zu geben, »seh’n wir uns Samstag auf dem Tanzabend?«
Max verdrehte die Augen – heute war Dienstag, bis zum Tanzabend war es noch lange hin… Und bloß, weil er mit den Burschen mal einen Obstler am Tresen getrunken hatte, waren sie noch lange keine Spezis.
»Hat sich was, mit ›Hallo Max‹«, gab er zurück. »Los, ich will eure Führerscheine seh’n und die Papiere für die Motorräder!«
Eher widerwillig zogen sie die gewünschten Sachen aus den Taschen ihrer Lederjacken.
»Ach, Max«, meinte Jonas Bruckner, »was soll das denn? Du kennst uns doch.« Er warf einen unsicheren Blick auf Isabell Bergierè, die nähergetreten war und nun am Kofferraum ihres Autos lehnte, die Arme vor der Brust verschränkt, ein spöttisches Lächeln auf den Lippen.
»Was das soll?« Max schüttelte den Kopf. »Ich hab euch schon eine ganze Weile im Blick«, antwortete er, »aber jetzt habt ihr’s übertrieben: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung und überhöhte Geschwindigkeit sind nur ein paar der Verstöße, die ich euch vorwerfe. Das gibt eine Anzeige, und ich kann euch jetzt schon sagen, dass ihr für einige Zeit zu Fuß geh’n werdet. Außerdem erwartet euch eine saftige Geldstrafe.«
Er blickte zu Isabell. »Vielleicht möchte die Dame ja auch noch Anzeige gegen euch erstatten…?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Lassen Sie nur, Herr Trenker, ich denke, die Herren sind genug gestraft.«
Der Polizist hatte die Daten aufgenommen und gab den Burschen ihre Führerscheine zurück.
»Schaut sie euch gut an«, meinte er, »lang werdet ihr sie nämlich net mehr haben. Und bedankt euch bei der Dame hier, dass sie noch einmal Gnade vor Recht ergeh’n lässt.«
Sie winkte ab. »Schon gut.«
Der Bruder des Bergpfarrers bedeutete den Motorradfahrern zu verschwinden.
»Ihr Papiere bräuchte ich allerdings auch«, wandte er sich an die junge Frau. »Möglicherweise werden Sie als Zeugin geladen.« Er warf einen Blick auf das Kennzeichen. »Sie kommen aus Marburg«, stellte der Beamte fest. »Machen S’ Urlaub bei uns?«
Isabell nickte und reichte ihm den Führerschein und die KFZ-Zulassung. »Sozusagen.«
»Na, das vereinfacht die Sache ja ungemein. Ich würd Sie nämlich bitten, am Nachmittag zu mir aufs Revier zu kommen, dann kann ich Ihre Aussage zu Protokoll nehmen.« Während er mit ihr sprach, schrieb Max die Daten in sein Notizbuch und reichte ihr die Unterlagen zurück. »So, Frau Bergierè, das wär’s fürs Erste.« Er nickte ihr freundlich zu und ging zum Streifenwagen.
Isabell stieg ebenfalls ein und atmete erleichtert auf, als sie in die Bergstraße einbog.
Von den vier Burschen auf ihren Maschinen war weit und breit nichts zu sehen.
*
Thomas Brandner hielt den Traktor an und sprang herunter. Irgendwas stimmte da nicht, der Motor stotterte immer wieder und einmal war er ganz ausgefallen.
Missmutig machte sich der Bauernsohn an die Arbeit. Er hatte sich eine kleine Leiter besorgt, die Motorhaube geöffnet und steckte seinen Kopf darunter.
»Auch das noch!«, stöhnte er. »So ein Mist!«
»Was ist denn los?« Xaver Brandner war eben aus der Scheune gekommen und hatte den Fluch seines Sohnes gehört.
Thomas tauchte wieder auf. »Ich fürcht, der Turbolader ist kaputt«, antwortete er.
Der Bauer zog die Augenbrauen in die Höhe. »Na, ein Glück, dass es jetzt passiert ist und net zur Ernte«, meinte er. »Ich ruf gleich mal den Schorsch an, dass er herkommt und sich den Schaden anschaut.« Er drehte sich um und stapfte zur Haustür. »Ach ja«, rief er seinem Sohn noch zu, »fahr doch mal zur Hütte hinauf und schau nach, ob die Frau irgendwas braucht – falls sie überhaupt noch da ist. Vielleicht hat sie ja noch gestern Abend das Weite gesucht.« Der letzte Satz wurde von einem spöttischen Grinsen begleitet.
Thomas grinste auch, allerdings nicht spöttisch, wie sein Vater, sondern erfreut.
Seit er gestern diese außerirdisch schöne Erscheinung zu Gesicht bekommen hatte – leider hatte er nur noch sehen können, wie die Frau in ihren Wagen stieg – kreisten seine Gedanken um sie.
Solch ein Wesen suchte man im ganzen Wachnertal vergeblich!
»Klar, mach ich«, rief er zurück und eilte ins Haus, um sich rasch Gesicht und Hände zu waschen.
Keine fünf Minuten später saß Thomas Brandner in seinem Auto und fuhr los.
Isabell – was für ein Name! Mehrmals sprach er ihn laut aus, ließ das Wort regelrecht auf der Zunge zerfließen.
Und dann der Nachname! Bergierè klang irgendwie Französisch, überlegte der junge Mann.
Im Gegensatz zu seinem Vater, hoffte der Bursche nicht, dass die Frau das Weite gesucht hatte. Vielmehr stellte er sich vor, wie sie ihn gleich begrüßen und vielleicht zu einem Kaffee einladen würde.
Während er weiter überlegte, schalt Thomas sich einen Dummkopf, weil er seinen Werkzeugkasten nicht mitgenommen hatte. Es hätte doch viel seriöser gewirkt. Andererseits hatte er so einen Grund, wiederzukommen…
Auf der Jenner-Alm standen mehrere Hütten, aber nur wenige davon waren bewohnt, und das auch nur an den Wochenenden, wenn die Besitzer aus München, Rosenheim oder wo sie sonst noch wohnten, herkamen, um ein paar Tage auszuspannen.
Die Brandner-Hütte lag oberhalb der Hütte, die Maria Devei gehörte. Dort wurde bis vor ein paar Jahren noch Sennenwirtschaft betrieben, doch dann hatte Xaver Brandner aufgegeben, die Kosten standen in keinem Verhältnis zum Gewinn, und mit der Zeit war die Hütte mehr oder weniger verfallen.
›Eher weniger‹, dachte Thomas, als er davor hielt. Zu seinem Erstaunen standen die Wände noch, und auch das Dach schien in Ordnung zu sein. Hier und da musste vielleicht eine Schindel ausgewechselt werden, aber das war eine Arbeit, die er mit Freuden übernehmen würde…
Er war schon ewig nicht mehr hier oben gewesen und wunderte sich, dass es nicht so schlimm ausschaute, wie sein Vater glaubte.
Der junge Mann hatte neben dem Sportwagen geparkt, jetzt überlegte er, ob er sein Auto nicht lieber verstecken sollte. Von dem Geld, das der Flitzer gekostet hatte, würde er locker zehn Wagen des Typs kaufen können, den er selber fuhr.
Langsam umrundete er den roten Sportwagen und beneidete insgeheim die Besitzerin. Doch was soll’s, so ein Gefährt würde er sich vermutlich nie leisten können.
»Grüß Gott. Jemand daheim?« Thomas hatte an die Hüttentür geklopft und trat ein. Drinnen war es hell, durch die weit geöffneten Fenster drang das Tageslicht herein, und die frische Luft vertrieb den muffigen Geruch, der sich vermutlich im Laufe der Jahre hier eingenistet hatte.
Von der ursprünglichen Einrichtung war kaum noch etwas vorhanden, sein Vater hatte seinerzeit die Hütte fast komplett ausgeräumt. Lediglich das alte Bettgestell stand noch dort, sowie ein Tisch, nebst einem Stuhl. Der frühere Gastraum war gänzlich leer, und in der ehemaligen Käserei stand nur noch ein leeres Regal.
Die Brandner-Hütte hatte nie mit der mithalten können, die auf der Kandereralm stand. Was vermutlich auch mit ein Grund war, weshalb der Bauer hier oben aufgegeben hatte.
Thomas erinnerte sich wieder, wie sie damals alles ausgeräumt hatten. Die Kupferkessel, in denen die Milch erwärmt wurde, hatte sein Vater verkauft, aus der Terrasse, auf der die Besucher meistens saßen, hatten sie Feuerholz gemacht, das längst verbrannt worden war.
Hin und wieder hatten sie überlegt, die Hütte umzubauen und an Urlauber zu vermieten, doch dann erschien Xaver Brandner der Aufwand zu groß und zu teuer.
Jetzt hatte er allerdings doch vermietet.
Der junge Bursche ging zur hinteren Tür, die auf die Rückseite führte, sie stand offen, und als er hinaustrat, sah er die Frau dort sitzen. Sie hatte offenbar telefoniert und sein Kommen gar nicht bemerkt. Als er sich räusperte und an die Hüttenwand klopfte, zuckte sie erschrocken zusammen.
»Grüß Gott«, sagte er und lächelte.
Sie aber funkelte ihn mit ihren großen, schönen Augen an und legte das Telefon auf den Tisch. »Was fällt Ihnen ein?«, rief Isabell Bergierè empört.
»Entschuldigen S’«, bat er, ein wenig verwirrt von diesem ungnädigen Empfang, »aber ich hab geklopft…«
»Wer sind Sie und was wollen Sie?«, überging sie seine Entschuldigung und blickte ihn von oben herab an.
Der junge Bauer schluckte seinen aufsteigenden Ärger über ihre offensichtliche Arroganz hinunter.
»Mein Name ist Thomas Brandner«, erklärte er, mit belegter Stimme, über die er sich selbst ärgerte. »Mein Vater hat Ihnen diese Hütte vermietet, er hat mich heraufgeschickt, ich soll schau’n, ob Sie irgendetwas brauchen…«
Isabell schüttelte den Kopf. »Ich brauche nichts«, entgegnete sie. »Es war völlig unnötig, dass Sie sich heraufbemüht haben.« Damit wandte sie den Kopf ab und gab ihm damit zu verstehen, dass das Gespräch beendet sei, und er gehen könne.
»Brauchen S’ vielleicht elektrischen Strom?«, unternahm er einen neuen Versuch, mit ihr zu sprechen. »Ich könnt die Leitung wieder anklemmen.«
Isabell hatte ihr Smartphone wieder in die Hand genommen und holte tief Luft, der Blick, mit dem sie ihn streifte, war eisig. »Drücke ich mich eigentlich so undeutlich aus?«, fragte sie, mit einem Unterton, der nichts Gutes verhieß. »Noch einmal zum Mitschreiben: ich brauche nichts und ich will nichts weiter, als meine Ruhe. Also stören Sie mich nicht länger!«
Der Brandner-Thomas war ein fescher Bursche, der Schlag bei den Madeln hatte. Auf dem Tanzabend konnte er sich kaum retten, wenn Damenwahl war. So eine Abfuhr hatte er sich noch nie geholt!
»Arrogante Zicke!«, murmelte er und drehte sich um.
»Das habe ich gehört«, rief sie ihm hinterher.
Thomas schoss aus der Hütte und stieg wutentbrannt in sein Auto.
›Was bildete die sich eigentlich ein, wer sie ist, dass sie so mit ihm umsprang? Pah, die würde noch sehen, was sie von ihrer Arroganz hatte, dieses Fräulein Rührmichnichtan! Sollte sie doch in ihrer Hütte verschimmeln!‹
Und während er zum Hof zurückfuhr, und ihm all diese Dinge durch den Kopf gingen, verspürte er dennoch das unbändige Verlangen, Isabell Bergierè in die Arme zu nehmen und nie wieder loszulassen.
Wie ein Blitz hatte es ihn getroffen, als sie ihn angeschaut hatte, und er zum ersten Mal ihr Gesicht sehen konnte. Sein Herz brannte lichterloh, und Thomas war bis über beide Ohren verliebt.
*
Wie ein in die Landschaft hingeworfener Klotz, wirkte die Bergklinik ›Nonnenhöhe‹ auf den Betrachter. Kaum jemand, der das Monstrum zum ersten Mal sah, mochte den Bau schön nennen, und nicht wenige wunderten sich, dass es dafür überhaupt eine Baugenehmigung gegeben haben sollte.
Hatte es auch nicht – zumindest nicht auf legalem Wege. Patricia Vangaalen, eine milliardenschwere Geschäftsfrau, hatte sich durch Lug und Betrug, Bestechung und Erpressung, die nötigen Genehmigungen erschlichen und mit dem Bau der Schönheitsklinik, als die die ›Nonnenhöhe‹ einst geplant war, Tatsachen geschaffen, die nicht mehr umzukehren waren.
Inzwischen war die ebenso schöne, wie skrupellose Geschäftsfrau längst Geschichte, ihr Imperium durch Manipulationen zerschlagen, das Vermögen in dunkle Kanäle verschwunden, und kein Mensch im Wachnertal weinte Patricia eine Träne nach.
Schon gar nicht der Bergpfarrer, der einen wesentlichen Anteil daran hatte, dass die Machenschaften Vangaalens aufgedeckt wurden, und man die Frau zur Rechenschaft zog.
Indes hatte Sebastian Trenker alle Hände voll zu tun gehabt, um mehreren hundert Mitarbeitern der Klinik, die von einem Tag auf den anderen auf der Straße standen, den Arbeitsplatz zu retten. Es gelang ihm, indem er seinen Freund, den bekannten Arzt Professor Dr. Bernhardt dafür gewinnen konnte, mit einem Konsortium namhafter Ärzte, die Schönheitsklinik zu übernehmen und daraus ein allgemeines Krankenhaus zu machen.
Längst hatte sich die Bergklinik ›Nonnenhöhe‹ einen guten Ruf, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, gemacht. Vor allem auch als Ausbildungsstätte für angehende Ärzte.
»Schön ist’s ja net«, meinte Marion Keppler, als sie auf dem Besucherparkplatz angehalten hatten und ausgestiegen waren.
»Stimmt«, grinste Matthias Marner, »schön ist was anderes.«
Er schaute die neben ihm stehende Krankenschwester nachdenklich an. Den ganzen Vormittag hatte er am Teglerjoch gearbeitet und die letzten Vermessungen vorgenommen, nun musste er seine Unterlagen nur noch einmal durchsehen und konnte im Prinzip zurück nach Hanau fahren. Von dort würde er die Vermessungsergebnisse nach Freienstein schicken, und sobald die Investmentfirma die Rechnung für seine Arbeit bezahlt hatte, war die Angelegenheit für das Vermessungsbüro ›Marner & Sohn‹ erledigt.
Doch, wie würde es mit ihm und Marion weitergehen? Auf seinen eher vagen Hinweis, in Frankfurt und Umgebung gäbe es etliche Krankenhäuser, und dass sie in einem von ihnen gewiss eine Anstellung finden würde, war Marion nicht direkt eingegangen. Nahm sie seine Worte nicht ernst oder hatte sie diese nicht als ernsthaft gemeint empfunden?
»Würdest du wirklich hier arbeiten wollen?«, fragte er.
Marion nickte. »Aber sofort! Ich kann mir gar net vorstellen, dass es woanders genauso gut sein sollte wie hier. Die Bergklinik ›Nonnenhöhe‹ ist nun mal ein Haus mit einem hervorragenden Ruf, nicht nur was die Ärzteschaft und das Pflegepersonal angeht, über beide liest man nur Gutes, auch das Arbeitsklima soll hier ganz hervorragend sein.«
Matthias schluckte beklommen. ›Offenbar komme ich in ihren Zukunftsplänen gar nicht mehr vor‹, dachte er.
Langsam folgte er der Krankenschwester, die bereits auf dem Weg zum Eingang war.
Als sie die große Halle betraten, hatten sie das Gefühl die Lobby eines Luxushotels zu betreten. Nichts hier erinnerte daran, dass es sich um ein Krankenhaus handelte. Erst beim näheren Betrachten der Leute, sah man, dass manche von ihnen Pyjama trugen und darüber Bademäntel angezogen hatten; Patienten, denen keine Bettruhe verordnet war und die entweder aus Langeweile spazieren gingen oder sich in dem kleinen Laden mit Zeitungen, Magazinen oder anderem Lesestoff eindecken.
Marion Kepler stand in der Mitte der Halle, drehte sich einmal um die eigene Achse und schaute sich ausgiebig um. Ja, das war genauso, wie sie es sich vorgestellt hatte.
Vor einiger Zeit hatte sie in einer Zeitschrift einen Bericht über die Bergklinik gelesen, aber die abgedruckten Fotos gaben nur einen kleinen Ausschnitt dessen wieder, was es hier zu sehen gab.
»Schau mal da.« Die Krankenschwester deutete auf einen Glaskasten, der zwischen den Aufzügen und dem offenen Treppenhaus stand. In ihm waren mehrere Plakate und Zettel zu sehen. Medizinische Vorträge wurden angekündigt und andere Veranstaltungen, wie Lesungen oder Musikabende. Offenbar wurde hier den Patienten, die längere Zeit in der Bergklinik verweilen mussten, einige Abwechslung geboten.
Auf der rechten Seite des Glaskastens waren ein paar DIN A4 große Blätter angeheftet, auf einem davon war Interessantes zu lesen.
»Du, die suchen tatsächlich Pflegepersonal«, sagte Marion atemlos zu Matthias, der neben ihr stand, und zeigte auf das Blatt Papier.
Sie ging noch näher und tippte mit dem Finger auf das Glas. »Qualifizierte Krankenschwestern gesucht«, las sie halblaut vor. »Für die Stationen der Inneren Medizin und der Chirurgie wird jeweils eine fachlich qualifizierte Krankenschwester gesucht.« Marion schaute Matthias an. »Das ist doch genau das, was ich mir die ganze Zeit vorstelle«, sagte sie und musste unwillkürlich schlucken.
Die Bezahlung war übertariflich, und eine Unterkunft konnte im Haus gestellt werden, las sie weiter. Das war tatsächlich viel mehr, als sie sich erträumt hatte.
Jetzt musste sie sich nur noch bewerben!
Das Gesicht des Vermessungsingenieurs versteinerte. Matthias wandte sich ab und schlenderte ein paar Schritte in Richtung des Geschäftes, wo er die Auslagen betrachtete. Neben Lesestoff und Lottoservice, konnte man auch Süßigkeiten, Ansichtskarten und Souvenirs kaufen.
»Ich hoffe, du drückst mir die Daumen, wenn ich mich bewerbe«, sagte Marion Kepler, die sich wieder dem Glaskasten zugewandt hatte.
Noch einmal las sie halblaut den Text vor ihr und wandte dann den Kopf, um Matthias zu fragen, ob er zufällig einen Zettel und einen Kugelschreiber bei sich habe. Sie wollte sich aufschreiben, an wen die Bewerbung geschickt werden musste. Jetzt sah sie erstaunt, dass ihr Begleiter gar nicht mehr neben ihr stand. »Matthias?« Ihr Blick glitt suchend hin und her, und schließlich entdeckte sie ihn vor dem Schaufenster stehend.
»Hier bist du«, sagte sie, als sie neben ihm stand.
Er erwiderte nichts darauf und blickte konzentriert auf eine Puppe, die wie ein Senner gekleidet war.
»Matthias?« Sie stieß ihn an, als er nicht reagierte. »Was ist denn los?«, wollte sie wissen und fragte ihn nach Zettel und Stift.
Er schüttelte nur den Kopf, ohne zu antworten, und reichte ihr das Gewünschte. »Ich gehe schon mal zum Auto«, sagte er, »mir bekommt die Luft hier drinnen nicht.«
Kopfschüttelnd blickte sie ihm hinterher. Was störte ihn an der Luft? Der typische Krankenhausgeruch herrschte drinnen jedenfalls nicht.
Marion ging zum Glaskasten zurück und schrieb sich die notwendigen Daten ab.
»Willst’ dich hier bewerben?«
Die Krankenschwester drehte sich um und blickte in das lächelnde Gesicht eines jungen Burschen, der kaum älter war, als sie selbst.
Sie nickte.
»Das ist das Beste was du machen kannst«, meinte er.
»Arbeitest du hier?«, erkundigte sie sich.
»Ja, ich bin Pfleger, oben auf der Inneren. Ich heiße Martin. Martin Gundlach.«
Marion Keppler stellte sich ebenfalls vor.
»Wo warst’ du denn bis jetzt?«, wollte er wissen.
Sie erzählte von dem Krankenhaus, in dem sie ausgebildet worden war und der Klinik, in der sie zuletzt gearbeitet hatte, bis sie geschlossen worden war.
Martin nickte verstehend. »Das ist ja eine ganz schön lange Zeit, die du jetzt arbeitslos bist«, meinte er und wandte sich zum Gehen, »dann drück ich dir mal die Daumen, dass es klappt.«
»Danke«, lächelte sie und winkte ihm hinterher.
»Wer war denn das?« Matthias, dem es draußen zu langweilig geworden war, stand neben ihr, er warf dem davongehenden Krankenpfleger einen finsteren Blick hinterher.
Marion lächelte. »Das war Martin« antwortete sie, »mein neuer Arbeitskollege, wenn es klappt…«
*
Johann Sander verabschiedete den Patienten und ging an das Waschbecken. Nachdem er sich die Hände gewaschen desinfiziert hatte, setzte er sich an seinen Schreibtisch und drückte den Knopf der Gegensprechanlage. »Frau Gärtner, Sie können den nächsten herein schicken.«
Sekunden später öffnete sich die Tür zum Sprechzimmer, aber es war kein Patient, der herein trat.
»Ach du bist es«, sagte der Arzt und deutete auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. »Nimm Platz.«
Torben Jansen setzte sich und blickte seinen Schwiegervater in spe fragend an.
»Und«, fragte er, »hast du Neuigkeiten?«
Doktor Jansen schüttelte den Kopf. »Und du?«
Der junge Arzt schüttelte ebenfalls den Kopf. »Ich habe mir die Finger wund gewählt und den Mund fusselig geredet, aber kein Mensch weiß, wo sie steckt.«
Johann Jansen hob die Schultern und ließ sie mutlos wieder sinken. »Ich habe auch keine Ahnung, wen ich da noch fragen soll«, gestand er. »Keine ihrer Freundinnen weiß irgendetwas, Andrea hat sich nirgendwo gemeldet und niemandem gesagt, was sie vorhat.«
Torben sah ihn durchdringend an. »War es denn wirklich so dramatisch, was da zwischen euch vorgefallen ist?«, fragte er.
Erneut zuckte der Arzt die Schultern. »Was heißt dramatisch«, antwortete ausweichend, »du weißt doch, wie sie ist.«
»Ging es denn wirklich nur um den kleinen Jungen?«, wollte der junge Arzt wissen. »Dann verstehe ich Ihre Reaktion umso weniger, der Bub wurde doch gerettet.«
Doktor Jansen nickte. »Aber nur, weil Andrea sich über alle Anweisungen hinweggesetzt und den Kleinen so behandelt hat, wie sie es von Anfang an wollte.« Er schaute seinen zukünftigen Schwiegersohn fragend an. »Habe ich noch Patienten draußen?«
Torben Jansen schüttelte den Kopf. »Nein, für heute sind wir durch. Ich mache noch einmal meine Runde durch die Patientenzimmer, und dann ist Schluss für heute. Gehen wir nachher zusammen etwas essen?«
Sander nickte und stand auf. »Sei so gut, und bitte Frau Gärtner, einen Tisch im ›Ratskeller‹ zu reservieren«, bat er und knöpfte den weißen Kittel auf.
»Mache ich.« Torben war ebenfalls aufgestanden und ging hinaus.
Doktor Sander hängte den Kittel an den Haken der Garderobe und trat ans Fenster. Mit müden Augen schaute er nach draußen. Der Sommer hatte seine ganze Kraft entfaltet, überall grünte und blühte es.
Und im weitläufigen Park der Arztvilla waren der Gärtner und seine Gehilfen dabei, die Wege zu rechen, den Rasen zu mähen und den kleinen Teich, in dem Goldfische schwammen, von auf dem Wasser schwimmenden Blättern zu befreien.
Von außen betrachtet, war die Privatklinik Sander ein vornehmer Prachtbau aus dem neunzehnten Jahrhundert.
Die Vorfahren des jetzigen Besitzers waren allesamt Mediziner gewesen, zwei Weltkriege hatte das große Haus unbeschadet überstanden, und seit mehr als hundert Jahren hatten hier Ärzte gewirkt. Neben der ambulanten Praxis verfügte die Privatklinik über sechs Patientenzimmer, ein eigenes Labor, sowie einen OP-Bereich.
›Was würde einmal daraus werden?‹ Diese Frage stellte sich der Arzt, während er seinen Blick schweifen ließ und sich dabei aber in Erinnerung rief, wie es zu dem Zerwürfnis zwischen ihm und seiner Tochter gekommen war.
Nach dem frühen Tod seiner Frau hatte er Andrea alleine aufgezogen und ihr alle Zuwendung angedeihen lassen, zu der er als liebender Vater fähig war. Nie hatte er sie gezwungen denselben Weg zu gehen, wie er selbst, aus freien Stücken hatte sie Medizin studieren wollen.
Natürlich hatte er sich darüber gefreut, würde sie doch eines Tages seine Nachfolgerin werden und die Klinik in seinem Sinne fortführen. Dass Andrea in Torben Sander nicht nur einen fürsorglichen und liebenden Mann gefunden hatte, sondern auch einen fähigen Arzt und Kollegen, machte die Zukunftsaussichten noch rosiger.
Johann Sander hatte sich immer vorgestellt, dass er beizeiten den weißen Kittel ausziehen und seinen Lebensabend im Kreise seiner hoffentlich zahlreichen Enkelkinder verbringen würde. Doch davon war er jetzt weiter entfernt, als die Erde vom Mond.
Wenn er es recht bedachte, dann hat es angefangen, nachdem Andrea von ihrem letzten Auslandseinsatz zurückgekommen war. Seit drei Jahren war sie immer wieder, im Auftrag des Vereins ›Ärzte ohne Grenzen‹, an die Brennpunkte dieser Welt geflogen, dorthin, wo Not und Elend herrschten, Seuchen und Kriege. Nach ihrem letzten Einsatz war seine Tochter ganz anders gewesen, nachdenklicher und in sich gekehrt.
»Weißt du, was mit Andrea los ist?«
Torben hatte ihn erst darauf gebracht, dass sie sich verändert hatte, dem Vater war es zunächst gar nicht aufgefallen.
»Was ist geschehen?«, fragte der Arzt seine Tochter, als sie eines Abends im Wohnzimmer vor dem Kaminfeuer saßen und sich bei einem Glas Rotwein unterhielten.
Andrea, die einen Schluck getrunken hatte, setzte das Glas ab und schaute ihren Vater an. »Ich weiß nicht genau«, antwortete sie, nach einer sehr langen Zeit des Überlegens. »Aber ich frage mich, ob das alles so richtig ist, was ich mache.«
Der Arzt schaute sie mit großen Augen an.
»Stellst du etwa deinen Beruf in Zweifel?«, fragte er, beinahe fassungslos.
Sie schüttelte den Kopf. »Nicht den Beruf an sich, aber die Art, in der wir ihn ausüben. Diese ganze Chemie, die wir in die Leute hineinpumpen, diese Apparatemedizin – ich frage mich wirklich, ob das alles so richtig ist.«
Johann Sander hob die Hände und ließ sie in beschwichtigender Geste wieder sinken.
»Was soll daran verkehrt sein?«, stellte er eine Gegenfrage. »Wir retten Menschenleben, und ohne das alles, ohne Chemie und die Apparate, wäre die Erfolgsquote längst nicht so hoch, wie sie seit Jahrzehnten ist.«
Andrea starrte in das Kaminfeuer und ihr war, als sehe sie in den Flammen noch einmal all das, was sie gerade erlebt hatte.
Der Einsatz für die ›Ärzte ohne Grenzen‹ hatte sie in ein westafrikanisches Land geführt, in dem vor fünf Jahren ein Bürgerkrieg ausgebrochen war, nachdem das Militär geputscht und die Macht an sich gerissen hatte. Inzwischen bekämpften und unterdrückten dort nicht nur die Truppen des Machthabers die Bewohner des Landes, eine extrem lange Dürreperiode hatte zudem auch noch zu Ernteausfällen und Hungersnot geführt.
Andrea arbeitete, zusammen mit sechs anderen Ärzten, unter den schwierigsten Bedingungen. Zwar hatten sie einige Hilfsgüter mitgebracht, doch die waren im Nu verteilt und aufgebraucht, genauso wie die Medikamente und das Verbandsmaterial.
»Wenn das so weitergeht, können wir in drei Tagen einpacken und nach Hause fliegen«, hatte ein Kollege geklagt und Andrea den leeren Karton gezeigt, in dem sich Einwegspritze befunden hatten.
Die junge Ärztin war verzweifelt. Wie sollte es weitergehen? Wie sollten sie den Menschen hier helfen, wenn sämtliche Hilferufe, die sie in die Heimat schickten, unbeantwortet blieben?
Das Einzige, worauf sie noch zurückgreifen konnten, war eine Anzahl homöopathischer Mittel. Sie hatten gar keine andere Wahl, als sie einzusetzen, auch wenn die meisten Kollegen der Homöopathie eher skeptisch gegenüberstanden.
War es Zufall oder Schicksal?
Tatsächlich gelang es ihnen, Schmerzen zu lindern, Krankheiten zu heilen. Eines Tages erschien dann ein alter, gebeugter Mann in der Station. Er schleppte einen Jutesack über der Schulter, den er absetzte und Andrea, die gerade Dienst hatte, bedeutete, sie solle sich den Inhalt ansehen.
Ein junger Eingeborener, der als Dolmetscher für die Ärzte arbeitete, übersetzte. Bei dem Alten handelte es sich offenbar um einen Medizinmann, der in seinem Dorf von den Weißen gehört hatte, die hier Menschen behandelten und seit neuestem keine Spritzen und Tabletten mehr verabreichten, sondern kleine Kügelchen, die wahre Wunder zu vollbringen schienen. In dem Sack befanden sich schwarz-braune Blätter, denen ein intensiver Geruch entströmte. Daraus sollten die Ärzte Tee kochen und den Patienten zu trinken geben, verlangte der Medizinmann.
Andrea, die eher zu den Skeptikern gehört hatte, war schon von der Wirkung der homöopathischen Mittel überrascht gewesen, jetzt aber wurde sie noch mehr in Erstaunen versetzt, als sie erkennen musste, dass der Tee den Menschen tatsächlich helfen konnte.
Heiß getrunken linderte er Schmerzen, kalt, indem man ein Stück Stoff damit tränkte und als Kompresse auflegte, beschleunigte der Tee tatsächlich den Heilungsprozess bei äußeren Verletzungen.
Kaum in Deutschland zurück, besorgte sich die junge Ärztin unzählige Bücher und Zeitschriften, die sich allesamt mit Homöopathie und andere Naturheilverfahren beschäftigten, die sie ausgiebig studierte.
»Ich habe übrigens das Mittel bei Yannick abgesetzt.«
Andrea schaute ihren Vater an, der erwiderte ihren Blick und wirkte irgendwie irritiert.
»Redest du von Yannick Johannsen?«
Sie nickte. Der neunjährige Sohn einer einflussreichen Bankiersfamilie, war vor zwei Tagen mit einem Blinddarmdurchbruch in die Privatklinik eingewiesen worden. Sonntag hatte er schon über Bauchweh geklagt, und erst als der Bub sich weigerte sein Bett zu verlassen, und ihm dicke Schweißperlen auf der Stirn standen, hatte die Mutter den Notarzt alarmiert.
Johann Sander sprang auf, sein Blick fixierte die Tochter. »Du hast was?«, fragte er, mit einem scharfen Unterton. »Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Der Junge schwebt zwischen Leben und Tod! Und du setzt das Medikament ab?«
Der Arzt wandte sich um und stürmte aus dem Wohnzimmer. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, hastete er die Treppe hinauf, in den ersten Stock, in dem die Patientenzimmer untergebracht waren. Auf den Aufzug wollte er nicht warten.
Mit zitternden Händen trat Johann Sander an das Bett und schaute auf die Anzeigen der Überwachungsgeräte. Blutdruck, Kreislauf, Sauerstoffsättigung alles schien normal. Dabei hatte es gar nicht so ausgesehen, als hätte das Kind noch eine Überlebenschance gehabt. Die Bauchhöhle war voller Eiter gewesen, und Yannick stand am Rand einer Blutvergiftung. Nur durch den Einsatz eines starken Antibiotikums war er noch zu retten gewesen.
»Am besten wir erhöhen die Dosis«, hatte der Arzt zu seiner Tochter gesagt, als sie während der Visite über den Zustand des kleinen Patienten sprachen.
Mindestens eine Woche würde er wohl noch das Antibiotikum bekommen müssen, ehe man davon ausgehen konnte, dass Yannick Johannsen außer Lebensgefahr war.
»Wie du siehst, geht es ihm gut.« Von ihrem Vater unbemerkt, war Andrea in das Zimmer gekommen und stellte sich neben ihn.
Er blickte sie böse an. »Wie kommst du dazu, dich über meine Anweisungen hinwegzusetzen?«, wollte er wissen.
Er konnte es immer noch nicht fassen. Nie zuvor war es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und seiner Tochter gekommen, immer waren sie einer Meinung gewesen, was die Behandlungsmethoden betraf.
Die junge Ärztin schüttelte unwillig den Kopf. »Sieh doch endlich ein, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu beschreiten«, verlangte sie. »Was ich in Afrika erlebt habe, hat mir gezeigt, dass es nicht immer richtig ist, den Empfehlungen der Pharmaindustrie zu folgen. Vater, du weißt doch selbst um die Nebenwirkungen dieser ganzen Mittel.«
Hatte Andrea gehofft, ihr Vater würde ein Einsehen haben, so sah sie sich getäuscht.
Die Diskussion wurde auch noch fortgesetzt, als Torben Jansen sich zu ihnen gesellte und in dasselbe Horn stieß, wie sein zukünftiger Schwiegervater.
Wie Doktor Sander, sparte auch er nicht mit Vorwürfen, und der Abend, der eigentlich harmonisch begonnen hatte, endete in einem Fiasko.
»Du hast selbst gesagt, dass die Chance für Yannick zu überleben, mehr als gering ist«, warf Andrea ihrem Vater vor. »Das Zeug, das du ihm verordnet hast, würde ihn endgültig umbringen!« Mit diesen Worten lief sie hinaus und knallte die Tür hinter sich zu.
Seit diesem Abend war Andrea Sander verschwunden, und alle Versuche, sie zu finden oder sie auf ihrem Mobiltelefon zu erreichen, blieben erfolglos.
Schwer atmend wandte sich der Arzt vom Fenster ab und verließ das Sprechzimmer. Im Nachhinein musste er seiner Tochter recht geben, ihre Behandlung hatte Erfolg gehabt, und in ein paar Tagen konnte Yannick Johannsen nach Hause entlassen werden. Dennoch war der Arzt nicht so rasch bereit, Andrea zu vergeben. Ihr Vorwurf, er habe mit seiner Behandlung das Leben des Jungen aufs Spiel gesetzt, wog einfach zu schwer.
*
»Nanu, den Wagen kenn ich doch.« Max schaute seinen Bruder verwundert an. »Ich hab dir doch von den Burschen mit ihren Motorrädern erzählt. In dem Auto vor uns sitzt die Frau Bergierè.«
Sebastian blickte interessiert nach vorne. »Aha, und was will die wohl auf der Jenneralm?«
Der Polizist zuckte die Schultern. »Vermutlich fährt sie zu einer der Almhütten …«
»Kann ich mir net vorstellen, die Besitzer sind doch alle die Woche über gar net hier, und du hast erzählt, dass die Frau hier im Urlaub ist. Keiner von denen, die auf der Alm eine Hütte haben, vermietet diese an Urlauber.«
»Vielleicht eine Bekannte von Maria und Richard?«
»Glaub ich net, dann hätten sie uns net gebeten, nach dem Rechten zu schauen, und ganz sicher würd Maria es mir gesagt haben, wenn sie einen Gast hätten. Hast die Frau Bergierè denn net gefragt, wo sie hier wohnt?«
»Nein, das erschien mir net so wichtig, ehe ein Strafverfahren gegen die Rowdys eingeleitet ist, wird sie ohnehin längst wieder abgereist sein. Nur ihre Heimatadresse hab ich aufgeschrieben.«
Sebastian und sein Bruder waren, auf Bitte von Maria Devei, auf dem Weg zur Hütte, die der Sängerin gehörte. Hin und wieder kontrollierte Max ohnehin hier oben, weil die Häuser schon einige Male aufgebrochen worden waren.
»Jetzt kann sie aber net mehr viel weiter«, deutete der Bruder des Bergpfarrers auf den roten Sportwagen vor ihnen. »Gleich kommt Marias Haus, und dann steht da oben nur noch die Brandner-Hütte.«
»Hm, da wird sie wohl kaum hinwollen«, überlegte der Bergpfarrer laut. »Da kann ja niemand drin wohnen.«
Sollte die Frau doch eine Bekannte der Sängerin sein? Aber warum hatte Maria dann nichts gesagt?
Das rote Auto fuhr an dem Geburtshaus Marias vorbei und weiter den Weg hinauf, der allmählich von einer befestigten Straße in eine Holperpiste überging.
»Vielleicht hat sie sich verfahren«, vermutete Sebastian. »Folge ihr, vielleicht braucht sie Hilfe.«
Die beiden Brüder staunten nicht schlecht, als das Auto vor ihnen, wenig später, tatsächlich an der alten Hütte hielt, in der seit einer Ewigkeit niemand mehr wohnte.
Isabell Bergierè stieg aus und ignorierte den Wagen, der hinter ihrem hielt. Eine ganze Weile schon hatte sie bemerkt, dass ihr jemand folgte, und sich innerlich gewappnet und auf Verteidigung eingestellt.
Leider stand die Sonne so, dass ihr Licht auf die Windschutzscheibe fiel, und sie das Gesicht des Fahrers nicht erkennen konnte.
Sie stieß erleichtert die Luft aus, als sie sah, wer da auf der Fahrerseite ausstieg. »Herr Polizeihauptkommissar«, sagte sie, »wollen Sie zu mir? Mit dem Zivilfahrzeug habe ich Sie gar nicht erkannt.«
»Herr Trenker reicht«, lächelte Max. »Wie Sie ja ganz richtig bemerkt haben, bin ich net im Dienst.« Er deutete auf den Geistlichen, der ebenfalls ausgestiegen war. »Darf ich Ihnen meinen Bruder vorstellen? Pfarrer Trenker, von der Kirchengemeinde St. Johann.«
Isabell gelang es, ihr Erstaunen zu verbergen, doch sie mochte kaum glauben, dass dieser ungemein attraktive Mann, braungebrannt und sportlich, ein Diener Gottes sein sollte – zudem trug er auch keine Soutane.
Sebastian reichte ihr lächelnd die Hand.
»Das ist Frau Bergierè, von der ich dir erzählt habe«, stellte Max sie vor.
»Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Hochwürden.«
»Ganz meinerseits«, entgegnete der Bergpfarrer und schaute sie fragend an. »Aber sagen Sie, was um alles in der Welt machen S’ hier oben? Haben S’ sich verfahren?«
Insgeheim musste Sebastian seinem Bruder recht geben, als Max beim Mittagessen von dem Vorfall mit den Motorradfahrern erzählte, hatte er regelrecht von der jungen Frau geschwärmt, die auf ihn wie Adlige gewirkt habe, und irgendwie unnahbar und stolz. Isabell Bergierè war wirklich eine ausnehmend schöne Frau.
Sie lachte und schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe mich nicht verfahren«, antwortete sie. »Die Hütte dort ist mein Ziel, ich habe sie gemietet.«
»Sie wohnen darin?«
Sebastian und Max mochten es kaum glauben. Hier im Wachnertal gab es mit Sicherheit komfortablere Unterkünfte, die man auch für einen längeren Aufenthalt mieten konnte, als ausgerechnet die marode Hütte des Brandner-Bauern.
»Ich stelle keine großen Ansprüchen«, erklärte Isabell, die ganz offenbar die Fassungslosigkeit der beiden Männer erkannt hatte. »Ein Dach überm Kopf, ein Schlafsack, das reicht mir schon.«
Kaum zu glauben, bei der Eleganz, die sie ausstrahlte. Auch wenn Isabell Bergierè Jeans und T-Shirt trug, so strahlte sie doch eine natürliche Vornehmheit aus, die nicht aufgesetzt wirkte.
»Dann brauchen wir unsre Hilfe ja gar net anbieten«, lächelte der gute Hirte von St. Johann. »Wie’s scheint, kommen S’ ganz gut allein zurecht.«
»Trotzdem vielen Dank«, erwiderte sie und lächelte ihrerseits charmant.
Sebastian und Max verabschiedeten sich.
»Wenn S’ dennoch mal einen Rat und Hilfe brauchen«, sagte der Geistliche, bevor er einstieg, »können S’ sich jederzeit an mich wenden. Die Kirche, drunten im Dorf, ist net zu überseh’n, und gleich daneben steht das Pfarrhaus.«
Isabell blickte dem davon fahrenden Wagen hinterher und hob grüßend die Hand.
›Ein bemerkenswerter Mann, dieser Pfarrer Trenker‹, überlegte sie und hoffte gleichzeitig, dass sie seine Hilfe nicht in Anspruch nehmen musste. Aber das Gotteshaus würde sie sich schon einmal ansehen wollen.
Nur nicht in den nächsten Tagen. Sie war ohnehin schon viel zu oft im Dorf gewesen und konnte nur hoffen, dass niemand, der sie kannte, sie gesehen habe…
*
Marion Keppler verstand die Welt nicht mehr. Seit sie in der Bergklinik gewesen waren, verhielt sich Matthias irgendwie seltsam. Beim Frühstück bekam er kaum den Mund auf, und auf Marions Vorschläge für gemeinsame Unternehmungen reagierte er ablehnend.
Er müsse arbeiten, schließlich sei er nicht zu seinem Privatvergnügen hier!
Dabei hatte er vor ein paar Tagen noch gesagt, er sei mit den Vermessungen fertig und könne noch ein wenig Urlaub machen.
Was sollte sie nun glauben?
Die Krankenschwester war alleine in den Biergarten gegangen. Als sie an seine Zimmertür geklopft hatte, hatte Matthias nicht reagiert. Vielleicht war er aber auch gar nicht daheim gewesen.
Marion Keppler hatte sich einen gemischten Salat bestellt, stocherte aber nur mit ihrer Gabel darin herum.
»Schmeckt’s net?«
Sie schaute auf und blickte in das Gesicht von Martin Gundlach. Lachend schob sich der Krankenpfleger neben sie auf die Bank.
»Und? Die Bewerbung schon abgegeben?«, wollte er wissen.
Marion nickte. »Ja, gleich am nächsten Tag, und mit meiner Urlaubsanschrift hier. Ich dachte, ich sollte keine Zeit verlieren.«
»Das ist richtig«, stimmte er ihr zu, »die Jobs bei uns sind heiß begehrt.« Er beugte seinen Kopf zu ihr. »Übrigens, ich hab den Zettel mit den Stellenangeboten vorsichtshalber aus dem Glaskasten entfernt…«, raunte er augenzwinkernd.
Sie lachte hell auf. »Na, du bist mir vielleicht einer. Was, wenn ich die Stelle gar net bekomme?«
Martin zuckte die Schultern. »Warum solltest du net? Ich bin sicher, dass du über kurz oder lang bei uns auf der ›Nonnenhöhe‹ arbeiten wirst«, meinte er zuversichtlich.
Marion bemerkte, dass ihr Appetit zurückgekehrt war, und begann zu essen.
Der Krankenpfleger bestellte sich ein Radler und schaute ihr zu. »Ach, morgen ist hier im ›Löwen‹ Tanzabend…«, sagte er.
»Ich weiß.«
»Und hast du schon jemanden, mit dem du hingehst?«
Die Münchnerin dachte einen Moment nach, dann schüttelte sie den Kopf.
Vermutlich würde Matthias nicht mit ihr hingehen wollen.
»Prima«, grinste er, »dann geh’n wir zusammen.« Er sagte es so bestimmt, als wäre es die selbstverständlichste Sache von der Welt.
Verblüfft schaute sie ihn an und musste feststellen, dass Martin Gundlach ein ziemlich fescher Bursche war.
Die kleinen Fältchen um seine blauen Augen zeugten davon, dass er oft und gerne lachte. Auch jetzt strahlte er über das ganze Gesicht, als er ihren Blick erwiderte.
»Wo wohnst du denn eigentlich?«, erkundigte er sich. »Soll ich dich irgendwo abholen, oder treffen wir uns hier?«
Auch wenn sie noch gar nicht zugesagt hatte, dass sie zusammen mit ihm auf das Tanzvergnügen gehen würde, schien es für ihn festzustehen. Noch einmal dachte sie kurz an Matthias Marner.
»Ich wohne in der Pension Stubler«, antwortete Marion schließlich, »aber wir können uns auch hier, am Eingang, treffen.«
Martin leerte sein Glas. »Ich würd’ ja gern noch bleiben«, sagte er und schaute sie dabei mit intensivem Blick an, »aber leider…«
»Musst du noch zum Dienst?«
Er nickte. »Ja, ich habe mit einem Kollegen getauscht und seine Nachtschicht übernommen. Das kommt immer wieder mal bei uns vor, aber wir helfen uns gern untereinander. Wie gesagt, bei uns herrscht ein erstklassiges Betriebsklima.« Wie selbstverständlich legte er seinen Arm um sie und zog Marion an sich. »Also dann, bis morgen Abend«, sagte er und drückte sie kurz. »Zwanzig Uhr am Eingang zum Saal, ich besorge die Karten.«
Lächelnd winkte sie ihm hinterher, als er durch den Ausgang des Biergartens auf die Straße hinaus trat.
Dass sie von der anderen Seite aus beobachtet wurde, ahnte Marion Keppler nicht.
Matthias Marner hatte sich in den letzten Tagen bewusst von ihr zurückgezogen. Der Vermessungsingenieur war nicht nur gekränkt, weil die Frau, die er liebte, und mit der er sich eine gemeinsame Zukunft erhoffte, nicht auf seinen Vorschlag reagiert hatte, sich in Frankfurt nach einer neuen Arbeitsstelle umzusehen. Noch viel mehr hatte es ihn getroffen, dass Marion offenbar überhaupt keinen Gedanken daran verschwendete, mit ihm zu gehen. Stattdessen war sie ganz begeistert gewesen, als sie das Stellenangebot in der Bergklinik ›Nonnenhöhe‹ gelesen hatte. Und dann auch noch der neue Kollege!
Wieso war sie so sicher, die Stelle auch zu bekommen? Kannte sie dem Bursche womöglich schon länger, und hatte er versprochen, für sie ein gutes Wort einzulegen?
Schmollend hatte er die letzten Tage größtenteils in seinem Zimmer, in der Pension, zugebracht und war kaum ausgegangen.
Aber vielleicht bestrafte er sich damit ja nur selbst, hatte Matthias schließlich überlegt, und sich am Abend dazu entschlossen, Marion in den Biergarten zu folgen. Dass sie dorthin gehen würde, war so gut wie sicher, dennoch hatte er vorsichtshalber erst in der Pizzeria ›Fontana‹ nach ihr gesucht. Als er sie dort nicht fand, war er zum Hotel weitergegangen.
Doch jetzt bereute er seinen Entschluss!
Wie fast immer, wenn sie hergekommen waren, war der Biergarten bis auf den letzten Platz gefüllt. Matthias bewunderte die Haustöchter immer wieder, denen es dennoch gelang, neuen Gästen doch noch einen Sitzplatz zu verschaffen. In dem Gewimmel hatte er Marion zunächst gar nicht gesehen. Erst, als am übernächsten Tisch gleich eine ganze Gruppe aufstand und das Gartenlokal verließ, hatte er einen freien Blick, und sah sie auf der anderen Seite sitzen.
Allerdings nicht alleine!
Den Burschen, der dabei ihr saß und sie so anlächelte, als wären sie ein Paar, erkannte Matthias sofort wieder. Es war der Krankenpfleger, von dem Marion gesagt hatte, er sei ihr neuer Kollege.
Martins Verdacht, die beiden würden sie schon länger kennen, bekam neue Nahrung, als er sah, wie vertraut sie miteinander umgingen. Sie redeten und lachten, und es sah ganz und gar nicht danach aus, als würden sie sich erst ein paar Tage kennen. Der Vermessungsingenieur glaubte, sein Herzschlag setze aus, als er sah, wie der Mann seinen Arm um Marion legte und sie an sich zog.
Und dann winkte sie ihm auch noch lächelnd hinterher…
*
»Jetzt sag mir bloß mal, was mit dem Bub los ist.« Katharina Brandner schaute ihren Mann fragend an. »Seit Tagen läuft er umeinand, wie ein Huhn ohne Kopf, aber wenn man ihn fragt, bekommt man keine Antwort«, setzte sie hinzu.
Xaver zuckte die Schultern. »Keine Ahnung, vielleicht hat’s was mit der Frau zu tun.«
»Die die Hütte gemietet hat?« Die Bäuerin schüttelte den Kopf. »Von der soll er bloß die Finger lassen«, sagte sie. »Wer weiß, was mit der los ist. Irgendwas stimmt doch mit ihr net…« Sie verstummte rasch, als ihr Sohn die Küche betrat. Staunend stellte sie fest, dass Thomas sich bereits umgezogen hatte. »Willst’ fort?«, fragte sie.
»Keine Sorge«, entgegnete er, »zum Melken bin ich wieder da.«
»Was hast’ denn vor? Wo willst’ denn hin?«, wollte sie wissen.
Thomas Brandner antwortete nicht. Er ging an den Kühlschrank, nahm eine Flasche Mineralwasser heraus und stapfte nach draußen.
Wenig später hörten sie seinen Wagen vom Hof fahren.
Seit seinem missglückten Besuch bei Isabell Bergierè, konnte der Bauernsohn an nichts anderes mehr denken, als an diese wunderschöne Frau, die ganz alleine in der Hütte hauste. Seit Tagen überlegte er, wie er es anstellen konnte, ihre nähere Bekanntschaft zu machen. Auch wenn er sich eine Abfuhr geholt hatte, so rasch wollte er nicht aufgeben.
Nach dem Mittagessen hatte der junge Bursche kurzerhand seinen Werkzeugkasten und einige Utensilien, die unter Umständen nützlich waren, in den Kofferraum seines Autos gestellt und wollte zur Jenner-Alm fahren.





























