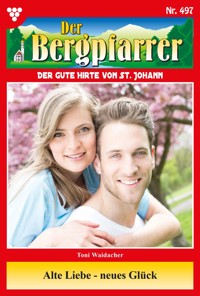30,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Bergpfarrer Staffel
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mit dem Bergpfarrer hat der bekannte Heimatromanautor Toni Waidacher einen wahrhaft unverwechselbaren Charakter geschaffen. Die Romanserie läuft seit über 13 Jahren, hat sich in ihren Themen stets weiterentwickelt und ist interessant für Jung und Alt! Toni Waidacher versteht es meisterhaft, die Welt um seinen Bergpfarrer herum lebendig, eben lebenswirklich zu gestalten. Er vermittelt heimatliche Gefühle, Sinn, Orientierung, Bodenständigkeit. Zugleich ist er ein Genie der Vielseitigkeit, wovon seine bereits weit über 400 Romane zeugen. Diese Serie enthält alles, was die Leserinnen und Leser von Heimatromanen interessiert. E-Book 61: Weil ich zu dir gehör'! E-Book 62: Nur durch deine Liebe E-Book 63: Ewiger Streit im Wachnertal E-Book 64: Der Mann ihres Herzens E-Book 65: Wen das Schicksal straft E-Book 66: Das Schicksal reist immer mit E-Book 67: Sie war nur eine Magd E-Book 68: Ein Madl aus dem Wachnertal E-Book 69: Die geborgte Braut E-Book 70: Der lange Weg E-Book 1: Weil ich zu dir gehör'! E-Book 2: Weil ich zu dir gehör'! E-Book 3: Nur durch deine Liebe E-Book 4: Nur durch deine Liebe E-Book 5: Ewiger Streit im Wachnertal E-Book 6: Ewiger Streit im Wachnertal E-Book 7: Der Mann ihres Herzens E-Book 8: Der Mann ihres Herzens E-Book 9: Wen das Schicksal straft E-Book 10: Wen das Schicksal straft E-Book 11: Das Schicksal reist immer mit E-Book 12: Das Schicksal reist immer mit E-Book 13: Sie war nur eine Magd E-Book 14: Sie war nur eine Magd E-Book 15: Ein Madl aus dem Wachnertal E-Book 16: Ein Madl aus dem Wachnertal E-Book 17: Die geborgte Braut E-Book 18: Die geborgte Braut E-Book 19: Der lange Weg E-Book 20: Der lange Weg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1128
Ähnliche
Inhalt
Weil ich zu dir gehör’!
Nur durch deine Liebe
Ewiger Streit im Wachnertal
Der Mann ihres Herzens
Wen das Schicksal straft
Das Schicksal reist immer mit
Sie war nur eine Magd
Ein Madl aus dem Wachnertal
Die geborgte Braut
Der lange Weg
Der Bergpfarrer – Staffel 7 –
E-Book 61-70
Toni Waidacher
Weil ich zu dir gehör’!
Spät hat er es erkannt…
Roman von Toni Waidacher
»Grüß dich, Christel.«
Die junge Bäuerin sah von der Arbeit auf. Ein Lächeln glitt über ihre Lippen, als sie den Besucher erkannte.
»Grüß Gott, Hochwürden, schön, daß Sie uns mal besuchen.«
Christel Enzinger saß vor dem Bauernhaus und putzte Gemüse. Auf dem Tisch vor ihr standen mehrere Schüsseln mit Erbsen, Bohnen und Möhren. Sie deutete auf einen Stuhl.
»Setzten S’ sich doch. Möchten S’ eine Tasse Kaffee? Ich glaub’, ein Stückl Kuchen ist auch noch da.«
Sebastian Trenker nickte dankend und nahm Platz.
»Das ist sehr freundlich von dir, Christel«, bedankte er sich und schnallte den Rucksack ab.
Die Bäuerin drehte sich um und rief ins offene Küchenfenster: »Geh’, Resl, sei so gut und bring’ dem Herrn Pfarrer einen Kaffee heraus. Und schneid’ ein großes Stückerl von dem Kuchen ab.«
»Mach ich«, rief eine Frauenstimme von innen.
Kurze Zeit später trat die alte Magd aus der Tür.
»Grüß dich, Resl, wie gehts denn so?« erkundigte sich der Geistliche.
»Ach, Hochwürden, was soll ich sagen?« erwiderte Therese Gramser. »Auf meine alten Tag’ kann ich nur froh sein, daß ich noch jeden Morgen aus dem Bett komm’. Na ja, ab und an kommt das Gliederreißen zurück, ansonsten will ich net klagen.«
Sie hatte Kaffee und Kuchen vor Sebastian abgestellt und verschwand wieder im Haus. Der gute Hirte von St. Johann biß in das Kuchenstück.
»Hm, sehr lecker«, lobte er.
Christel hatte die letzte Möhre geschabt und in Würfel geschnitten. Sie schüttete die Gemüsestücke in ein Sieb, um sie später noch einmal gründlich durchzuwaschen.
»Ja, backen kann sie, die Resl«, sagte die Bäuerin. »Da macht ihr so leicht keiner was vor.«
Sie senkte die Stimme.
»Aber ansonsten ist sie net mehr viel zu gebrauchen. Es tut mir leid, daß ich das sagen muß, aber eine rechte Hilfe ist sie net.«
Sebastian Trenker nickte verstehend, er kannte das arbeitsreiche Leben auf den Höfen, und trank einen Schluck Kaffee.
Jemand, der ihn nicht kannte, hätte in ihm niemals einen Got-tesmann vermutet. Der Bergpfarrer, wie er wegen seiner Leidenschaft für die Berge, des Wanderns und Kletterns genannt wurde, trug wetterfeste Kleidung. Mit dem markanten Gesicht, das vom vielen Aufenthalt im Freien stets leicht gebräunt war, und seiner schlanken sportlichen Gestalt entsprach so gar nicht dem Bild, das die Leute gemeinhin von einem Landpfarrer hatten.
Aber Sebastian war mit Leib und Seele Geistlicher. Er liebte die Menschen und es war ihm immer ein Bedürfnis, da zu sein, wenn ihm ein Menschenschicksal begegnete, das nach Hilfe rief. Für seine Schäfchen war er Tag und Nacht zu sprechen, und sie dankten es ihm mit Respekt, Liebe und Vertrauen.
Der Besuch auf dem Enzingerhof war kein Zufall. Pfarrer Trenker hatte ihn bereits am Abend zuvor eingeplant, als er seine Tour festlegte, die er am frühen Morgen gegangen war. Bis auf die Streusachhütte hinauf war er gewandert, hatte ein paar schöne Stunden mit dem jungen Sennerpaar verbracht, das die Hütte vor nicht langer Zeit übernommen hatte, und war dann zielstrebig zum Enzingerhof weitergegangen.
»Daß die Resl net mehr springen kann, wie ein junges Reh, liegt halt am Alter«, sagte er. »Ich weiß, daß sie dir mehr Last, als Hilfe ist. Um so mehr weiß ich zu schätzen, daß du sie immer noch behältst und net in ein Heim abschiebst.«
Die Bäuerin schüttelte den Kopf.
»Das würd mir auch niemals einfallen«, beteuerte sie. »Dann hätt ich ja, außer dem Leopold, bald niemanden mehr.«
Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Seitdem der Wolfgang net mehr ist, weiß ich sowieso net, wie’s noch weitergeh’n soll.«
Sebastian konnte sie gut verstehen. Er hatte das Drama um den Enzingerbauern, der beim Holzfällen im Bergwald tödlich verunglückte, ja selbst miterlebt.
»Bekommst denn keine Hilfe von deiner Familie?« erkundigte er sich.
Christel verzog die Lippen.
»Meine Familie? Die hat mir nie verzieh’n, daß ich den Wolfgang geheiratet hab«, erwiderte sie.
Sie holte tief Luft.
»Wenn uns doch nur vergönnt’ gewesen wär’, Kinder zu haben! Wolfgang hatte sich so sehr einen Buben gewünscht, obwohl mir ein Madl auch recht gewesen wär’. Aber es hat net sein soll’n…«
Die junge Witwe sprach noch lange über ihre Lage. Da war die Hypothek, die ihr Mann hatte aufnehmen müssen, um das Dach des Bauernhauses neu zu decken, und eine neue Scheune zu bauen, nachdem die alte immer hinfälliger geworden war.
Diese Last drückte nun auf ihren Schultern. Hinzu kam, daß die Ernte im letzten Jahr schlechter ausgefallen war, als erhofft. Was aber auch daher rührte, daß Leopold Huber, der alte Knecht, der allmählich auf die Siebzig zuschritt, auch nicht mehr so viel arbeiten konnte, wie er gerne wollte. Christl selbst tat ihr Bestes, aber es war einfach nicht zu schaffen. Felder mußten liegenblieben, und dann sanken die Holzpreise durch Billigimporte aus Osteuropa. Es war ein einziges Dilemma, aus dem es keinen Ausweg zu geben schien.
»Und Aussicht, einen jüngeren Knecht einzustellen, hast auch net?«
Die Bäuerin schüttelte den Kopf.
»Es gibt ja keine mehr«, antwortete sie. »Die Saison hat angefangen. Wer jetzt noch ohne Arbeit ist, will auch gar keine.«
Sie seufzte ermüdet auf.
»Ach, manchmal möcht’ ich alles hinwerfen und mich irgendwo verkriechen«, sagte Christel leise. »Am liebsten würd’ ich den Hof verkaufen und irgendwo ein neues Leben anfangen…«
Auf dem Weg, hinunter nach St. Johann, grübelte Sebastian noch lange darüber nach, wie man der jungen Witwe helfen konnte.
Ein neuer Knecht, jung und kräftig. So einer konnte die Rettung für Christel Enzinger sein. und wenn sie sich sympathisch waren…
Warum net? Die Bäuerin war erst Mitte Zwanzig und attraktiv. Das ganze Leben lag noch vor ihr.
Sebastian spann den Gedanken nicht weiter aus. So weit war es noch lange nicht. Erst einmal mußte tatkräftige Hilfe her, sonst überlegte sie es sich womöglich ernsthaft, den Hof zu verkaufen und fortzugehen.
Vielleicht, überlegte der Geistliche, hilft’s, wenn ich mit ihrer Familie red’. Sie muß doch ein Einsehen haben, daß man unter diesen Umständen alte Streitigkeiten beilegen, und sich gegenseitig helfen mußte.
Allerdings wußte er auch, daß das kein leichtes Unterfangen war. Christels Eltern waren nicht einmal zur Beerdigung ihres Schwiegersohnes erschienen…
*
Markus Bruckner stand am Fenster seines Büros und schaute hinaus. Unzählige Touristen spazierten unten am Rathaus vorbei. Touristen, die Geld nach St. Johann brachten, das auch in das Säckl der Gemeinde floß. Wenn es jedoch nach dem Bürgermeister des kleines Alpendorfes gegangen wäre, dann hätten es ruhig ein paar Tausender mehr im Jahr sein dürfen.
Allerdings – der Bruckner-Markus machte sich da gar keine Illusionen –, die meisten Leute fuhren in die bekannteren Urlaubsorte Bayerns, wo sie auch besondere Attraktionen fanden. Ein großes Schwimmbad zum Beispiel oder eine Diskothek.
Aber hier?
Hier war die einzige Attraktion der samstägliche Tanzabend im Löwen. Gewiß – ein beliebter Treff, auch für auswärtige Gäste. Aber Leute, die Geld hatten und auch bereit waren, es auszugeben, die fuhren lieber nach Garmisch oder Mittenwald.
Markus dachte an den Besuch des Bauunternehmers vor ein paar Wochen. Josef Ramsauer, ein gewiefter Geschäftsmann, hatte von ihm die Genehmigung für eine Straße haben wollen, die vom Hochberghof durch den Ainringer Wald führen sollte. Als Verbindung zur Bundesstraße und von dort aus weiter an die Autobahn.
Hintergrund der Geschichte war, daß der Ramsauer ein Gespräch zwischen Pfarrer Trenker und dem Erben des Berghofes mit angehört hatte. Dabei war zur Sprache gekommen, daß der junge Mann den Hof so schnell wie möglich wieder verkaufen wolle.
Das hatte das Interesse des Bauunternehmers geweckt, dem es wirtschaftlich nicht gerade rosig ging. Trotzdem hatte er Felix Thorwald eine bedeutende Summe als Kaufpreis genannt, mit der Absicht, aus dem Berghof ein Tagungshotel zu machen, in dem Firmen aus ganz Europa ihre Schulungen abhalten sollten.
Ein schöner Plan, der doch scheiterte. Woran Pfarrer Trenker nicht ganz unschuldig war. Der Bau dieses Hotels hätte dem Ramsauer wirtschaftlich wieder auf die Beine helfen können – Geldgeber hatte er schon für diese Projekte –, und St. Johann hätte eine neue, nicht unbedeutende Steuereinnahmequelle gehabt. Allerdings hätte es auch bedeutet, daß bestimmte Auflagen der Umweltschutzbehörde seitens der Gemeinde hätten umgangen werden müssen.
Und da verstand Hochwürden überhaupt keinen Spaß! Die Bürotür wurde geöffnet, und Markus’ Sekretärin führte den Besucher hinein.
»Na endlich«, begrüßte der Bürgermeister den Bauunternehmer, nachdem sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte.
Josef Ramsauer ließ sich schweratmend auf den Stuhl vor dem Schreibtisch sinken.
»Was gibts denn so Dringendes?« fragte er und kramte in der Jackentasche nach seinem Zigarettenetui.
Markus Bruckner setzte sich in seinen Sessel. Er stellte die Ellenbogen auf den Tisch und faltete die Hände.
»Vielleicht ist die Sache mit einem Tagungshotel doch noch net aus der Welt«, begann er das Gespräch.
Sein Gegenüber hatte sich eine Zigarre angezündet und losgepafft. Als er den Bürgermeister so reden hörte, war er so überrascht, daß er sich an dem Rauch verschluckte. Er japste nach Luft und hustete, daß man glauben konnte, einen Grippekranken vor sich zu haben.
»Was red’st’ da?« sagte er, nachdem er sich von der Überraschung einigermaßen erholt hatte. »Steht der Hochberghof jetzt doch zum Verkauf?«
Der Bruckner-Markus schüttelte den Kopf. Nein, der Erbe, Felix Thorwald, war zwar nach Amerika zurückgekehrt, aber nur, um dort seine Zelte abzubrechen und alles für seine Rückkehr nach Deutschland in die Wege zu leiten. Unterdessen sorgte seine junge Braut dafür, daß es mit dem Hof wieder berg-auf ging. Unter der Leitung eines Verwalters sollte aus dem Hochberghof schon bald ein ökologisch arbeitendes Unternehmen werden.
»Der net«, schüttelte der Bürgermeister den Kopf. »Aber vielleicht ein and’rer…«
»Wirklich?«
Josef Ramsauer hatte sich unvermittelt aufgerichtet. Durch die heftige Bewegung war die Asche seiner Zigarre abgefallen und auf dem Schreibtisch gelandet. Der Bauunternehmer übersah die hochgezogene Augenbraue des Bürgermeisters, die dieses kleine Malheur kommentierte.
»Von welchem Hof ist denn die Rede?« wollte er wissen.
Markus hob die Hand.
»Gemach, gemach«, erwiderter er. »Erst einmal möcht’ ich wissen, ob du an so einer Sache überhaupt noch interessiert bist, und ob es immer noch Geldgeber gibt, die bereit sind, zu investieren.«
Bei dem Projekt »Hochberghof« war er nur in seiner Eigenschaft als Bürgermeister von Interesse für den Bauunternehmer gewesen, um die benötigte Genehmigung im Gemeinderat durchzudrücken. Jetzt aber lag der Fall anders. Eine Straße brauchte nicht gebaut zu werden, denn der Hof an den er dachte, lag nahe genug an der Kreisstraße. Wenn es jetzt aber wirklich umgesetzt werden sollte, und St. Johann ein Tagungshotel bekam, dann wollte er, Markus Bruckner, mehr daran beteiligt werden, als nur durch die Steuereinnahmen. Ein bißchen was mußte auch für die eigene Tasche drin sein.
Dabei wollte er ja keine Schmiergelder kassieren. Nein, nein, ganz legal sollte es ablaufen. Dem Bügermeister von St. Johann schwebte ein Posten im Aufsichtstrat einer noch zu gründenden Hotelgesellschaft vor.
»Darüber läßt sich reden«, kommentierte Josef Ramsauer die Ausführung des Bürgermeisters, untermauert von einem ungeduldigen Kopfnicken. »Aber jetzt erzähl erst einmal, welchen Hof du meinst. Vielleicht ist er ja net geeignet…«
Markus Bruckner setzte sich bequem in seinen Sessel zurück, er verschränkte die Arme vor der Brust und lächelte.
»Der ist geeignet, Sepp«, mit großem Grundstück drum herum. Da paßt sogar ein Schwimmbad für die Gäste drauf. Außerdem gehör’n Felder und ein Bergwald dazu. Wenn wir die verkaufen, haben wir gleich noch ein bissel mehr Grundkapital.«
Der Bauunternehmer starrte ihn an. Er ließ sich nicht anmerken, daß er längst Feuer gefangen hatte.
»Und?« fragte er, scheinbar gelangweilt. »Wie heißt jetzt der Hof?«
»Ich red’ vom Enzingerhof. Der Bauer ist vor ein paar Jahren tödlich verunglückt, und seine Witwe schleppt sich mit dem Hof mehr oder weniger dahin. Ich hab’ schon ein paarmal mit ihr geredet, und sie hat mir ihr Leid geklagt. In diesem Jahr kommt’s ihr besonders hart an. Die letzte Ernte war net besonders, und auf dem Hof lastet eine Hypothek, die die Bäuerin net zurückzahlen kann.«
Josef Ramsauer nickte.
»Versteh’«, meinte er. »Könnt ich mir den Hof mal anseh’n?«
Der Bürgermeister zuckte die Schultern.
»Freilich«, antwortete er.
»Aber wir wollen nix überstürzen. Erstmal wollt’ ich nur wissen, ob du mit von der Partie bist? Die Details klären wir später noch und einen Besuch auf dem Hof können wir… Wart mal.«
Er blätterte in seinem Terminkalender und nickte.
»Ja, übermorgen ginge es. Wenn’s dir paßt?«
*
Der junge Mann ging gemächlichen Schrittes die Landstraße entlang. Er trug einen großen Rucksack, die Jacke hatte er wegen der Hitze darüber gehängt, seine Hände steckten in den Hosentaschen.
Thomas Brenner hatte nicht wie andere Tramper den Daumen herausgestreckt, um mitgenommen zu werden. Wenn ein Autofahrer von sich aus anhielt und ihn mitnehmen wollte, dann stieg er freilich ein. Aber ebenso gerne ging er auch zu Fuß.
Seit dem frühen Morgen war er unterwegs. Das heißt, eigentlich hatte seine Wanderschaft schon vor fünf Tagen begonnen. Da hatte Thomas sich von Neustadt an der Donau aufgemacht, in seine Heimat zurückzukehren. In der Nähe von Neustadt hatte er bei einem Bauern gearbeitet. Fünf Jahre lang waren sie gut miteinander ausgekommen. Sein Brotherr hatte sich mit dem Sohn überworfen, und ihn von Haus und Hof verwiesen. Dann, eines Tages, kreuzte der Bauernsohn auf und vertrug sich wieder mit seinem Vater. Und von da an war für Thomas kein Platz mehr auf dem Hof gewesen. Einen Knecht hatte der Bauer sich leisten können. Jetzt aber, wo sein Sohn wieder da war, sah er, daß er den Lohn, den er Thomas gezahlt hatte, sparen konnte.
Der junge Mann aus dem Wachnertal ging, und sie schieden nicht im Streit. Es waren gute Jahre gewesen, die Thomas dort verbracht hatte, aber so manches Mal hatte er auch die Sehnsucht nach der Heimat verspürt. Als der Bauer nun die Kündigung aussprach, ging er leichten Herzens.
Wie es wohl zu Hause aussehen mochte?
In all den Jahren hatte er nichts aus der Heimat gehört, was daran lag, daß auch er gewissermaßen im Zorn geschieden war. Als Zweitgeborener war der väterliche Hof auf den Bruder übergegangen, und mit dem hatte Thomas sich nie besonders gut verstanden. Die Aussicht, als Knecht auf dem Hof des Bruders arbeiten zu müssen, erfüllte Thomas Brenner mit Grausen und er zog es vor, in die Fremde zu gehen.
So ein Schritt hatte natürlich nicht nur für ihn Konsequenzen. Oft dachte er an das Madel, das er zurückgelassen hatte, und fragte sich, wie es ihm wohl ergangen war. Er erinnerte sich noch sehr gut an die Auseinandersetzungen, die sie über dieses Thema geführt hatten, als er dann schließlich einsehen mußte, daß es keinen Sinn mehr hatte, ging er alleine aus Waldeck fort. Schlecht war es ihm in dieser Zeit nicht gegangen. Tobias hatte ihm sein Erbteil ausgezahlt, und was er von dem Lohn erübrigen konnte, hatte Thomas zusammen mit dem Geld angelegt, so daß er jetzt über ein recht ansehnliches Guthaben verfügte. Nur die Sehnsucht war immer noch da und ließ ihn wirklich manche Nacht nicht schlafen.
Thomas schaute den Wegweiser an, der in einiger Entfernung an der Straßenkreuzung stand.
Bis St. Johann waren es noch elf, bis Waldeck noch sieben Kilometer. Der junge Bursche entschloß sich, weiter in Richtung seines Heimatdorfes zu gehen, und nach geraumer Zeit sah er in der Ferne die ersten Häuser liegen.
Kurz vor Waldeck bog er jedoch vom Weg ab. Thomas hatte es sich anders überlegt und schlug die Straße zum Kärnerhof ein. Xaver Kärner war ein alter Spezi von ihm.
Zusammen hatten sie die Schulbank gedrückt und als Buben so manchen Streich ausgeheckt. Xaver würde später den Hof übernehmen, und Thomas überlegte, ob es nicht dort ein Unterkommen für ihn geben könnte. Bei dem Freund würde er allemal eher als Knecht arbeiten, als auf dem Brennerhof, unter der Leitung seines Bruders.
*
Christel Enzingers Familie lebte in Waldeck. Sebastian Trenker nutzte seinen wöchentlichen Besuch im dortigen Altenheim, um die Verwandten der Bäuerin aufzusuchen. Das Haus stand am Dorfrand, aber es glich eher einer protzigen Villa, als dem Stil der anderen Häuser. Es war von einer großen Mauer umgeben, und dichte Tannen verwehrten einen Einblick auf das Grundstück.
Ernst Hofer verdiente sein Geld als Direktor eines großen Brauereiunternehmens. Zahlreiche kleinere Privatbrauereien waren aufgekauft worden, seitdem Hofer die Regie in dem Unternehmen übernommen hatte. Seine Expansionspolitik hatte ihm dem Spitznamen »Imperator« eingebracht, und nicht wenige mittelständige Unternehmen waren von seinem Wohlwollen abhängig. Schließlich diktierte er die Bierpreise, und so mancher Gastwirt bedauerte es inzwischen, mit dem Hoferbräu einen Bierlieferungsvertrag abgeschlossen zu haben.
Von all diesen Dingen hatte der Bergpfarrer gerüchteweise gehört. Dies jedoch war nicht der Grund seines Kommens, ihm ging es darum, für die Tochter des Hauses ein gutes Wort einzulegen.
Nachdem er einige Zeit vor dem Eisentor hatte warten müssen, fragte eine Frauenstimme nach seinem Begehr. Der Geistliche nannte seinen Namen und bat darum, den Herrn Hofer sprechen zu dürfen. Schließlich wurde er von einem jungen Madel, das ganz offensichtlich das Hausmädchen war, hereingebeten und in das Haus geführt. Das Madel bat ihn in einen kleinen Salon und versicherte, daß der Herr Direktor ihm in ein paar Minuten wieder zur Verfügung stände.
Sebastian sah sich um. Die Ausstattung der Einganshalle und des Salons kündeten nicht nur vom Reichtum der Bewohner. Sie hatten auch Geschmack bewiesen bei der Wahl der Möbel, Teppiche und Bilder. Staunend hatte der gute Hirte von St. Johann beim Betreten des Hauses auf die kunstvoll geschnitzte Treppe gesehen, die in das obere Stockwerk führte.
Er stellte sich ans Fenster und warf einen Blick in den Park hinaus. Eine große Rasenfläche, aufwendig angelegte Blumenrabatte, ein Teehaus. Das alles instand zu halten benötigte die Arbeitskraft eines eigenen Gärtners. Sebastian bezweifelte nicht, daß dieser der Familie zur Verfügung stand. Genauso wie das Hausmädchen, ein Chauffeur und eine Köchin.
Die Tür hinter ihm wurde geöffnet, und der Geistliche drehte sich um.
»Grüß Gott, Herr Pfarrer«, sagte Ernst Hofer. »Was führt Sie zu mir?«
Er war ein stattlicher, hochgewachsener Mann, dem man ansah, daß er über das notwendige Durchsetzungsvermögen verfügte, das ein Mann in seiner Position benötigte, um ein solches Unternehmen, wie das Hoferbräu zu führen.
»Geht’s um eine Spende für eines Ihrer Projekte?«
Als reicher Brauereibesitzer war es für ihn nichts Ungewöhnliches, daß er hin und wieder von Leuten aufgesucht wurde, die an seine Großherzigkeit appelierten, und Ernst Hofer war ein Mann, der sich durch sein Mäzenentum einen postiven Ruf erworben hatte.
Doch Sebastians Besuch hatte einen anderen Grund.
»Ich grüße Sie, Herr Hofer«, antwortetet er und schüttelte den Kopf. »Nein, ich möcht kein Geld von Ihnen. Es ist etwas Privates, das mich hier hergeführt hat.«
Der Brauereidirektor runzelte die Stirn und bat den Besucher Platz zu nehmen. An der Längsseite des Salons stand eine Bar mit eingebauter Zapfanlage.
»Ein Bier?« erkundigte sich der Hausherr. »Seit kurzem produzieren wir ein dunkles Rauchbier. Das müssen S’ unbedingt mal probieren.«
Er war bereits an die Zapfanlage getreten, doch der Seelsorger winkte ab.
»Für mich net«, sagte Sebastian. »Ich bin mit dem Auto da. Lieber ein Mineralwasser.«
»Verstehe«, nickte Ernst Hofer und entnahm dem kleinen Kühlschrank eine Flasche.
Sich selbst zapfte er ein Glas Bier und kam dann zu Sebastian, der sich an einen kleinen, runden Tisch gesetzt hatte, der am Fenster stand.
»So, Hochwürden, dann mal heraus mit der Sprache«, forderte der Brauereidirektor ihn auf. »Was haben S’ auf dem Herzen?«
Der Geistliche trank einen Schluck und lehnte sich zurück. Ernst Hofer sah ihn gespannt an.
Ahnte er bereits den Grund des Besuches?
»Ich war gestern auf dem Enzingerhof«, begann der Seelsorger das Gespräch. »Es steht net zum Besten mit der Christel – finanziell geseh’n, mein ich. Gesundheitlich hat sie keinen Grund zum Klagen.«
Die Miene seines Gegenübers verfinsterte sich.
»Den hätt’ sie auch in finanzieller Hinsicht net, wenn sie auf ihre Mutter und mich gehört hätt’«, antwortete der Vater der Bäuerin. »Wir waren von Anfang an gegen diese Verbindung.«
»Sie haben’s Ihre Tochter auch deutlich spüren lassen. Net einmal zur Beerdigung Ihres Schwiegersohnes sind S’ gekommen. Geschweige denn, daß Sie einen Kranz geschickt hätten, einen letzten Gruß, ein paar tröstliche Worte.«
Der Vorwurf war unüberhörbar. Trotzig blickte der Hausherr seinen Besucher an.
»Wir haben uns nix vorzuwerfen, Hochwürden«, entgegnete Ernst Hofer. »Im Gegenteil. Wenn die Christel net ihren störrischen Kopf durchgesetzt hätt’, wär sie längst ins Unternehmen eingestiegen und könnt’ ein sorgenfreies Leben führen. Aber nein, sie mußte ja unbedingt einen armen Bauernsohn heiraten.«
»Glauben S’ wirklich, daß man das gegeneinander aufwiegen könnt’ – Liebe und wirtschaftliches Kalkül? Was meinen S’ wohl, wie viele glückliche Ehen net auf dieser Welt geschlossen würden, wenn man immer nur danach gefragt hätt’, ob die Verbindung standesgemäß sei, und wie positiv sie sich in der Bilanz niederschlägt?«
Er schüttelte den Kopf.
»Nein, Herr Hofer«, fuhr er fort, ohne dessen Antwort abzuwarten. »Das ist doch net die Frage, die im Vordergrund steht, sondern vielmehr, wie man der Christel helfen kann.«
Der Brauereibesitzer sah ihn an, dann auf das Bierglas vor sich und wieder zurück.
»Wissen S’, Hochwürden, ich stände heut net da, wo ich steh, wenn ich mich in meinem Leben net durchgesetzt hätt’. Jeder ist seines Glückes Schmied, und uns’re Tochter wollt einen anderen Weg gehen. Schauen S’, in der Firma hab’ ich einen tüchtigen jungen Mann, den ich als meinen Nachfolger aufbau. Diese Position hätt’ einmal die Christel einnehmen soll’n. Sie hat net gewollt und jetzt muß sie zusehen, wie sie aus ihrer Lage herauskommt. Am besten raten S’ ihr, den ganzen Krempel zu verkaufen. Vielleicht überlegt sie’s sich ja noch einmal und kommt wieder zu uns zurück. In diesem Fall stände unsere Tür für sie immer offen. Sagen S’ ihr das. Aber eine finanzielle Unterstützung für einen maroden Bauernhof, also bei aller Barmherzigkeit, Herr Pfarrer, aber damit dürfen S’ nun wirklich net rechnen.«
Sebastian ließ sich seine Enttäuschung über den Ausgang des Gespräches nicht anmerken. Er erhob sich und schüttelte den Kopf, als der Hausherr ihn begleiten wollte.
»Lassen S’ nur. Ich find allein’ hinaus.«
Er schloß die Tür zum Salon hinter sich und atmete tief durch. Der Bergpfarrer hatte sehr an sich halten müssen, um auf die Worte des sturköpfigen Bierbrauers nicht heftig zu reagieren. Aber er wußte, daß es keinen Zweck gegeben hätte. Vorerst würde er nichts in dieser Angelegneheit ausrichten können.
Sebastian Trenker durchquerte die Halle, ohne daß ihm eine Menschenseele begegnete. Erst als er die Klinke in die Hand nahm, hörte er ein Geräusch auf der Treppe. Er drehte sich um und sah eine Frau die Stufen heruntereilen.
»Warten S’, Hochwürden«, rief sie leise.
Maria Hofer zog ihn unter die Treppe, durch eine Tür, in ein kleines Zimmer. Der Einrichtung nach zu schließen, war es das Arbeitszimmer der Hausherrin.
Sie stand an der Tür und lauschte. Sie legte einen Finger auf die Lippen.
»Pst. Mein Mann verläßt gerade das Haus.«
Sie hörten seine Schritte in der Halle, wenig später klappte die schwere Haustür ins Schloß. Maria atmete erleichtert auf.
»So«, sagte sie erleichtert, »jetzt können wir reden.«
*
Xaver Kärner riß ungläubig die Augen auf.
»Bist du’s wirklich oder träum ich?« rief er, als er Thomas Brenner auf dem Hof stehen sah.
Der junge Bursche lächelte.
»Kannst es ruhig glauben.«
Sekunden später lagen sie sich in den Armen.
»Mensch, mein Alter, woher kommst denn so plötzlich und unerwartet?« fragte der Bauernsohn. »Ich kann’s immer noch net glauben!«
»Ach, das ist eine lange Geschichte«, antwortete Thomas.
Er schaute sich um.
»Hier hat sich ja fast nix verändert«, meinte er und sah den Freund wieder an. »Wie ist’s, könnt’ ihr nicht einen tüchtigen Knecht gebrauchen?«
Xaver verzog das Gesicht.
»Da schaut’s eher schlecht aus«, erwiderte er mit ehrlichem Bedauern. »Aber komm erstmal mit hinein. Beim Abendessen reden wir über alles.«
Sie betraten die Diele des Bauernhauses und gingen weiter in die Küche. Dort war der große Tisch bereits gedeckt. Außer der Bauernfamilie fanden sich eine Magd und ein Knecht ein. Als Thomas den Kollegen sah, ahnte er schon, warum Xaver das Gesicht bei seiner Frage nach Arbeit verzogen hatte.
Trotzdem wurde ihm bereitwillig ein Platz eingeräumt. Früher war er oft auf dem Kärnerhof zu Gast gewesen, und Xavers Eltern erinnerten sich noch gut an die Streiche, die die beiden Lausbuben früher gespielt hatten.
Der Besucher erzählte, wie es ihm in der Fremde ergangen war, und der alte Kärnerbauer schüttelte bedauernd den Kopf, als er noch einmal die Frage nach Lohn und Brot stellte.
»Hast ja geseh’n«, sagte Xavers Vater. »Ein Knecht, eine Magd – damit sind wir ausreichend versorgt. Noch einen könnten wir uns net leisten. So rosig sind die Zeiten net. So leid es mir auch tut.«
»Ich versteh’ schon«, nickte Thomas. »Macht euch deswegen keine Gedanken. Ich werd’ schon irgendwo unterkommen.«
Xaver tippte ihn an.
»Komm, laß uns ein bissel hinausgeh’n«, schlug er vor.
Sie gingen über den Hof, schauten nach den Kühen, zu den Feldern hinüber und machten einen Spaziergang, fast bis zum nahen Bergwald.
»Sag mal«, fragte Xaver, während sie über den Felderweg liefen, »warum versuchst’ es net darüben, auf dem Enzingerhof? Die Christel steht seit dem Tod ihres Mannes ganz allein da. Und wie man hört, soll’s dem Hof wirtschaftlich net so gut geh’n.«
Thomas Brenner war blaß geworden.
»Du redest doch net etwa von der Christel Hofer?«
»Freilich. Ihr wart doch mal zusammen, und alle haben geglaubt, daß ihr einmal heiraten würdet. Nachdem du dann verschwunden bist, hat sie den Wolfgang Enzinger genommen.«
Der junge Mann schluckte.
»Und der ist tot? Davon hab’ ich ja gar nix gewußt…«
Xaver legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Ich weiß ja net, warum sie damals net mit dir gegangen ist«, meinte er. »Aber was da auch immer war, Thomas, jetzt gehts ihr net gut und sie braucht Hilfe. Man munkelt bereits, daß ihr nix and’res übrig bleibt, als den Hof zu verkaufen, wenn net bald ein Wunder geschieht.«
Er deutete zum Hof hinüber.
»Schau, hier kannst net bleiben, so gern Vater dich auch einstellen tät. Aber da ist eine junge Bäuerin in Not.«
Er zuckte die Schultern.
»Vielleicht könnt das jetzt net nur eine Rettung für Christel Enzinger sein…«
Thomas sah ihn fragend an.
»Was meinst damit?«
Xaver grinste.
»Mensch, bist wirklich so schwer von Begriff? Ihr wart doch mal ein Paar. Vielleicht leben die alten Gefühle wieder auf. Überleg doch mal. Was könnt euch Besseres passieren?«
Thomas Brenner schaute nachdenklich vor sich hin.
Daß Christel inzwischen verheiratet sein könnte, damit hatte er schon gerechnet. Schließlich waren sie damals im Streit auseinander gegangen. Daß sie inzwischen Witwe war, bedauerte er. Was mußte sie alles durchgemacht haben, in all den Jahren!
Aber würde sie ihn wirklich als Knecht einstellen?
Von dem, worauf Xaver spekulierte, wollte er gar nichts wissen. Bestimmt empfand sie nichts mehr für ihn. Sonst hätte sie kaum einen anderen Mann geheiratet.
Trotzdem, er spürte, daß die junge Frau ihm nicht nur leid tat. Da war noch immer etwas, tief in seinem Herzen zumindest wollte er ihr seine Hilfe anbieten. Wenn sie ablehnte – gut, dann konnte er nichts daran ändern.
»Hautpsache, sie jagt mich net gleich davon…«
Xaver grinste.
»Heut, auf die Nacht, bleibst erstmal hier. Und morgen fahr ich dich rüber. Einverstanden?«
Thomas Brenner nickte. Als er später in der Kammer lag, die man ihm auf dem Kärnerhof zur Verfügung gestellt hatte, fand er trotz des anstrengenden Tages, der hinter ihm lag, keine Ruhe. Immer wieder sah er das Gesicht des jungen Madls vor sich, dem einst seine ganze Liebe gegolten hatte.
Auf einem Fest hatten sie sich gesehen und rettungslos ineinander verliebt. Drei Jahre waren sie unzertrennlich. Trotz der Widerstände in ihrer Familie, die diese Verbindung als nicht standesgemäß betrachtete, hatte Christel zu ihm gehalten.
Doch als er sie dann fragte, ob sie bereit wäre, mit ihm zu gehen, da zeigte sich, daß er wohl doch zuviel von ihr forderte.
Thomas wußte, daß sie sehr an ihrer Heimat hing. Und immer noch hoffte sie, daß die Eltern ihrer Liebe zu ihm ihren Segen gaben. Selbst einen Eintritt in die Firma des Vater schlug sie vor, damit Thomas das Brauereihandwerk von der Pike auf lernen könne, um das Unternehmen später einmal mit ihr zusammen zu führen.
Doch da hatte er vehement abgelehnt.
»Ich bin Bauer«, sagte er. »Und das bleibe ich.«
Ein Wort gab das andere. Er liebe sie nicht mehr, behauptete Christel, und ihre Liebe sei nicht stark genug, ihm zu folgen, beharrte er auf dem Standpunkt. Als er ihr schließlich ein letztes Ultimatum stellte, ließ die junge Frau es verstreichen, und Thomas ging für lange Zeit fort.
Jetzt lag er in seinem Bett, ließ die Vergangenheit Revue passieren und dämmerte mit banger Erwartung dem nächsten Tag entgegen.
*
»Es geht um Christel, net wahr?«
Maria Hofer sah den Geistlichen ängstlich an.
»Ist sie krank?«
Sebastian schüttelte den Kopf, wollte sie schnell beruhigen.
»Nein, machen S’ sich keine Sorgen, gesundheitlich geht’s ihr gut«, antwortete er. »Aber Sie haben recht, der Grund meines Besuches ist tatsächlich Ihre Tochter.«
»Bitt’ schön, Hochwürden, setzen S’ sich«, bat die Hausherrin.
Sie setzten sich in eine gemütliche Besucherecke, und Maria Hofer blickte erwartungsvoll.
»Was ist denn mit ihr?«
»Wie ich schon sagte, gesundheitlich hat sie keine Probleme«, erklärte er. »Aber finanziell geht’s sehr schlecht. Seit ihr Mann tot ist, hält sie sich und den Hof grad’ so über Wasser. Die Ernte im letzten Jahr fiel deshalb schlecht aus, weil die Christel die meiste Arbeit allein machen muß. Einen weiteren Knecht einzustell’n, dazu fehlt ihr das nötige Geld, und der Leopold ist viel zu alt, um noch so zu schaffen wie früher. Aber die Christel will ihn natürlich net entlassen. Dazu hat sie ein viel zu gutes Herz.«
Maria Hofer kramte in der Tasche ihres teuren Kostüms nach einem Taschentuch. Tränen rannen ihr über die Wangen, während sie den Worten des Geistlichen lauschte.
»Wissen S’, Hochwürden«, sagte sie, nachdem sie die Tränen abgewischt hatte, »ich hab’ immer bedauert, daß es zum Bruch zwischen uns und der Christel gekommen ist. Wie oft hab’ ich gebetet, mein Mann möge ein Einsehen haben und ihr die Hand zur Versöhnung reichen.«
Sie schluchzte wieder auf.
»Wir haben doch nur dieses eine Kind! Aber mein Mann – so liebevoll er als Gatte auch sein mag – ist gewohnt, daß alles nach seiner Pfeife tanzt. Was er net will, das will er dreimal net. Ich wag schon gar net mehr, von der Christel zu reden anzufangen, damit er net explodiert. Sie hätte sich alles selbst zuzuschreiben und muß seh’n, wie sie wieder da heraus kommt. So waren doch seine Worte, net wahr?«
»So in etwa«, bestätigte Sebastian.
»Was soll denn jetzt werden?«
Maria Hofers Frage klang wirklich verzweifelt.
»Christel braucht Hilfe«, antwortete der Geistliche. »Net nur finanzieller Art. Auch ein Knecht muß her, der zupacken kann. Aber das ist net alles. Vor allem braucht sie die Liebe ihrer Eltern. Solang sie die net hat, ist all ihre Mühe vergebens.«
Christels Mutter rang verzweifelt die Hände.
»Wenn ich nur wüßte, wie ich meinen Mann umstimmen könnt«, rief sie. »Glauben S’ mir, Hochwürden, lieber heut, als morgen würd ich zu meiner Tochter eilen und sie in die Arme schließen. Aber Ernst – er würd mir nie verzeihen, wenn ich ihm in den Rücken fiele…«
Sie erhob sich und ging an den kleinen Schreibtisch, wo sie eine Schublade aufzog und ein Scheckheft herausnahm.
»Sei’n S’ so gut und bringen der Christel den Scheck von mir«, bat sie. »Viel ist’s net, aber mir sind in finanzieller Hinsicht auch die Hände gebunden. Ich weiß zwar noch net, wie ich ihm die Ausgaben dieser Summe erklären soll, aber mir wird schon was einfallen. Sagen S’ der Christel, es kommt von Herzen, und daß ich an sie denk.«
Der Bergpfarrer nahm den Scheck und steckte ihn ein.
»Das will ich gern tun, Frau Hofer«, nickte er. »Aber Sie sollten sich überlegen, ob es sich net lohnt, sich aus dem übermächtigen Schatten Ihres Mannes zu lösen.
Damit will ich Sie beileibe net auffordern, daß sie ihn verlassen sollen. Aber ein bissel mehr Selbständigkeit in Ihren Entscheidungen sollten S’ schon haben. Dann wird’s Ihnen auch leichterfallen, den Kontakt zu Ihrem Kind wieder aufzunehmen.«
Christels Mutter begleitete ihn an die Tür.
»Ich nehm’s mir zu Herzen«, versprach Maria Hofer. »Und ganz will ich die Hoffnung auch net aufgeben, daß Ernst eines Tag’s zur Besinnung kommt und sich mit der Christel aussöhnt.«
Sebastian reichte ihr die Hand.
»Das wär’ auch ganz schlecht, Frau Hofer, wenn man die Hoffnung aufgeben wollt«, sagte er zum Abschied.
»Nur warten S’ net zu lang mit Ihrer Emanzipation, eines Tag’s – das könnt’ schon bald zu spät sein.«
Nachdenklich fuhr der Geistliche nach St. Johann zurück. Der Scheck knisterte in seiner Tasche. Sebastian bezweifelte, das die Summe, die darauf stand, ausreichen würde, um Christel Enzinger aus ihrer wirtschaftlichen Not zu befreien. Aber vielleicht konnte sie damit fürs erste die Kosten für einen weiteren Knecht decken.
Vorausgesetzt, es fand sich überhaupt einer.
Aber dann blieb immer noch das Problem mit der Hypothek. Und mit säumigen Rückzahlern kannten die Banken meistens kein Pardon.
Pfarrer Trenker ahnte, daß die dunklen Wolken, die über dem Enzingerhof schwebten, noch lange nicht bereit waren, sich zu verziehen. Trotzdem war er gewillt, alles in seiner Macht stehende zu tun, um sie zu verscheuchen.
Sebastian Trenker würde nicht seinem guten Ruf genießen, ließe er sich von solchen Problemen abschrecken.
*
»Guten Morgen, Christel.«
Die junge Bäuerin war im Garten und hielt die Hacke in der Hand. Das Unkraut stand meterhoch, wie sie meinte. Nachdem Resl in den vergangenen Wochen sich wegen eines Rückenleidens nicht darum hatte kümmern können, wucherte es zwischen den Gemüsebeeten. Christel war erst heute dazu gekommen, hier endlich einmal Ordnung zu schaffen.
Als sie die Stimme hörte, drehte sie sich um und starrte den Sprecher entgeistert an.
»Du?« sagte sie fassungslos und hielt sich am Stiel der Hacke fest, weil sie glaubte, jeden Moment umfallen zu müssen.
Jeden anderen hätte sie erwartet, aber diesen Mann ganz bestimmt nicht!
Thomas Brenner lächelte verlegen. Er hatte seinen schweren Rucksack vor dem Haus abgeschnallt und dort stehen gelassen. Die alte Magd, die draußen in der Sonne saß, antwortete auf seine Frage, daß die Bäuerin hinten im Garten sei.
»Ja, ich bin’s«, nickte er und spielte mit einem Jackenknopf. »Wie ich gehört hab’, ist hier die Stelle eines Knechts frei. Ich wollt mich dafür anbieten.«
Christel Enzinger hatte einigermaßen ihre Fassung wiedergewonnen. Das plötzliche Auftauchen des Mannes, der einmal ihre große Liebe gewesen war und der dann für lange Jahre verschwand, hatte sie durcheinander gebracht. Als er jetzt so unversehens vor ihr stand, da fühlte sie ihr Herz heftig klopfen, und wie im Zeitraffer schien ein Film vor ihr abzulaufen, in dem sie all die Bilder von früher wiedersah.
Sie räusperte sich.
»Ich weiß net«, antwortete die Witwe. »Es stimmt schon, einen Knecht könnt ich gebrauchen. Ich kann ihn bloß net zahlen.«
Thomas zuckte die Schultern.
Mein Gott, dachte er, wie schön sie immer noch ist. Nein sie war noch viel schöner geworden in all den Jahren!
Er schaute sie an. Das Gesicht einer reifen Frau. Fein geschnitten, von blonden Locken umrahmt, mit vollen roten Lippen. Lippen, die er so oft geküßt hatte…
Aber er sah auch den dunklen Zug, der darum lag, und Thomas ahnte, was Christel in den zwei Jahren, seit ihr Mann tot war, durchgemacht haben mußte.
»Ich hab’ vom Kärner-Xaver gehört, was gescheh’n ist«, sagte er. »Das mit deinem Mann tut mir leid. Der Xaver hat mir auch erzählt, daß es net so gut steht, um den Hof. Wenn ich helfen kann? Auf die Bezahlung kommt es mir net so an…«
Stolz hatte sie den Kopf erhoben und erwiderte seinen Blick.
Warum war er gekommen? Aus Mitleid?
Darauf konnte sie verzichten. Almosen wollte sie nicht. Wenn die Enzingerbäuerin einen Knecht einstellte, dann zahlte sie ihn auch!
»Vielen Dank, für dein Angebot«, schüttelte die den Kopf. »Aber ich kanns net annehmen. Versuchs doch woanders.«
Mit zwei Schritten war er bei ihr und packte sie bei der Schulter.
»Madel, sei doch vernünftig«, sagte er eindringlich. »Ich seh’ doch, daß es hier an allen Ecken und Enden fehlt.«
Er deutete mit dem Kopf zum Haus.
»Es ist ja wirklich edel von dir, daß du die beiden Alten mit durchschleppst, aber davon stellst den Hof net wieder auf die Beine. Die Arbeit ist zuviel, als daß du sie allein schaffen könnt’st. Ich will dir doch nur helfen!«
Sein Gesicht war ganz nahe an ihrem. Christel spürte seinen Atem auf ihren Wangen, fühlte seinen Griff, mit dem er sie festhielt.
Wie sehr wünschte sie sich, er würde sie jetzt in seine Arme nehmen und küssen. Seit Wolfgangs Tod hatte sie nicht mehr die Nähe eines Manne verspürt, und jetzt war Thomas zurückgekommen…
Doch dieses Gefühl überwältigte sie nur für Sekunden, dann hatte sie es abgeschüttelt, wie ein lästiges Insekt. Ihre Liebe zu Thomas Brenner war an jenem Tag gestorben, als er sie verließ. Nur zu gut erinnerte sie sich der Auseinandersetzung, die sie darüber geführt hatten, ob sie gemeinsam fortgehen sollten. Christel hatte Zweifel, ob sie es zusammen in der Fremde schaffen könnten. Sie waren beide noch viel zu jung. Außerdem hing sie an der Heimat. An dem Abend, als es endgültig zum Bruch kam, da hatte Thomas sie genauso festgehalten wie jetzt, und genauso auf sie eingeredet.
Die Tage und Wochen, die dann folgten, schienen unerträglich zu sein. Besonders ihr Vater erging sich in hämischen Bemerkungen darüber. Daß seine Tochter fürchterlich litt, sah er überhaupt nicht.
Eher aus Trotz, als aus echter Zuneigung hatte sie ein Jahr später Wolfgang Enzinger geheiratet, als der ihr einen Antrag machte.
Die Liebe wird sich schon noch einstellen, glaubte Christel.
Natürlich tat es weh, daß die Eltern nicht zur Hochzeit kamen. Daß sie Jahre später selbst auf den Tod des Schwiegersohnes nicht reagierten, berührte die junge Witwe schon nicht mehr. Sie hatte sich damit abgefunden, daß der Riß zwischen ihr und den Eltern nicht mehr zu kitten war.
Dafür konnte sie sich aber sagen, daß sie Wolfgang immer eine gute Ehefrau gewesen war, auch wenn die wahre große Liebe sich doch nicht einstellte, wie sie es sich erhofft hatte.
Wolfgang war ein liebevoller und treusorgender Ehemann, der fleißig arbeitete, um für sich und Christel ein gesichertes Heim zu schaffen. Leider war sein größter Wunsch, Vater zu werden, nie in Erfüllung gegangen, und das war das einzige, was Christel an dieser Ehe bedauerte. Unwillig befreite sie sich aus seinem Grifff.
»Nein, Thomas«, sagte sie
energisch, »ich kann dich net einstellen. Und jetzt laß mich meine Arbeit machen.«
Enttäuscht gab er sie frei und wandte sich nach einem letzten Blick um. Während er durch den Garten schritt, hatte Christel sich gebückt und zupfte das Unkraut mit der Hand heraus.
Den Kopf hielt sie gesenkt, damit er ihre Tränen nicht sah.
*
Dieser unerwartete Besucher brachte die hübsche Witwe mehr aus der Fassung, als sie sich eingestehen wollte.
Nachdem Thomas Brenner den Hof verlassen hatte, war sie nach vorne gegangen und hatte sich zu Resl auf die Bank gesetzt.
»Was hat er denn gewollt, der junge Mann«, erkundigte sich die Magd.
»Eine Stelle als Knecht hat er gesucht«, antwortete die Bäuerin, während sie mit ihren Gedanken ganz woanders war.
»Und?« wollte Resl wissen. »Hast ihn eingestellt?«
Christel nahm die Frage nur am Rande wahr.
»Was hast g’sagt?« fragte sie und sah die Magd an, als wäre sie erstaunt, daß sie überhaupt da sei.
»Ob du ihn eingestellt hast, wollte ich wissen. Du weißt doch selbst, der Leopold kann net mehr. Wie willst denn die ganze Arbeit allein schaffen?«
»Nein, ich hab’ ihn wieder fortgeschickt«, erwiderte die Bäuerin zum Entsetzen der alten Magd. »Ich kann mir keinen Knecht leisten.«
»Aber wieso…?«
Das Auto des Geistlichen aus St. Johann, das auf den Hof fuhr, enthob sie einer Antwort. Christel stand auf und ging dem Besucher entgegen.
»Grüß Gott, Hochwürden«, sagte sie lächelnd. »Daß ich Sie schon so bald wiederseh’, hätt’ ich net gedacht. Gibt’s einen besonderen Grund für ihren Besuch?«
»In der Tat, Christel«, antwortete der Bergpfarrer und griff in die Jackentasche. »Das hier soll ich dir von deiner Mutter geben. Ich war gestern bei deinen Eltern.«
Die junge Bäuerin warf einen Blick auf den Scheck und steckte ihn dann achtlos in die Tasche ihrer Schürze.
»Er ist von meiner Mutter«, stellte sie fest.
»Ja, und sie läßt dir Grüße ausrichten.«
»Und was ist mit Vater?«
Sie waren ein paar Schritte gegangen. Die Magd war im Haus verschwunden, um das Mittagessen herzurichten. Sebastian Trenkers Miene verriet nicht, was er dachte.
»Es tut mir leid, Christel«, erwiderte er. »Leider ist dein Vater längst net so umgänglich, wie deine Mutter. Ich hab’ deine Eltern aufgesucht, und ihnen von deiner Lage erzählt. Dein Vater ist der Ansicht, du hättest dich selbst da hineinmanövriert, und müßtest zuseh’n, wie da wieder rauskommst.«
»So etwas hab’ ich mir schon gedacht, als ich die Unterschrift auf dem Scheck sah. Vater hätte ihn niemals ausgestellt.«
»Ich bin sicher, daß er doch noch zur Vernunft kommt«, sagte der Geistliche. »Deine Mutter will jedenfalls etwas in diese Richtung unternehmen.«
Sie hatten sich auf die Bank gesetzt. Die Einladung zu einem Kaffee oder Glas Saft lehnte Sebastian dankend ab.
»Sag mal«, wechselte er das Thema, »ich hab’ da eben auf der Herfahrt einen jungen Mann geseh’n. Er schien mir direkt vom Hof zu kommen.«
»Ja, der war hier«, antwortete Christel und bemühte sich, ihrer Stimme einen belanglosen Ton zu geben.
»Zufällig?«
»Nein, eine Arbeit hat er gewollt…«
Sebastian sah sie erstaunt an.
»Und? Hast ihn etwa wieder fortgeschickt?«
»Was soll ich denn machen, Hochwürden? Ich hab’ net das Geld, um einen Knecht einzustellen. Außerdem…«
»Ja?«
Sie zuckte die Schultern.
»Ach, nix.«
Der gute Hirte von St. Johann sah sie forschend an.
»Na, was hast mir noch sagen wollen?«
Christel biß sich auf die Lippen.
Warum bloß hatte sie nicht den Mund halten können?
»Es ist so, ich kenn’ den Thomas von früher«, erzählte sie schließlich. »Es gab mal eine Zeit, da hat er mir sehr viel bedeutet…«
»Aha.«
Sebastian war neugierig geworden, aber er drängte sie nicht, weiter zu erzählen. Er wußte, daß sie es schon von ganz allein tun würde.
Langsam, erst mit stockenden Worten, dann immer flüssiger sprach sie wirklich weiter. Verschwieg und beschönigte nichts und endete schließlich mit dem plötzlichen Auftauchen Thomas’, an diesem Morgen.
»Schade«, sagte Sebastian schließlich. »Vielleicht war es ein Fehler, ihn gehen zu lassen. Was auch immer zwischen euch war – Thomas ist gekommen, um dir zu helfen. Du hast keinen Grund, so stolz zu sein, diese Hilfe abzulehnen. Ganz im Gegenteil.«
»Ich weiß, Hochwürden«, nickte Christel Enzinger.
Sie fühlte den Scheck in ihrer Schürzentasche. Mit dem Geld würde sie sich einen Knecht leisten können. Mindestens für ein Jahr.
Doch was kam dann?
Immer noch schwebte das Damoklesschwert der Zwangsversteigerung über dem Hof, wenn es ihr nicht gelang, die Ratenzahlung wieder aufzunehmen. Vielleicht sollte sie den Scheck ihrer Mutter lieber dafür verwenden.
Als habe Sebastian ihre Gedanken geahnt, sagte er: »Mit dem Geld von deiner Mutter kannst doch sicher, zumindest eine Zeitlang, einem Knecht den Lohn zahlen.«
Die Bäuerin sah ihn an.
»Schon. Aber was ist dann?«
Der Seelsorger hatte sich erhoben.
»Das wird sich finden«, antwortete er und reichte ihr die Hand. »Ich muß jetzt leider los. Aber ich schau’ bald wieder vorbei.«
Recht schnell stieg er ins Auto und fuhr vom Hof. Sebastian hatte eine Idee, und wenn er die in die Tat umsetzen wollte, dann mußte er sich beeilen.
Hoffentlich war es nicht schon zu spät.
Aber nein, überlegte er, lange hatte er sich nicht auf dem Enzinger aufgehalten, und der junge Mann, um den es ihm ging, war zu Fuß unterwegs. So schnell war er da nicht.
Daß er damit richtig lag, sah Sebastian Trenker wenig später, als er Thomas vor sich die Straße entlang marschieren sah. Er hupte kurz, nachdem er ihn erreicht hatte und winkte durch das offene Fenster.
»Grüß Gott, Herr Brenner«, rief er.
Thomas war an den Wagen getreten.
»Sie kennen mich…, Hochwürden?«
Lediglich an dem Priesterkragen hatte er erkannt, daß es sich bei diesem Unbekannten mit dem markanten Gesicht um einen Gottesmann handelte.
»Ich bin Pfarrer Trenker, aus St. Johann«, erklärte Sebastian. »Hätten S’ Lust auf ein Mittag-essen im Pfarrhaus? Meine Haushälterin ist eine ausgezeichnete Köchin.«
*
»Sehr gut!«
Josef Ramsauer stand neben dem Bürgermeister an dessen Auto gelehnt und schaute zum Enzingerhof hinüber. Markus Bruckner hatte das Fahrzeug in einiger Entfernung abgestellt, um dem Bauunternehmer Gelegenheit zu geben, das Anwesen von dort aus anzusehen. Er deutete mit dem Arm über die Felder, rechts und links.
»Das Land gehört alles dazu.«
Josef Ramsauer war verwirrt.
»Soviel Land? Aber da ist ja fast nix bewirtschaftet!«
»Sag ich doch. Die Enzingerbäuerin muß praktisch ganz allein schaffen. Einen Knecht und eine Magd hat sie, aber die beiden sind schon weit über sechzig. Deshalb liegt hier alles brach. Die Christel schaffts net allein, also hat sie auch keine großen Einnahmen zu erwarten.«
Der Bauunternehmer strich sich nachdenklich über den Bauch. Dem war deutlich anzusehen, daß der Ramsauer sich ein gutes Essen nicht entgehen ließ.
»Wär’s da net besser abzuwarten, bis der Hof unter den Hammer kommt?« fragte er. »Du hast doch gesagt, daß die Frau in Zahlungsschwierigkeiten ist.«
Markus Bruckner wußte, daß sein Geschäftspartner damit recht hatte. Allerdings widerstrebte es ihm, die Notlage der Enzingerbäuerin auszunutzen. Schließlich wollte er im nächsten Jahr als Bürgermeister wiedergewählt werden, und da machte es auf die Wähler einen schlechteren Eindruck, wenn er als jemand dastand, der sich am Schicksal anderer bereicherte. Dann wollte er lieber ein paar Tausender mehr ausgeben. Das sicherte ihm die Sympathie und die nötigen Stimmen.
»Schon«, erwiderte er, »aber was wir hier mehr bezahlen, bekommen wir mit dem Tagungshotel spielend wieder herein.«
Josef Ramsauer rieb sich die Hände.
»Na, dann los. Machen wir der guten Frau ein Angebot.«
Im Geiste sah er bereits den Hotelkomplex an der Stelle stehen, an der sich jetzt noch der Bauernhof befand. Der Bürgermeister hatte recht gehabt. Es gab soviel Land, daß man mühelos ein Schwimmbad einplanen konnte. Luxus pur, für zahlungsfähige Kundschaft.
Im Kopf überschlug er schon mal, wieviel das alles kosten würde, und wieviel unterm Strich für ihn übrig blieb. Vor allem aber würde dieser Hotelbau die Arbeitsplätze seiner Leute für einige Zeit sichern.
Sie fuhren weiter zum Hof. Unterwegs ermahnte Markus Bruckner seinen Begleiter, daß es einen besseren Eindruck machte, wenn er, der Bürgermeister, das Angebot an die Bäuerin weitergebe. Immerhin sah es dann so aus, als ob die Gemeinde dahinter stehe und nicht eine Privatperson.
Auf ihr Klopfen öffnete die Magd.
»Grüß Gott, Resl«, sagte Markus Bruckner mit einem Lächeln. »Wie gehts denn immer? Ist die Bäuerin auch zu Haus’?«
Die alte Frau zuckte die Schultern.
»Eben war’s noch da«, antwortete sie und deutete auf die Bank vor dem Haus. »Da ist s’ gesessen, als der Herr Pfarrer da war. Vielleicht ist s’ jetzt im Garten oder der Scheune.«
Bei der Erwähnung des Herrn Pfarrer schrillten beim Bürgermeister die Alarmglocken. Was wollte Hochwürden hier? Einfach nur so ein Besuch, bei einem seiner Schäfchen? Oder steckte mehr dahinter? Hatte er vielleicht schon von den Plänen erfahren?
Der Bruckner-Markus rief sich zur Ruhe.
Unsinn, woher sollte Pfarrer Trenker wissen, was er und der Ramsauer planten? Schließlich hatte er mit niemandem ein Wort darüber gewechselt. Nicht einmal mit seiner Frau. Es konnte also nur ein Zufall sein, daß der Geistliche gerade heute zum Enzingerhof gefahren war.
Allerdings – so ganz wohl war dem Bürgermeister bei diesem Gedanken nicht. Schon oft hatte Sebastian Trenker ihm seine schönsten Pläne durchkreuzt!
»So, was hat er denn gewollt, der Herr Pfarrer?« erkundigte er sich deswegen bei der Magd.
Resl zuckte die Schultern.
»Woher soll ich’s wissen«, antwortete sie. »Ich bin ja net die Bäuerin.«
Sie deutete zur Scheune hinüber.
»Da kommt s’ übrigens, die Christel.«
Die beiden Männer drehten sich um. Die junge Witwe hatte Stimmen gehört und wollte nachsehen, wer da gekommen war. Als sie den Bürgermeister von St. Johann erblickte war sie sehr erstaunt. Es kam nicht sehr oft vor, daß er sich hier blicken ließ.
»Grüß dich, Bürgermeister«, nickte sie ihm zu. »Was verschafft mir die Ehre dieses Besuches?«
Markus Bruckner grinste breit.
»Guten Tag, Christel«, sagte er und reichte ihr die Hand.
Dann deutete er auf seinen Begleiter.,
»Das ist Herr Ramsauer.«
Die Bäuerin gab auch ihm die Hand und sah die beiden Männer fragend an.
»Ach, weißt, wir sind grad ein bissel unterwegs, die Gegend anschau’n«, erzählte Markus fadenscheinig.
Er wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Womöglich roch die Bäuerin den Braten und versuchte dann den Preis in die Höhe zu treiben, wenn sie merkte, wie groß das Interesse an ihrem Hof war.
»Tja – und dabei sind wir hier vorbeigekommen, und mir fiel ein, daß ich schon lange net mehr da war.«
»Um genau zu sein. Es ist jetzt zwei Jahre her…«
Markus nickte.
»Ja, natürlich. Schreckliche Geschichte, damals. Ich kann’s eigentlich immer noch net glauben.«
»Kann ich euch was zu trinken anbieten?« wollte die Bäuerin wissen.
Josef Ramsauer griff sich mit zwei Fingern unter den Hemdkragen. Trotz der Hitze trug er Anzug und Krawatte und schwitzte entsprechend.
»O ja, ein Glas Saft oder so würd mir, glaub’ ich, guttun«, nickte er.
Die junge Witwe bat sie, Platz zu nehmen, und verschwand kurz im Haus, um schon bald darauf mit einer Saftkaraffe und Gläsern zurückzuzkehren.
»Ja, Christel, wie ich schon sagte, ein schlimme Sache, das mit dem Wolfgang«, meinte Markus Bruckner. »Wie ich geseh’n hab’, kommst net gut allein zurecht, was. Ein Jammer um die Felder, die net bewirtschaftet sind.«
»Ich hab’s dir ja schon erzählt«, antwortete die Bäuerin. »Allein ist’s wirklich net zu schaffen.«
Ihr Gesichtsausdruck bei diesen Worten sprach Bände. Der Bürgermeister hielt die Gelegenheit für günstig, auf sein Anliegen zu sprechen zu kommen.
»Vielleicht wüßt’ ich einen Weg, daß’ aus dieser Misere kommst…«, sagte er.
Christel Enzinger sah ihn fragend an.
»Und der wär’?«
Markus Bruckner beugte sich vor.
»Hast schon mal dran gedacht, den Hof zu verkaufen?«
Er deutete auf seinen Begleiter, der bisher geschwiegen hatte.
»Der Herr Ramsauer ist Bauunternehmer«, erklärte er. »Er arbeitet für die Gemeinde. Wir würden dir ein reelles Angebot machen, daß du deine Sorgen auf einen Schlag los wärst.«
Christel war erstaunt.
»Was will die Gemeinde denn mit meinem Hof anfangen?« wollte sie wissen. »Doch bestimmt net die Felder bewirtschaften und die Küh’ melken.«
Der Bürgermeister lachte.
»Natürlich net«, erwiderte er. »Aber du kannst mir glauben, wenn ich dir sag’, daß es nur zu deinem Besten wär’, wenn du uns den Hof überläßt. Mit dem Geld hast’ ein sorgenfreies Leben, wenn du’s gut anlegst.«
Die junge Bäuerin überlegte.
Den Hof verkaufen – wie oft hatte sie diesen Gedanken schon gehabt?
Allerdings war sie immer wieder davor zurückgeschreckt. Der Enzingerhof war ihre Heimat, alles was ihr geblieben war.
Wohin sollte sie, wenn sie ihn nicht mehr besaß?
Aber wenn sie weiter darüber nachdachte – wahrscheinlich würde sie ihn ohnehin nicht halten können. War es da nicht besser, ihn zu verkaufen, bevor die Zwangsvollstreckung drohte?
»An wieviel hast’ denn so gedacht?« fragte sie.
Natürlich war ihr aufgefallen, daß der Bürgermeister ihre Frage, was die Gemeinde mit dem Hof vorhabe, nicht beantwortet hatte. Das konnte ihr zwar auch egal sein, aber so leicht würde sie sich nicht über den Tisch ziehen lassen.
Viel war es vielleicht nicht, was sie von ihrem Vater mitbekommen hatte. Aber einen ausreichenden Geschäftssinn, um zu merken, wenn jemand sie übervorteilen wollte, den besaß sie schon.
Die Summe, die Markus Bruckner nannte, ließ ihren Atem stocken. Er hatte recht – damit wäre sie wirklich auf einen Schlag aller Sorgen ledig. Nicht nur das, sie konnte auch dafür sorgen, daß Resl und Leopold einen geruhsamen Lebensabend genossen.
Die Witwe schluckte. Zu verlockend war das Angebot, eine Närrin müßte sie sein, wenn sie es ablehnte.
Dennoch – irgend etwas hielt sie davon ab, sofort zuzuschlagen. Markus Bruckner entging ihr Zögern nicht.
»Ich weiß«, sagte der Bürgermeister, »es kommt überraschend. Darum sollst dir auch ein bissel Zeit lassen, mit der Antwort. Allerdings muß ich dich bitten, über unser Gespräch heut Stillschweigen zu bewahren. Es muß niemand wissen, was wir drei besprochen haben. Kann ich mich darauf verlassen?«
Christel nickte.
Ja, eine Denkpause würde sie schon einlegen müssen. Immerhin stand ihre ganze Zukunft auf dem Spiel, da lohnte es schon, ein bissel darüber nachzudenken, was richtig und was falsch war.
Die beiden Männer hatten sich erhoben. Die junge Frau stand ebenfalls auf. Markus Bruckner reichte ihr die Hand.
»Also, ich würd’ sagen, daß wir uns in zwei Tagen noch einmal zusammensetzen. Bis dahin mußt dir’s überlegt haben.«
Die Bäuerin lächelte.
»Damit hast mir ein paar schlaflose Nächte bereitet, Bürgermeister«, sagte sie.
Nachdenklich sah sie den beiden Männer hinterher, die in das Auto stiegen und vom Hof fuhren. Dann schaute sie sich um.
Fünf Jahre lebte sie jetzt hier. Schöne und schlechte Zeiten hatte sie erlebt.
Wie würde es sein, wenn sie nicht mehr jeden Morgen mit den Hühnern aufstand, die Kühe melkte, den Stall ausmistete, mit dem Traktor über die Felder fuhr? Würde es ein besseres Leben sein?
Mit dem Geld, das sie besitzen würde, ja. Aber ob sie dann auch glücklicher war?
*
»Darf ich fragen, woher Sie meinen Namen kennen?«
Thomas Brenner sah den Geistlichen von der Seite her an.
»Von der Christel«, antwortete Sebastian. »Sie hat mir erzählt, daß Sie bei ihr nach Arbeit gefragt haben. Daraus schließ ich, daß Sie im Moment keine Beschäftigung haben, und hab’ mir gedacht, ich lad Sie zum Mittag ins Pfarrhaus ein.«
Der junge Mann, der an der Seite des Bergpfarrers saß, schmunzelte. An den Pfarrer aus seiner Jugend erinnerte der Geistliche neben ihm nun überhaupt nicht. Wenn er seinen Kragen nicht getragen hätte, dann würde Thomas angenommen haben, es handele sich um einen Urlauber.
»Das ist ja sehr freundlich von Ihnen«, sagte Thomas.
»Aber ich versteh’ immer noch net, warum.«
Sebastian Trenker lächelte ebenfalls. Er hatte sich alles schon zurecht gelegt, und wenn der gute Hirte von St. Johann erst einmal einen Plan geschmiedet hatte, dann brachte diesen niemand so leicht zum Schwanken.
»Ich erklär’s Ihnen Thomas«, erwiderte er. »Nach dem Essen. Wir sind gleich da.«
Sebastian fuhr den Wagen nicht in die Garage, er war sicher, ihn am Nachmittag noch einmal brauchen zu müssen. Über den Kiesweg gingen sie zum Pfarrhaus hinauf.
Der Geistliche öffnete die Tür und rief in den Flur:
»Frau Tappert, ich bin’s. Ich hab’ uns einen Gast mitgebracht.«
Der Kopf der Haushälterin erschien in der Küchenür.
»Ist recht, Hochwürden«, antwortete Sophie Tappert. »In zehn Minuten gibt’s Essen.«
»Kommen S’«, sagte Sebastian und führte seinen Gast durch das Wohnzimmer hinaus, auf die Terasse des Pfarrgartens. Dort saß schon Max Trenker, der Bruder des Geistlichen und Polizist von St. Johann.
Der Bergpfarrer machte die beiden Männer miteinander bekannt und bat seinen Bruder, etwas Kaltes zum Trinken zu holen.
Thomas sah sich unterdessen um. Er war gespannt, was der Seelsorger wohl von ihm wollte. Es war schon ungewöhnlich, daß der ihn so einfach von der Straße aufgelesen und mit nach Hause genommen hatte. Dabei war er, Thomas, mit seinen Gedanken ganz woanders gewesen, als der Wagen neben ihm hielt.
Als er so unverrichteter Dinge den Enzingerhof verließ, da tat ihm schon das Herz weh. Auch wenn er sich vor dem Wiedersehen mit Christel gefürchtet hatte, so war er doch auch gespannt, wie sie sein unerwartetes Kommen wohl aufnahm. Aber, daß sie so abweisend sein würde, hätte er sich nie gedacht.
Natürlich wußte er, daß er ihr damals weh getan hatte. Aber hatte sie es nicht anders gewollt? Mit Händen und Füßen hatte er auf sie eingeredet. Vor ihr gekniet und sie gebeten, mit ihm zu kommen.
Aber sie wollte bleiben.
Lange, sehr lange, haderte er damit, und es brauchte seine Zeit, bis er es verwunden hatte. Doch wenn er recht überlegte – hatte er sie wirklich jemals ganz vergessen?
Waren da nicht die einsamen Nächte, in denen er sich nach ihr gesehnt und verzehrt hatte?
Um so enttäuschter war er über ihre ablehnende Haltung, die sie ihm gegenüber an den Tag gelegt hatte. Dabei wollte er doch nichts anderes, als ihr helfen.
»So kommen S’, Thomas, trinken wir erst einmal einen Schluck«, unterbrach Sebastian Trenker seine Gedanken.
Der Geistliche reichte ihm ein Glas mit kaltem Apfelsaft.
»Ah, das tut gut«, nickte Thomas, nachdem er getrunken hatte.
»Den macht meine Haushälterin selbst«, erzählte der Gastgeber und deutete zur Küche. »Ich glaub, wir können essen. Es macht Ihnen doch nix aus, wenn wir in der Küche sitzen?«
Der Knecht schüttelte den Kopf. Bisher hatte er immer in der Küche des Bauern gesessen, bei dem er gearbeitet hatte. Nur an Sonn-, und Feiertagen wurde in der Diele gedeckt.
Sophie Tappert hatte bereits die Suppenteller gefüllt. Überrascht stellte Thomas fest, daß der Inhalt kühl war.
Nein, eiskalt sogar.
»Das ist eine kalte Kartoffelsuppe«, erklärte Sebastian. »Herrlich erfrischend an solch einem heißen Tag.«
Da konnte der Gast nur zustimmen.
Sophie Tappert hatte am frühen Morgen die Suppe mit Rauchspeck, Kartoffeln und Lauch angesetzt. Nachdem alles gegart war, wurde es mit Sahne verrührt und mit Pfeffer und Salz gwürzt. Die Pfarrköchin pürierte die fertige Suppe im Mixer, schmeckte noch einmal ab und stellte sie zum Abkühlen in den Keller. Damit sie dann zur Essenszeit richtig kalt war, stellte die Haushälterin den Topf noch für ein paar Stunden in die Kühltruhe. Zum Anrichten gab sie einen Klecks geschlagener Sahne obendrauf und streute frisch gehackten Schnittlauch darüber.
»Wirklich köstlich«, mußte Thomas zugeben.
Nach der Suppe gab es ein kleines Hauptgericht. Ein feines Rehgulasch mit Preiselbeersauce und Nudeln. Thomas, der sich darüber wunderte, welche Form die Nudeln hatten, erfuhr, daß es im Pfarrhaus Ehrensache war, so weit wie möglich alles selber herzustellen. Dazu gehörten natürlich auch Kartoffelknödel oder eben Teigwaren.
Max zuliebe hatte Sophie Tappert zum Nachtisch einen Vanillepudding gekocht, zu dem sie frische Erdbeeren reichte.
Thomas Brenner, der mit gu-tem Appetit gegessen hatte, war erstaunt darüber, wieviel der Bruder des Geistlichen essen konnte. Während alle anderen bereits wundervoll gesättigt ihre Bestecke aus der Hand legten, langte der junge Polizist noch einmal herzhaft zu.
Nach dem Essen bat Sebastian seinen Gast wieder hinaus in den Pfarrgarten.
*
»Ich vermute, Sie werden mir jetzt erklären, warum ich in den Genuß eines solch köstlichen Mittagessens gekommen bin«, sagte Thomas und schaute sein Gegenüber erwartungsvoll an.
»Selbstverständlich«, lachte Sebastian. »Ich wollte die Mahlzeit mit einem Geschenk krönen und Ihnen sagen, daß ich einen Arbeitsplatz für Sie weiß.«
Der junge Mann blickte erstaunt auf.
Soviel Umstand, nur um ihm eine Arbeit anzubieten?
»Net ich«, schüttelte der Geistliche den Kopf. »Sondern die Christel.«
»Aber… ich…«
»Ich weiß«, nickte der Bergpfarrer. »Sie haben sich heut morgen umsonst bemüht. Aber es war ein Fehler von der Christel, Sie net zu nehmen. Sie braucht Hilfe, und zwar dringend. Sie haben sicher g’seh’n, wie’s um den Hof bestellt ist.«
»Allerdings. Ich fürcht’ jedoch, daß nix daraus wird. Sie hat mich rundheraus abgelehnt.«
Sebastian sah seinen Gast an.
»Daran sind S’ aber net ganz unschuldig…«
»Das wissen S’ auch? Daß die Christel und ich einmal ein Paar waren?«
Pfarrer Trenker konnte verstehen, daß Thomas etwas überrascht war.
»Sie hat’s mir erzählt«, antwortete er. »Alles, was damals geschehen ist. Auch von ihrer Enttäuschung, und daß sie den Wolfgang Enzinger eher aus Trotz geheiratet hat.«
»Aber wie kommen S’ darauf, daß sie mich nun doch nimmt, wo sie doch heut morgen…«
»Weil sie dich immer noch liebt. Darum!«
»Hat… hat die Christel das gesagt?«
»Nein, das hat sie net. Aber ich weiß es. Aus allem was sie sagt, sprach die Sehnsucht einer Frau nach Liebe. Nach einer Liebe, die bis heute unerfüllt geblieben ist. Deshalb mein’ ich, daß Sie net aufgeben dürfen. Gehn S’ zurück zum Enzingerhof. Lassen S’ sich was einfallen, damit S’ bleiben dürfen.«
Thomas Brenner sah den Geistlichen unsicher an.
»Halten S’ das wirklich für eine gute Idee?« fragte er zweifelnd.
»Die beste Idee, die ich seit langem hatte«, lachte der gute Hirte von St. Johann. »Ich bin überzeugt, daß auch der letzte Groll, den die Christel vielleicht noch gegen Sie hegen mag, verfliegt, wenn sie erst einmal g’seh’n hat, wie Sie anpacken können. Bestimmt werden Sie’s mit ihr zusammen schaffen, daß der Hof net unter den Hammer kommt.«
Thomas schaute entsetzt.
»Steht’s denn wirklich so schlecht?«