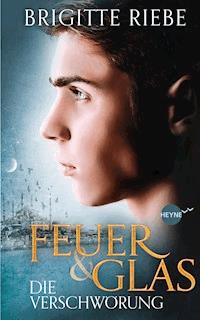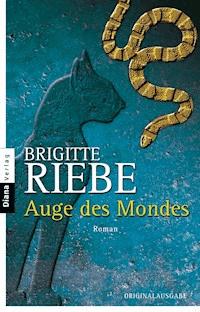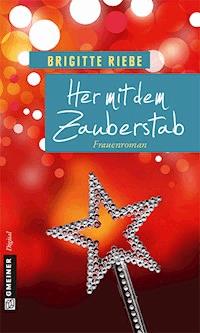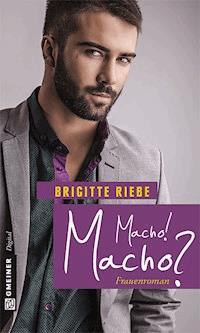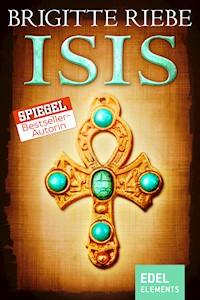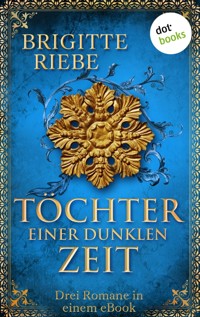Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Seit Ruth Bastian diese schreckliche Entdeckung gemacht hat, verliert sie mehr und mehr den Boden unter den Füßen. Warum hat sie nie etwas bemerkt vom Doppelleben ihres Mannes jenseits der Grenzen bürgerlicher Sexualmoral? Und was wissen Liz und Max Donati, ihre besten Freunde, über die perversen Vorlieben von Martin? Schließlich geschieht ein blutiges Verbrechen, das die ganze grausame Wahrheit ans Tageslicht bringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brigitte Riebe
Ehemänner und andere Fremde
Roman
Copyright dieser Ausgabe © 2012 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg. Copyright der Originalausgabe © 1997 by Brigitte Riebe
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-000-5
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Cover
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Toscana
Sexuelle Freiheit, Befreiung der Sexualität: moderne Illusionen. Wir sind hierarchiebewußte Tiere.
CAMILLE PAGLIA, Die Masken der Sexualität
Jedes Foto ist ein Tod.
RICHARD AVEDON
All das Dunkle, auf dessen Grund die Institution der Ehe sich erhebt, die barbarische Verfügung des Mannes über Eigentum und Arbeit der Frau, die nicht minder barbarische Sexualunterdrückung, die den Mann tendenziell dazu nötigt, für die sein Leben lang die Verantwortung zu übernehmen, mit der zu schlafen ihm einmal Lust bereitete – all das kriecht aus den Kellern und Fundamenten ins Freie, wenn das Haus demoliert ist.
THEODOR W. ADORNO, Minima Moralia
1
Ihre Hände zitterten. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen. Alles in ihr schrie nach sofortiger Flucht. Aber sie blieb auf dem Bett sitzen, kerzengerade, den Rücken gegen die Wand gepreßt. Sie hielt den Hörer umklammert und lauschte endlos lange dem Freizeichen. Niemand hob ab. Kein Anrufbeantworter sprang an. Auch das Autotelefon blieb, nachdem sie abermals gewählt hatte, tot. Als Ruth Bastian es satt hatte, wie gebannt die gegenüberliegende weiße Wand zu fixieren, legte sie auf, erhob sich und ging langsam zum Fenster hinüber. Aus einem plötzlichen Impuls heraus schlug sie mit der flachen Hand gegen den hölzernen Rahmen. Und ein zweites Mal. Es tat weh, ordentlich weh sogar, und sie war so erleichtert über den körperlichen Schmerz, daß sie auf der Stelle hätte losheulen können. Sie biß sich auf die Lippe und kämpfte gegen die Woge von Angst, Enttäuschung und Wut an, die sie zu überwältigen drohte.
Wo verdammt noch mal steckte Martin?
Sie war schon lange vor Anbruch der Dämmerung aufgestanden; ein Blick auf ihre Armbanduhr zeigte, daß es inzwischen kurz nach sieben war. Ruth öffnete das Fenster einen Spalt und sog die frostige Luft ein. Es roch nach Schnee und war entschieden zu kalt für Ende Februar. Sie machte ein paar tiefe Atemzüge. Auch ohne Spiegel wußte sie, wie sie im Moment aussah: eine große, dunkelhaarige Frau mit aufgelösten Zügen, blassen, zerbissenen Lippen und den steilen Falten, die immer dann auf ihrer Stirn erschienen, wenn sie besonders zornig oder durcheinander war.
Allmählich legte sich das flaue Gefühl im Magen. Sie strich eine lästige Strähne aus dem Gesicht; ihre Hände flatterten noch immer leicht, ihr Verstand aber begann wieder zu arbeiten, klar, schnell und präzise, wie sie es gewohnt war. War sie denn verrückt geworden, wegen einer Lappalie so außer sich zu geraten? Zu Hause, jenseits des Atlantiks, war es drei Uhr mittag und Freitag noch dazu. Konnte sie da ernsthaft erwarten, daß er noch am Schreibtisch saß und auf ihren Anruf lauerte? Warum es später nicht noch einmal versuchen, in aller Ruhe und ohne jeden Vorwurf? Egal, ob er schon auf dem Heimweg war, mit Geschäftsfreunden noch essen oder sonstwo unterwegs – irgendwann mußte Martin ja schließlich nach Hause kommen.
Muß er das? höhnte die unfreundliche Stimme in ihr, der sie schon seit einiger Zeit auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war. Woher willst du das eigentlich so genau wissen? Halt die Klappe! dachte Ruth grimmig und zog die Wolljacke enger um die Schultern. Und laß mich endlich in Ruhe! Ich habe hier doch wirklich schon genug um die Ohren!
Ein tiefer, grauer Himmel hing über Santa Fé; kein Sonnenstrahl drang durch die dichte Wolkendecke. Nur im Norden zeichnete sich ein schmaler Streifen zornigen Grüns ab, der, so die Ankündigung des lokalen Radiosenders, Sturmböen bis zu Windstärke acht bedeuten konnte. Wieder kein Leuchten über dem Horizont, wieder keine Spur von dem berühmten Licht New Mexicos, das, wie alle vor ihrer Abreise geschwärmt hatten, Hügel, Schluchten und Flußtäler in Gold, Siena, Purpur und dunklem Graubraun schimmern läßt, wieder kein irisierendes Flimmern in klarer, durchsichtiger Luft, geschweige denn ein Äther, weiter und blauer und unendlicher als jeder Ozean. Vorgestern Nebelbänke, gestern schneeversetzter Dauerregen, der sie kurz nach Mittag zum Abbrechen genötigt hatte, und heute sah es ganz so aus, als bräuchten sie ihre Jeeps erst gar nicht zu beladen.
Schon die letzten beiden Produktionen hatten reichlich Nerven gekostet, aber diese Modeaufnahmen empfand Ruth als schier unerträglich. Das Honorar, mit dem sie ein Steuerloch stopfen wollte, die Aussicht, ein paar Tage dem heimischen Matsch zu entfliehen, ein scheinbar verlockendes Reiseziel – alles Quatsch! Sie hatte sich den Auftrag so lange schöngeredet, bis sie halbwegs überzeugt war. Aber eben nur halbwegs. »Gewürzfarben im Indianerland« – allein diese Headline sprach Bände!
Ruth hatte die Country-Mode, die sie für eine renommierte Frauenzeitschrift fotografieren sollte, von Anfang an nicht besonders gefallen – und schon gar nicht die überreichlich mitgelieferten Vorgaben. Außerdem gab es Schwierigkeiten im Team. Und jetzt auch noch dieses Wetter! Sie hatte sich in regelrechte Haßgefühle gegenüber der düster-verhangenen Landschaft hineingesteigert. So nah am Aufgeben war sie noch nie gewesen. Warum nicht auf der Stelle abbrechen? Die Koffer packen und nach Hause fahren, bevor weitere Kosten anfielen?
Die Redaktion in München war kopfgestanden, als sie diesen Vorschlag gemacht hatte. Also harrten sie aus und hofften. Aber die ersehnte Wendung ließ weiterhin auf sich warten. Es gab nur noch eine Lösung: das gesamte bisherige Layout umstoßen und ganz von vorn anfangen. Wieder lange nächtliche Krisensitzungen mit Vera, der mitreisenden Redakteurin, wieder Dutzende von Telefonaten, begleitet von hektisch hin- und hergefaxten Entwürfen. Schließlich brachten vereinte Anstrengungen einen annehmbaren Neuansatz zustande. Ruth konnte endlich zu arbeiten beginnen.
Allerdings bedeutete das die Suche nach neuen Locations. Endlos hatten sie in den letzten Tagen touristisch umfrisierte Pueblos, Kakteenmeere, winteröde Steppenlandschaften und karge Hochwüsten durchstreift. Lag es an Ruths immenser innerer Anspannung oder am wachsenden Streß im Team – der vielbesungene Zauber dieser Region wirkte bei ihr nicht richtig. Nur die Berge flößten ihr Respekt ein, Giganten, die in einen bleiernen Himmel ragten, glatt und unberührt wie überdimensionale Schiefertafeln die einen, Sandsteinpfeiler, kupfern und zerborsten, die anderen. Es erschien ihr beinahe als Sakrileg, sie als Kulisse für Modeaufnahmen zu mißbrauchen. Und offenbar ging es nicht nur ihr so, selbst die sonst unbekümmerten Models verspürten im gewaltigen Schatten dieser Riesen eine Art heilige Scheu. Jedenfalls verzichteten sie auf ihr gewohntes Protestpalaver, bevor sie sich aus ihren wärmenden Schichten schälten und vor der Kamera posierten.
Crissie, die jüngste von allen, mit rostfarbenen Locken und Myriaden von Sommersprossen, besaß die richtige Mischung aus Unbefangenheit, Straßengörenschalk und leiser Verruchtheit, um in den intimen Dialog mit der Kamera zu treten. Wenn sie sich exaltiert und schamlos vor Ruths altgedienter Nikon wand und diesen zweideutigen Komm-her-aber-bleib-mir-gefälligst-vom-Leib-Blick aufsetzte, vergaß man, daß man sie gerade noch für ein mageres, zu groß geratenes Kind hätte halten können. Neben ihr wirkten die anderen steif, nahezu unbeholfen. So ergab es sich scheinbar wie von selbst, daß Crissie, von allen eifersüchtig beäugt, zum beunruhigend präsenten Mittelpunkt der neuen, sehr eigenwilligen Kompositionen Ruths wurde.
Da die diesigen Lichtverhältnisse gegen harte Konturen sprachen, arbeitete sie verstärkt mit Spezialfiltern, Weichzeichnern oder Diffusem und setzte auf den Effekt sanfter Linien und fließender Bewegungen. Vor vielen Jahren war sie brillant in dieser Technik gewesen, nun mußte sie jeden Tag aufs neue dazulernen. Und doch, es funktionierte offenbar; ein paar der Polaroids waren aufregend, versprachen satte, beinahe monochrome Bilder von melancholischer Schönheit. Stoffe und Landschaft schienen ineinander verwoben, die erdigen, gedämpften Farben der Kollektion mit dem Braun und Rosenholz und Rauchblau der Natur verschmolzen. Sie konnte nur hoffen, daß sich beim Entwickeln der Diafilme keine unliebsamen Überraschungen zeigen würden. Aber für eine weitere Neuorientierung war es ohnehin zu spät; noch drei Tage, zog man den heutigen ab, dann mußte das Set endgültig im Kasten sein.
Vermutlich wäre die Arbeit trotz aller Schwierigkeiten reibungsloser verlaufen, hätte sich Ingo, ihr Assistent, nicht als Fehlbesetzung entpuppt. Er war träge, nicht besonders geschickt und stand die meiste Zeit im Weg herum. Dafür war sein Talent als Intrigant um so beachtlicher. Offenbar tief von dem Umstand getroffen, daß er einer Frau zuarbeiten mußte, nutzte er jede Gelegenheit, um aufzubegehren oder miese Stimmung gegen Ruth zu machen. Nicht nur ihm gegenüber hatte sie sich deshalb einen knappen, fast schon ruppigen Ton angewöhnt. Sie ertappte sich dabei, daß sie auch die Models anraunzte, die ihrerseits trotzig reagierten; kein Wunder, daß die Stimmung innerhalb der kleinen Gruppe mittlerweile hochexplosiv war.
Was war eigentlich los mit ihr? Lag es tatsächlich am geballten Anblick naiven Frischfleischs, daß Ruth täglich unleidlicher wurde, wie Fee, die Stylistin, frech behauptet hatte? Hatte es mit den stumpfen, schnapsroten Augen der Indianer zu tun, die sie bis in ihre Träume verfolgten? Oder gab es nach über zehn Jahren Arbeit als Modefotografin Anzeichen von Ermüdung oder gar Resignation?
Ruth schob diese Gedanken beiseite, allerdings nicht rasch genug. Ein Nachgeschmack blieb; ihre Kehle fühlte sich plötzlich so trocken an, daß das Verlangen nach heißem Kaffee nahezu übermächtig wurde. Sie schloß das Fenster, nahm ihre Tasche und verließ das Zimmer. Im schmalen, immer zu dunklen Flur, der nach vorn zur Küche führte, duftete es nach frischem Kuchen. Offenbar hatte Mary, die sich auf rührende Weise um das Wohl ihrer Gäste kümmerte, eine ihrer spontanen Backschichten eingelegt.
In dem kleinen, funktional eingerichteten Raum standen zwei große Thermoskannen mit Kaffee bereit, daneben eine Platte mit warmen Muffins. Ruth schenkte sich eine große Henkeltasse ein, schüttete reichlich Milch zu und nahm ein Stück von dem Gebäck. Mit beidem verzog sie sich in den Wintergarten, den sie zu dieser frühen Stunde noch ganz für sich hatte.
Draußen war der Wind so stark geworden, daß die winzigen Kolibris nicht mehr um ihre hängende Zuckertränke schwirren konnten; sie wurden abgetrieben wie schwerelose, schillernde Federknäuel, gaben aber erst auf, als ihre Kräfte erlahmt waren, und suchten schließlich unter der blauen Holzbank Schutz. Ein paar dicke Flocken fielen, dann kam der Schnee als dichter Schleier. Im Nu war der Rasen verschwunden und das ganze Grundstück weiß. Über dem geheizten Whirlpool stiegen Dampfwolken auf.
Ruth begann zu frösteln trotz der Wärme, die zwei Radiatoren verbreiteten. Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, wirklich ehrlich, dann wußte sie sehr wohl, woher ihre innere Unruhe rührte. Es war der Gedanke an Martin, der sie nicht losließ.
Warum konnte er nicht anrufen, nur dieses eine Mal?
Sie seufzte halblaut. Sie kannte die Antwort, kannte sie bestens. Er, Meister aller Meister im Ausweichen, würde wieder die passende Ausrede parat haben. Wahlweise hatte er den Zettel verlegt, auf dem sie ihm alle Telefonnummern aufgelistet hatte, oder er behauptete, ihre Schrift sei unleserlich und er habe zudem bis über beide Ohren in Arbeit gesteckt. Immer wieder gelobte Martin Besserung, niemals hatte er sein Versprechen gehalten. Ruth hatte gelernt, damit zu leben. Weshalb also die ganze Aufregung? Was war schon anders als die vielen Male zuvor?
Alles, dachte Ruth. Alles. Schon im Flugzeug hatte sie begonnen, ihn zu vermissen, mit einer wehmütigen, hoffnungslosen Intensität, die sie selbst erschreckte. Wenn sie die Augen schloß und sein Bild heraufbeschwor, hatte sie das Gefühl, als weite sich ihr Herz und beginne gleichzeitig, schneller und dumpfer zu schlagen. In den letzten Monaten wirkte er gehetzt und müde, irgendwie bedrückt. Die Augen tiefer in den Höhlen, die Haut straffer über den Wangenknochen.
»Der Zahn der Zeit«, hatte er lächelnd abgewehrt, als sie ihn darauf ansprach, mit diesem weisen, leicht entrückten Gesichtsausdruck, der allen weiteren Nachfragen einen Riegel vorschob, sanft und höflich, aber bestimmt. Wenn Martin nicht wollte, konnte niemand zu ihm durchdringen. »Frauen tragen ein bißchen mehr Rouge auf oder kaufen sich ein neues Kleid. Männern bleibt nichts anderes übrig, als mit Anstand grau und faltig zu werden. Über Vierzig sind wir alle fällig, schau dich doch nur mal um! Ganz schön ungerecht eigentlich, meinst du nicht?«
Sie trank ihre Tasse leer und zog ihren Terminplaner heraus. Im hinteren Fach steckten die Fotos, die sie auf allen Reisen dabeihatte. Großmutter Wilma, Isolde, Timmie als Welpe. Und Martin. Immer wieder Martin.
Am meisten mochte sie den Schnappschuß, den Max gemacht hatte. Darauf schimmerte Martins braunes Haar rötlich, und die Sommersprossen auf der Nase, die sie an ihm so liebte und er überhaupt nicht leiden konnte, machten ihn frech und jungenhaft. Von wegen faltig und grau! Er lachte aus vollem Hals; unübersehbar die Lücke zwischen seinen vorderen Schneidezähnen. Er war von unten bis oben naß. Jakob hatte ihn gerade mit seiner nagelneuen Wasserpistole bespritzt. Es war der dritte Geburtstag des Sohnes ihrer Nachbarn und Freunde gewesen, sie erinnerte sich noch so genau daran, weil der Nachmittag, der ausgelassen begonnen hatte, wenig später unschön in Streit und Tränen endete.
Eigentlich seltsam, dachte Ruth, und fuhr mit der Fingerkuppe auf dem Foto langsam die Kuhle von Martins Schlüsselbein nach, daß die meisten Festivitäten bei den Donatis ähnlich enden. Lag es an Liz’ exaltierter Vorfreude, die alle einschüchterte? An der zerstreuten Reserviertheit, die Max immer gerade dann an den Tag legte, wenn sie Gäste empfingen? Oder daran, daß Jakobs Stimmungen so instabil waren und schon kleinste Vorkommnisse ihn aus dem Gleichgewicht bringen konnten?
Auf dem Foto, das sie erst vor ein paar Wochen gemacht hatte, grinste er und hatte zum Glück nicht das blasse, verletzte Gesichtchen, das sie viel zu gut an ihm kannte. Sein langes, hellbraunes Haar war verfilzt und über der Stirn verschnitten, die meergrauen Augen wirkten übergroß. Mehr denn je erinnerte er sie an Elfengestalten aus altmodischen Kinderbüchern. Er war zu klein für sein Alter und viel zu dünn, sein Hals schien erschreckend zart unter dem schweren Kopf. Obwohl er mittlerweile fast fünf war und damit zu den Großen im Kindergarten gehörte, hatte er noch immer nicht gelernt, sich zu behaupten. Die meiste Zeit lebte er zurückgezogen in seiner Traumwelt. Seine Schüchternheit ging so weit, daß er kaum mit anderen Kindern sprach. Wenn er überhaupt redete. Was dann noch lange nicht hieß, daß man ihn auch verstand.
Sie blätterte schnell weiter und betrachtete ein altes Kinderbild von Martin, natürlich schwarzweiß und verknittert vom langen Herumtragen. Er hatte keine Ahnung, daß sie es schon beim ersten Besuch heimlich aus dem Album seines Vaters genommen hatte; es war nicht das einzige geblieben, inzwischen besaß sie eine ganze Sammlung davon. Er sah ernst darauf aus, ein kleiner Kämpfer mit trotzigen Augen und geballten Fäusten. Neben ihm im Gras lag ein hölzerner Roller.
Idiot! dachte sie mit jäh aufflammender Zärtlichkeit. Spürst du nicht, daß wir wertvolle Zeit vergeuden?
Ein Räuspern ließ sie hochfahren. Crissie, bis zu den Knöcheln in einem Flanellnachthemd, schaute ihr neugierig über die Schulter. Sie hatte Schichten von dunkelblauer Algenmaske aufgelegt, das Haar zu Zöpfen geflochten und sah keinen Tag älter als fünfzehn aus.
»Darf ich sehen mal?«
Ihr flüssiges, grammatikalisch jedoch chaotisches Deutsch verdankte sie, wie sie jedem erzählte, einer Grandma, die aus Heidelberg stammte.
Wie ertappt schob Ruth die Bilder übereinander. Obenauf blieb der kleine Martin liegen. Crissie hatte ihre Hände schneller an dem Foto, als Ruth lieb war.
»Dein Kind? Ich mein’, dein Junge? Oh, zeig ihm mir! Er ist so klein und niedlich.«
Unwillkürlich nickte Ruth. Mein Gott, sie hatte tatsächlich genickt!
»Wie ist sein Name?« Crissie schien die Befangenheit Ruths nicht zu spüren.
»Paul«, sagte diese schnell. »Das ist Paul.« So hätte ihr Sohn heißen sollen. Wenn sie einen Sohn gehabt hätten.
Sie konnte nur ganz flach weiteratmen. Eine Art weicher, dunkler Schwindel hatte sie überfallen, der ihre Knochen gallertartig machte. Zum Glück konnte sie sitzen bleiben. Vermutlich hätte sie es nicht einmal bis zum Nebentisch geschafft.
»Ist er fünf? Oder erst vier? Vermißt du ihm? Sehr?«
Ruth spürte einen heißen Knoten aus Scham in der Nähe ihres Nabels. Weshalb hatte sie gelogen? Und wieso tat sie das immer wieder? Ihre Wangen brannten. Sie mußte dunkelrot geworden sein.
»Ich könnte mein Kind nicht lassen für so lange Zeit, das weiß ich«, zwitscherte das Mädchen weiter. »Du mußt ihm immer anrufen, daß er seine Mommy spürt! Verspricht?«
Jetzt waren die Tränen gefährlich nah, gegen die Ruth schon den ganzen Morgen angekämpft hatte. Sie hörte Schritte, halblautes Lachen, Ingos typisches Fluchen. Sie räusperte sich im allerletzten Augenblick. Ihr Assistent, Fee, Vera und ein paar der Mädchen kamen mit Kannen, Tellern und Tassen herein. Im Nu waren die kleinen Tische gedeckt; zwei der Models knabberten tapfer an ihren ungesalzenen Reiskeksen, während die anderen über die frischen Muffins herfielen.
»Sieht nicht so aus, als kämen wir heute entscheidend weiter.« Vera, einen großen Kaffeepott in der Hand, deutete nach draußen. Es schneite, dünn inzwischen, aber gleichmäßig. »Was schlägst du vor? Im Hotel bleiben? Däumchen drehen und wieder mal abwarten?«
Der Streß der vergangenen Tage und die lockere amerikanische Art, mit Vornamen umzugehen, hatten dazu geführt, daß sich alle im Team duzten. Ruth hatte sich wohl oder übel angeschlossen, wenngleich sie den meisten gegenüber lieber förmlicher geblieben wäre.
»Bis Mittag auf jeden Fall«, erwiderte sie und benützte die Gelegenheit, um Fotos und Notizbuch verschwinden zu lassen. Sie hatte sich schon fast wieder ganz im Griff. »Falls sich der Sturm legt, fahren wir später noch rüber nach Galisteo und machen das Wüsten-Set mit den bunten Lederjacken. Könnte ich mir im Extremfall sogar vor Weiß ganz reizvoll vorstellen, vorausgesetzt, der Schnee bleibt so lange liegen. Ich denke, mit vier Stunden müßten wir hinkommen.« Sie wandte sich an die Stylistin. »Fee, such schon mal die passenden Accessoires raus, und bügle die Leinenhosen auf! Und du, Andrea, kannst gleich nach dem Frühstück mit Haaren und Make-up anfangen.« Prüfend schaute sie zu den Models hinüber. »Petra, Crissie, Susanne und Melanie, ihr vier seid heute dran. Kathrin, du hältst dich bitte als Reserve bereit!«
»Und falls nicht?« Das kam natürlich von Ingo. »Was, wenn dieses Pißwetter weiter anhält?«
Ruth warf ihrem Assistenten einen scharfen Blick zu. »Na, allerherzlichste Gratulation! Dann ist heute der freie Tag, um den du kämpfst, seitdem wir ins Flugzeug gestiegen sind. Jeder kann tun und lassen, was er will, vorausgesetzt, es gefährdet nicht seine Arbeitskraft.«
Die Mädchen kicherten. Alle wußten, worauf sie anspielte. Vor ein paar Abenden hatte Ingo sich in den Jeep gesetzt und war von einer Kneipentour so volltrunken zurückgekommen, daß er am nächsten Morgen, noch ganz unsicher auf den Beinen, beinahe Stativ und Kamera umgerissen hätte.
»Liegt echt kein Segen drauf, wenn Weiber das Sagen haben«, murmelte er halblaut und wandte sich in Richtung Tür. »Sind einfach nicht dafür gemacht, das steht fest.«
»Die Filme für heute kommen in die Schutztaschen«, rief Ruth ihm ungerührt hinterher. »Alle! Die Hasselblad und die Ersatz-Nikon nehmen wir auch mit! Aber die Ausrüstung bleibt noch im Warmen, verstanden? So lange, bis wir definitiv entschieden haben, ob wir fahren oder nicht.«
Er reagierte mit einem Brummen, das alles bedeuten konnte, und verschwand. Die Models, zum Haarewaschen und Anziehen verdonnert, taten es ihm nach. Vera verzog sich mit der Zeitung in eine Ecke. Fee kramte ihre Zigaretten heraus, schüttelte den Kopf und steckte sie wieder weg. Ungewöhnlich, daß sie nicht sofort zu rauchen begann, kaum daß sie auf den Beinen war. Ruth hatte schon in verschiedenen Ländern mit ihr gearbeitet und wußte, wie abhängig sie war.
»Einen Schluck Kaffee?«
Ruth deutete auf die Kanne, froh darüber, daß der Arbeitstag mit all seinen kleinen Ritualen langsam anlief und ihre düsteren Gedanken in den Hintergrund gedrängt hatte, zumindest ein Stück. Richtig ruhig, das wußte sie genau, würde sie erst werden, wenn sie Martins Stimme hörte.
»Danke, ich bleibe lieber bei Kräutertee.« Fee übersah Ruths fragend hochgezogene Brauen. »Sag mal, hast du zufällig Lust auf eine kleine Ortsbesichtigung?« Wie immer war sie exotisch gekleidet, mit gefleckten Lederhosen und einem Hemd im Russenstil, das sie nach eigenen Angaben einem Mitglied des Bolschoi-Theaters abgeluchst hatte. Darüber trug sie einen breiten, silberbeschlagenen Gürtel und mindestens ein Dutzend verschieden lange Türkisketten. An ihrem Hals baumelte ein großer, goldgefaßter Kristall. »Natürlich nur, wenn wir nicht arbeiten. Ich kenn’ mich hier ganz gut aus. Ist ein aufregender Fleck auf unserer Mutter Erde, dieses Santa Fé. Tarot, Pendeln, Auralesen, was immer du willst – ganz schön ausgeflippt die People hier, kann ich dir sagen.«
»Falls du damit andeuten willst, daß Wahrsagerinnen oder ähnliches auf deinem Programm stehen; passe ich sofort«, protestierte Ruth. »Du weißt doch, daß ich mit dem ganzen Zeug nichts anfangen kann! Das eine Mal hat mir wirklich gereicht.«
»Keine Wiederholung von Amalfi, das verspreche ich hoch und heilig! Ein Stadtbummel, nichts weiter.«
Fee erhob sich anmutig. Sie war klein und drall, aber perfekt proportioniert. Kußmund, Porzellanteint, rabenschwarze Locken. Der Typ Frau, dem Männer scharenweise nachlaufen. Leider jedoch immer die falschen, wie sie behauptete, beispielsweise der Italiener, der sie damals in Amalfi bedrängt hatte. Die Fotoarbeit war vorbei. Ruth und sie hatten sich auf einen entspannten Abschiedsabend bei Wein und Pasta gefreut. Statt dessen gab der Mann keine Ruhe, bis sie ihm schließlich zum Strand gefolgt waren. Dort, bei den Bootsschuppen, wartete die Alte auf sie. Sie behandelte Fee, als sei sie gar nicht vorhanden, und hatte nur Augen für Ruth, schwarz, glühend, unheimlich; so lange sie lebte, würde sie dieses Augenpaar nicht mehr vergessen, ebensowenig die rauhen Finger, die ihre Hand gepackt und festgehalten hatten. Sogar Fee, die von Okkultem nicht genug bekommen konnte, war in jener Nacht ängstlich geworden. Ihre Stimme hatte ganz brüchig geklungen – kein Wunder bei dem, was sie zu übersetzen hatte.
»Ich sehe den Tod in deinem Leben, spüre seinen Atem, ganz in deiner Nähe. Jemand, den du liebst. Sehr jung, viel zu jung. Du mußt noch warten. Aber er kommt, kommt zu dir auf den schwarzen Flügeln der Nacht …«
Unsinn, natürlich. Sie wußten es alle beide. Aber keine von ihnen verspürte Lust, je wieder über jene Nacht zu sprechen.
»Ich geh’ dann erst mal bügeln«, sagte Fee. »Wir müssen ohnehin abwarten, was sich tut.«
»Ja«, sagte Ruth, »das müssen wir.«
Jetzt war Martin wieder ganz präsent, und die Gelassenheit, die sie ausstrahlte, nur gespielt. Sie spürte, wie ihr die Kontrolle abermals zu entgleiten drohte, und sie versuchte stark zu bleiben. Ob er inzwischen nach Hause gekommen war? Ihr graute vor dem Gedanken, ihn wieder anzurufen. Aber sie mußte es tun. Sie hatte keine andere Wahl.
Wann hatte sie zum erstenmal gelogen? Auf eines von Martins Kinderfotos gezeigt und behauptet, das sei Paul, ihr kleiner Junge. Während der Fahrt vom Hotel nach Santa Fé fiel es ihr wieder ein.
Kaum Verkehr auf der nassen Straße, nur eine Handvoll Autos, die sie überholten oder ihnen entgegenkamen. Der Wind war abgeflaut, aber ab und zu schneite es noch in dünnen, weißen Fäden. Über den Hügeln im Südwesten lag blaßgelbes Licht. Es schien ein wenig heller geworden zu sein, eine durchgreifende Wetterbesserung jedoch war erst für morgen angekündigt. Ruth hatte dem Team den Nachmittag freigegeben und sich entschlossen, Fee in die Stadt zu begleiten.
Es war während einer Zugfahrt von München nach Frankfurt am Main gewesen, lange vor Jakob Donatis Geburt.
Nur noch undeutlich erinnerte sie sich an das teigige Gesicht der Frau gegenüber, die sie in ein endloses Gespräch über die Schar ihrer Töchter, Söhne und Enkel verwickelt hatte. Irgendwann waren Ruth die halb anteilnehmenden, halb unverschämten Fragen nach ihrer Familie zuviel geworden; um die andere endlich zum Schweigen zu bringen, aber auch aus einem merkwürdigen Bedürfnis heraus, sich zu rechtfertigen, hatte sie ihr das Bild gezeigt. Damals war Kinderlosigkeit noch kein Thema für sie gewesen, eher ein vages Schreckgespenst, das ausschließlich andere betraf. Zeit? Mein Gott, was bedeutete damals Zeit für sie? Sie besaß doch Unmengen davon! Sie war gerade dreißig und hatte Martin soeben geheiratet.
Allerdings nicht ganz so, wie sie es sich immer gewünscht hatte: eine kleine, intime Feier auf der Fraueninsel mitten im Chiemsee, nur mit Wilma, Isolde und Ferdinand, seinem Vater, und natürlich den Trauzeugen Max, Martins Partner, und Mona, ihrer Sandkastenfreundin. Martin jedoch hatte zu ihrer Überraschung auf einer bombastischen Hochzeitsveranstaltung bestanden. Sie hatten damals so oft über das Wer und Wie und Wo gesprochen, daß Ruth sich schon allein davon müde und krank fühlte.
Martin dagegen wirkte wie berauscht. Seine Augen hatten einen seltsamen Glanz. »Alle sollen dabeisein, wenn wir den Bund fürs Leben eingehen. Und eines sag’ ich dir auch gleich, mein Herz. Merk es dir gut! Wenn schon – dann für immer. Eine Scheidung kommt nicht in Frage.«
In diesem Augenblick hätte sie am liebsten alles rückgängig gemacht, sich ins Flugzeug gesetzt, um irgendwohin zu fliegen, aber dafür war es wohl zu spät. Die Ringe waren gekauft. Das Kleid fertiggenäht. Der Termin festgesetzt.
Die Vorbereitungen, die Trauung selbst und die anschließende Party erlebte sie wie in Trance. Ihr sonst so sparsamer Bräutigam gab das Geld in vollen Zügen aus; nichts war ihm zu teuer, nichts aufwendig genug. Eine ehemalige Fabrikhalle wurde angemietet, alles war im Überfluß vorhanden, als wäre der letzte aller Tage angebrochen. Eine Farbe regierte: loderndes, feuriges Rot, wie die Liebe, wie das Herzblut. Rot war ihr Brautkleid, rot die Rose, die Martin im Knopfloch hatte. Rot trugen auch die Mitglieder der Band. Bei Samba und Salsa, Tango und Rock feierten sie ein wildes, heidnisches Fest, während draußen Novembernebel zogen und heftiger Regen auf das Dach trommelte. Niemals zuvor hatte sie Martin attraktiver gefunden, niemals ihn mehr begehrt. Er tanzte die ganze Nacht bis zum Morgengrauen, mit Frauen, mit Männern, bewegte seine Hüften auf die herausfordernde, geschmeidig-laszive Art, die noch heute ihre Knie weich werden ließ. Und er trank. Nie wieder hatte sie ihn so trinken sehen.
Irgendwann, viel zu schnell, war alles vorbei. Dann fiel er neben ihr in das Himmelbett, Monas Vermählungsgeschenk, und schlief sofort ein. Es gab keine Hochzeitsnacht, keine Umarmungen, nicht einmal Hautkontakt. Ruth wollte sich ihre Enttäuschung nicht anmerken lassen, Martin spürte sie trotzdem.
»Mach doch nicht so ein böses Gesicht! Holen wir alles ausgiebig nach.« Seine rauhe Katerstimme am nächsten Nachmittag, als er endlich wieder die Augen aufschlug und nach Kaffee und Aspirin verlangte, hatte sie bis heute nicht aus ihrem Gedächtnis löschen können, ebensowenig die Stunden, in denen sie stumm und hilflos seinem schweren Atem gelauscht hatte.
Mehr als acht Jahre waren seit jener Nacht vergangen. Der Kokon um Martin hatte sich verändert, war fester und immer dichter geworden. Wer war dieser Mann, der an ihrer Seite lebte? Im Grunde wußte sie wenig von ihm. Nicht, daß er ihr gegenüber unfreundlich oder lieblos gewesen wäre. O nein, dachte Ruth voller Bitterkeit, während die ersten braunen Adobe-Häuser an ihnen vorbeiglitten, wir gehen behutsam miteinander um, höflich, richtiggehend nett. Das perfekte Paar, von vielen bewundert und beneidet.
Sie waren am Parkplatz angekommen. Fee stellte den Motor ab. »Willkommen im ›Herzen der tanzenden Sonne‹! So haben die Indianer früher diesen Platz genannt. Paßt doch gut, findest du nicht?«
Ruth starrte vor sich hin.
»Du hast ihn nicht erreicht, stimmt’s? Hab’ ich mir gleich gedacht, als ich dein Gesicht beim Einsteigen gesehen habe.«
»Nein. Er muß wohl noch unterwegs sein.«
»Vermißt du ihn?«
»Ach, auch nicht mehr als sonst.« Sie verbannte jeden Ausdruck aus ihrem Gesicht bis auf ein, wie sie hoffte, nichtssagendes Lächeln. In diesem Augenblick bereute Ruth, Fee eingeweiht zu haben, wenn auch nur andeutungsweise. Ihr Mitgefühl machte alles nur noch schlimmer. Sie sehnte sich nach zu Hause. Jede Bewegung kostete sie unendlich viel Kraft.
»Und du willst wirklich nicht in die Canyon Road mitkommen? Ganz sicher nicht?«
Die ganze Fahrt über hatte Fee von den Galerien, Ateliers, Schmuckläden und Töpferwerkstätten geschwärmt, eine wahre Fundgrube bizarrster Raritäten und Kostbarkeiten, wenn man ihr glauben konnte.
»Danke, aber ich lass’ mich ein bißchen treiben, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Sag mal, kennst du nicht ein nettes Restaurant, wo wir uns später treffen können?« lenkte Ruth ein. Alles immer noch besser, als allein im Hotelzimmer zu dümpeln. »Ein Abend ohne die ganze Bande – ist das nicht eine wunderbare Vorstellung?«
»Natürlich«, erwiderte Fee, noch immer leicht gekränkt. »Taos, Apple Street. Ganz leicht zu finden. Sagen wir gegen sechs?« Sie stieg aus. »Übrigens würde ich an deiner Stelle die Kameratasche nicht im Wagen lassen, nicht in dieser Stadt.«
Ruth hatte ihre alte Nikon eingepackt und ein paar hochempfindliche Schwarzweißfilme. Während die andere davonstöckelte, machte sie sich auf den Weg in Richtung Plaza.
Vor dem Palast der Gouverneure hockten, von einem Säulenumgang nur notdürftig vor der naßkalten Witterung geschützt, Indianer und hatten vor sich Schmuck und Kunstgewerbe ausgebreitet. Ruth schlenderte langsam von einem zum anderen. Vielleicht fand sie etwas Hübsches für Wilma und Isolde. Oder für Jakob. Sie hatte sich angewöhnt, ihm von jeder Reise ein Souvenir mitzubringen. »Die kleine Elster«, wie sie ihn manchmal neckte, liebte alles, was schimmerte und glitzerte. »Senka Smuck!« flüsterte er manchmal in seiner Geheimsprache, dem seltsamen Singsang, in den er verfiel, wenn er aufgeregt war oder etwas unbedingt haben wollte. Trotz seiner Zartheit konnte er ausdauernd und zäh, manchmal geradezu überraschend hartnäckig sein. »Senka Jacco, biti!«
Wann immer sie Ketten, Armreife oder Clips vermißte, wußte sie, wo sie sie finden würde. Nicht, daß etwa Jakob klaute; Ruth sah es nicht so und er selbst erst recht nicht. Er lieh sich lediglich Dinge aus, Dinge, die er schön fand, Dinge, die er zum Spielen brauchte. Er fand es in Ordnung, sie wieder zurückzugeben, auch wenn es ihn traurig machte. »Bissi noch, Rara!« erbat er bisweilen einen kleinen Aufschub. »Bissi, biti!« Inzwischen besaß er ein eigenes Kästchen mit billigem Geschmeide, »Smeidi«, wie er es nannte, das er wie seinen Augapfel hütete. Sie freute sich an seiner Freude, wenn sie ihm ab und zu etwas Neues dazuschenkte.
Ruth erstand schließlich eine Kette aus schmalen, länglichen Türkisen, an der ein silbernes Bärenamulett hing. Sie steckte das Päckchen in ihre Tasche und ging langsam weiter, obwohl der Wind durch ihren Parka blies. Wenigstens fiel kein Schnee mehr. Als sie einen Augenblick zögerte und nach Westen schaute, packte eine junge Indianerin ihre Hand und zerrte sie zu einem hölzernen Stand. Sie hatte wirklich schöne Schmuckstücke zu verkaufen, nicht die billige Massenware, die viele der anderen anboten. Während Ruth eine Kette für Wilma und ein Paar Ohrringe für Isolde aussuchte, ließen sie zwei kleine Mädchen mit festen, bräunlichen Wangen nicht aus den Augen. Ruth bezahlte, ging ein paar Schritte weiter und schaute sich neugierig um.
All diese verschiedenartigen Gesichter um sie herum! Viele von ihnen wirkten stumpf und hatten die erloschenen Augen, die sie schon von den Pueblo-Fahrten her kannte. Einige aber waren anders, dunkel, streng, hoheitsvoll. Königlich, war das Wort, das ihr spontan dazu einfiel. Ja, sie waren Könige, denen man alles genommen hatte bis auf ein paar bunte Fetzen mit Türkisperlen. Sie konnte ihnen nicht zurückgeben, was sie verloren hatten. Sie konnte nur versuchen, mit ihrer Kamera einzufangen, was diese Gesichter ausdrückten und was sie so tief an ihnen berührte: Fremdheit, Würde, Trauer.
Ruth trat ein gutes Stück zurück und zog die Nikon heraus. Sie machte eine Reihe von Aufnahmen mit Teleobjektiv und großer Brennweite. Das Licht war ziemlich schwach; sie hoffte, dennoch genug Tiefe in die Bilder zu bekommen, scharfe Kontraste, die jeden Muskel hervorheben. Allmählich geriet sie in Schwung. Sie arbeitete konzentriert, ab und zu veränderte sie ihren Standort, das war alles. Zwischendrin kam eines der Mädchen zu ihr herüber und zupfte sie am Ärmel. Sie gab ihr ein paar Münzen, um ungestört weitermachen zu können, als Gegenleistung überreichte ihr das Mädchen sehr ernst eine kleine Stoffpuppe mit ein paar blauen Federn.
Nach dem letzten Film erwachte Ruth wie aus einem Traum. Sie spulte den Film zurück, legte ihn in die Tasche zu den anderen. Zu Hause würde sie gleich mit den Entwicklungsarbeiten beginnen. Wahrscheinlich mußte sie zuvor die Dunkelkammer gründlich säubern und aufräumen. Seit Monaten hatte sie sie nicht mehr betreten. Irgend etwas hatte sie daran gehindert, beinahe so etwas wie Furcht. Aber das war jetzt zum Glück vorbei. Als sie ihre Gerätschaften zusammenpackte, stellte sie fest, daß sich tiefe, gelöste Ruhe in ihr ausgebreitet hatte. Und mit einer leisen Verwunderung über sich selbst registrierte sie, daß sie in den vergangenen Stunden kein einziges Mal an Martin gedacht hatte.
Es war ein Fehler gewesen, hierher zu kommen, Ruth wußte es, kaum daß sie den Raum betreten hatte, und ein noch größerer, nicht auf der Stelle wieder hinauszulaufen. Aber inzwischen war es zu spät. Der Kreis war bereits geschlossen; alle schwiegen.
Sie befand sich in einem nachgebauten Kee-vah, was in der Sprache der Hopi Zeremonialraum bedeutete, ein rechteckiges, leicht gewölbtes Gebäude, halb unter der Erde versteckt. Niemals hätte sie etwas ähnliches in dieser Gegend vermutet, einer Neubausiedlung mit schmucken, ockerbraunen Reihenhäuschen, kleinen Gärten und einer zentral gelegenen Pool-Anlage. Weshalb war sie überhaupt mitgegangen? Fee hatte sie nicht einmal lange überreden müssen. Wahrscheinlich war der Auslöser die schwebende, beinahe übermütige Stimmung gewesen, in der sie sich befunden hatte. Die Schwere der letzten Tage und Wochen schien von ihr abgefallen; endlich war wieder die Ruth zum Vorschein gekommen, die sie kannte und mit der sie bestens auskam: die Abenteurerin, die Sammlerin, die unerschrockene Pionierin. Alles schien köstlich gewesen zu sein, der Bohneneintopf, den sie hungrig verschlang, der Wein, die Kerze auf dem Tisch, das schwindende Licht, das den nahenden Abend angekündigt hatte.
»Wieso ißt du eigentlich nichts?«
Fee hatte an einem Mineralwasser genippt und vielsagend gelächelt. »Weil ich noch etwas ganz Spezielles vorhabe. Ich schaue mir ein uraltes Indianerritual an, das kaum noch zelebriert wird. Vielleicht mach’ ich sogar mit. Klingt aufregend, nicht wahr?« Sie hatte kehlig gelacht. »Was ist? Hast du Lust mitzukommen?«
An der Wand vor ihnen befand sich die Feuerstelle, darüber der Kamin, der für Frischluftzufuhr sorgte. Davor hatte man einen primitiven Steinaltar errichtet, auf dem verschiedene Gegenstände lagen. Ruth erkannte einen Stab, eine Trommel, eine Flöte und etwas, das sie an eine Rassel erinnerte. Entlang den Wänden Bänke, hochgemauert und mit bunten Decken belegt, auf denen aber niemand saß. Auch den Boden hatte man bis auf eine Stelle mit farbenfrohen Webteppichen bedeckt. Das freigelassene Loch im Boden vor ihnen, zwischen Feuerstelle und Wand, verkörperte, wie Fee ihr zugeraunt hatte, nach indianischer Tradition den Zugang zu den vier Unterwelten.
Es roch nach Salbei und Weihrauch; der alte Mann, der die Zeremonie leitete und von den anderen respektvoll Großvater Peyote genannt wurde, hatte soeben eine umfangreiche Räucherung vorgenommen. Mehr als ein Dutzend Kerzen warfen seltsame Schatten auf die Gesichter der Anwesenden. Es waren dreizehn: vier Männer, neun Frauen, und Ruth war eine von ihnen. Wieso war sie überhaupt noch hier? Weshalb nicht längst nach draußen gegangen, wo inzwischen ein riesiger, kürbisgelber, fast voller Mond am Himmel stand?
»Begierig auf Geheimnisse?« hatte Fee gefragt. »Willst du verborgene Dinge sehen? Gefühle spüren, die sonst wie ein dunkler Wald in dir verschlossen sind? Nach New Mexico zu reisen heißt auch, zu sich selbst zu kommen.«
»Hör bloß auf mit diesem New-Age-Quatsch!«
»Das, meine Liebe, hat damit nicht das geringste zu tun!« Fee schaute sie prüfend an. »Oder hast du so große Angst vor dem, was du erkennen könntest?«
Ruth war fest entschlossen, nicht zu trinken. Aber als der Alte den Becher an ihre Lippen setzte, trank sie doch. Eine scharfe, säuerliche Flüssigkeit rann durch ihre Kehle. Sie mußte husten. Brechreiz stieg in ihr auf. Panisch erschreckt schaute sie sich um.
»Besser, du wärst wie ich den ganzen Tag nüchtern geblieben«, flüsterte Fee neben ihr. »Aber keine Angst! Das geht schnell vorbei.«
Sie hatte einen glasigen Blick und ein unbestimmtes Lächeln auf den Lippen. Ruth schien sie Lichtjahre entfernt.
Mittlerweile saßen alle auf dem Boden, noch immer im Kreis um das Feuer. Manche hatten den Gürtel gelockert, andere sich Decken um die Schultern gelegt. Ein paar Lieder waren gesungen worden, ein paar Gebete gesprochen; Ruth hatte schweigend zugehört. Der Alte schlug die Trommel und das, was wie eine Rassel aussah, und kam noch zweimal mit dem Becher wieder; beim erstenmal nahm sie einen weiteren Schluck, beim zweitenmal wandte sie den Kopf ab. Schließlich saß der Alte statuengleich vor dem Altar.
Ruth wußte nicht, weshalb sie geblieben war. Im Augenblick wußte sie überhaupt nichts mehr. Unfähig, sich zu bewegen oder auch nur einen klaren Gedanken zu fassen, starrte sie vor sich hin. O Gott, war ihr schlecht! In großen, unregelmäßigen Wellen schwappte Übelkeit über sie hinweg, so unbarmherzig, daß sie beinahe zu atmen vergaß. Voller Panik kniff sie die Augen zusammen. Täuschte sie sich, oder stand da tatsächlich auf einmal ein großer Kaktus im Raum?
Seine stachligen grünen Arme schienen zu wachsen und im nächsten Augenblick zu schrumpfen. Es kam ihr vor, als bewege er sich langsam auf sie zu. Ruth wich unsicher aus und fiel dabei hart auf die Seite. Sie roch die strenge Ausdünstung des Alten, als er sich über sie beugte und sie fürsorglich wieder aufrichtete.
»Sit!« flüsterte er. »And relax! It’s much better to sit. You will soon see why.«
Auch der Raum veränderte sich. Dehnte sich aus, wurde enger, weitete sich wieder. Im nächsten Moment wird das Dach wegfliegen, dachte Ruth noch, dann sitzen wir direkt unter dem Sternenhimmel. Und dann hörte sie ganz zu denken auf.
Sie trieb einfach vor sich hin, Minuten, möglicherweise auch Stunden, bedeutungslos, es schien auf einmal so gleichgültig. Sie war schwerelos, ohne Berührung oder Kontakt, aber warm und pulsierend. Sie lebte. Sie war. Sie empfand sich als atmendes Wesen, aber ob Pflanze, Tier oder Mensch, hätte sie nicht bestimmen können. Im Hintergrund hörte sie undeutliche Geräusche. Als sie einmal den Kopf hob und sich umschaute, sah sie, wie sich der Mann neben ihr in einem Schwall übergab.
Ihr wurde sofort wieder schlecht. Ihre Schläfen schmerzten wie unter unerträglichem Druck, ihr Puls begann zu rasen. Längst hatte sie den Raum verlassen, sie flog, nein, sauste durch lange, dunkle Korridore. Allein. Verzweifelt. Angst krampfte ihren Magen zusammen. Sie begann leise zu wimmern.
Es wurde hell, dann rot. Blut, überall klebte Blut, auf den Buchentreppen, die sie zögernd hinunterstieg, dem Handlauf, den sie schmerzhaft fest umklammerte. Sie zitterte. Es gab nichts, was ihre dünne Haut schützen konnte, weder Schuppen noch Federn oder Fell. Sie war beinahe gelähmt vor Furcht.
Sie hörte schleppende Schritte über sich, ein Zerren und Schieben, als würde ein großer, metallischer Gegenstand bewegt. Dann wieder Stille. Nur mit großer Kraftanstrengung kam sie weiter voran.
Auch der Dielenboden war voller Blutspritzer von einem bedrohlichen, aggressiven Rot. Sie konnte es nicht mehr ertragen, wollte die Augen schließen, um es nicht länger sehen zu müssen, aber sie waren bereits geschlossen. Stickige Luft. Die Fenster waren verriegelt, und in den Räumen lag ein staubiger Geruch, der ihr die Kehle austrocknete und in den Augen brannte.
Es war nicht nötig, eine der Türen zu öffnen. Plötzlich wußte sie auch so Bescheid. In ihren Ohren dröhnte Türenknallen, und sie spürte das erschrockene Zittern der Ziegel. Beklemmung legte sich auf ihr Herz und preßte es zusammen. Schreien wollte sie, um sich schlagen, aber sie brachte keinen einzigen Ton heraus, war bewegungsunfähig.
Sie war gefangen im Haus der flüsternden Wände, und sie wußte, welches Haus es war, sie erkannte es wieder. Es war ihr Haus. Das schöne, rote Haus, in dem sie seit ihrer Heirat mit Martin lebte.
2
Die Donatis stammten ursprünglich aus Monza und besaßen Geld, altes Geld, das sie vor allem im Möbel- und Antiquitätenhandel gemacht hatten. Wesentlich später hatte noch eine Schweizer Linie eingeheiratet, wohlhabende Tuchfabrikanten, die nach und nach die passenden Stoffe beigesteuert hatten. Ob aus Monza, Florenz oder Basel, die meisten Donatis waren mit ganzem Herzen Kaufleute, tüchtig, fleißig und rechtschaffen. Aber vereinzelt hatte es immer wieder Familienmitglieder gegeben, die ausgeschert waren, um eigene Wege einzuschlagen: Erfinder, Philatelisten, Kunstsammler oder Ethnologen. Diesen Sonderlingen und Spinnern, vom Rest der Familie zu Lebzeiten belächelt und teilweise sogar befehdet, verdankten die Donatis eine nahezu komplette Auflage ungarischer Briefmarken aus der Zeit von 1921 bis 1939 sowie eine schmale, aber exquisite Sammlung französischer Impressionisten, zu der unter anderem zwei Werke von Berthe Morisot zählten. Von geradezu unschätzbarem Wert war jedoch, was Andrea Donati und sein Neffe Franco um die Jahrhundertwende auf nicht ganz legale Weise aus Nigeria nach Italien gebracht hatten: ein halbes Dutzend Statuen, Köpfe und Torsi der sagenhaften Könige von Ife, Hunderte von Jahren alt, Bronzearbeiten auf höchstem handwerklichem Niveau und von faszinierendem künstlerischem Wert.
Im Lauf der Zeit hatte man gezielt Weinberge und Olivenhaine erworben, gruppiert um vierzehn verstreut liegende Landsitze in ausgesucht schönen Regionen Italiens. Die Familie war schon so lange reich, daß es nicht ganz einfach war, den exakten Überblick über Mobiles und Immobiles zu behalten. Das gelang am besten Tante Chiara. Sie hatte im Januar ihren siebzigsten Geburtstag gefeiert und lebte in einer erlesen vergammelten Villa unweit von Arezzo, wo sie sich, umgeben von Willy, ihrem sprechenden Beo, kläffenden Hunden und den schönsten Stücken der Africana, ebenso gewitzt wie energisch um die Erhaltung und Vermehrung des Familienvermögens kümmerte.
Sie besaß eine spitze Zunge, schnelle, gletschergraue Augen und einen Gang, der nichts von seiner Elastizität verloren hatte, dazu mehr als einen Hang zu Arroganz. Ganz Dame bis in die gepflegt gebläuten Haarspitzen, war sie gleichzeitig eine Geschäftsfrau, die schon so manchen das Fürchten gelehrt hatte. »Der einzig wahre Kerl der gesamten Sippschaft«, pflegte Max Donati respektvoll von ihr zu sagen, »und ein gutes Stück männlicher, als ich es je sein werde.«
Er hing in zärtlicher Zuneigung an ihr, auch wenn er sich scheute, es nach außen zu zeigen. Im übrigen hätte Tante Chiara »Liebesgesäusel« nicht einmal ansatzweise geduldet. Lieber ging sie auf ihre scherzhafte, bisweilen ruppige Art mit ihm um, was beide herrlich fanden, vielleicht, weil sie in ihm den Sohn sah, den sie nie geboren, und er in ihr die Mutter, die er sich immer gewünscht hatte. Depressionen hatten das Leben seiner wirklichen Mutter schwergemacht; die letzten Jahre ihres Lebens hatte Elisa Donati in einem Schweizer Sanatorium verdämmert. Ihr Tod war für alle eine Erlösung gewesen; Max hatte sich standhaft geweigert, Trauer zu heucheln, auch wenn es von ihm erwartet worden war.
Seine beiden Brüder lebten nicht mehr; Bruno, der jüngere, war den Folgen eines Motorradunfalls erlegen, Filippo, der ältere, mit Anfang Zwanzig im Indischen Ozean ertrunken. Auch sein Vater Leandro, Chiaras Zwillingsbruder, war vor einiger Zeit gestorben. »Ganz beachtliche Menge von Ausfallserscheinungen«, kommentierte Max lakonisch, um schmerzliche Gefühle von vornherein zu ersticken. Vielleicht behandelte er deshalb das Thema Familie – Chiara, seine Frau Liz und den Sohn Jakob ausgenommen – distanziert, am liebsten sogar mit triefendem Spott. Es war ihm peinlich, wenn man ihn auf seine Herkunft ansprach; auf keinen Fall wollte er als fauler reicher Erbe abgestempelt werden. Er tarnte sich durch schlichte, betont unmodische Kleidung, bevorzugte zum Entsetzen seiner Frau klapprige Gebrauchtwagen und schwärmte für Urlaub im Zelt oder Wohnmobil. Auch sein Reihenhaus, das an das der Bastians grenzte, war pures Understatement, trotz aller Umbauten verwinkelt, ungünstig aufgeteilt und mit seinen steilen Treppen nicht gerade komfortabel.
Trotzdem wußte jeder, der ihm begegnete, sehr schnell, woran er war; man konnte den »erstklassigen Stall« geradezu riechen. Massimiliano Anselm Riccardo Donati, wie er mit vollem Namen hieß, hatte ein untrügliches Auge, treffsicheren Geschmack und war in der Lage – kein unerheblicher Vorteil für das expandierende Möbelunternehmen, das er seit einer Reihe von Jahren mit Martin Bastian betrieb –, auf Anhieb Qualität von Minderwertigem zu unterscheiden. Das lag nicht nur an seinem Doktor der Kunstgeschichte oder seinen Lehrjahren in einem feinen britischen Auktionshaus, das lag auch nicht an den Unmengen von Büchern, Fachzeitschriften und Katalogen, die er geradezu manisch erwarb.
Ruth war überzeugt, daß er es im Blut hatte. Ein Hauch von Distinguiertheit umgab ihn, eine Aura vornehmer Zurückhaltung, gegen die Martin wie ein Bauer wirkte. Eine verblüffende Mischung aus Aristokratischem und Animalischem allerdings, denn Max war durchaus fähig aufzubrausen und lautstark auf seinem Recht zu beharren. In solchen Augenblicken erinnerte er Ruth mit seinen vollen schwarzen Haaren und den zornigen Augen an einen Hazienda-Besitzer, dessen hitziges Temperament sich erst durch gezielte Genveredelung in Generationen halbwegs abgeschliffen hatte. Dazu gehörte ebenfalls eine kräftige Prise Ironie, die gelegentlich in herbe Selbstkritik umschlagen konnte.
»Irgend etwas ist faul an diesen Donatis! Ihre Kinder sterben zu früh oder überwerfen sich mit den Eltern. Und der Rest haut ab, wandert eines Tages aus oder verschwindet für immer im Busch.«
Er spielte auf eine Nebenlinie der Familie in Sydney an, auf die die Europäer ein bißchen herabsahen: Horden von Cousins und Cousinen, Farmersfrauen und kraftstrotzenden Baumfällertypen – wenn man den bunten, glänzenden Fotos glauben durfte, die sie in unregelmäßigen Abständen schickten –, geradezu darauf versessen, sich fortzupflanzen. Die Zahl ihrer blondschöpfigen und rothaarigen Nachkommen, all jene Bills, Susans und Mikes, die sich explosionsartig zu vermehren schienen, gab Liz Anlaß zu endlosen Sticheleien. Max wünschte sich seit langem ein zweites Kind, sie jedoch wollte sich durch nichts zu einer neuerlichen Schwangerschaft bewegen lassen. Unweigerlich gab es Streit, wann immer dieses Thema zur Sprache kam.
Kurz vor ihrer Abreise nach Santa Fé war Ruth zufällig Zeugin einer dieser Auseinandersetzungen geworden. Die Härte, mit der die Donatis sich gegenseitig die Argumente an den Kopf warfen, erschreckte sie. Sie wartete, bis Max wütend hinausgegangen war. Erst dann besaß sie den Mut, auf dem Sofa ein Stück näher zu rücken und Liz zu fragen, was in aller Welt gegen ein zweites Kind spreche.
Die blaßgrünen Augen weiteten sich. »Weißt du, was passiert, wenn du schwanger wirst? Willst du das wirklich von mir hören? Als erstes wirst du für Männer unsichtbar. Sie schauen dich an, aber sehen dich nicht, so, als ob es dich gar nicht mehr gäbe. Du hörst einfach auf zu existieren, von einem Augenblick zum anderen. Aber das ist erst der Anfang. Während dein Bauch wächst, beginnst du dich mehr und mehr aufzulösen. Dein Ich verschwindet; du bist nichts anderes als ein Tier, das die Pflicht erfüllt, die die Natur allen weiblichen Tieren auferlegt hat. Ganz und gar machtlos. Dir bleibt nichts anderes übrig, als dich deinem Schicksal zu beugen.«
»Ich denke, du bist gern Mutter?«
»Natürlich bin ich gern Mutter.« Liz antwortete in dem sanften, seltsam ausdruckslosen Ton, den sie sich in den letzten Monaten angewöhnt hatte. Nur wenn man sie sehr gut kannte, hörte man die Ungeduld dahinter. »Das heißt aber doch noch lange nicht, daß ich gleich haufenweise Kinder in die Welt setzen muß, oder? Jakob ist schwierig, viel schwieriger, als ihr alle es wahrhaben wollt. Er braucht meine ungeteilte Aufmerksamkeit, wenn einmal ein halbwegs vernünftiger Mann aus ihm werden soll. Manchmal bin ich so müde und erschöpft, daß ich nur noch weinen könnte. Aber es muß ja weitergehen, nicht wahr?«
Es stimmte, was sie sagte. Sie war ganz und gar für den Kleinen da, beinahe zu viel, wie Ruth inzwischen glaubte, und schirmte ihn gegen die feindliche, gefährliche Welt mit einem Wall aus Fürsorge und Zuwendung regelrecht ab. Ruth kam es vor, als habe Jakob schon längst vor diesem Übermaß resigniert, als versuche er gar nicht mehr, dagegen zu rebellieren. Es fiel ihr schwer, mit Liz darüber zu reden. Deren Reaktion war jedesmal die gleiche.
»So kann nur jemand reden, der selbst keine Kinder hat. Siehst du nicht, wie ungeschickt er ist, wie tolpatschig? Wenn man ihn auch nur eine Sekunde aus den Augen läßt, stolpert er, fällt hin und tut sich fürchterlich weh.«
Jakob, der ein Stück entfernt auf dem Teppich vor dem großen hölzernen Zweimastschoner saß, den sein Vater für ihn zu Weihnachten gebastelt hatte, ließ zwei Playmobil-Piraten hart aneinander geraten und tat, als ob er taub wäre. In Wirklichkeit aber hörte er aufmerksam zu. Ruth war überzeugt, daß er es haßte, wie von ihm in der dritten Person gesprochen wurde, als sei er unwichtig oder gar nicht anwesend; sie sah es an seinem Gesicht, das sich immer mehr verschloß. Natürlich gab er keinen Ton von sich. Wenn ihm etwas gegen den Strich ging, konnte er stunden-, manchmal sogar tagelang verstummen.
»Ganz der Vater!« behauptete Liz. »Typisch Donati! Wenn nicht alles nach seinem Kopf geht, stellt er sich tot. So lange, bis die restliche Welt ihre Fehler reumütig einsieht.«
So oder ähnlich äußerte sie sich auch, wenn es um die sprachlichen Schwierigkeiten ihres Sohnes ging, in heiterem, fast amüsiertem Ton, als handle es sich um nichts anderes als eine kindliche Marotte, die irgendwann von selbst verschwinden würde. In Wirklichkeit aber, davon war Ruth seit langem überzeugt, lagen die Dinge ganz anders.
Als sie vor zwei Tagen aus Santa Fé bei den Donatis angerufen hatte, war nicht Liz, sondern Jakob am Apparat. Während ihrer Abwesenheit mußte etwas geschehen sein, das ihn vollkommen aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Er klang wie ein Zweijähriger, stammelte, stotterte und gab seltsame, fast tierhafte Laute von sich. Kein einziges »Rara« brachte er heraus, nicht einen der kleinen Scherze, die nur sie beide verstanden. Bevor Ruth nachfragen konnte, hatte Liz ihm bereits den Hörer abgenommen und Jakob auf ihre aufgesetzt muntere Art zurück zum Spielen geschickt, als sei alles in bester Ordnung.
»Weißt du, wo Martin steckt? Ich versuche seit Tagen, ihn zu erreichen.«
»Martin?« erwiderte Liz. »Keine Ahnung! Hat uns eines Morgens Timmie in den Flur gesetzt, und weg war er. Warte mal ’ne Sekunde, ich geh’ Max fragen.« Ihr Ton veränderte sich. »Wieso rufst du eigentlich erst jetzt an? Hast uns vor lauter Wichtig-Wichtig wohl total vergessen, was?«
»Martin?« sagte Max dann gedehnt. »Der ist doch in Brandenburg unterwegs. Hat ganz geheimnisvoll getan, unentdeckte Designerstücke, wenn ich es richtig verstanden habe. Hat er dir nicht Bescheid gesagt? Na ja, ärgere dich nicht, du weißt doch, wie er ist! Wird übrigens allmählich Zeit, daß du wieder hier eintrudelst. Ich glaube, unserem Junior fehlst du schon mächtig.«
»Wie geht es Jakob? Er war vorher so merkwürdig am Telefon.«
»Natürlich geht es ihm gut. Was für eine Frage!« versicherte Max. »Abgesehen davon, daß er gerade kräftig schmollt. Liegt wohl an der Beule, die er sich heute früh geholt hat. Wieder mal die Kellertreppe zu schnell genommen. Ich schätze, das geht bald vorbei. Die Mieze vom Nachbarn kriegt Junge, eigentlich müßte es jeden Tag soweit sein. Ich hab’ ihm versprochen, daß er ein Katerchen bekommt. Sozusagen als männliche Verstärkung.«
»Prima Idee.« Sie holte noch einmal tief Luft. »Weißt du zufällig, wann Martin zurück sein wollte?«
Hoffentlich hatte es beiläufig genug geklungen. Eine tiefsitzende Scheu hielt sie davon ab, sich Max gegenüber zu öffnen. Er war Martins bester Freund, nicht ihrer.
»Kommt wahrscheinlich ganz drauf an, wie es bei dem alten Ehrgeizling läuft.« Max lachte spöttisch. »Vielleicht kommt ihr ja zur gleichen Zeit nach Hause. Wär’ doch richtig nett, wenn ihr euch vor der Tür in die Arme laufen würdet, oder?«
»Wahnsinnig nett«, sagte Ruth und legte auf.
Martin war nicht da. Sie wußte es schon, als sie aufschloß und die Tür sich knarzend öffnete. Kein Timmie, der sie mit lautem Bellen schwanzwedelnd empfing. Das Haus war leer, kalt, unbelebt. Sie wagte nicht hineinzugehen. Der Alptraum war noch zu gegenwärtig. Ruth war froh, daß der Taxifahrer, beschwingt von ihrem viel zu hohen Trinkgeld, das Gepäck bis an die Schwelle getragen hatte.
»Sie sind ja auf einmal so grün um die Nase. Ist Ihnen nicht gut?« erkundigte er sich anteilnehmend. »Kleiner Schnaps gefällig?« Er machte ein paar Schritte in Richtung Auto.
»Nein, danke, alles in Ordnung«, sagte sie schnell. »Ich war nur viel zu lange unterwegs.«
Er nickte, blieb aber stehen. Ein kalter Wind blies, und es hatte wieder zu nieseln begonnen. Im trüben Nachmittagslicht wirkte das Rot der Fassade fahl und ungesund. »Soll ich die Koffer hineintragen?«
Jetzt wollte sie nur noch, daß er verschwand.
»Danke, mach’ ich schon.« Sie versuchte zu lächeln. »Ich bin viel stärker, als ich aussehe. Den Rest erledigt mein Mann. Auf Wiedersehen und gute Fahrt.«
Sie wartete, bis er losgefahren war. Dann ging sie langsam hinein.
Überall war peinlich aufgeräumt, wie immer, wenn Martin allein war und sich von ihrer »Schlamperei«, wie er es gern nannte, erholen konnte. An der Garderobe hing sein brauner Mantel, aber seine Aktentasche fehlte und der komische Hut, den er den ganzen Winter über getragen hatte. Als sie die Rosen auf der Bauernkommode berührte, zerfielen sie; er mußte schon eine ganze Weile unterwegs sein.
Sofort war die seltsame Beklemmung wieder da. Der flatternde Puls. Das Ziehen im Magen. Die Schwierigkeit beim Schlucken. Ruth hatte wie eine Besessene gearbeitet und das gesamte Team zur Höchstleistung angetrieben, um seelischen Untiefen keine Chance zu lassen. Aber kaum war die Arbeit vorbei, kehrten sie zurück. Zusätzlich hatte ihnen der lange Flug neue, gefährliche Nahrung gegeben. Und nun das Haus. Es war widersinnig, aber sie kam sich in ihrem eigenen Haus wie ein Eindringling vor.
So beherzt wie möglich betrat sie die kleine Gästetoilette, um sich Hände und Gesicht zu waschen. Erst danach wagte sie, Dielenboden und Treppe genauer in Augenschein zu nehmen. Warmes, rötliches Buchenholz, bei näherer Betrachtung allerdings leicht aufgerauht. Verblaßte, weißliche Streifen. Weil die Putzfrau schlampig gearbeitet hatte? Oder weil jemand mit einem scharfen Mittel alle Blutspritzer weggescheuert hatte?
Reiß dich zusammen! befahl sie sich selbst und stieß die Tür zur Küche auf. Behalte bloß den Überblick!