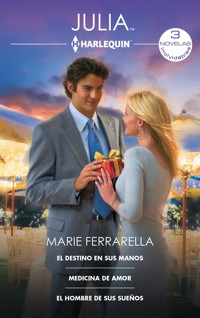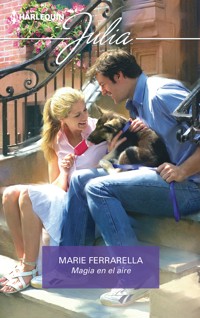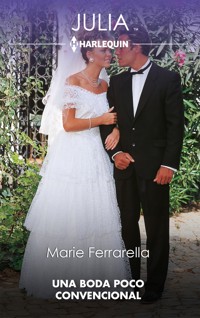2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Digital Edition
- Sprache: Deutsch
Als Anwältin kann Jewel dem kleinen Halbwaisen Rick, der seinen Vater sucht, leider nicht helfen. Doch stattdessen träumt sie plötzlich davon, ihm eine liebevolle Mama zu sein. Und Ricks jungem und gut aussehenden Onkel Chris eine zärtliche Ehefrau … Doch das geht zu weit, oder?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
IMPRESSUM
Ein Daddy für Rick erscheint in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
© 2010 by Marie Rydzynski-Ferrarella Originaltitel: „Finding Happily-Ever-After“ erschienen bei: Silhouette Books, Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe BIANCA, Band 1777 Übersetzung: Valeska Schorling
Umschlagsmotive: Harlequin Books S.A., Roman Rybalko / Getty Images
Veröffentlicht im ePub Format in 03/2023
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783751521673
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, HISTORICAL, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
1. KAPITEL
Er war den Anblick von Unordnung gewohnt, zum Beispiel auf seinem Schreibtisch an der Universität. Aber dabei handelte es sich eher um ein Chaos mit System. Christopher Culhane hätte ohne zu zögern den Platz fast aller Bücher seiner umfangreichen Bibliothek benennen können, ganz egal, ob es sich um Mathematik- und Physikbücher handelte oder um Notizen, die er in den letzten sechs bis neun Monaten angefertigt hatte.
Aber hier, dachte er und sah sich in dem Raum um, der vermutlich ein Wohnzimmer sein sollte, sieht es aus, als wäre ein Tornado hindurchgefegt. Ach! Noch viel, viel schlimmer!
Er hatte immer gewusst, dass seine jüngere Schwester Rita nicht besonders ordentlich war. Als kleines Mädchen war sie unfähig gewesen, in ihrem Zimmer auch nur so etwas wie einen Anschein von Ordnung zu wahren, obwohl ihre Mutter immer wieder darum bat und deswegen drohte. Aber verglichen mit dem Anblick hier war Ritas Kinderzimmer geradezu makellos gewesen.
Wie konnte ein normaler Mensch nur so leben? Die Antwort darauf machte Chris umso schmerzlicher bewusst, welche Probleme auf ihn zukamen.
Er unterdrückte einen Seufzer und rieb sich erschöpft das Gesicht. Die letzten sechsunddreißig Stunden waren emotional höllisch anstrengend gewesen. Er konnte nur hoffen, dass er so etwas nie wieder durchmachen musste.
„Geht es dir gut, Onkel Chris?“, hörte er die helle, aber ungewöhnlich reif klingende Stimme seines Neffen, in der nackte Angst mitschwang.
Ricks Besorgnis war offenkundig. Der Junge war klein und zart für sein Alter, wodurch er jünger wirkte als fünf Jahre, aber sobald er den Mund öffnete, strafte er diesen Eindruck Lügen. Er hörte sich an wie ein alter Mann, der im Körper eines Kindes gefangen war.
„Du hast doch nicht etwa Kopfschmerzen oder so?“, fragte Rick mit sorgenvoll geweiteten Augen.
Chris schüttelte den Kopf. „Nein.“
Wenn man bedachte, was der Junge alles hatte durchmachen müssen, war seine Frage durchaus berechtigt. Genauso wie die Angst, die sich dahinter verbarg. Nach Ricks Schilderung der Ereignisse hatte seine Mutter über wahnsinnige Kopfschmerzen geklagt, bevor sie zusammengebrochen war.
Doch anders als sonst war sie diesmal nicht nur vorübergehend durch Alkohol- oder Drogeneinfluss außer Gefecht gesetzt gewesen. Diesmal öffnete Rita Johnson die Augen nämlich nicht wieder, ganz egal, wie heftig Rick seine Mutter schüttelte oder wie oft er sie anflehte aufzuwachen.
Abgesehen von den sehr starken Kopfschmerzen war die Gehirnblutung ohne Vorwarnung aufgetreten.
Es war Rick, der den Notarzt angerufen hatte, und Rick, der dem Polizisten im Krankenhaus erzählt hatte, dass der Bruder seiner Mutter in der Gegend lebte. Der Junge hatte mit düsterer Miene hinzugefügt, dass seine Mutter keine Besuche von Onkel Chris wollte. Sie hatte immer gesagt: „Mein Leben passt ihm nicht!“
Chris hatte von Ritas Tod kurz nach Seminarschluss erfahren. Die Assistentin des Dekans hatte ihm einen Zettel überreicht, auf dem stand, dass er Dr. MacKenzie im Blair Memorial Hospital zurückrufen solle. Es ginge um seine Schwester.
Seine Hände waren eiskalt gewesen, als er die Nummer auf dem Zettel gewählt hatte.
Und von da an war alles nur noch schlimmer geworden.
Es war fast drei Jahre her, dass er Rita das letzte Mal gesehen hatte, was jedoch nicht seine Schuld gewesen war. Mit lallender Stimme, aber doch unmissverständlich, hatte sie damals schreiend gefordert, dass er aus ihrem Haus und ihrem Leben verschwinden solle, da sie auch ohne seine ständige Missbilligung schon genug Probleme am Hals habe.
Vernünftig mit ihr zu reden war unmöglich gewesen. Chris hatte sich damit begnügen müssen, manchmal heimlich an ihrem Haus vorbeizufahren, um einen Blick auf seinen Neffen werfen zu können und sich zu vergewissern, dass es ihm gut ging.
Dafür sorgten nicht zuletzt die Schecks, die er Rita regelmäßig für den Jungen schickte. Er wusste, dass seine Schwester ihren Sohn liebte und er immer alles Notwendige bei ihr bekommen würde. Er wusste aber auch, dass sie es ihrem Bruder irgendwie heimzahlen würde, wenn sie den Eindruck bekam, dass er sie kontrollierte. Er hatte es daher für sicherer gehalten, ihr einfach nur das Geld zu schicken und sich ansonsten zurückzuhalten. Irgendwie würde Rita dem Jungen auf ihre seltsame Art schon geben, was er emotional brauchte.
Es fiel ihm sehr schwer, seine Schwester im Krankenhaus zu identifizieren. Als er sich von Ritas leblosem Körper abwandte, sahen ihn zwei große traurige braune Augen unter einem dicken Pony an.
Chris war deprimiert über die sinnlose Verschwendung eines Lebens. Er ging auf den Jungen zu, der sich bis dahin erstaunlich erwachsen verhalten hatte. Aber dennoch war der Kleine noch immer ein Fünfjähriger, der gerade seine Mutter verloren hatte und Trost brauchte.
Chris hatte jedoch keine Ahnung, wie man mit jemandem sprach, der so jung war.
In den letzten Jahren hatte er ausschließlich mit Erwachsenen zu tun gehabt. Kinder nahm er genauso nebenbei wahr wie Blumen, Straßenbänke oder Gebäude, und er hatte zu keinem einzigen Kind direkten Kontakt. Daher wusste er auch nicht, wie er dem Jungen beibringen sollte, dass seine Mutter zehn Minuten nach ihrer Einlieferung ins Blair Memorial Hospital gestorben war.
Doch wie sich herausstellte, war seine Sorge unbegründet, denn mit der Frage „Meine Mutter ist tot, nicht?“, sah Rick ruhig zu ihm auf. Es klang eher nach einer sachlichen Feststellung als nach einer Frage.
Der Junge hatte eine wirklich erstaunliche Selbstbeherrschung. In den anderthalb Tagen seit ihrer Begegnung im Krankenhaus hatte Chris den Jungen noch nicht einmal weinen sehen und hielt es inzwischen auch für unwahrscheinlich, dass dies jemals passieren würde.
Es war geradezu unheimlich.
Da er nicht wusste, was er sonst tun sollte, fuhr Chris mit Rick zu dem Haus, in dem der Junge mit seiner Mutter gelebt hatte. Dort stand er dem Chaos einfach nur fassungslos gegenüber. Kein Zimmer war verschont geblieben: Zeitungsstapel türmten sich in den Ecken, verschimmelte Essensreste lagen auf verstreuten Papptellern, und der ganze Boden war mit dreckiger Wäsche bedeckt.
Rick begann sofort, einige Dinge aufzusammeln. Seine systematische Art verriet Chris, dass es nicht Rita war, sondern Rick, der sich um Ordnung bemüht hatte – wenn auch offensichtlich erfolglos. Anscheinend hatte der Junge ein gewisses Bedürfnis nach Ordnung, vor allem jetzt, wo sein Leben ein einziges Durcheinander war. Aus diesem Grund rief Chris kurz entschlossen eine Reinigungsfirma an.
Zu seiner Überraschung versprach die freundliche Frau am Apparat, schon am nächsten Morgen vorbeizukommen.
„Ich muss mich für die Unordnung entschuldigen“, sagte er zu ihr, als sie am nächsten Tag mit einem warmen Lächeln und einem arbeitswilligen Trupp im Schlepptau pünktlich vor der Tür stand. Cecilia Parnell betrat das Haus als Erste und betrachtete das Chaos ungerührt.
Sie beruhigte Chris mit einem Lächeln. „Nicht nötig. Wäre es hier nicht so unordentlich, bräuchten Sie meine Dienste schließlich auch nicht, oder?“, antwortete sie fröhlich. Sie bahnte sich einen Weg durch Papierstapel und nahm hier und da etwas in die Hand, als wolle sie ein Gefühl dafür bekommen, was alles zu tun war und wie lange es dauern würde. „Entschuldigen Sie die Frage, aber wie lange ist es her, dass Sie …?“ Cecilia beendete den Satz absichtlich nicht, damit der Mann sich nicht womöglich noch angegriffen fühlte.
„Oh, das hier ist nicht mein Haus“, erklärte Chris hastig. „Es ist das meiner Schwester.“
„Dann wollen Sie ihr also eine Überraschung bereiten?“, fragte Cecilia.
Chris’ Brust schnürte sich zusammen. Warum war er in den letzten Jahren nicht einfach bei Rita vorbeigefahren und hatte darauf bestanden, Teil ihres Lebens zu sein? Wer weiß, vielleicht wäre sie dann noch am Leben. Schuldgefühle überwältigten ihn.
„Dafür ist es leider schon zu spät“, antwortete er. Mrs. Parnells fragender Blick machte ihm bewusst, dass er anscheinend in Rätseln sprach. Chris holte tief Luft. „Meine Schwester ist kürzlich verstorben“, fügte er hinzu.
Cecilia empfand spontan Mitleid mit dem jungen Mann. „Oh! Das tut mir schrecklich leid.“ Sie sah sich erneut um. Hinter ihr packten Kathy und Ally, zwei ihrer Angestellten, ihre Arbeitsgeräte aus. Horst brachte den Industriestaubsauger herein und murmelte etwas auf Deutsch vor sich hin.
„Dann wollen Sie das Haus also von Grund auf reinigen lassen, um es zu verkaufen?“ Cecilia wollte nur einschätzen können, wie gründlich sie arbeiten mussten. Ein Haus, das verkauft werden sollte, musste tadellos aussehen. Allerdings boomte der Immobilienmarkt derzeit nicht gerade. Sogar ihre beste Freundin Maizie, eine Maklerin, beschwerte sich schon darüber, dabei konnte sie selbst Vegetariern eine Currywurst andrehen.
„Nein!“ Rick, der bis dahin noch kein Wort gesagt hatte, sprang bei dem Wort „verkaufen“ sofort auf. Bestürzt zupfte er Chris am Ärmel. „Bitte verkauf das Haus nicht! Du darfst es nicht verkaufen. Es ist mein Zuhause!“
Auf keinen Fall wollte Chris dem Jungen noch mehr Leid zufügen. Etwas unbeholfen legte er Rick den Arm um die schmalen Schultern. „Ich werde das Haus nicht verkaufen, Rick. Ich möchte nur, dass du hier herumlaufen kannst, ohne ständig irgendwo anzustoßen. Oder dich mit irgendetwas zu infizieren“, murmelte er. Er war davon überzeugt, dass allein in der Küche drei Sorten Schimmelpilze wucherten. Vielleicht sogar vier.
Cecilia kombinierte blitzschnell. „Ihr Neffe?“, fragte sie liebenswürdig.
Chris nickte. Er hatte den Arm noch immer um Ricks Schultern gelegt. „Das ist Rick.“
Zu Cecilias Überraschung streckte der Junge ihr die Hand entgegen. Sie schüttelte sie mit ernstem Gesicht. „Freut mich, dich kennenzulernen, Rick.“ Sie hob den Blick zu Chris und fragte: „Wo ist denn der Vater des Jungen?“
Ah, die Eine-Million-Dollar-Frage. „Ich habe nicht die geringste Ahnung“, antwortete Chris und unterdrückte einen Seufzer. Als er von Ritas Tod erfahren hatte, hatte er sofort zwei Wochen Urlaub genommen, aber inzwischen war er sich nicht mehr so sicher, ob die Zeit ausreichen würde. „Ich muss ihn erst noch ausfindig machen – sobald dieses Haus hier wieder bewohnbar ist.“
Na endlich, dachte Cecilia erleichtert. Ich danke dir, lieber Gott!
Sie hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, einen geeigneten Mann für ihre Tochter Jewel aufzutreiben, aber das Zusammentreffen mit Christopher Culhane kam ihr wie der lang ersehnte Wink des Schicksals vor. Ihren beiden besten Freundinnen Maizie und Theresa war es bereits gelungen, unter ihren jeweiligen Kunden Männer zu finden, die zu ihren unabhängigen und karriereorientierten Töchtern passten.
Maizie hatte den Plan ursprünglich ausgeheckt und war kurz darauf von ihrem zukünftigen Schwiegersohn Lucas nach einem Haus und einem Kinderarzt für seine Tochter gefragt worden. Maizie hatte ihm ein Haus verkauft und einen Kinderarzt empfohlen – zufälligerweise ihre Tochter Nikki. Und Theresa hatte für ihren zukünftigen Schwiegersohn das Catering für eine Party organisiert und ihm einen Familienanwalt empfohlen – zufälligerweise ihre Tochter Kate. Und Kate und Jackson würden auch bald heiraten.
Jetzt sah endlich Cecilia ihre große Chance gekommen. Christopher Culhane brauchte nämlich nicht nur eine Reinigungsfirma, sondern auch jemanden, der ihm bei der Suche nach einem verschwundenen Menschen half – genau Jewels Stärke.
Cecilia war plötzlich ganz aufgeregt. Anscheinend war ihr das Schicksal doch wohlgesonnen.
„Ich kenne eine sehr gute Privatdetektei, falls Sie Interesse haben. Dort kann man Ihnen sicherlich helfen, Ricks Vater zu finden.“ Sie tat ihr Bestes, unbekümmert zu klingen, auch wenn ihr Herz wie verrückt klopfte.
Da Chris offensichtlich dankbar für ihren Tipp war, zitterte sie förmlich vor Glück. Wirklich, sie hatte ein sehr gutes Gefühl bei der Sache.
Jewel roch den Braten sofort.
Sie hätte das Angebot am liebsten ausgeschlagen, aber leider konnte sie es sich einfach nicht leisten, einen Auftrag abzulehnen – selbst dann nicht, wenn er durch ihre Mutter vermittelt wurde.
Seufzend fuhr sie zu der Adresse, die Cecilia ihr gegeben hatte. Privatdetektive hatten es wegen der Wirtschaftskrise nicht gerade leicht. Misstrauische Ehefrauen lebten lieber in Ungewissheit weiter, als eine Scheidung zu riskieren. Das war zurzeit nämlich einfach zu teuer.
Da Jewel jedoch den Großteil ihres Geldes damit verdiente, untreue Ehepartner zu beschatten, hatte sie gerade nicht besonders viel zu tun. Bevor ihre Mutter sie wegen des neuen Falls angerufen hatte, hatte sie sogar ernsthaft überlegt, sie nach einer Teilzeitstelle zu fragen. Sie hasste es nämlich, tatenlos herumzusitzen – ganz zu schweigen von dem Risiko, ihre monatlichen Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können.
Dieser Job war daher wie ein Aufschub, ehe der Gerichtsvollzieher kam, und hatte einen zusätzlichen Anreiz: Ausnahmsweise einmal musste sie nämlich nicht jemandem in ein schäbiges Motel folgen und Zeugin von Geschehnissen sein, die ihr immer das Gefühl gaben, dringend duschen zu müssen.
Die Sache hatte nur einen Haken. Der Tipp stammte von ihrer Mutter, und Jewel wusste alles über den Pakt, den Cecilia mit ihren zwei besten Freundinnen geschlossen hatte. Alle drei – Maizie, Theresa und ihre Mutter – hatten sich geschworen, ihre Töchter unter die Haube zu bringen. Inzwischen war nur noch Cecilia übrig – und damit Jewel selbst.
Ein sehr unangenehmes Gefühl für jemanden, dem seine Privatsphäre so wichtig war wie ihr.
„Ist die Sache auch wirklich koscher?“, hatte sie ihre Mutter nicht nur telefonisch, sondern für alle Fälle auch höchstpersönlich gefragt.
Doch Cecilia Parnell hatte Stein und Bein geschworen, dass der Name und die Adresse des Kunden echt waren, und diese Worte mit dem beliebten Satz gekrönt: „Wenn du deiner Mutter nicht trauen kannst, wem dann?“
Aber warum hatte ihre Mutter ihr nur eine Adresse statt einer Telefonnummer gegeben? Das hatte bestimmt nichts Gutes zu bedeuten.
Jewel hätte ihren Klienten lieber erst angerufen, aber ihre Mutter hatte ihr versichert, dass der Mann so dringend einen Privatdetektiv brauchte, dass ein Telefonat bloße Zeitverschwendung wäre.
Also fuhr sie an diesem Morgen trotz starker Vorbehalte in die Auffahrt eines ihr völlig Fremden, um dessen Fall zu übernehmen. Was blieb ihr auch anderes übrig? Nichts, dachte Jewel düster.
Sie stieg aus ihrem gepflegten Auto, ging zur Eingangstür und klingelte.
Vielleicht würde es ja gar nicht so schlimm werden, tröstete sie sich und drückte sich im Geiste die Daumen.
Als die Tür aufging, begegnete Jewel dem Blick des ernsthaftesten Kindes, das sie je gesehen hatte.
Der Junge schien darauf zu warten, dass sie etwas sagte.
„Hi!“, sagte Jewel fröhlich.
Der traurige kleine Junge verzog keine Miene. Wie sich herausstellte, war er jedoch gut erzogen. Er grüßte nämlich zurück, wenn auch etwas lustlos.
„Hi.“
Offensichtlich blieb es ihr überlassen, das Gespräch zu bestreiten. Jewel lächelte dem Jungen zu und widerstand dem Impuls, ihm über das seidige Haar zu streichen. Stattdessen hockte sie sich hin, sodass sie auf Augenhöhe mit ihm war.
„Ich bin Jewel. Und wie heißt du?“
Der kleine Junge schüttelte so vehement den Kopf, dass die dunklen Haare nur so flogen. „Das darf ich Ihnen nicht sagen.“
Jewel war zunächst wie vor den Kopf gestoßen, aber dann verstand sie. „Weil du nicht mit Fremden reden darfst?“, fragte sie. „Da hast du natürlich völlig recht“, lobte sie ihn. Der Junge sah sie noch immer an. Sein Blick ließ ihn uralt wirken. „Ich bin hier verabredet mit …“, Jewel warf einen Blick auf den Zettel in ihrer Hand, „… Christopher Culhane.“ Sie faltete den Zettel zusammen und richtete den Blick wieder auf den Jungen. „Dein Vater, nehme ich an?“
Der Kleine schüttelte den Kopf.
„Ich bin sein Onkel“, antwortete plötzlich ein Mann, der gerade zur Tür kam.
Der Geschmack meiner Mutter hat sich eindeutig gebessert, dachte Jewel und musterte den Mann verstohlen. Er ist groß und dunkelhaarig. Wenn ich ihn so anschaue, kommt mir das Wort gut aussehend plötzlich total unzureichend vor.
„Kann ich irgendetwas für Sie tun?“, fragte Chris ruhig. Fürsorglich legte er die Hände auf die Schultern des Jungen.
Wenn Sie mich schon so fragen, dachte Jewel, ermahnte sich jedoch im gleichen Augenblick. Schließlich war nicht alles Gold, was glänzte.
„Eigentlich bin ich gekommen, um etwas für Sie zu tun“, antwortete sie. Da der Mann sie etwas ratlos ansah, fügte sie hinzu: „Ich bin Jewel Parnell.“ Sie gab ihm ihre Visitenkarte, um mögliche Zweifel an ihrer Identität zu zerstreuen. „Sie erwarten mich.“
Was ich erwarte, dachte Chris, ist ein Mann. Die Frau, die das Haus seiner Schwester auf wundersame Weise wieder bewohnbar gemacht hatte, hatte nämlich einen „Jay“ Parnell erwähnt. Chris dämmerte, dass sie keinen Vornamen, sondern bloß einen Anfangsbuchstaben gemeint hatte.
„Sie sind Privatdetektivin?“, fragte er, um ganz sicher zu sein.
„Ja, bin ich“, bestätigte Jewel. „Wollen Sie ein paar Referenzen sehen?“, fügte sie fröhlich hinzu. Es war nicht das erste Mal, dass man sie ungläubig anstarrte.
„Also, eigentlich …“
„Schon gut“, unterbrach Jewel ihn, öffnete ihre Tasche, zog einen Ordner heraus und gab ihn dem Mann. „Da drin sind die Rückmeldungen all meiner zufriedenen Kunden.“
„Und die Ihrer unzufriedenen Kunden?“
„Es gibt keine“, antwortete Jewel lächelnd und hob stolz das Kinn.
Chris warf einen ratlosen Blick auf den Ordner und dann wieder auf die Frau vor sich. Aber was hatte er schon zu verlieren, abgesehen von Zeit natürlich? Außerdem hatte er nichts gegen ein bisschen Gesellschaft einzuwenden. Irgendwie machte ihn das Alleinsein mit seinem Neffen nämlich ziemlich nervös.
Chris winkte Jewel ins Haus und sagte: „Kommen Sie rein.“
2. KAPITEL
Jewel sah sich verstohlen um. Das Haus machte einen ordentlichen und sauberen Eindruck, aber abgesehen von der mit Wildblumen gefüllten Vase auf dem Couchtisch – eindeutig das Werk ihrer Mutter – wirkte der Raum total unpersönlich. Irgendwie trostlos.
In ihrer eigenen Wohnung war das ganz anders. Überall standen Reisesouvenirs herum, und Fotos dokumentierten ihr Leben und das ihrer Mutter von Kindheit an. Dinge wie diese waren es, die einer Wohnung ihrer Meinung nach erst Wärme und Ausstrahlung verliehen. Unter diesem Dach deutete noch nicht einmal etwas darauf hin, dass hier ein Kind lebte.
Abgesehen von dem Namen und der Adresse ihres Kunden hatte Jewel noch keine Hintergrundinformationen zum Fall. Was ihre Mutter Cecilia ebenfalls nicht erwähnt hatte, war der kleine Junge. Er betrachtete Jewel gerade so eindringlich, als müsste er jeden Augenblick ihr Porträt aus dem Gedächtnis zeichnen können.
In seinem Kopf hinter den dunkelbraunen Augen schien allerhand vorzugehen. Zum ersten Mal wurde Jewel bewusst, dass an den Worten „alte Seele“ doch etwas Wahres dran war.
„Ein schönes Haus“, bemerkte sie schließlich, um das Schweigen zu brechen.
Doch anstelle des Mannes antwortete der Junge: „Jetzt schon.“ Als Jewel ihn mit fragend erhobenen Augenbrauen ansah, zuckte er nur die Achseln. „Mom hat nicht gern sauber gemacht“, erklärte er. „Ich habe das für sie übernommen, wenn ich konnte.“
Jewel empfand plötzlich Mitleid mit ihm. „Wie heißt du?“, wiederholte sie ihre Frage von vorhin.
„Rick“, antwortete er ernst.
„Mein Name ist Jewel. Jewel Parnell“, fügte sie hinzu und schüttelte ihm die Hand wie einem Erwachsenen. „Jetzt, wo wir uns kennen, kannst du mir bestimmt auch dein Alter verraten, oder?“
„Fünf“, antwortete er.
Er klingt eher wie ein Fünfundzwanzigjähriger, dachte Jewel.
Sie drehte sich zu Christopher Culhane um. „Was kann ich eigentlich für Sie tun?“
Doch wieder gab der Junge die Antwort: „Onkel Chris will, dass Sie meinen Vater finden.“
Jewel hatte das Gefühl, noch nie eine so traurige Stimme gehört zu haben.
Da der Kleine erheblich auskunftsfreudiger zu sein schien als der Mann, richtete Jewel die nächste Frage gleich an ihn: „Ist er denn plötzlich verschwunden?“
„Nur, wenn Sie drei Jahre für plötzlich halten.“ Diesmal kam die Antwort von Chris.
„Gibt es einen speziellen Grund, warum Sie sich erst jetzt auf die Suche nach ihm machen?“
„Meine Mom hat immer gesagt, dass wir ohne ihn besser dran sind.“
Jewel kam sich allmählich vor wie bei einem Tennisdoppel, nur dass sie allein auf ihrer Seite stand. Außerdem hatte sie noch immer keine Antwort auf ihre Frage. Warum jetzt, nach all dieser Zeit?
„Ich verstehe. Ist Ricks Mutter Ihre Schwägerin?“, fragte sie Chris.
„Nein, meine Schwester“, antwortete er.
Ach, er handelte also im Auftrag seiner Schwester, die sich anscheinend gerade nicht selbst darum kümmern konnte.
„Kann ich mal mit Ihrer Schwester reden?“, fragte Jewel und sah sich suchend nach ihr um.
„Nur, wenn Sie sich mit Séancen auskennen.“
Chris wurde sich bewusst, wie verbittert er klingen musste, aber er konnte nichts dagegen tun. Warum hatte Rita nicht auf ihn gehört, als er sie damals angefleht hatte, eine Entziehungskur zu machen – wenn nicht für sich selbst, dann zumindest für ihren Sohn? Er hatte ihr sogar angeboten, nicht nur die Kosten für die Kur, sondern auch für Ricks Betreuung zu übernehmen.
Sie hätte sein Angebot nur anzunehmen brauchen. Aber dafür, dachte Chris, hätte sie auch den nötigen Willen zur Veränderung haben müssen. Und das war eindeutig nicht der Fall gewesen. Er war inzwischen fest davon überzeugt, dass Rita im Grunde ihres Herzens nicht geglaubt hatte, so etwas wie Glück zu verdienen.
Großer Gott, Rita, warum hast du einfach alles weggeworfen? Du hattest einen Sohn, verdammt noch mal!
Jewel spürte, wie emotional angespannt der Mann war, der bald ihr Klient sein sollte – vorausgesetzt natürlich, sie nahm den Fall überhaupt an.
Machst du Witze? fragte sie sich spöttisch. Sie wusste verdammt genau, dass sie diesen Fall nur dann ablehnen konnte, wenn der Typ sich als direkter Nachkomme Satans oder als Zombie entpuppen würde. Sie brauchte das Geld einfach.
Und sie brauchte Informationen, Privatsphäre hin oder her. Außerdem hatte Jewel es sich nach den Erfahrungen in ihrem ersten Fall zur Regel gemacht, grundsätzlich zuerst herauszufinden, worauf sie sich einließ. Damals hatte sie einen untreuen Ehemann in flagranti erwischt. Dessen Frau hatte jedoch leider vergessen zu erwähnen, dass der Kerl ein mit Orden dekorierter Scharfschütze der Marine war, der sich ohne seine Schusswaffe nackt fühlte. Der Job hatte Jewel also fast das Leben gekostet.
Chris’ Worte ließen nur einen Schluss zu.
„Sie ist …“ Beinahe hätte Jewel „tot“ gesagt, aber wegen des Jungen griff sie zu einer beschönigenden Umschreibung. „Dahingegangen?“
Ihre Vorsicht erwies sich als überflüssig. Der Junge bestätigte ihren Verdacht unumwunden. „Meine Mutter ist tot.“
„Ich verstehe.“ Ein tapferer kleiner Mann, dachte Jewel. „Wann genau ist sie gestorben?“ Sie richtete den Blick von Mr. Groß, Dunkelhaarig und Gutaussehend auf das kleine Häufchen Elend neben ihm.
„Vor zwei Tagen“, antwortete Chris. Und ich kann es noch immer kaum glauben, fügte er im Stillen hinzu.
„Und die Beerdigung?“, fragte Jewel. „Wann findet die statt?“
Chris unterdrückte einen Seufzer. Er fühlte sich total überfordert. Normalerweise wäre er jetzt in seinem Arbeitszimmer an der Universität, um zu korrigieren oder an Beiträgen für Herausgeberwerke zu schreiben – wenn er nicht gerade Studenten betreute, die sein Zimmer manchmal regelrecht zu belagern schienen. Er kümmerte sich gern um seine Studenten, aber die, die ihn aufsuchten, waren in der Regel weiblich und nur scharf auf ein privates Tutorium. Manche von ihnen besuchten noch nicht einmal seine Vorlesungen.