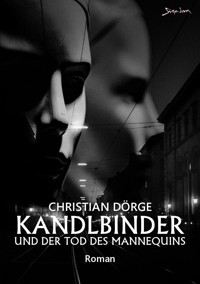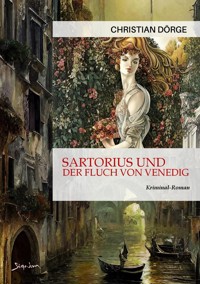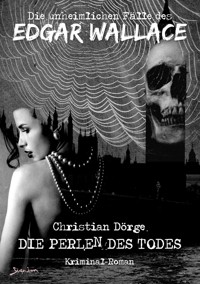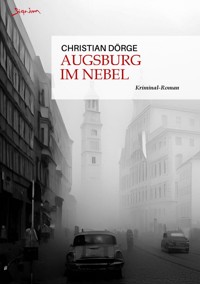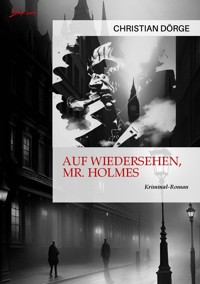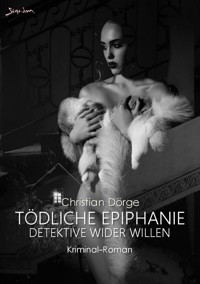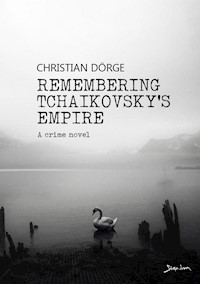6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Weihnachten, für den Großteil der Menschen das Fest der Liebe, der Besinnung, der Freude und der Gemeinschaftlichkeit; doch es gibt auch einige, für die ist es ein »Fest« des Hasses, des Neides und der Kaltblütigkeit. Und diese Menschen nehmen Weihnachten zum Anlass, sich an ihren Mitmenschen zu rächen, sie zu hintergehen, sie zu betrügen oder manchmal auch aus dem Weg zu räumen …
Zu »GIFTIGE NIKOLÄUSE« Mitten in der Nacht bricht Rias Mann Jürgen zusammen, kurz nachdem er sich mit letzter Kraft zur Toilette geschleppt und dort erbrochen hat. Ria ist schockiert, als sie erfährt, dass er wenig später im Krankenhaus an einer Schwermetallvergiftung gestorben ist. Das Gift soll in einem Schokoladennikolaus versteckt gewesen sein. Als dann auch noch die Polizei sie des Mordes verdächtig, bricht für Ria die Welt zusammen. Kurz darauf stirbt ein weiterer Mann und die Indizien gegen sie erhärten sich.
Hilft Michael, den sie kennenlernt, ihr dabei, den Mörder zu finden?
In diesem Band sind folgende Krimis zum Fest und in der Zeit danach enthalten:
› Tödliche Epiphanie – Detektive wider Willen– von Christian Dörge
› Schüsse am Silvesterabend – von Rainer Keip
› Giftige Nikoläuse – von Stefan Lochner
› Die Weihnachtstradition – von Benyamen Cepe
› (K)eine schöne Bescherung – von Roland Heller
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Christian Dörge, Rainer Keip, Stefan Lochner, Benyamen Cepe, Roland Heller
Ein kriminelles Weihnachtsfest
- Giftige Nikoläuse -
5 Krimis zum Fest und die Zeit danach
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Kerstin Peschel, 2022
Tödliche Epiphanie – Detektive wider Willen mit freundlicher Genehmigung des Signum-Verlages mit Lektorat und Korrektorat: Dr. Birgit Rehberg
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Tödliche Epiphanie
Detektive wider Willen
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Schüsse am Silvesterabend
1.
2
3.
4.
5.
Epilog
Giftige Nikoläuse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Die Weihnachtstradition
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Epilog
(K)eine schöne Bescherung
Mittwoch, 18. Dezember
Donnerstag, 19. Dezember
Freitag, 20. Dezember
Samstag, 21. Dezember
Sonntag, 22. Dezember
Montag, 23. Dezember
Weitere Weihnachtsbände sind erhältlich:
Das Buch
Weihnachten, für den Großteil der Menschen das Fest der Liebe, der Besinnung, der Freude und der Gemeinschaftlichkeit; doch es gibt auch einige, für die ist es ein »Fest« des Hasses, des Neides und der Kaltblütigkeit. Und diese Menschen nehmen Weihnachten zum Anlass, sich an ihren Mitmenschen zu rächen, sie zu hintergehen, sie zu betrügen oder manchmal auch aus dem Weg zu räumen …
Zu »GIFTIGE NIKOLÄUSE« Mitten in der Nacht bricht Rias Mann Jürgen zusammen, kurz nachdem er sich mit letzter Kraft zur Toilette geschleppt und dort erbrochen hat. Ria ist schockiert, als sie erfährt, dass er wenig später im Krankenhaus an einer Schwermetallvergiftung gestorben ist. Das Gift soll in einem Schokoladennikolaus versteckt gewesen sein. Als dann auch noch die Polizei sie des Mordes verdächtig, bricht für Ria die Welt zusammen. Kurz darauf stirbt ein weiterer Mann und die Indizien gegen sie erhärten sich.
Hilft Michael, den sie kennenlernt, ihr dabei, den Mörder zu finden?
In diesem Band sind folgende Krimis zum Fest und in der Zeit danach enthalten:
› Tödliche Epiphanie – Detektive wider Willen– von Christian Dörge
› Schüsse am Silvesterabend – von Rainer Keip
› Giftige Nikoläuse – von Stefan Lochner
› Die Weihnachtstradition – von Benyamen Cepe
› (K)eine schöne Bescherung – von Roland Heller
***
Tödliche Epiphanie
Detektive wider Willen
- Ein Krimi aus Oberbayern -
von Christian Dörge
Klappentext
Der Schauplatz: Anfang Januar 1965 am Kreuzeck oberhalb von Garmisch-Partenkirchen.
In einem verlassenen, tief verschneiten Haus, hoch oben im Gebirge, entdecken der Maler Gedeon Sckell und seine Frau Elisabeth die Leiche eines ihnen unbekannten Mannes – aufgebahrt in der Kapelle des Hauses.
Von diesem Moment an sind Gedeon und Elisabeth in höchster Lebensgefahr …
Tödliche Epiphanie von Christian Dörge, Autor u. a. der Krimi-Serien Jack Kandlbinder ermittelt, Ein Fall für Remigius Jungblut, Die unheimlichen Fälle des Edgar Wallace und Friesland, ist der zweite Band der Roman-Serie Detektive wider Willen und ein ebenso spannender wie wendungsreicher und nostalgischer Krimi aus Oberbayern.
Die Hauptpersonen dieses Romans
Gedeon Sckell: Maler und Hobby-Detektiv.
Elisabeth Sckell (geb. Kleeberger): Gedeons Frau
und Hobby-Detektivin.
Frederic Todenwart: Psychiater.
Dr. Fiona Bailey: Wissenschaftlerin.
Martin Carter: ein Bekannter von Candice Bailey.
Armand de Groot: holländischer Geschäftsmann.
Max Wiesner: Bergführer.
Alfie Day-Armstrong: Reiseveranstalter.
Sir Walther Richardson: ein Reisender aus England.
Lady Lucy Richardson: seine Frau.
William Grimmel: Chemiker aus England.
Patsy Kensit: Beat-Sängerin.
Dieser Roman spielt Anfang Januar 1965 am Kreuzeck oberhalb von Garmisch-Partenkirchen.
Erstes Kapitel
Es besteht wohl kaum ein Zweifel daran, dass sowohl meine Frau als auch ich geradezu wie ein Magnet Verbrechen anziehen; das ist leider so, auch wenn es dafür keine rationale Erklärung gibt. Elisabeth ist eine Frau mit bronzefarbenem Haar und grünlichen Augen, die alle weiblichen Tricks und darüber hinaus noch ein paar ganz private kennt, während ich selbst ein mäßig erfolgreicher Maler mit geselliger Veranlagung, schlichtem Gemüt und vielleicht ein paar liebenswerten Eigenheiten bin. Man sollte daher glauben, wir wären zwei vollkommen harmlose Menschen. Aber sobald in zehn Kilometer Umkreis irgendeine Untat oder Teufelei vor sich geht oder auch nur geplant wird, so werden wir schon irgendwie in die Sache mit hineingezogen. Durch diese seltsame Eigenschaft wurden wir bereits in mehrere unliebsame (gleichwohl unterhaltsame) Eskapaden verwickelt. Inzwischen bin ich ganz sicher, dass wir früher oder später wirklich in ernsten Schwierigkeiten stecken werden, sofern wir nicht bald die tiefere Ursache für diesen Magnetismus herausfinden.
Wir taten keinem Menschen etwas zuleide, sondern saßen einfach nur friedlich bei der abendlichen Party im Posthotel in Garmisch-Partenkirchen, unterhalb des Kreuzecks, eines 1.651 m hohen Skiparadieses mit majestätischer Bergkulisse, das vom Idiotenhügel bis zu steilen Abfahrten alles zu bieten hat und das in seiner internationalen Fröhlichkeit kaum von einem anderen Wintersport-Paradies übertroffen wird.
Diese internationale Fröhlichkeit im Posthotel steuerte gerade auf einen besonderen Höhepunkt zu. Es war ein Wunder, dass der Krach nicht irgendwo eine Lawine auslöste. Bierkrüge krachten auf die Tische, der blankgeschrubbte Holzboden erbebte unter stampfenden Schritten, und ein dicker Mann in Lederhosen klatschte sich jodelnd auf die blanken Oberschenkel, während ihn ein junges Mädchen in bayerischer Tracht auf einem aus Kuhglocken bestehenden Instrument begleitete. Man sah Cocktail-Kleider und Pullover, ein paar aufregende Après-Ski-Anzüge und sogar einen schottischen Kilt.
Wir saßen da und überlegten uns, warum zwei der Gäste uns mehr oder weniger unverhohlen musterten.
»Die wollen sicher mit uns bekannt werden«, sagte ich. »Wenn du in einem solchen Aufzug herumläufst, darfst du dich nicht wundern.«
Elisabeth warf mir einen ihrer berühmten Seitenblicke zu. »Der eine dort neben der Tür heißt Armand de Groot. Vermutlich Holländer. Er hat’s schon probiert. Zunächst mit ein paar Verbeugungen.«
De Groots gutsitzender Skidress war teuer und stammte sicher aus einem erstklassigen Laden. Dem Äußeren nach war er ein harter Bursche: dunkles Haar, eckiges Gesicht, gerade Augenbrauen, schmaler Mund. Alter etwa vierzig, dazu gefährlich intelligent, offenbar mehr daran gewöhnt Befehle zu erteilen als Bitten zu äußern. Als Freund sicherlich sehr nützlich und vermutlich sogar ein guter Gesellschafter, wenn er sich in einem geselligen Kreis bewegte, aber zweifellos auch ein Mann, mit dem nicht gut Kirschen essen war, sofern er etwas gegen jemanden im Schilde führte.
»Seltsam ist nur, dass er sich offenbar mehr für dich interessiert.«
»Das ist nicht nur seltsam«, antwortete ich, »sondern insbesondere unhöflich.«
»Ganz und gar nicht.« Sie warf mir wieder einen Seitenblick zu. »Er macht das ganz richtig. Ich habe den Eindruck, dass er geschäftlich hier ist, und dasselbe nimmt er wohl von dir an.«
Ich beobachtete drei kleine Französinnen, die sich drüben an der Bar um einen Skilehrer in rotem Pullover bemühten. Er wirkte leicht eingeschüchtert, aber offenbar entschlossen, sein Bestes zu tun. Max Wieser, einer der besten Bergführer aus Garmisch, beobachtete ihn mit ironischem Lächeln.
»Vermutlich Holländer und allem Anschein nach ein harter Bursche«, stellte ich fest. »Vielleicht ein Diamantenhändler? Oder Goldkaufmann? Oder Tulpenzüchter? Es gibt eine Sorte, die nennt sich Sauromatum guttatum, angeblich soll sie blassgrün mit purpurroten Flecken …«
»Der andere«, unterbrach mich Elisabeth gelassen, »ist der ehrenwerte Alfie Day-Armstrong.«
»Man muss schon hart sein, wenn man diese Dinge züchten will. Stell dir nur einmal vor, eins davon jagt dich in einer Mondnacht quer durch den Garten.«
»Ich habe allerdings so meine Zweifel, dass er ehrenwert ist«, murmelte Elisabeth.
»Ich meine in einer hellen Mondnacht, wenn die Knospen sprießen …«
»Was macht dieser Herr Day-Armstrong eigentlich?«
»Er ist eine Art Reise-Agent der exklusiveren Sorte. Aber nach außen hin gibt er den Playboy. Bist du jetzt fertig mit deinem Gerede über Tulpen? Er ist der Reisebegleiter für die englische Gesellschaft oben im Hotel. Und es ist eine sehr eigenartige Gesellschaft. Sie tun alle so, als hüteten sie ein düsteres Geheimnis.«
»In Anbetracht der Tatsache, dass wir kaum vierundzwanzig Stunden hier sind, hast du aber schon sehr gründlich herumgeschnüffelt. Du hast eine sehr hübsche Nase, aber wenn du so weitermachst, wirst du bald wie ein Bluthund aussehen.«
»Ich kenne zwei aus dieser Gesellschaft«, erklärte sie. »Sir Walther und Lady Richardson. Das heißt, Sir Walther kennt meinen Vater. Recht amüsante Leute, allerdings hier offenbar in den falschen Gewässern. Normalerweise besuchen sie die Bahamas.«
»Wird unsere Unterhaltung nicht allmählich etwas zu surreal?«, fragte ich.
»Zum surrealistischen Teil kommen wir erst noch«, sagte sie. »Lady Richardson und Sir Walther machen sich allmählich Sorgen: Bei der Gesellschaft befindet sich nämlich noch eine gewisses Fräulein Bailey, anscheinend erweckt sie den Eindruck, als könnte sie jeden Augenblick einen Mord begehen.«
Die Darbietung war zu Ende und es wurde plötzlich sehr ruhig. Day-Armstrong unterhielt sich jetzt mit Max Wieser. Dabei beobachtete er uns jedoch aus den Augenwinkeln. Er hatte glattes, helles Haar und eine sehr sportliche Figur, dazu ein etwas derbes, aber liebenswürdiges Gesicht. Er gehörte zu den Leuten, aus denen man nicht gleich schlau wird.
Elisabeth fuhr fort: »Lady Richardson gefällt das alles nicht.«
»Wann ist dir denn diese hübsche Information über den Weg gelaufen?«, wollte ich wissen. »Und wer ist das mutmaßliche Opfer?«
»Beim Kaffee heute Nachmittag. Und der Grund, warum man sich derartige Sorgen macht, ist: keiner weiß Genaueres. Lady Richardson sagt, man könne schließlich nicht hingehen und die arme Frau fragen. Über solche Dinge redet man nicht. Das macht sie ja gerade so beunruhigend!«
»Eine geradezu klassische Untertreibung«, sagte ich. »Du übertriffst dich.«
Sie fuhr unbekümmert fort: »Außerdem erzählt man sich von einem unsichtbaren Skifahrer, der hier überall über die Pisten flitzt.«
Das erneute Getöse des Orchesters übertönte meine Bemerkung, dass ihr Kaffeekranz wohl sehr kurzweilig gewesen sein müsse. Doch bevor ich sie wiederholen konnte, entfernte sich Day-Armstrong von der Bar und schob sich auf uns zu. Er wich geschickt einem Tanzpaar aus, das lebensgefährlich mit schweren Skistiefeln herumstampfte, duckte sich unter dem hochgehaltenen Tablett der Kellnerin Anna hindurch, legte für eine Sekunde seinen Arm um ihre Taille und sah dabei gleichzeitig hinüber zu de Groot. Ich hätte schwören mögen, dass die beiden sich verständigten, bevor er unseren Tisch erreichte und uns aus ein paar ungewöhnlich kühlen, schlauen Augen in einem ansonsten ausdruckslosen Gesicht anfeixte. Ich dachte: Wenn dieser Herr Day-Armstrong wirklich ein Playboy ist, dann weiß er genau, wie er seine Rolle spielt.
»Gefällt’s Ihnen?«, fragte er.
»Ja«, antwortete Elisabeth, »der Krach und die Leute.«
Ich sah sie misstrauisch an und fragte mich, ob vielleicht Day-Armstrong der Grund war, warum sie gerade heute Abend unbedingt hierher gewollt hatte. Elisabeth konnte bei all ihrem Charme ausgesprochen berechnend sein.
»Sie haben meinen Mann noch nicht kennengelernt«, lächelte sie.
»Verdammt unhöflich von mir, wenn ich sage, wie leid es mir tut, dass ich ihn ausgerechnet jetzt kennenlerne«, polterte er. »Kriegen Sie's nicht in den falschen Hals. Ich bin nur ein harmloser Narr. Aber ich habe mir heute Nachmittag im Hotel Königsspitze mit Frau Sckell alle Mühe gegeben.«
Leicht verärgert stellte ich mir vor, welchen Empfang man Elisabeth bereitet haben musste, während ich in der Stadt gewesen war. Aber ich antwortete: »Damit ist alles erklärt.«
Er lachte leise. »Sie sind der Maler Gedeon Sckell? Ich habe schon von Ihnen gehört.« Während ich mir flüchtig überlegte, was er gehört haben mochte, fuhr er fort: »Sind Sie zum Arbeiten hier oder zum Skifahren?«
»Nur zum Skifahren«, antwortete ich sofort. »Ich will Skifahren und sonst gar nichts.« Das war auch für Elisabeths Ohren gemeint.
»Zu lauter Protest ist immer verdächtig«, grinste Day-Armstrong.
Elisabeth warf ein: »Erzählen Sie uns doch von Ihren Reisegesellschaften.« Ich sah sie wieder an und machte mir allmählich Sorgen. Sie spielte das charmante junge Fräulein, zwar nicht so ausgeprägt, wie sie es schon bei anderen Gelegenheiten getan hatte, aber immerhin sie spielte gefährlich genug. »Ich habe mich beim Kaffee mit Sir Walther und Lady Richardson unterhalten.« Sie klimperte mit den Wimpern. »Wobei Walther und Lucy selbstverständlich Tee getrunken haben.«
Für einen kurzen Augenblick glitt ein Schatten der Besorgnis über Day-Armstrongs Gesicht, aber dann lächelte er wieder. »Ich will Ihnen sagen, woran es liegt«, antwortete er. »Ich bin ein Tagedieb, wie er im Buche steht. Ich arbeite nicht gern und tauge auch sonst nicht viel. Für krumme Sachen bin ich nicht schlau genug. So sind diese kleinen Gesellschaftsausflüge genau das richtige für mich. Ich habe sie mir selbst ausgedacht, sie tragen meine Unkosten, manchmal werfen sie sogar ein bisschen Profit ab. Außerdem kann ich so leben, wie es mir Spaß macht. Erleben Sie die weiße Welt des Wintersports mit Day-Armstrong, das kostet zwar Geld, aber es macht verdammt viel Spaß!«
»Wie organisieren Sie das?«, fragte ich.
»Durch diskrete kleine Inserate in der Times natürlich: Private Urlaubs-gesellschaft, erstklassiger Luxus, sorgfältige Zusammenstellung, beste Gesellschaft garantiert. Sie würden staunen, wie viele Zuschriften ich bekomme. Ich kann mir die Leute buchstäblich aussuchen.«
»Ihre Gäste sind also handverlesen ausgesucht?«, murmelte Elisabeth.
Das Lächeln verschwand von seinem Gesicht, aber er antwortete: »In der Tat. Wer so aussieht, als passte er nicht dazu, bekommt gleich von Anfang an die übliche höfliche Entschuldigung zu hören: Tut mir leid, aber wir sind vollständig ausgebucht.« Und dann fügte er seltsamerweise in einem Ton hinzu, als müsste er sich rechtfertigen: »Wissen Sie, ein bisschen muss man die Leute dann aber doch mischen. Sonst wird’s arg langweilig. Und ein Fehler … kann natürlich immer passieren.«
Es war ihm deutlich anzumerken, dass ihm die Richtung unserer Unterhaltung gar nicht behagte. Betont beiläufig fragte ich: »Darf ich Ihnen etwas bestellen? Falls wir Anna erwischen.« Und dann fiel mir ein kleines Experiment ein. Es gab eine schlichte Erklärung für seine defensive Haltung und für die Reisegesellschaft mit dem Schuldkomplex. Ich fuhr fort: »Sie können Ihre Kunden noch so sorgfältig aussuchen, manchmal werden Sie bestimmt ein paar recht seltsame Typen dabei haben. Wenn nun jemand zufällig Zollbeamter wäre?«
Die erwartete Reaktion trat auf der Stelle ein. Sein Blick wurde eisig und hart. »Soll das ein Witz sein, Herr Sckell?« Es kostete ihn einige Mühe, wieder den liebenswürdigen Mann nach außen zu kehren. »Warum soll ich es Ihnen nicht sagen, Sie würden es ja doch von irgendjemandem erfahren: Wir haben eine Frau dabei, die ist nicht ganz richtig im Kopf – danke.« Dann kam er auf meine erste Frage zurück: »Ich trinke nichts, ich habe schon an der Bar etwas gehabt.« Er wandte sich zum Gehen, fügte aber noch hinzu: »Max Wieser hat mir erzählt, dass Sie früher schon hier waren. Sie kennen sich hier aus.« Er schien sich zu überlegen, ob er seine Gedanken laut aussprechen sollte. »Ich brauche Ihnen also nicht zu sagen, dass es hier in der Umgebung ein paar recht gefährliche Stellen gibt.«
»Machen Sie sich um uns keine Sorgen«, antwortete ich so freundlich wie möglich.
»Verzeihen Sie, ich hätte das vielleicht nicht sagen sollen, aber Max hat mir gerade erzählt, dass Sie ein bisschen der Typ des Abenteurers sind und vielleicht auf eigene Faust losgehen könnten.«
Elisabeth murmelte: »Gedeon riskiert nie etwas.«
Er lachte wieder, aber diesmal klang es ziemlich ungemütlich. »Glauben Sie mir, das ist auch das Beste. Sie nehmen’s mir nicht übel, okay? Wir sehen uns noch.«
Er kehrte wieder zurück an die Bar und beachtete dabei de Groot nicht. Hinter seinem freundlichen Benehmen verbarg sich eine ungewöhnliche Unverschämtheit. Diese letzten Worte von ihm waren ganz unmissverständlich eine Drohung. Er hatte etwas Bestimmtes im Sinn, und das hatte, zumindest teilweise, mit Elisabeths und meinem Aufenthalt hier zu tun. Schade, dass er mir keine Zeit gelassen hatte, es ihm zu erklären: Wir hatten hier rein gar nichts vor, wir waren nicht an ihm interessiert.
Elisabeth fragte: »Gedeon, hast du nicht auch das Gefühl, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht?«
»Das spürt man doch bis ans andere Ende der Stadt, das ganze Gebäude zittert förmlich vor Spannung.«
»Ich meine, unter der Oberfläche brodelt es mächtig …«
»Vermutlich ein Bergrutsch; es könnte auch durchaus sein, dass der Dicke da ein Erdbeben auslöst.«
Sie beobachtete de Groot nachdenklich und murmelte: »Es ist wirklich sehr seltsam.«
Die Kellnerin servierte ihm gerade eine halbe Flasche Sekt. Daran fand ich nun gar nichts seltsam, das war sogar ziemlich zurückhaltend. Aber Elisabeth meinte: »Ich glaube nicht, dass wir uns da werden heraushalten können, das gelingt uns nie und nimmer.«
»Diesmal schon.« Dem Nachdruck in meine Stimme traute ich selbst nicht. »Jetzt gehen wir zu Fuß in unser Hotel zurück, das wird uns abkühlen. Und dann gehen wir ins Bett.«
»Ja«, sagte sie gefügig. Ich glaubte schon, damit wäre die Sache erledigt.
Ich hätte es besser wissen müssen.
Draußen war es sehr still und kalt. In Garmisch leuchteten noch warm ein paar Lichter aus den Fenstern, aber die geschnitzten Holzbalkons und Lüftlmalereien der Gebäude mit ihren weit vorspringenden Dächern unter mächtigen Schneemützen ragten neben uns auf wie Gebilde aus Grimms Märchen. Es roch nach brennendem Holz und Kuhställen, bis wir den festgetretenen Pfad quer über die breite Wiese erreichten, der zum Hotel Königsspitze führte. Es war eine kristallklare Nacht, in der frostig die Sterne vom Himmel blinkten.
Aber Elisabeth hatte keinen Sinn für Poesie. Als wir in den Pfad einbogen, wo sich beiderseits die Schneewälle türmten und rechts unten der Fluss Partnach unter seinem Eispanzer rauschte, gab sie zu bedenken: »Irgendetwas an der Reisegesellschaft ist sehr seltsam.«
»Nun, mein Liebling, das ist ganz einfach«, erklärte ich ihr. »Unser lieber Staat erlaubt seinen ehrlichen Bürgern nicht, ihr Geld so auszugeben, wie sie es möchten. Es gibt die hübsche Einrichtung der Devisenzuteilung. Hier haben wir es mit einer Gesellschaft von offenbar wohlhabenden Leuten zu tun, die in einem recht teuren Hotel wohnen. Legal können sie das kaum. Der ehrenwerte Day-Armstrong treibt in aller Stille eine kleine Devisenschieberei. Meinetwegen soll er das tun.«
»Glaubst du wirklich, dass nicht mehr dahintersteckt?«
»Ich bin ganz sicher. Wenn sich die Gelegenheit bietet, kannst du ihm ja sagen, dass ich an einen netten Herrn aus Österreich zwei Bilder verkauft habe und dass dieser mich freundlicherweise in Mark bezahlt hat. Und sag ihm auch, dass dein Bruder Ludwig nachts keinen Schlaf findet, weil er sich überlegt, wie er Leute wie uns unter die Guillotine bringen kann.«
Sie musste immer lachen, wenn ich gegen ihren ziemlich pingeligen Bruder einen Seitenhieb austeilte, aber dann fuhr sie fort: »Eine Kleinigkeit hast du vergessen: Den Ärger, den es letztes Jahr in Frankreich gegeben hat. Das hat in allen Zeitungen gestanden. Als wir heirateten, kamen Dutzende von Fotografen. Day-Armstrong und de Groot könnten leicht etwas über unsere anrüchige Vergangenheit erfahren haben.« Sie kicherte leise vor sich hin. »Sie könnten glauben, dass wir sozusagen geschäftlich hier sind.«
»Da siehst du mal wieder, wie einen der schlechte Ruf auf Schritt und Tritt verfolgt«, seufzte ich ein wenig zu theatralisch. »Sag ihm, dass wir diesmal gar nichts mit der Polizei zu tun haben.«
Wir überquerten die Straße und begannen den Privatweg zum Hotel hinaufzusteigen. Er führte über flache Stufen und zahlreiche Windungen durch einen kleinen Wald in die Höhe. Rechts unter uns lief ein gerader und nicht so steiler Weg zwischen verschneiten Bäumchen und Wiesenbuckeln dahin. Alles ringsum war dunkel und scheinbar menschenleer. Aber plötzlich durchbrach die Stille ein hoher, schriller Schrei, der irgendwo von dort unten kam. Er hörte sich ebenso überrascht wie entsetzt an und schien zwischen den Bäumen ein Echo hervorzurufen.
Danach vernahmen wir das unverwechselbare Geräusch rasch dahingleitender Skier. Wir blieben stehen und sahen auf den unteren Pfad hinunter. Ein undeutlicher Schatten huschte vorüber, dann verklang das Geräusch auf der Straße.
Als ein zweiter schwacher Ruf folgte, machten wir kehrt und rannten auf die Stelle zu, wo ein paar hölzerne Stufen hinunterführten. Dort sahen wir eine seltsame schwarze Gestalt wie eine riesige Fledermaus auf dem weißen Boden liegen. Als wir darauf zuliefen, richtete sie sich mühsam auf, kippte aber wieder um.
Aus der Nähe sahen wir dann einen schwarzen Pelzmantel und schwarze Skihosen, Hände in dunklen Handschuhen und ein blasses Gesicht auf dem Schnee. Eine Frau richtete sich auf die Knie auf und starrte entsetzt zu uns empor. Dann sagte sie: »Sie sind wenigstens real.« Sie zitterte.
»Sogar ausgesprochen real«, bestätigte ich. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Wer sind Sie?«, fragte sie und sah Elisabeth an. »Oh, einen Augenblick, Sie sind doch das hübsche Fräulein mit dem Après-Ski-Anzug aus Goldlamé. Ich habe Sie gestern Nacht gesehen …«
»Gedeon und Elisabeth Sckell«, stellte uns Elisabeth vor. »Fräulein Bailey?«
Das musste ja so kommen. Wir können dem Ärger nie ausweichen. Wer sonst hätte es sein sollen als ausgerechnet Fräulein Bailey?
»Was ist denn geschehen?«, fragte Elisabeth. »Sind Sie ausgerutscht?«
Die Kälte war derart durchdringend, dass man beinahe den Frost klirren hörte. Deshalb schlug ich vor: »Gehen wir ins Hotel.« Wir stützten Fräulein Bailey von beiden Seiten.
»Sie werden es nicht glauben«, keuchte sie. Plötzlich klang verzweifelte Wut aus ihrer Stimme. »Oder glauben Sie vielleicht, dass es so etwas wie einen unsichtbaren Skifahrer geben kann?«
»Durchaus nicht«, antwortete ich. »Auf gar keinen Fall.«
Sie versuchte zu lachen. »Sehr vernünftig! Ich glaub’s nämlich auch nicht. Aber wenn man etwas hört und wenn etwas an einem vorbeiflitzt, wovon man weiß, dass es eigentlich nicht existieren kann – was würden Sie dann sagen?«
»Das Licht ist sehr trügerisch«, erklärte ich. »Der Schnee schimmert, er rieselt von den Bäumen herab. Wenn irgendein Idiot diesen Pfad hinunterfährt, dann haben Sie ihn vielleicht erst im allerletzten Augenblick gesehen.«
»Sie sind so sachlich«, Fräulein Bailey fest. »Das ist erfrischend, nach …« Sie brach ab und fuhr dann fort: »Ich ging den Pfad entlang, und zwar ziemlich langsam, weil ich über Verschiedenes nachdenken musste. Dann hörte ich hinter mir ganz deutlich das Geräusch von Skiern, das rasch näher kam. Ich dachte noch: Das muss ein Verrückter sein – bei dieser Beleuchtung! Ich blieb stehen und sah mich um. Aber da war nichts.«
»Überhaupt nichts?«, fragte Elisabeth.
»Ich weiß nicht.« Ihre Stimme wurde wieder schrill. Sie holte tief Luft. »Nur ein Eindruck, das war alles. Es ging so furchtbar schnell. Etwas raste an mir vorüber. Es war eine Bewegung, wissen Sie, keine bestimmte Gestalt. Ich trat zurück und stürzte. Danach – ich weiß es nicht«, wiederholte sie. »Ich muss wohl ganz benommen gewesen sein, bis Sie kamen. Es war ein schönes Gefühl, wieder richtige, wirkliche Menschen zu sehen.«
Elisabeth warf mir einen Seitenblick zu. Ich schüttelte den Kopf. Im Augenblick war es besser, wenn wir nicht über unsere eigenen Einbildungen sprachen.
Wir erreichten die Terrasse vor den Glastüren des Hotels und traten in das helle Licht der Lampen am Vordach. Hier wirkte alles solide und einladend, und durch die dünnen Vorhänge der Fenster sahen wir die Leute im großen Saal tanzen. Aber am Fenster daneben, das zur Bar gehörte, sah ich die Silhouette einer massigen Gestalt, die zu uns herausblickte. Das Licht hinter dem Mann warf einen langen, schwarzen Schatten über den Schnee, und als die Frau an meiner Seite ihn erblickte, zuckte unwillkürlich ihre Hand unter meinem Arm.
»Fräulein Bailey«, erkundigte ich mich, »als Sie vorher hierherkamen – war da sonst niemand? Haben Sie sonst niemanden gesehen?«
»Dieser schreckliche Mann …« Sie holte wieder tief Luft. »Herr Todenwart, er war da drüben beim Sommerhaus. Neben dem Gebüsch stand ein hübscher kleiner Pavillon im Landhausstil. Ich glaubte zuerst, dass er sich mit jemandem unterhielt, aber dann drehte er sich um und sah mir nach. Selbst aus der Entfernung sah ich noch das Licht auf seiner Brille blitzen. Es war schrecklich.« Sie unterbrach sich, dann fuhr sie hastig fort: »Entschuldigen Sie, ich rede wirres Zeug. Bitte, ich möchte nicht, dass Sie beide wie eine Eskorte wirken, wenn wir jetzt hineingehen. Wirklich, es geht mir schon wieder ganz gut.«
Erst in der Bar hatten wir Gelegenheit, sie richtig anzusehen. Sie sah wirklich nicht wie jemand aus, dem man einen Mord zutrauen könnte. Sie war ein wenig blass, als hätte sie zu viel Zeit in künstlichem Licht zugebracht, sie hatte kurzsichtige Augen und einen breiten Mund, eine unordentliche Frisur und teure Kleidung, die ihr aber nicht besonders gut stand: schwarze Samthose und stumpfgrüner Pullover. Sie wirkte wie eine halbwegs erfolgreiche Geschäftsfrau von etwa fünfunddreißig Jahren. In einer größeren Gruppe wäre sie nie aufgefallen. Hätte man sie bei einer Party getroffen, so wäre es wohl interessant gewesen, sich mit ihr zu unterhalten, aber am nächsten Tag hätte man vermutlich schon wieder ihren Namen vergessen. Durch die ausgestandene Angst und innere Spannung sah sie mit der seltsamen Mischung von Verwirrung und Zorn auf ihrem Gesicht beinahe aus, als sei sie sich selbst fremd geworden.
»Sind Sie beide gute Skifahrer?«, fragte sie plötzlich.
Das klang im ersten Moment, als hätte es etwas Besonderes zu bedeuten. In ihrer Stimme schwang ein drängendes Interesse mit, aber dann geschah etwas Überraschendes und sehr Bestürzendes: Der massige Mann, der uns offenbar durch das Fenster beobachtet hatte, als wir über die Terrasse kamen, ging hinüber zur Bar. Er trug ein affiges, pflaumenfarbenes Dinnerjackett aus Samt, eine Fliege und ein zerknittertes Hemd. Er hatte ein rundes Babygesicht, eine hochgewölbte Stirn und kreisrunde Brillengläser, darüber schütteres Haar, das wie kindlicher Flaum aussah, und einen kleinen rosa Mund mit vollen, schmollenden Lippen. Er bestellte etwas, drehte sich dann zu uns um und verbeugte sich, während er einen abschätzenden Blick auf Elisabeth warf und dann Fräulein Bailey ansah.
Sie erwiderte den Blick, und aus ihren Augen funkelte die kalte Mordlust …
Nach einer Sekunde war es vorüber. Sie wandte sich ruckartig wieder uns zu und plauderte drauflos. »Mögen Sie lange Skitouren? Ich plane nämlich eine Skiwanderung.« Plötzlich erhob sie sich. »Seien Sie mir nicht böse, ich möchte schlafen gehen.«
»Soll ich Sie begleiten?«, bot Elisabeth an.
Als die beiden gegangen waren, saß ich da … und machte mir Sorgen. Wenn jemand sich so offenkundig die Mordlust anmerken lässt, muss er damit rechnen, dass andere sich darüber Gedanken machen. In diesem Fall schien der Kerl in dem pflaumenfarbenen Jackett – vermutlich Herr Todenwart – das auserwählte Opfer zu sein. Er unterhielt sich jetzt mit dem Barmixer, beobachtete mich aber durch den Spiegel hinter der Bar. Ich fragte mich, ob sich unter seiner Jacke wohl Fett oder Muskeln verbargen. Das runde Gesicht wirkte weichlich, aber es lag eine bestimmte Härte unter der Oberfläche, und seine Bewegungen waren flink und geschmeidig. Voller Beunruhigung spürte ich, dass wir uns hier schon wieder auf etwas Gefährliches einließen. Ich musste der Sache bald einen Riegel vorschieben.
Dann kam er auf mich zu. »Herr Sckell? Mein Name ist Todenwart – Frederic Todenwart. Darf ich mich zu Ihnen setzen?«
»Bitte sehr.« Innerlich verdrehte ich die Augen.
Er ließ sich nieder, faltete seine sorgfältig manikürten Finger auf der Tischkante, schob schmollend die Lippen vor und betrachtete mich. Seine kalten Augen gefielen mir gar nicht. Ich schwieg.
Nach einer Weile fragte er leise: »Herr Sckell, wo ist Ihnen Fräulein Bailey begegnet?«
»Irgendwo draußen. Sie machte eine Bemerkung über die Kälte, und wir antworteten, dass es tatsächlich sehr kalt sei. Wir luden sie zu einem Drink ein.«
»Ich bin Arzt – Psychiater.«
»Wie interessant.«
»Fürwahr. Manchmal aber auch … nun ja, tragisch.« Sein Schmollmund ging mir auf die Nerven. Ein schmollender Psychiater ist mir einfach zu viel.
Dann kamen zwei Leute herein, bei denen es sich nur um Sir Walther und Mylady handeln konnte. Danach erschien ein rothaariges Mädchen aus Day-Armstrongs Reisegesellschaft mit ihrem Freund. Er hatte ein kalkweißes, kinnloses Gesicht.
Mit einem Anflug von Abscheu murmelte Herr Todenwart: »Sie ist Sängerin. Beat. Fräulein Patsy Kensit. Nicht sehr anziehend.« Dann schob er wieder die Lippen vor. »Fräulein Bailey – es ist schrecklich, und ich spreche nicht gern darüber. Aber bei ihr erkenne ich eine ganz eindeutige Verhaltensweise, die unversehens einem Höhepunkt zustrebt.«
Es entstand eine kurze Pause. »Ich verstehe kein Wort«, bemerkte ich. »Was bewegt sich rasch auf einen Höhepunkt zu?«
»Wenn ich mich nicht täusche, und das ist sehr unwahrscheinlich, dann wird Fräulein Bailey früher oder später, wahrscheinlich schon sehr bald, eine gewalttätige Handlung begehen. Vielleicht in ein paar Tagen, vielleicht auch schon in ein paar Stunden.«
Wieder entstand eine Pause. Ich fragte: »Und warum sagen Sie ausgerechnet mir das? Weil sich diese Handlung gegen uns richten könnte? Das bezweifle ich doch sehr.«
Er blinzelte mich durch die runde Brille an, bevor er antwortete: »Eine sehr gute Frage. Der Gewaltakt könnte sich gegen jeden Beliebigen wenden. Die Frau ist gefährlich. Aber Sie könnten ihr helfen, wenn Sie wollten.«
»Wie?«
»Sie haben die anderen Teilnehmer unserer Reisegesellschaft noch nicht kennengelernt? Die scheinen ihr wenig Mitgefühl entgegenzubringen.« Er warf einen Blick hinüber zu dem unsympathischen Paar an der Bar. »Aber eine Art mitfühlender Überwachung ist genau das, was sie jetzt braucht. Am besten geeignet wären zwei intelligente Menschen, die mich irgendwie verständigen könnten, sobald sie Anzeichen ungewöhnlicher Erregung feststellen.« Er betrachtete seine Fingernägel. »Wie ich höre, sind Sie überdurchschnittlich gute Skifahrer. Das trifft auch auf Fräulein Bailey zu. Alle anderen von uns sind leider nur Anfänger. Natürlich mit Ausnahme von Day-Armstrong, verstehen Sie?«
Ich verstand. Und die Sache gefiel mir nicht. »Sie möchten also, dass wir sie im Auge behalten?«
»Genau«, sagte er und erhob sich. »Nur für ein paar Tage, dann wird ein Freund von ihr eintreffen.«
»Noch eine Frage – eigentlich zwei Fragen: Seit wann kennen Sie Fräulein Bailey?«
»Ich hatte sie noch nie gesehen, bis wir uns in Zugabteil zwischen München und Garmisch trafen. Das war letzten Sonntag, am Neujahrstag, vor fünf Tagen also.«
In diesem Fall hatte er eine bemerkenswert rasche Diagnose gestellt. Aber vielleicht war derlei tatsächlich möglich.
Er fuhr fort: »Und die andere Frage?«
»Wir sind erst gestern Abend hier angekommen. Woher wissen Sie eigentlich, dass wir – sagen wir mal – einigermaßen Skilaufen können?«
»Von unserem scharfsinnigen Day-Armstrong«, antwortete er. »Er hat sie am Morgen beobachtet.«
»Ihnen entgeht kaum etwas, Herr Todenwart, nicht wahr? Sie haben doch sicher auch etwas von einem unsichtbaren Skifahrer gehört?«
»Na, wissen Sie«, sagte er herablassend. »Ich habe auch schon vom fliegenden Holländer gehört. Aber ich kann Ihnen versichern, dass solche Dinge in der Welt eines Psychiaters nichts zu suchen haben.«
»Das scheint aber die einzige Welt zu sein, wo er eine Rolle spielen könnte«, grinste ich.
Er sah mich eine ganze Weile an, zog wieder einen Schmollmund und wandte sich mit einer Verbeugung ab.
Elisabeth kam nicht mehr herunter.
Nach einigen Minuten trank ich aus und ging auch nach oben. Sie saß im Schlafzimmer vor dem Frisierspiegel. Sie ließ sich von meiner Unterhaltung mit Herrn Todenwart berichten. Dass sie ein bisschen Angst hatte, merkte man ihr nur an, wenn man sie sehr gut kannte. Außerdem wurde sie ein wenig böse.
»Nun«, fragte sie, als ich meinen kleinen Vortrag beendet hatte, »und was werden wir tun? Inzwischen interessierst du dich doch auch dafür, Gedeon.«
»Ich gebe mir alle Mühe, es nicht zu tun.«
»Es ist so gemein«, murmelte sie, »so unglaublich gemein.«
»Meinst du nicht, dass wir etwas übertreiben? Unser gutes Fräulein Bailey ist schon ein komischer Vogel.«
»Ich glaub’s nicht. Willst du wissen, was ich denke?«, fragte sie. »Sag meinetwegen, dass ich voreilig urteile, aber ich glaube, dass hier ein Mord vorbereitet wird.«
»Charmanter Gedanke«, stellte ich fest. »Was verleitet dich zu dieser Annahme?«
»Weil sich Todenwart oder sonst jemand alle Mühe gibt, sie zu einer Mörderin zu stempeln. Ich bin sicher, dass alles sorgfältig geplant ist. Das liegt doch auf der Hand.« Elisabeths Stimme klang ungeduldig. »Wenn jetzt etwas passiert, dann werden alle sofort schreien, dass es Fräulein Bailey gewesen sein muss.«
»Wirklich sehr scharfsinnig.« Ich ging hinüber zum Fenster, zog den Vorhang zurück und schaute hinüber zum Gipfel des Kreuzeck, der im kalten Mondlicht eisig herüberschimmerte. »Morgen haben wir wieder schönes Wetter«, sagte ich. »Nein, mein Liebling, du konstruierst einfach aus dem Kaffeeklatsch einer neurotischen Frau und aus dem Gerede eines nicht sehr angenehmen Mannes dein eigenes Drama, das ist alles.«
»Hoffentlich«, antwortete sie. »Aber da ist noch etwas: Herr Day-Armstrong sagte doch, dass er die Teilnehmer für seine Gesellschaftsreisen sorgfältig aussucht. Er betont das immer wieder. Findest du nicht, dass er diesmal ein paar auffallend seltsame Typen ausgewählt hat?«
In diesem Augenblick summte das Telefon. Ich ging hinüber ins Wohnzimmer und meldete mich. Eine Stimme flüsterte: »Hier Bailey. Hören Sie, Herr Sckell – wegen der Skiwanderung morgen. Ich fahre mit dem Langenstein-Sessellift hinauf. Das ist der lange Lift gleich bei der Kirche. Meinen Sie nicht, dass Sie mitkommen könnten?«
Bevor ich etwas erwidern konnte, unterbrach sie mich: »Nein, bitte sagen Sie jetzt nichts. Es sei denn, Sie können mir … Was wissen Sie über die Vier Erzengel?«
»Worüber?«, fragte ich.
»Spielt keine Rolle«, sagte sie, dann war die Leitung tot.
Zweites Kapitel
Damit also war Elisabeth auf dem Kriegspfad, und auch ich selbst war ein wenig neugierig geworden.
Am nächsten Morgen warteten wir vor dem Gipfelhaus an der Spitze des Langenstein-Sessellifts hoch über Garmisch-Partenkirchen, kilometerweit das einzige Haus zwischen Gipfeln und Schneefeldern. Alles ringsum leuchtete blau-silbrig und golden, und man kam sich vor wie in einer gewaltigen Schüssel aus glänzendem Licht. Die Skifahrer glichen beweglichen hellen Farbpunkten auf den weiten, weißen Hängen, und über uns ragte der Anstieg zum Kreuzeck auf. Die dünne Luft atmete sich wie Champagner, und selbst die heiße, süße Schokolade, die normalerweise nicht mein Geschmack ist, war irgendwie etwas Besonderes.
Wieder einmal fragte Elisabeth: »Was glaubst du wohl, wer die Vier Erzengel sind?«
»Vielleicht sind das vier beieinanderstehende Berge. Sie sehen ja wirklich fast wie Erzengel aus, wie sie blauschimmernd dastehen.«
»Ist das wieder einer deiner Geistesblitze?«, fragte sie rasch.
»Nur so eine Schnapsidee«, antwortete ich. »Das liegt wahrscheinlich an der Höhenluft und an der Schokolade. Wie lange sollen wir noch warten?«
Elisabeth beobachtete die Sessel, die schwankend heraufkamen und sich um das große Rad herumbewegten, und die buntgekleideten Menschen, die nacheinander absprangen.
»Da ist sie!«
Fräulein Bailey trug eine blaue Skihose mit weißen Rennstreifen und einen blau-weiß gemusterten Pullover. Sie sprang geschickt von ihrem Sitz, trat an die Kante der Betonplattform und sah eine Weile zu uns herüber. Dann machte sie sich auf den Weg.
Auf der steinernen Veranda vor der Hütte waren sechs oder acht Tische aufgestellt, an denen vielleicht ein Dutzend Leute saßen. Sie kam mit ihren Skiern und Stöcken auf der Schulter direkt auf uns zu und begann unvermittelt: »Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mich gestern Abend ziemlich dumm benommen.«
»Den Eindruck hatte sonst niemand«, antwortete ich. »Darf ich Ihnen etwas bestellen? Heiße Schokolade? Ich trinke sie sonst nicht, aber hier schmeckt sie großartig.«
Die stämmige, braungebrannte Kellnerin kam heraus. Elisabeth bestellte: »Eine Schokolade, bitte.«
Fräulein Bailey lehnte ihre Skier an das Geländer und setzte sich bedächtig hin. Sie zog ihre Handschuhe aus.
»Fräulein Bailey«, eröffnete Elisabeth das Gespräch, »Sie werden vielleicht glauben, dass wir aufdringlich sind – aber wenn wir Ihnen in irgendeiner Weise helfen können …«
Mit leichtem Stirnrunzeln sah sie an uns vorbei, hinauf zur weitgeschwungenen Flanke des Kreuzeck. »Ich weiß nicht«, sagte sie, »vielleicht sind Sie auch schon infiziert, genau wie die anderen.«
»Infiziert?«, fragte ich.
»Sagen Sie: Halten Sie es für möglich, dass man jemanden zum Wahnsinn treibt, indem man ihm immer wieder sagt, dass er verrückt ist?«
»Nein, das glaube ich nicht, das ist völlig unmöglich.«
»Vor einer Woche hätte ich das auch noch gesagt, jetzt bin ich mir dessen nicht mehr so sicher.«
Ich beobachtete sie und versuchte herauszufinden, was für ein Mensch unter dieser starren Maske wirklich steckte. Sie war intelligent, das konnte man sehen. Vermutlich recht humorlos und manchmal sogar rechthaberisch. Aus dieser Kombination konnte sich leicht ein labiler Charakter ergeben und vielleicht sogar bemerkbar machen. Ich war mir nicht ganz sicher.
Elisabeth fragte: »Wollen Sie es uns nicht erzählen?«
Fräulein Bailey zögerte, dann begann sie plötzlich: »Sie wissen über Alfie Day-Armstrongs Reisegesellschaften Bescheid? Angeblich soll es da immer sehr fröhlich zugehen. Wir fuhren mit dem Zug von Hamburg aus über München hierher, und alle waren sehr freundlich, bis auf dieses unangenehme Mädchen, das unverschämt wurde. Es ging um eine ganz lächerliche Sache – zu ihrer Verabschiedung waren am Münchner Hauptbahnhof keine Fotografen erschienen. Was ich damit sagen will … Ich glaube, ich habe mich ziemlich dumm benommen. Ich habe seit mehr als zwei Jahren ziemlich hart gearbeitet und vor einigen Wochen eine ausgesprochen schwierige Aufgabe beendet. Ich weiß auch nicht mehr, was über mich kam, aber im Zug war ich … war ich wie beschwipst.«
Elisabeth nickte. »Das kann leicht passieren, wenn man überarbeitet ist.«
Ein wenig zweifelnd fuhr Fräulein Bailey fort: »Eigentlich wollte mich ein Bekannter begleiten, aber er musste im letzten Augenblick absagen, dann wäre das alles nicht geschehen …« Sie hielt inne und sah hinüber zu den Leuten, die aus dem Sessellift stiegen. Wir drängten sie nicht.
»Ich ging frühzeitig schlafen und ließ die anderen im Speisewagen sitzen. Ich hatte ein Schlafwagenabteil für mich allein und schlief sofort ein. Aber dann wurde ich wach. – Jedenfalls glaube ich das. Etwas beugte sich über mich. Ich höre noch den Zug pfeifen. Es war ein langgezogener, klagender Ton. Wir fuhren sehr schnell, und eine Lichterkette huschte draußen am Fenster vorbei. Irgendwo klingelte eine Glocke. Sie wurde lauter, als wir näher kamen, und auch höher im Ton, aber dann war es vorbei. Sie wissen schon: der Dopplereffekt. Der Zug fuhr um eine Rechtskurve. Man spürte, wie sich die Waggons in die Kurve neigten. Ich kann das alles nicht geträumt haben, nicht in allen Einzelheiten. Aber wenn es kein Traum war, wie ist dieser schreckliche Kerl dann in mein Abteil gekommen?«
Sie schloss die Augen und fuhr dann fort: »Es war natürlich Todenwart. Sein fleischiges rosa Gesicht schwankte im bläulichen Licht der Lampe hin und her. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Angst hatte. Ich versuchte, mich aufzusetzen, und ich glaube, ich lachte sogar. Dann schob er mich sanft zurück auf das Kissen und sagte: Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, wir dachten nur, es ginge Ihnen nicht gut. Es besteht keinerlei Anlass zur Besorgnis, aber Sie müssen die Vier Erzengel vergessen. Sie müssen sie vergessen. Ich fragte zurück: Warum Vier Erzengel? Und er sagte: Sie müssen nur die Zahl vier vergessen, nur die Vier Erzengel. Dann verschwand er. Ich muss wohl wieder eingeschlafen sein. Falls ich überhaupt wach gewesen bin. Ich weiß es immer noch nicht genau.«
Eine ganze Weile sagte keiner von uns ein Wort. Dann wollte Elisabeth wissen: »Haben Sie den anderen etwas davon gesagt?«
Wieder zögerte Fräulein Bailey, bevor sie antwortete: »Nein, ich wollte es zwar, ich hatte vor, es als Scherz zu erzählen, aber als ich dann am nächsten Morgen zum Frühstück in den Speisewagen ging, geschah etwas Schreckliches. Die anderen waren alle schon da und in sehr fröhlicher Stimmung. Aber als ich auftauchte, hörten alle Gespräche auf, sie starrten mich nur an. Es war ein Kreis ausdrucksloser Blicke, die sich auf mich richteten. Es war fast so, als würde ich an einer schrecklichen, deutlich sichtbaren Krankheit leiden. Aber dann kam Todenwart auf mich zu, und so etwas wie ein erleichtertes Aufatmen ging durch die anderen.«
Sie sah hinüber zum Sessellift. Plötzlich veränderte sich ihr Gesichtsausdruck. Ohne ihren Blick abzuwenden, streckte sie die Hand nach ihren Skiern aus. »Danke«, sagte sie. »Sie sind gute Zuhörer.«
»Fräulein Bailey«, fragte ich, »wer hatte denn das Abteil neben dem Ihren?«
»Ich glaube, ich habe jetzt keine Zeit mehr«, beschloss sie und trat hinaus in den Schnee. Sie schnallte die Halteriemen ab und legte die Skier auf den Boden. Dann sah sie noch einmal zum Lift hinüber, bückte sich rasch, machte die Bindungen zu, richtete sich auf und fuhr davon. Sekunden später war sie verschwunden.
Ich starrte hinter ihr her und fragte: »Was hat denn das nun wieder zu bedeuten?«
»Day-Armstrong«, antwortete Elisabeth.
Er kam auf uns zu, blieb dann aber stehen und schaute Fräulein Bailey nach, die inzwischen schon gut hundertfünfzig Meter entfernt war und immer schneller auf die nächste Kuppe zu wedelte.
»Wo will sie hin?«, fragte er.
»Das hat sie uns nicht gesagt«, antwortete ich. Plötzlich lag Spannung in der Luft. Er war schon damit beschäftigt, seine Bindungen zu befestigen.
»Was ist denn eigentlich los?«, verlangte ich zu wissen.
»Es könnte gefährlich werden, wie sie so achtlos dahinrast.« Sie war jetzt im Begriff, rasch einen Hügel hinaufzuklettern. »Der Teufel soll sie holen«, brummte er und zog sich die Skibrille über die Augen.
»Wir kommen auch mit«, sagte Elisabeth.
Day-Armstrong warf einen Blick über die Schulter. »Hören Sie, das ist keine Rettungsaktion. Ich will sie nur vor Schwierigkeiten bewahren. Überlassen Sie das bitte mir.« Er lächelte uns entwaffnend an und fuhr dann im Schuss davon.
»Gedeon, sollen wir ihn fahren lassen?«, fragte Elisabeth.
»Ja, ihr wird schon nichts passieren.«
»Woher weißt du das?« Der Zweifel in ihrer Stimme war unüberhörbar.
»Es war doch deine eigene Idee, dass hier ein Mord vorbereitet wird. Sollte Fräulein Bailey tatschlich die Mörderin sein, dann wird man sehr gut darauf aufpassen, dass ihr nichts Unvorhergesehenes passiert.«
»Du glaubst es also auch schon?«
»Ich weiß nicht recht. Aber dieses kleine Drama eben wirkte … ja, es wirkte völlig unvorhergesehen. Wenn es geplant gewesen wäre, hätte sich Day-Armstrong nicht so hastig davongemacht. Wollen wir nicht auch ein bisschen Skifahren? Wir könnten zur Kreuzeckabfahrt hinübersteigen.«
Wir fuhren am Lift vorbei, dann den Hang oberhalb des Waldes hinunter, bogen von der Richtung ab, die Fräulein Bailey eingeschlagen hatte, und fuhren quer hinüber auf die Bäume zu. Nach ein paar Sekunden hatten wir die anderen Skifahrer hinter uns gelassen. Nur noch der Fahrtwind pfiff an uns vorüber, der Schnee knirschte unter unseren Brettern, und die silbrig-braun leuchtenden Tannen kamen näher. Es war eine lange, rasche Abfahrt mit einigen Anstiegen dazwischen. Während der nächsten halben Stunde sagte keiner von uns beiden etwas, und wir dachten auch kaum noch an Fräulein Bailey, bis wir auf ein weites Schneefeld am oberen Ende des Kreuzeckhangs hinausfuhren und weit unter uns den Schlepplift und die Almen im Tal liegen sahen.
Über uns zog sich eine markierte Abfahrt bis über die Baumgrenze hinauf und verschwand wie ein dünner Faden um eine weiß aufragende Bergschulter. Alles war sehr still hier. Der Berghang lag verlassen da, bis auf ein kleines hölzernes Chalet mit steilem Dach, das sich wie ein alter brauner Hut halb zwischen den Bäumen verbarg. Es hatte einen geschnitzten und bemalten Balkon, ein weit hervortretendes Dach, einen windschiefen Schornstein, aus dem ein dünner blauer Rauchfaden aufstieg, und ein Holzschild an der Tür, das in altmodischen Lettern verkündete: Jausenstation.
Elisabeth sagte: »Ein richtiges Knusperhäuschen. Lass uns reingehen.«
»Du siehst aber gar nicht wie Gretel aus«, antwortete ich.
Wir ließen unsere Skier auf der Veranda stehen und traten in einen kleinen, dunklen, holzverkleideten Raum, in dem es muffig und still war bis auf das lärmende Ticken einer bemalten Schweizer Uhr. Ein kleines Mädchen auf einer Schaukel diente als Pendel.
Nahezu geräuschlos erschien eine Frau. Sie war schmal und hager und bis auf die buntbestickte Schürze ganz in Schwarz gekleidet. Sie stand da und sah uns wortlos an.
Ich fragte: »Kaffee?«
Da machte die Uhr ein furchtbar albernes Geräusch und krächzte Kuckuck!.
Elisabeth kicherte. »Wirklich ein echtes Knusperhäuschen, und wenn die Frau keine Hexe ist, fresse ich einen Besen.«
»Reden wir nicht von Hexen«, schlug ich vor. »Erzengel genügen schon.«
»Richtig«, stimmte sie mir zu, »was hältst du von dieser komischen Geschichte? War Todenwart wirklich in Fräulein Baileys Abteil?«
»Schon möglich«, sagte ich. »Die Sache ist ganz einfach: Je zwei Schlafwagenabteile haben eine Verbindungstür. Man kann sie öffnen und notfalls zu einem Viererabteil verbinden. Er brauchte sich nur, während alle anderen im Speisewagen waren, zurückschleichen und diese Verbindungstür öffnen. Wenn diese dumme Gans nicht abgehauen wäre, hätte ich ihr all das innerhalb einer Minute erklären können.«
»Wirklich einfach«, murmelte sie leise. »Und was sonst?«
»Fräulein Bailey hat vom Dopplereffekt gesprochen. Was glaubst du wohl, wie viele Menschen das unter diesen Umständen festgestellt hätten und es zudem ganz selbstverständlich erwähnen würden?«
»Sehr viele, dieser Effekt ist doch bekannt. Ich würde auch davon sprechen.«
»Du hast ja schließlich auch studiert, für dich ist die Sache selbstverständlich. Außerdem sagte sie, sie hätte die letzten zwei Jahre furchtbar hart gearbeitet und gerade etwas sehr Wichtiges beendet. Ob sie wohl Wissenschaftlerin ist? Nehmen wir an, hier wird tatsächlich ein Mord vorbereitet. Es mag dann vielleicht nicht wichtig sein, aber es könnte doch von Nutzen sein, wenn man wüsste, was Fräulein Bailey von Beruf ist.«
Die Frau brachte den Kaffee. Ich wartete, bis sie wieder gegangen war. »Einen geeigneteren Ort könnte man sich dafür kaum aussuchen. Man braucht nur jemanden bewusstlos zu schlagen oder einen kleinen Unfall zu arrangieren, ihn ein paar Stunden liegenlassen, und schon stirbt er an Unterkühlung. Das könnte darauf hindeuten, dass die ganze Sache hier oben über die Bühne gehen soll. Deshalb versucht man vielleicht, Fräulein Bailey als Psychopathin hinzustellen. Dann kann man nämlich von ihr erwarten, dass sie unvermutet und ohne jegliches Motiv tötet. Die Sache bliebe automatisch an ihr hängen.«
»Du hast manchmal eine ausgesprochen charmante Phantasie.«
»Es ist ja auch ein charmanter Gedanke«, erwiderte ich. »Und praktisch idiotensicher. Niemand könnte mit so einer Geschichte zur Polizei gehen. Die würden sich kranklachen. Jedenfalls bevor es geschieht – nicht nachher.«
Sie legte ihre Hände wie ein kleines Mädchen um die Kaffeetasse und sah stirnrunzelnd aus dem Fenster. »Ich weiß, dass ich diesen Gedanken angestoßen habe«, sinnierte sie. »Aber jetzt erkenne ich eine Menge Lücken in meiner Theorie.«
»Ich auch, aber im Augenblick haben wir keine andere. Falls also Todenwart und vielleicht auch noch andere Leute wahrhaftig einen Mord planen, so sollten wir tatsächlich versuchen, das Opfer ausfindig zu machen. Wer gehört denn außer dieser Beat-Sängerin und ihrem blonden Freund und dem adligen Paar noch zu der Reisegesellschaft?«
»Ein recht harmloses Ehepaar namens Frankenstein – ulkig, was? Außerdem ein Herr Knight, ein Mann um die Dreißig.« Sie trank ihren Kaffee aus. »Heute Nachmittag spreche ich einmal mit dem Pfarrer.« Als sie meinen verständnislosen Blick bemerkte, erklärte sie: »Liebling, schau mich nicht so verblüfft an. Meinst du nicht, dass ein Geistlicher der Einzige wäre, der uns etwas über Erzengel sagen könnte?«
Der Gedanke erschien mir ganz vernünftig. Also machten uns auf den Rückweg zum Hotel Königsspitze.
Nach dem Mittagessen – Fräulein Bailey erschien nicht, obwohl wir lange auf sie warteten – ging Elisabeth in die Stadt hinunter. Ich stieg hinauf zur Eislaufbahn des Hotels. Hier herrschte am Nachmittag immer buntes Treiben, und man konnte gewiss damit rechnen, jemanden aus Day-Armstrongs Reisegesellschaft zu treffen.
Einer von ihnen, ein großer, hagerer Mann, bei dem es sich nur um Herrn Knight handeln konnte, stand auf den Stufen und schaute den Schlittschuhläufern zu. Er sah vermutlich älter aus als er war. Er hatte sich eine Pelzmütze tief über die Ohren gezogen und trug einen Mantel, der ihm fast bis an die Knöchel reichte. Er wirkte düster, kalt und traurig. Als ich mich ihm näherte, murmelte er etwas von der verdammten Kälte und ging davon. Ich peilte Sir Walther und Lady Lucy Richardson an. Sie saßen in warme Decken eingewickelt neben einem Ehepaar, von dem ich annahm, dass es die Frankensteins waren. Auch sie machten einen vollkommen normalen Eindruck. Die Frau war hübsch, aber bestimmt nicht übermäßig klug, während ihr Mann ein solider leitender Angestellter in irgendeiner Firma sein mochte.
Sir Walther war mir sofort sympathisch. Er war schon über die besten Jahre hinaus, klein und ein wenig plump, ohne wirklich dick zu sein. Dabei hatte er ein pfiffiges Gesicht, das vor Lebensfreude nur so glühte, und ein paar helle, neugierige Augen. Er hielt ein dampfendes Glas zwischen den Händen und sagte: »Na, junger Freund, wollen Sie sich doch einmal mit uns abgeben? Sie sind doch sicher der Bursche, der sich die kleine Elisabeth Kleeberger geschnappt hat, nicht wahr? Damit haben Sie verdammt guten Geschmack bewiesen.«
»So ein hübsches Mädchen«, sagte Lady Richardson und lächelte mich an. Auch sie war sehr zierlich und wirkte ganz und gar natürlich. »Und noch dazu ein so ruhiges Kind«, fügte sie hinzu.
»Mach dir nichts vor, Lucy«, knurrte Sir Walther. »Ich kenne ihren Vater, und der ist mit allen Wassern gewaschen. Ein ausgesprochen harter Bursche. Wie kommen Sie denn mit dem General zurecht, Sckell?«
»Aber Walt!«, sagte Lucy. »Eine wirklich aufdringliche Frage. Wie gefällt es Ihnen hier, Herr Sckell? Wir finden es nett, aber sehr kalt. Aber da wir sonst für gewöhnlich auf den Bahamas Urlaub machen, ist es mal eine hübsche Abwechslung.«
»Halt den Mund, Lucy«, sagte Sir Walther.
Das konnte den ganzen Nachmittag so weitergehen, wenn ich nicht etwas unternahm. Ich wollte zumindest auf eine Frage eine Antwort bekommen.
»Warum sind Sie diesen Winter ausgerechnet hierhergekommen?«
Es folgte ein überraschtes Schweigen. Dann lachte Lady Richardson plötzlich laut auf. »Ach, du liebe Zeit«, sagte sie. »Das ist Walts großes Geheimnis.«
Er wurde erst rosarot und dann dunkelrot und sah mich über sein Glas hinweg unglücklich an. Mit einem Seitenblick auf Lady Richardson presste er den Mund zusammen.
»Tut mir leid«, sagte ich, »ich hätte diese Frage nicht stellen sollen.« Dann führ ich rasch fort: »Aber etwas können Sie mir sicher sagen, es ist nichts Persönliches. Sir Walther, was ist auf der Herfahrt im Zug tatsächlich geschehen?«
»Die arme Frau«, murmelte Lady Richardson. »Sie tut mir natürlich leid, aber das alles ist nicht sehr schön. Ich meine, wenn man Urlaub macht, darf man doch erwarten … So vieles existiert nur in der Einbildung, nicht wahr? Man weiß es nicht genau. Wie die arme Nancy Prescott, die überall Pekinesen sieht. In meinem Kopf geht auch manchmal alles ein bisschen durcheinander, Herr Sckell, aber ich sage mir immer …«
»Halt den Mund, Lucy«, wiederholte Sir Walther.