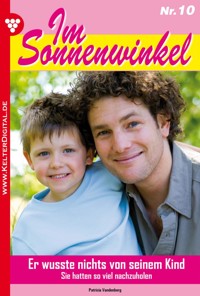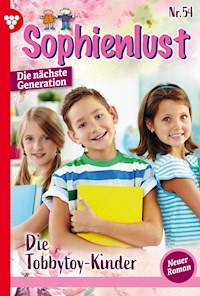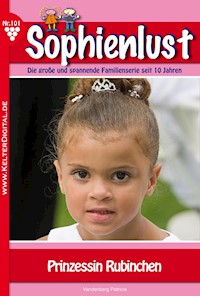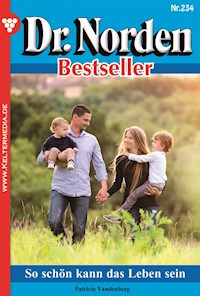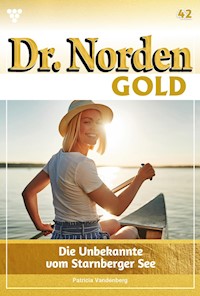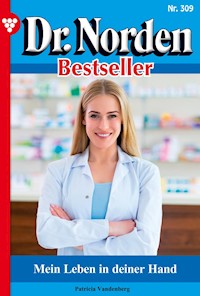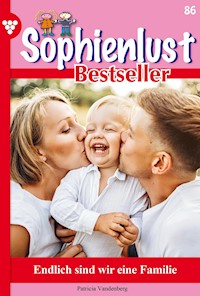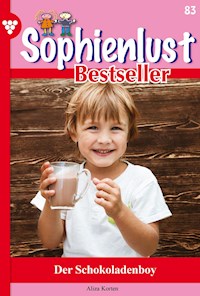Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Dr. Norden Bestseller
- Sprache: Deutsch
Für Dr. Norden ist kein Mensch nur ein 'Fall', er sieht immer den ganzen Menschen in seinem Patienten. Er gibt nicht auf, wenn er auf schwierige Fälle stößt, bei denen kein sichtbarer Erfolg der Heilung zu erkennen ist. Immer an seiner Seite ist seine Frau Fee, selbst eine großartige Ärztin, die ihn mit feinem, häufig detektivischem Spürsinn unterstützt. Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten. Mehr als 1.000 Romane wurden bereits geschrieben. Die Serie von Patricia Vandenberg befindet sich inzwischen in der zweiten Autoren- und auch Arztgeneration. Es war ein trauriger Tag im Leben der Familie Porta, als die heißgeliebte Omi ihre gütigen Augen für immer schloss. Dr. Norden hatte Johanna Alberti nach einem schweren Herzanfall noch in die Behnisch-Klinik bringen lassen, aber diesmal hatte man ihr nicht mehr helfen können. Es war bereits der dritte Anfall gewesen. Renate Porta blieb bis zur letzten Minute bei der Mutter. »Nicht weinen, nicht traurig sein, es war eine schöne Zeit mit dir, mit euch«, das waren Johanna Albertis letzte Worte gewesen. »Gönnen wir ihr dieses friedliche Ende«, sagte Dr. Daniel Norden leise. »Sie war die beste, gütigste Mutter«, flüsterte Renate, »aber sie hat wohl zu lange mit Vater gelitten und ihn dann doch zu sehr vermisst.« Ja, so war es gewesen. Jochen Alberti war viele Jahre krank gewesen, schon im Krieg schwer verwundet worden, dann fast erblindet. Aber er hatte alle Schmerzen mit unendlicher Geduld und Tapferkeit ertragen und war von seiner geliebten Johanna rührend umsorgt worden. Sie kannten sich von Jugend an, und sie hatten es erzählt, dass sie Jojo die Unzertrennlichen genannt wurden. Jürgen Porta kam nun herein und nahm seine Frau in die Arme. Dr. Norden ging hinaus zu den Kindern Isabel und Florian, die blass am Fenster standen. Die Achtzehnjährige wirkte völlig versteinert, nur ihre großen dunklen Augen drückten eine unendliche Traurigkeit aus. Florian machte seinem Kummer in rauer Bubensprache Luft. »So ein Mist, andere Leute werden hundert Jahre alt«, murmelte er. Und dann wandte er sich ab, damit man die Tränen nicht sehen sollte, die ihm nun über die Wangen rollten. Isabel
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Norden Bestseller – 213 –Eine Frau sucht ihren Namen
Patricia Vandenberg
Es war ein trauriger Tag im Leben der Familie Porta, als die heißgeliebte Omi ihre gütigen Augen für immer schloss. Dr. Norden hatte Johanna Alberti nach einem schweren Herzanfall noch in die Behnisch-Klinik bringen lassen, aber diesmal hatte man ihr nicht mehr helfen können. Es war bereits der dritte Anfall gewesen.
Renate Porta blieb bis zur letzten Minute bei der Mutter. »Nicht weinen, nicht traurig sein, es war eine schöne Zeit mit dir, mit euch«, das waren Johanna Albertis letzte Worte gewesen.
»Gönnen wir ihr dieses friedliche Ende«, sagte Dr. Daniel Norden leise.
»Sie war die beste, gütigste Mutter«, flüsterte Renate, »aber sie hat wohl zu lange mit Vater gelitten und ihn dann doch zu sehr vermisst.«
Ja, so war es gewesen. Jochen Alberti war viele Jahre krank gewesen, schon im Krieg schwer verwundet worden, dann fast erblindet. Aber er hatte alle Schmerzen mit unendlicher Geduld und Tapferkeit ertragen und war von seiner geliebten Johanna rührend umsorgt worden. Sie kannten sich von Jugend an, und sie hatten es erzählt, dass sie Jojo die Unzertrennlichen genannt wurden.
Jürgen Porta kam nun herein und nahm seine Frau in die Arme. Dr. Norden ging hinaus zu den Kindern Isabel und Florian, die blass am Fenster standen.
Die Achtzehnjährige wirkte völlig versteinert, nur ihre großen dunklen Augen drückten eine unendliche Traurigkeit aus. Florian machte seinem Kummer in rauer Bubensprache Luft.
»So ein Mist, andere Leute werden hundert Jahre alt«, murmelte er. Und dann wandte er sich ab, damit man die Tränen nicht sehen sollte, die ihm nun über die Wangen rollten.
Isabel weinte nicht, und sie sagte kein Wort. Sie ging hinaus zum Blumenladen und kaufte einen Strauß Vergissmeinnicht. Die legte sie dann wenig später ihrer Omi auf die Bettdecke.
»Sie schläft doch nur«, murmelte sie, und da konnte Renate die Tränen doch nicht mehr zurückhalten.
Isabel war ein besonders sensibles und eigenartiges Kind gewesen, und sie hatte mit einer Liebe ohnegleichen an ihrer Omi gehangen. Bevor sie zur Schule ging, hatte sie immer erst geschaut, ob die Omi schon wach sei, wenn sie aus der Schule kam, fragte sie immer gleich, wo die Omi sei.
Was die Omi kochte, schmeckte ihr am besten, und niemand konnte schönere Geschichten erzählen, als sie. Später, als Isabel erwachsen wurde, hätte sie gern mehr von früheren Zeiten erfahren und von der alten Heimat, in der die Großeltern aufgewachsen und zur Schule gegangen waren, aber da sagte Johanna Alberti dann nur: »Wir wollen froh sein, dass wir hier eine neue Heimat gefunden haben, und dass es uns wieder gutgeht, Isabel. Man soll sich das Herz nicht schwermachen mit Erinnerungen, die unwiederbringlich verloren sind.«
Wie schwer sie wohl manches Mal an diesen Erinnerungen gelitten hatte, sollte ihnen, die sie nun vermissen mussten, erst später bewusst werden.
Johanna Alberti fand ihre letzte Ruhestätte neben ihrem Mann, und als der Sarg ins Grab gesenkt wurde, weinte Isabel so fassungslos und erschütternd, dass es Renate Angst wurde.
Es sollten Wochen vergehen, bis Isabel die Räume, die die Omi bewohnt hatte, erstmals wieder betrat. Eines Tages sagte sie: »Omi hat immer so viel in dem Buch geschrieben, Mami. Hast du es gelesen?«
»Welches Buch meinst du, Isabel?«, fragte Renate erstaunt.
»Ich denke, dass es so eine Art Tagebuch war, nur viel dicker. Sie konnte so schöne Geschichten aufschreiben. Vielleicht sollte das ein Roman werden.«
»Ich weiß gar nicht, wo sie das Buch aufbewahrt haben könnte, Isabel«, sagte Renate nachdenklich.
»In der Truhe, in ihrer Truhe, Mami.«
Renate wandte sich ab. »Die sie ausdrücklich dir bestimmt hat, mein Kind«, sagte sie leise. »Ich wollte darüber noch nicht sprechen, bevor du den ersten großen Schmerz nicht überwunden hast, Isabel. Wir, Jürgen und ich, sind uns ja einig, dass ihr beide sowieso alles bekommen sollt, was von den Großeltern bleibt.«
»Mir geht es doch nicht um Geld und materielle Dinge, Mami. Sie fehlt mir, weil ich nicht mehr mit ihr sprechen kann. Sie hat so oft gesagt, dass ich vieles verstehen würde, wenn ich erwachsen bin. Aber ich bin doch jetzt erwachsen.«
»Es tut mir weh, dass du so sehr trauerst, Isabel«, sagte Renate leise. »Wir, deine Eltern, lieben dich doch auch.«
»Und ich euch auch, Mami«, erwiderte Isabel weich. »Daran darfst du nicht zweifeln, aber Omi war für mich was ganz Besonderes. Du und Papi, ihr führt doch eine so glückliche Ehe, und da wollte sie sich nie hineindrängen, aber sie war so glücklich, dass ich so gern bei ihr war, besonders dann, als Opi nicht mehr da war. Sie hätte bestimmt noch viel länger gelebt, wenn Opi nicht so früh gestorben wäre. Wenn man so viel von seinem Herz verschenkt, dann hat der andere Teil nicht mehr viel Kraft.«
Renate traten Tränen in die Augen. »Du bist so jung, Isabel. Du darfst nicht ewig trauern«, sagte sie leise.
»Ich möchte jetzt gern wissen, was sie geschrieben hat. Wenn ich zu ihr kam, legte sie das Buch schnell fort. Wenn ich sie fragte, ob sie mir daraus nicht vorlesen wolle, schüttelte sie den Kopf. Das sei noch nicht für mich bestimmt, hat sie gesagt. Und wenn ich sie gefragt habe, ob ich sie störe, hat sie mich in die Arme genommen. Lebendiges Glück, hat sie mich genannt. Aber sie hat Florian auch sehr lieb gehabt, das darfst du nicht bezweifeln. Alle hat sie geliebt, und sie war so dankbar, dass du einen so guten Mann bekommen hast. Aber das hat sie dir doch auch oft gesagt, Mami.«
»Ja, das hat sie oft gesagt. Mütter wünschen sich immer, dass ihre Töchter auch eine so harmonische Ehe führen, wie sie selbst. Ich wünsche das für deine Zukunft auch, Isabel.«
»Damit hat es ja noch viel Zeit«, meinte Isabel.
»Sag das nicht, mein Kleines. Oft geht es viel schneller, als man denkt. Ich war ja auch erst neunzehn, als ich Jürgen kennenlernte, und wir hatten das Glück, dass meine Eltern nicht dagegen waren, dass wir so bald geheiratet haben. Ein bisschen haben sie wohl immer gedacht, dass wieder ganz plötzlich ein Krieg kommen könnte. Ihnen wurde so viel zerstört, Isabel. Aber denk du jetzt daran, wie sie das Leben gemeistert haben, welches Vorbild sie uns sein können. Ich habe nie etwas entbehrt.«
Nach diesem Gespräch war Isabel nach oben gegangen, und Renate bekam ihre Tochter lange nicht zu Gesicht.
Sie wollte Isabel nicht stören, weil sie nun dachte, dass sie wieder in Trauer versunken sei. Aber dann schien Isabel auch das Abendessen vergessen zu haben, und so ging Renate hinauf, sie zu holen.
»Hast du keinen Hunger, Isabel?«, fragte sie sanft. »Florian muss heute noch zum Handballtraining.«
Isabel blickte auf. »Daran habe ich gar nicht gedacht«, sagte sie leise, »aber das ist gut, dann sind wir allein.«
Renate erschrak ein wenig. Plötzlich kam ihr Isabel soviel gereifter vor, sehr ernst, aber nicht deprimiert.
Isabel umarmte ihre Mutter. »Jetzt begreife ich erst ganz, welch eine großartige Frau Omi war«, sagte sie leise. »Ich hoffe, du wirst es auch so empfinden, Mami.«
Renate war verwirrt. Beim Essen war sie diesmal die Schweigsame.
Da Florian wieder für zwei aß, fiel es nicht so auf, dass es ihr an Appetit mangelte, und dann hatte es der Junge eilig.
»Spring nicht zu hoch, Flori«, scherzte Jürgen. »Jedesmal, wenn du vom Training kommst, habe ich das Gefühl, dass du wieder ein paar Zentimeter größer bist.«
»Hast wohl Angst, dass ich dich bald überhole, Paps?«, fragte Florian.
»Noch länger als ich brauchst du wirklich nicht zu werden, Junge. Sonderanfertigungen kosten einen Haufen Geld«, meinte Jürgen Porta seufzend.
Er war aber zufrieden, dass sich bei ihnen das normale Leben wieder eingependelt hatte, da er nicht ahnen konnte, welche Überraschung ihnen dieser Abend noch bringen sollte.
*
Isabel kam mit dem dicken Buch ins Wohnzimmer, nachdem sie für eine Weile verschwunden war.
»Was ist das?«, fragte Jürgen Porta erstaunt, während ein ängstlicher Ausdruck in Renates Augen kam.
»Omis Geschichte«, erwiderte Isabel sanft. »Florian braucht das nicht gleich zu erfahren. Jungs in seinem Alter reagieren da manchmal komisch.«
»Du willst damit doch nicht etwa andeuten, dass es einen dunklen Punkt in Omis Vergangenheit gibt?«, fragte Jürgen. »Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.«
»Einen ganz hellen Punkt möchte ich es nennen«, sagte Isabel. »Und ich hoffe, dass ihr es so versteht wie ich, und dann nicht sagt, dass sie es nicht hätte verschweigen dürfen. Im Grunde ist es ja wie ein Märchen, wenn es sich auch in sehr traurigen Zeiten zutrug. Du warst ja auch erst acht Jahre alt, als dieser schreckliche Krieg zu Ende war, Papi. Wo warst du da eigentlich?«
Jürgen sah seine Tochter betroffen an. »Soviel ich weiß, war ich da in Oberammergau bei meinen Großeltern. Mein Vater war vermisst, meine Mutter war als Ärztin in einem Lazarett tätig. Ist das jetzt noch wichtig, Isabel?«
»Jetzt ist alles für mich sehr wichtig«, sagte Isabel leise. »Uns ist es immer so gut gegangen. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie schwer es die Menschen damals hatten. Hättest du Mami eigentlich auch geheiratet, wenn sie so ein Findelkind gewesen wäre?«
»Du stellst plötzlich Fragen«, sagte er nachdenklich. »Ich glaube, mich hätte es nicht interessiert, wer ihre Eltern sind, woher sie kommt und was das für eine Familie sein könnte. Als wir uns kennenlernten, es war auf dem Oktoberfest, wusste niemand etwas vom andern. Wir waren jung und sofort sehr verliebt. Es stimmt doch, Reni?«
»Und wie verliebt«, sagte Renate träumerisch. »Damals war ja alles noch viel romantischer. Was willst du uns eigentlich sagen, Isabel?«
»Dass du ein Findelkind bist, Mami, wenn man es so nennen will. Soll ich euch vorlesen, was Omi geschrieben hat, oder wollt ihr es lieber selbst lesen?«
»Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein«, stammelte Renate. »Ich habe doch eine richtige Geburtsurkunde, und da sind Joachim und Johanna Alberti als meine Eltern ausgewiesen. Wir haben niemals Schwierigkeiten gehabt.«
»Die Omi dir auch ersparen wollte«, sagte Isabel ruhig. »Oh, ich habe sie genau begriffen. Ich lese es euch vor: ›Wir müssen Usedom verlassen. Ich kann Jo nur mitteilen, dass ich nach Berlin gehen werde zu Elmar und Antje. Ob ihn der Brief erreicht? Wo mag er jetzt sein? Wie wird unsere kleine Reni diese Reise überstehen? Sie ist so zart.‹«
»Aber dann bin ich doch kein Findelkind«, sagte Renate tonlos.
»Hör weiter, Mami«, sagte Isabel. »Ein paar Tage später schreibt Omi: ›Im Zug konnten wir kaum atmen, so viele Frauen und Kinder waren da zusammengedrängt, und die meisten waren schon so mutlos. Und dann immer diese Durchhalteparolen. Reni ist so schwach gewesen. Ich hatte Angst. Dann wurde der Zug bombardiert. Ich dachte nicht, dass wir das lebend überstehen, aber als es vorbei war, ich könnte es nicht mehr beschreiben, wie wir aus dem Zug herauskamen und es war finstere Nacht, hielt ich mein totes Baby im Arm. Ich konnte, ich wollte es nicht begreifen. Eine hochschwangere junge Frau tröstete mich. Komm, sagte sie, vielleicht sind wir bald auch tot. Deinem Kind bleibt viel erspart. Gott allein weiß, was einem beschieden sein wird, wenn es überhaupt noch zur Welt kommt.‹«
Isabel machte eine Pause und blätterte die Seite um. Jürgen und Renate saßen wie erstarrt. Dann fuhr Isabel fort: »›Ich muss das aufschreiben, obgleich ich mich nicht mehr an alles, was dann geschah, genau erinnern kann. Kristina, den Namen hatte sie mir genannt, zog mich mit. Sie schob den Kinderwagen mit meinem Baby. Wir werden es begraben, Johanna, sagte sie, und vielleicht begraben sie uns dann auch. Alles kommt wie es uns bestimmt ist.
Dann war plötzlich Tag, und ich konnte sie deutlich sehen. Eine große blonde Frau mit einem sehr schönen Gesicht. Auch voller Schmutz war es noch schön. Ich habe sie bewundert, da ich mich selbst so schwach fühlte. Sie war bestimmt im achten Monat.
Kristina hieß sie, mit K, das betonte sie, und sie stammte aus Ostpreußen. Sie wollte auch nach Berlin. Wir waren noch weit davon entfernt und mussten den Weg zu Fuß zurücklegen. Aber dann kamen plötzlich Männer, Sanitäter und wohl auch Soldaten. Sie brachten uns in ein Notlazarett. Kristina hatte schon starke Wehen, und als ich spürte, welche Schmerzen sie litt, fühlte ich mich als die Stärkere. Gott allein weiß, woher man die Kraft nimmt in solchen Stunden, woher ich sie nahm, da ich doch mein Kind verloren hatte. Kristina brachte ein Mädchen zur Welt. Als man es ihr sagte, verließ sie alle Kraft. Er wollte nur einen Sohn, murmelte sie, und sie starb. Und in meinem Kinderwagen lag wieder ein Baby. Niemand sagte mir, was mit meinem Kind geschehen war, es ging alles drunter und drüber. Wieder kam ein Flugzeugangriff. Ein fremder Wille zwang mich, mit dem Kinderwagen wegzulaufen. Irgendwo verließ mich die Kraft. Ich wusste nicht, wo ich war, aber ich erwachte vom Weinen des Babys, es weinte jämmerlich. Es hatte Hunger, und ich dachte, es wäre meine Reni. Ich legte es an meine Brust. Es begann zu saugen. Ich konnte es nicht begreifen, dass es möglich war, aber es gab auch mir Kraft, weiterleben zu wollen. Es war ein Wunder, es war wohl Gottes Wille. Ein alter Bauer fand uns, brachte uns auf seinen Hof. Weit hinter Berlin lag der schon, nahe der Elbe. Wir wurden gut versorgt, meine kleine Renate und ich, soweit man das damals als gut versorgt verstehen konnte. In dem Kinderwagen fand ich einen Umschlag mit ein paar Fotografien und einer Kette mit einem Medaillon, die mir nicht gehörten, aber ich hatte meine Tasche nicht verloren, in der sich meine Papiere befanden und eine Geburtsurkunde, die auf den Namen Renate Alberti lautete. Ich hatte mein Kind verloren und ein anderes bekommen, das seine Mutter verloren hatte, und Kristinas Worte: Er wollte ja nur einen Sohn, klangen mir in den Ohren. Ihren Nachnamen habe ich nicht erfahren, aber ich nehme an, dass ihr die Kette und die Fotos abgenommen wurden und zu dem Baby gelegt worden waren. Aber es war kein Ausweis dabei, keine Urkunde, durch die ich ihren Nachnamen hätte erfahren können, und vielleicht sollte das auch so sein. Wie ich die schrecklichen Monate, die dann noch folgten, überstanden hätte, wenn ich mein Kind nicht gehabt hätte, ja, ich sage mein Kind, dem ich alle Liebe geben konnte, hätte ich nicht gewusst. Aber wie dieses Kind in all dem Elend gedieh, war ein Wunder, und so begriff ich es. Das Kind brauchte mich, es brauchte Liebe, und es gab mir die Kraft zum Weiterleben. Wenn Renate dies einmal liest, soll sie wissen, dass ihre Mutter sie nicht hätte mehr lieben können, als ich. Aber wenn ich an Kristina dachte, musste ich weinen, und ich habe mir immer gewünscht, wenigstens ein paar Blumen auf ihr Grab legen zu können, als Dank für das, was sie mir schenkte.‹«
Ganz leise hatte Isabel die letzten Worte gesagt, dann schlug sie das Buch zu. »Für heute ist das wohl genug«, flüsterte sie.
»Sie hat das ganz allein mit sich herumgetragen«, sagte Renate bebend.
»Du warst ihr Kind, Mami«, sagte Isabel. »Sie wollte, dass du unbeschwert von der Vergangenheit heranwächst. Was konnte sie dir mehr geben, als so viel Liebe, die sie dann auch uns gab. Nie kam ein böses Wort über ihre Lippen, immer war sie nur bereit zu geben, nie hatte sie etwas gefordert. Für mich wird sie immer das bleiben, was sie war, meine über alles geliebte Omi. Und dennoch möchte ich das erfüllen, was ihr versagt blieb.«
»Was denn, Isabel?«, fragte Renate.
»Blumen auf Kristinas Grab legen, als Dank, das uns durch Omis Liebe unsere sehr geliebte Mutter geschenkt wurde«, sagte Isabel.
Ein atemloses Schweigen war im Raum. »Aber wie denn, Kind?«, fragte Jürgen beklommen. »Wie sollten wir dieses Grab finden?«
»Ich will und werde es finden«, sagte Isabel. »Es gibt doch einen Suchdienst des Roten Kreuzes. Auch jetzt kann man noch manchmal in der Zeitung lesen, dass Verwandte zusammengeführt werden, oder Gräber von Gefallenen gefunden werden. Ich habe bisher nicht so darüber nachgedacht, aber jetzt glaube ich, dass ich das unserer Omi schuldig bin. Wir würden doch gar nicht auf der Welt sein, wenn Omi nicht gewesen wäre.«
*
»Womit sie recht hat«, sagte Jürgen Porta gedankenverloren.
»Sie war mir eine so liebevolle Mutter«, flüsterte Renate. »Warum soll nach vierzig Jahren Vergangenes heraufbeschworen werden? Es waren schreckliche Zeiten, aber davon weiß ich doch gar nichts mehr.« Fröstelnd zog sie die Schultern zusammen.