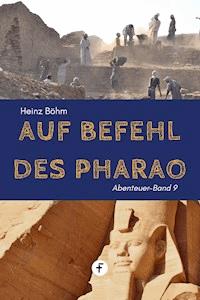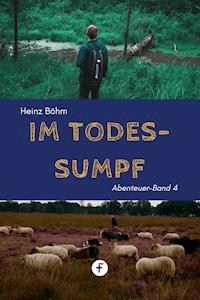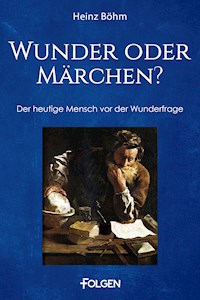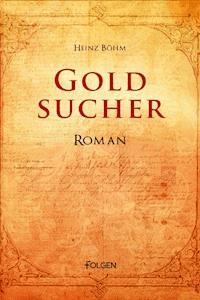Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Woher kommt die Hoffnungslosigkeit, die so viele Bereiche unseres Lebens prägt? Was bleibt noch, worauf man hoffen kann, wenn wir ständig an die Grenzen des Wachstums stoßen? Gibt es mehr als nur eine Hoffnung, die sich auf die Welt beschränkt? In diesem Buch zeigt Böhm die Wurzeln einer verlorenen Hoffnung auf und beleuchtet, wie Dichter wie Hemingway, Sartre und Camus sowie Philosophen wie Feuerbach, Marx und Bloch der Hoffnungslosigkeit in ihren Werken Ausdruck verliehen haben. Diese Denker haben vielleicht nur das aufgegriffen, was „in der Luft lag“, aber ihre Gedanken haben über Jahrzehnten hinweg das Denken, insbesondere an Universitäten, maßgeblich beeinflusst. Oft ist es schwer, geistesgeschichtliche Zusammenhänge zu verstehen, da Fachleute für ein Fachpublikum schreiben. Doch Böhm macht es dem Leser leicht, die Verbindungen nachzuvollziehen. Er bringt uns die Hauptideen dieser Persönlichkeiten näher, zitiert aus ihren Werken und setzt ihre Gedanken in Bezug zur biblischen Hoffnung. Denn eines ist klar: Kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Stellvertretend für all diejenigen, die eine biblische Perspektive der Hoffnung vertreten, stellt Böhm den Theologen Paul Schütz vor. Schütz' Denken über Hoffnung gründet sich fest auf die Bibel – eine Hoffnung, die nicht nur im Leben, sondern auch im Sterben trägt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Generation der Hoffnungslosen
Eine Auseinandersetzung zwischen atheistischerWeltanschauung und christlichem Glauben
Dichter: Ernest Hemingway, Jean Paul Sartre, Albert Camus; Philosophen: Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Ernst Bloch; Theologe: Paul Schütz
Heinz Böhm
Impressum
© 2015 Folgen Verlag, Bruchsal
Autor: Heinz Böhm
Cover: Peter Voth, Düren
Lektorat: Mark Rehfuss, Schwäbisch Gmünd
ISBN: 978-3-944187-88-4
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Impressum
Inhalt
1. Teil - Horizonte der Sinnlosigkeit
Ernest Hemingway
Der Weg nach nirgendwo …
Der alte Mann und das Meer
Jean Paul Sartre
Zur Freiheit verurteilt
Humanismus ohne Gott
Freiheit und Wahl
Wahl und Verantwortung
Der Ekel
Bei geschlossenen Türen
Albert Camus
Klar denken und nicht hoffen
In der Nacht des Absurden
Der Mythos von Sisyphos
Der Fremde
Der Mensch in der Revolte
Die Pest
2. Teil - Gott als Hindernis der Hoffnung
Ludwig Feuerbach
Gott – Wunschbild des Menschen
Feuerbachs Lutherkritik
Die Gestalt Jesu aus der Sicht Feuerbachs
Der Unterschied zwischen Information und Erkenntnis
Karl Marx
Religion – Opium des Volkes
Zwei Klassen
Abhängigkeit durch Gnade
Die Schlagzeile vom Opium des Volkes
Falsche Motive der Religion
Arbeit als Recht, aber nicht als Rechtfertigung
3. Teil - Ernst Bloch
Der Mensch, das hoffende Wesen
Das Prinzip Hoffnung
Die heile Welt aus dem Möglichen
Mose als Stifter des Exodusgottes
Jesus und der Vater
Wer war Jesus wirklich?
Ein neuer Gott entsteht
Drei Wunschmysterien
Das Ausgelassene bei Ernst Bloch
Des Menschen Freude an Gott
Die unterschlagene Herrlichkeit Jesu
4. Teil - Paul Schütz
Das Charisma Hoffnung
Das Charisma ist verloren gegangen
Ja und nein zur theologischen Wissenschaft
Die Folgen des erloschenen Charismas
Erloschenes Charisma als Gericht
Das Geheimnis der »Leisen Stimme«
Keine Gemeinde ohne die »Leise Stimme«
Die »Leise Stimme« und die Heilige Schrift
Das isolierte Kreuz
Die »Rechtfertigung« des Gekreuzigten
Das eigentliche Ärgernis
Nichts Neues an der Auferstehungskritik
Der falsche Bezug zur Auferstehung Jesu
Gibt es ein Weiterleben nach dem Tode?
Zwischen Enttäuschung und Hoffnung
Die ausgebliebene Wiederkunft Jesu
Der biblisch verstandene Begriff Parusia
Entsprachlichung ist Entwirklichung
Nur der Heilige Geist spricht Leben zu
Anmerkungen
I. Teil
Horizonte der Sinnlosigkeit
Durch die Kraft der Sprache gelingt es den drei Dichtern Hemingway, Sartre und Camus, die Horizonte der Sinnlosigkeit als drohende Wände in unserer Zeit aufzuzeigen.
Da werden Schicksale geschildert, zufällig aus dem Nichts fallend, erloschenen Sternen gleich, von niemandem gelenkt, gesteuert oder beobachtet. Selbst hinter glücklichen Stunden ragt die Rätselwand des Zufalls auf, und besonders bei Hemingways Erzählungen neigt sich diese unheimliche Wand immer zum Verderben des Menschen.
Eines darf nicht übersehen werden, das gilt sowohl für die Dichter als auch für die Philosophen, dass Dichtung und Leben größtenteils mit ihren eigenen Lebenserfahrungen aufs Engste verwoben sind. Jean Paul Sartre hat in dieser Hinsicht ein bemerkenswertes Zeugnis hinterlassen. In seinen Büchern und Dramen lässt er keinen Zweifel darüber aufkommen, dass für ihn selbst der göttliche Horizont ausgelöscht ist, gleichwohl aber schreibt er in seinen »Wörtern«, wie er sich der Gegenwart Gottes einmal hautnah bewusst wurde. Er schreibt:
»Ein einziges Mal hatte ich das Gefühl, es gäbe Ihn. Ich hatte mit Streichhölzern gespielt und einen kleinen Teppich versengt; ich war im Begriff, meine Untat zu vertuschen, als plötzlich Gott mich sah. Ich fühlte Seinen Blick im Innern meines Kopfes und auf meinen Händen; ich drehte mich im Badezimmer bald hierhin, bald dorthin, grauenhaft sichtbar, eine lebende Zielscheibe. Mich rettete meine Wut: Ich wurde furchtbar böse wegen dieser dreisten Taktlosigkeit, ich fluchte, ich gebrauchte alle Flüche meines Großvaters. Gott sah mich seitdem nie wieder an.«1
Dieses schonungslose Bekenntnis des französischen Dichters stellt dem Glaubenden einige ernste Fragen. Werden die Glaubenden in ihrer Hoffnung auf Gott so bewegt, wie die Dichter durch ihre Hoffnungslosigkeit erschüttert werden? Diese Anfrage der Welt müssen sich die Glaubenden gefallen lassen; sie sollten sich sogar bemühen, eine Antwort darauf zu geben.
Erweist sich die Hoffnung als eine verwandelnde Kraft – oder bleibt alles in einer frommen Sprache stecken? Hier sind die Glaubenden zur Verantwortung ihres Bekenntnisses gerufen.
Ernest Hemingway
Der Weg nach nirgendwo …
Am 02.07.1961 nahm sich der berühmte amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway das Leben. Hemingways Biograf Astre berichtet: »Er nahm sein Lieblingsgewehr, eine mit Silber eingelegte speziell für ihn angefertigte Jagdflinte, aus dem Ständer, steckte sich die Läufe in den Mund und drückte beide Abzüge ab. Die Explosion riss ihm den Kopf fast vollständig weg.«2 In der folgenden kurzen Betrachtung über den Dichter Hemingway wollen wir uns insbesondere seiner Meistererzählung: »Der alte Mann und das Meer« zuwenden.3 Hemingway hat wohl zumindest in seinen letzten Lebensjahren das Selbstgespräch des alten Mannes als persönliches Credo übernommen: »Aber der Mensch darf nicht aufgeben. Man kann vernichtet werden, aber man darf nicht aufgeben.«4
Über den glücklichsten Stunden seiner Romanhelden liegt oft das seltsame Zwielicht des bereits hinter dem Horizont heraufziehenden Verderbens. Die Menschen können sich ihres Glückes nicht lange freuen.
Es ist wie die Atempause des Schicksals, das gewissermaßen die Luft anhält, um dann umso wütender sein Zerstörungswerk zu treiben.
Eindrücklich hat Hemingway diese Tatsache in seinem Roman: »In einem andern Land« beschrieben. Nach vielen Qualen, Ängsten und Entbehrungen gelingt es einem jungen Paar über die Grenze in die sichere Schweiz zu fliehen. Hier scheint sich ihr ganzes Glück der Zweisamkeit voll entfalten zu können. Sie sind ein Herz und eine Seele; nichts trübt ihre innige Gemeinschaft. Aber dann geschieht das Unfassbare. Catherine, die Geliebte, erwartet ihr erstes Kind und wird in die Klinik eingeliefert. Dumpfe Ahnungen, dass die Sache nicht gut ausgeht, peinigen den wartenden Mann. Seine Ahnungen treiben ihn zur Klinik. Scheinbar geht alles reibungslos, aber dann – dann schlägt der Hammer des Schicksals unerbittlich zu. Sowohl Catherine als auch das Kind sterben, und der gebrochene Mann schlurft durch den strömenden Regen durch die Nacht.
Der alte Mann und das Meer
In der Erzählung »Der alte Mann und das Meer« hat Hemingway sich selbst ein Denkmal gesetzt, und wenn man diese Erzählung aufmerksam zu sich reden lässt, wird der spätere Selbstmord des Dichters irgendwie begreiflich. Da wird uns die Geschichte eines Fischers erzählt, dem sein Handwerk das Nötige zum Leben einbringt, aber nie kann er »vorsorgen«; er lebt sozusagen jeden Tag von der Hand in den Mund. Dann scheint auch seine große Stunde zu kommen. Auf der Wasserwüste des Meeres begegnet ihm der freundliche Zufall in der Form eines so herrlichen Fisches, wie er noch keinen in seinem Leben vorher gesehen hat.5
Unter dem bestimmten Eindruck, dass dieser Fisch ein Geschenk des Himmels sein muss, will der alte Mann durch viele Gebete und durch eine Wallfahrt sich bei der Jungfrau von Cobre bedanken.6 Auf den folgenden Seiten schildert Hemingway den Kampf des alten Mannes mit dem Fisch. Immer wieder klagt der Fischer darüber, dass er alt geworden sei und dass er den Jungen nicht bei sich habe, der ihn schon so oft begleitet hat. Schließlich gelingt es ihm, den Fisch mit einer Harpune zu treffen. Meisterhaft wird dieser Augenblick von Hemingway beschrieben:
»Nun wurde der Fisch lebendig, als er den Tod in sich spürte, und sprang hoch aus dem Wasser und zeigte seine ungeheure Länge und Breite und seine ganze Macht und Schönheit. Er schien über dem alten Mann in dem Boot in der Luft zu hängen. Dann fiel er krachend ins Wasser, so dass Schaum über den alten Mann und über das ganze Boot spritzte.«7
Der alte Mann kann es selbst kaum fassen, dass er diesen Fisch erledigt hat, aber es ist keine Täuschung; die glucksenden Wellen umspülen dessen schimmernden Leib. Zwischen dem erfolglosen Leben seiner Vergangenheit und dem schon erahnten Dunkel der nächsten Zukunft erfährt der alte Mann das beglückende Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt! Er weiß, nun beginnt die eigentliche Plackerei, aber im Augenblick verwandelt sich seine düstere Zukunft in leuchtende Helle. Der alte Mann beginnt sogar zu rechnen:
»Er wiegt über fünfzehnhundert Pfund, so wie er ist, dachte er. Vielleicht viel mehr. Wenn er ausgenommen zwei Drittel davon wiegt, zu dreißig Cent das Pfund«.8
Sobald man Hemingways Leben aus der Sicht des modernen Erfolgsdenkens, des Karrierestrebens betrachtet, leuchtet der Vergleich mit dem herrlichen Fisch ohne weiteres ein. Offensichtlich hat es die Glücksgöttin Fortuna gut mit dem amerikanischen Dichter gemeint. Er war weltberühmt, Träger des Nobelpreises für Literatur; seine Bücher wurden fast alle erfolgreich verfilmt und nahezu in alle Kultursprachen übersetzt.
Aber das alles vermochte sein Leben nicht wahrhaftig und ganz auszufüllen. Das heißt im Blick auf seine berühmte Erzählung: Der herrliche Fisch war dauernd gefährdet. Aus der Tiefe des Meeres waren schon die Haie unterwegs, um den Fisch zu zerstören. Hemingway beschreibt diese Situation:
»Der Hai kam nicht zufällig. Er war von tief unten im Wasser heraufgekommen, als die dunkle Blutwolke sich gesetzt und in der meilenweiten See verteilt hatte. Er war so schnell heraufgekommen und so völlig ohne Vorsicht, dass er die Oberfläche des blauen Wassers durchbrach und in der Sonne war.«9
Der erste Hai reißt nach der Schätzung des alten Mannes vierzig Pfund Fleisch aus dem Leib des Fisches.10 Nach diesem Überfall durch den Hai mag der alte Mann den verstümmelten Fisch nicht ansehen. Aber schon jetzt verliert der Augenblick seine Bedeutung, und der alte Mann konzentriert sich auf die zukünftige Zeit. »Denk an irgend etwas Erfreuliches, alter Freund«, sagte er. »Jede Minute bist du jetzt näher an Zuhaus. Du segelst um vierzig Pfund leichter.«11
Im Verhältnis dessen, was der alte Mann als Beute noch heimzubringen hofft, fallen die vierzig Pfund nicht ins Gewicht, aber so überlegt er, die frische Blutwolke im Meer wird andere Haie heranlocken. Dass Hemingway sich mit jenem alten Mann seiner Geschichte identifiziert, davon sind die meisten seiner Kritiker überzeugt; was aber bedeuten die Signale der Hoffnung, die immer wieder zwischen der Resignation blitzartig aufleuchten? Während der alte Fischer mit der angefetzten Beute gut vorankommt, kehrt ein Teil seiner Hoffnung zurück. Er denkt darüber nach, dass Hoffnungslosigkeit sogar Sünde sein könnte, aber dann fährt er sich selbst in seine Gedanken und meint, er habe jetzt andere Probleme, als an die Sünde zu denken.12
Vom allgemeinen Verständnis her wird der Lebenssinn eines Menschen am Erfolg gemessen. Wer Erfolg hat, der hat aus seinem Leben etwas gemacht.
Wird Hemingways Leben an dieser Wertskala gemessen, dann hat er ein erfolgreiches Leben gehabt. Was bei den meisten nur unerreichbarer Wunschtraum bleibt, hat sich in seinem Leben randvoll verwirklicht. So verstanden, hätte er als Sieger mit dem herrlichen Fisch im Heimathafen einfahren müssen. Umjubelt, bewundert, aber doch nicht, wie Hemingway es schildert, geschlagen, innerlich zerstört, hinter sich das kahlgefressene Skelett des Fisches.
Wie können wir symbolisch die gefräßigen Haie einordnen, die das Leben des alten Mannes zerstört haben? Offensichtlich hat Hemingway gerade hier die radikale Sinnlosigkeit seines Lebens unterstreichen wollen; also keine Erklärung geben, keine Antwort suchen, sondern lediglich feststellen wollen, dass des Menschen Weg dunkel und ohne Hoffnung im alles verschlingenden Nichts endet. Ob sich Hemingway darüber klar war oder nicht; seine eigentliche Not lag darin, dass er Jesus Christus in seinem Leben ausgeklammert hatte.
Gewiss hat er sich mit dem christlichen Glauben oft befasst und sich damit auseinandergesetzt; jedoch erwies sich der Sog seines nihilistischen Untergrundes als mächtiger. Der starke Wunsch, auf Nimmerwiedersehen im Nirgendwo zu verlöschen, trug endlich seine volle, überreife Frucht. Die aufhorchende Welt war entsetzt und erschüttert, dagegen ahnten es die »Eingeweihten«, dass jene schreckliche Versuchung des Selbstmordes schließlich zur Tat werden musste. War es nicht doch die fehlende Ewigkeit, die den Dichter zu seinem Verzweiflungsschritt getrieben hatte? Hans Jürgen Baden zitiert in seinem Buch »Poesie und Theologie« einige Sätze aus Hemingways Nobelpreisrede aus dem Jahre 1954. Hemingway äußert sich da über den Beruf des Schriftstellers:
»Arbeitet er doch in der Einsamkeit und muss, wenn er ein guter Schriftsteller ist, sich jeden Tag mit der Ewigkeit auseinandersetzen – oder mit dem Fehlen dieser Ewigkeit.«13
Die Sehnsucht Hemingways, bzw. den Drang, sich selbst in Nichts aufzulösen, finden wir in manchen Aussagen, die er seinem alten Mann gewissermaßen als Bekenntnis in den Mund legt.
So z. B. als er in seinem Boot auf der Wasserwüste treibt, umgeben von See und Himmel. Da spricht er zu sich selber: »Du bist müde, alter Freund. Du bist innendrin müde.«14
Obwohl die Haie dem alten Mann zwischendurch eine Atempause gönnen und den angerissenen Fisch nicht angreifen, so weiß er doch, sie werden wieder auftauchen.
So überraschend und unberechenbar das Meer ihm vor Stunden den herrlichen Fisch bescherte, ebenso unberechenbar trägt ihm das gleiche Meer jetzt die gefräßigen Haie zu. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann werden ihre grausamen Kiefer wieder zuhacken. Um Mitternacht ist es dann soweit. Hemingway schildert:
»Aber um Mitternacht kämpfte er, und diesmal wusste er, dass der Kampf zwecklos war. Sie kamen in einem Rudel, und er konnte nur die Linien sehen, die ihre Flossen im Wasser machten und ihr Phosphoreszieren, als sie sich auf den Fisch stürzten. Er schlug mit seiner Keule auf Köpfe ein und hörte ihre Kiefer zuhacken und spürte das Beben des Bootes, als sie sich festbissen.«15
Sollte es bloßer Zufall sein, dass Hemingway die hoffnungsloseste Stunde im Leben des alten Mannes durch die gleichen Worte einleitet, mit denen die Erscheinung des himmlischen Bräutigams angekündigt wird? Wir lesen da im Matthäusevangelium:
»Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, gehet aus, ihm entgegen« (Matth. 25, 6)!
Hier brechen wir ab. Wer wagt es, den ersten Stein zu werfen? Hemingway hat bewusst auf alle Hilfe von oben verzichtet. Es scheint so, dass ihn dieser Verzicht nicht besonders tief berührt hat. Auf den letzten Seiten der berühmten Erzählung erfährt der alte Mann einen fast glückseligen Abstand von sich selbst und seinem Kampf mit den mörderischen Haien. Seine Gedanken gehen zurück, die Augenblickschance mit dem großen Fisch weicht dem Bild der Vergangenheit. Der großgeträumte Traum von dem Fisch, von den erwarteten Einnahmen durch sein Fleisch, der Bewunderung durch die anderen Fischer wird abgelöst von nur dem einen Wunsch, schlafen, ruhen, abschalten.
»Und mein Bett, dachte er. Mein Bett ist mein Freund. Ja, mein Bett, dachte er. Das Bett wird wunderbar sein. Es ist einfach, wenn man geschlagen ist, dachte er. Ich wusste niemals, wie einfach es ist. Und was hat dich geschlagen?, dachte er. Nichts, sagte er laut. Ich bin zu weit hinausgefahren.«16
Für den alten Mann wird das im Heimathafen aufragende Skelett des riesigen Fisches zu einem Zeichen, dass er endgültig und unwiderruflich geschlagen war.17
Wir wiederholen noch einmal die Frage: Wer wagt den ersten Stein zu werfen? Hemingway hat den eisigen Hauch der Sinnlosigkeit nicht ausgehalten und hat wohl, wenn auch unbewusst, das Wort Kierkegaards bestätigt: »Gottes bedürfen, ist des Menschen höchste Vollkommenheit.«
Jean Paul Sartre
Zur Freiheit verurteilt
Der französische Dichter und Philosoph Jean Paul Sartre hat mit seinen Werken, besonders durch seine Romane und Dramen, die breite Masse des Volkes erreicht. Gegenüber den herkömmlichen Philosophen, deren Gedanken mehr im Lager der Intellektuellen »verhandelt« werden, hat Sartre durch seine Doppelbegabung – Philosoph und Dichter – die abstrakten philosophischen Gedanken mundgerecht und für jeden verständlich, in seinen zahlreichen Romanen und Theaterstücken verarbeitet.
Bevor wir auf seine Romane und Dramen eingehen, wenden wir uns kurz seinem rein philosophischen Denken zu. Der Dichter Sartre nennt sich ganz bewusst atheistischer Existentialist, also ein sogenannter Ungläubiger, für den es keinen Gott gibt.18 Allerdings, so bekennt er selbst, sei ihm der Unglaube nicht mit in die Wiege gelegt worden. In dem bereits angeführten Buch »Die Wörter« schreibt Sartre:
»Ich gelangte zum Unglauben nicht durch den Konflikt der Dogmen, sondern durch die Gleichgültigkeit meiner Großeltern.«19
Friedrich Nietzsches Parole: »Gott ist tot!« wird für Sartre zur Voraussetzung seines ganzen literarischen Schaffens. Die Frage, ob Gott existiert oder nicht, scheidet als Diskussionsthema von vornherein aus. Durch diese Voraussetzung rückt der Mensch ganz in den Vordergrund. Sartre ist sich durchaus klar darüber, dass er durch die Leugnung Gottes zugleich alte, herkömmliche Werte zerstört.
Hat er mit dieser Entscheidung der menschlichen Willkür und Grausamkeit nicht Tür und Tor geöffnet? Aus der Sicht des christlichen Denkens verbindet sich das Wissen um den lebendigen Gott sofort mit einer anderen, gewissermaßen notwendigen Folgerung: der Verantwortung des Menschen gegenüber seinem Schöpfer.
Sartre weiß um diese Schutzzone, die der Mensch eben um Gottes willen gegenüber dem Nächsten nicht ungestraft überschreiten darf. Sartre zitiert den bekannten Satz Dostojewskis: »Wenn Gott nicht existierte, so wäre alles erlaubt«, und Sartre nennt diesen Satz sogar den Ausgangspunkt des Existentialismus.20
Humanismus ohne Gott
Sartre versteht den Satz des russischen Dichters nicht als eine große Negation, wie es Dostojewski wohl gesehen hat; vielmehr steigert sich nach Sartres Verständnis die Verantwortung des Menschen ins Unermessliche. Dem Menschen wird nach dem »Tode Gottes« fortan die Rolle zugeteilt, die sonst Gott zugeschobene Funktion zu übernehmen. Das heißt, der Mensch ist nicht mehr der Beschützte, sondern der Schützende, nicht mehr der Behütete, sondern der Hüter. Es ist des Menschen ureigenste Verantwortung für den Menschen, und er erhält sie nicht etwa als einen Auftrag von oben, und darum hat er sich oben auch nicht zu verantworten. Weil diese Verantwortung dem Menschen von keinem Gott aufgetragen ist, kann sie sich nur im ganz irdischen Horizont einer absoluten Freiheit vollziehen und auswirken. Bevor wir dem Sartreschen Freiheitsbegriff nachdenken, streifen wir kurz den Freiheitsbegriff des Neuen Testamentes. Nach dem biblischen Zeugnis ist der Mensch nicht frei; vielmehr muss er befreit werden (Joh. 8, 36). Diese Unfreiheit äußert sich in doppelter Weise:
Der gebundene Mensch steht in dem Konflikt zwischen Wollen einerseits und Nichtkönnen andererseits (Röm. 7, 13). Und hier stößt Sartres Freiheitsbegriff mit dem biblischen sofort zusammen. Von Sartres Verständnis her gibt es nichts Vorgegebenes, was diese Freiheit in irgendeiner Weise einschränkt bzw. beeinflusst.
Weil Sartres Freiheit durch nichts eingeschränkt ist, auch nicht durch den Willen eines Gottes, wie es das Neue Testament bezeugt, so ist der Mensch für sein Tun voll verantwortlich. Natürlich kann des Menschen Freiheit sich auch zu einer Knechtschaft entwickeln, falls der Mensch diese Freiheit nicht zu gebrauchen weiß und sie darum verfehlt.
Demgegenüber bezeugt der Apostel Paulus, dass eine absolute Freiheit durch die Macht der Sünde im Fleisch für den gebundenen Menschen einfach nicht möglich ist. Sartre verwirft solche Gedanken vollständig. Er gibt durchaus zu: Verfehltes Leben ja, aber eben niemals durch eine vorgegebene Knechtschaft, wie z. B. durch die Macht der Sünde, gegen die der Mensch schlechthin ohnmächtig ist. Sartres Denken über die Freiheit gipfelt in dem kurzen prägnanten Satz:
»Der Mensch ist verurteilt, frei zu sein.«21
Darum hängt alles an des Menschen Entscheidung, d. h. an seiner Wahl.
Freiheit und Wahl
Freiheit und Wahl gehören für Sartre unbedingt zusammen. Von dieser Freiheit her, die durch nichts eingeschränkt ist, erhält des Menschen Tun seinen Wert erst durch die Wahl. Der Mensch kann, ja, er muss sogar aufgrund seiner absoluten Freiheit, die Werte seines Lebens selbst bestimmen. Weil er durch nichts in seiner Freiheit festgelegt ist, ist er andererseits auch durch nichts eingegrenzt. Es kommt allein auf den Menschen an, was er aus seinem Leben macht, und das heißt, was er wählt.
Es hängt von seiner Wahl ab, ob er ledig bleibt, ob er sich verheiratet, ob er sich betrinkt, oder ob er nüchtern bleibt, ob er aus seinem Leben etwas macht – oder ob er ein Versager wird. Dieser Wahl liegt auch nicht eine besondere Vorbelastung zugrunde, etwa dadurch, dass der Sohn eines Trinkers notwendigerweise in die Fußstapfen seines Vaters treten müsste. Sartre bestreitet nicht, dass Umwelt und Milieu den Menschen beeinflussen können, und dass solches oft geschieht, aber nichtsdestoweniger bleibt die Wahl – wie der Mensch sein Leben entwirft – als Möglichkeit seiner absoluten Freiheit voll bestehen.
Eindrücklich hat Sartre diesen Sachverhalt im Leben des Dichters Baudelaire beschrieben. Baudelaire liebte seine Mutter abgöttisch, und ihm brach eine Welt zusammen, als sie zum zweiten Mal heiratete. Nun wählte er die Einsamkeit als Grundlage seines weiteren Lebens; nicht weil er keine andere Möglichkeit hatte, vielmehr weil er es so wollte.
Sartre schreibt in diesem Zusammenhang:
»Der Mensch ist nichts anderes als sein Entwurf, er existiert nur in dem Maße, in welchem er sich verwirklicht, er ist also nichts anderes als die Gesamtheit seiner Handlungen, nichts anderes als sein Leben.«22
Diese offenbar einleuchtende Schreibtischthese des französischen Philosophen wird durch das gelebte Leben der Menschen radikal in Frage gestellt. Entgegen Sartres Auffassung ist der Mensch in den seltensten Fällen das, was er aus sich macht; vielmehr wird er geprägt von dem, was ihn treibt und beherrscht. Sartres Entwurf einer absoluten Freiheit ist nur möglich geworden, indem der eigentliche Hintergrund unserer Weltwirklichkeit geleugnet wird. Karl Heim betont es in seinen theologischen Werken immer wieder, dass dämonische Gewalten in der Auseinandersetzung mit göttlichen Mächten stehen, und hier ganz besonders den Menschen in diese Auseinandersetzung mit einbeziehen.23
Sartre leugnet beides, sowohl die göttliche Macht als auch eine ihr gegenüberstehende widergöttliche Macht.
Sartre bleibt bei seiner vorausgesetzten Entscheidung, dass es keinen Gott gibt, und er folgert daraus, dass der Mensch nach dem »Tode Gottes« neue Werte zu erfinden habe. Er führt aus:
»Aber da ich Gottvater ausgeschaltet habe, muss es wohl jemanden geben, der die Werte erfindet.«24
Sartre lässt seine zahllosen Anhänger nicht im Unklaren darüber, dass es solche Werte gibt, und dass diese Werte das Leben eines Menschen stark beeinflussen und prägen. So fügt er zu dem Begriff der Wahl den der Verantwortung hinzu.
Wahl und Verantwortung
Der Mensch hat nicht allein zu wählen, vielmehr muss er auch verantwortlich wählen. Wer vom christlichen Denken herkommt, geht als Glaubender davon aus, dass es absolute Verantwortung nicht gibt; höchstens übertragene oder noch abhängiger, nur aufgetragene Verantwortung. Wer setzt den Maßstab für die Verantwortung, wenn kein Gott da ist?
Sartre entgegnet solchen Argumenten, dass der Mensch selbst die Maßstäbe zu setzen hat. Darin sei die Ethik des Existentialismus sowohl anspruchsvoll und zugleich absolut. Eine sogenannte Vergeltungsethik, nach deren Vorstellung Gott die Bösen straft und die Guten belohnt, wird jede Zuwendung zum anderen durch falsche Motive von vornherein verseuchen. Verantwortung ist da bereits gefälscht, wo sie vom Lohngedanken einerseits und dem Erwarten einer Strafe andrerseits getragen wird.
Sartre schreibt:
»Was wir wählen, ist immer das Gute, und nichts kann für uns gut sein, wenn es nicht gut für alle ist.«25
Dieser theoretisch eindeutige, und wohl auch ehrlich gemeinte Satz des französischen Dichters erweist sich angesichts der erfahrbaren Wirklichkeit als Utopie. In dem einen Punkt hat Sartre allerdings recht, dass der Mensch wohl das Gute wählt, aber vorzugsweise für sich selbst und nicht für den andern. Darum ist wohl hier die Frage an ihn und auch an seine Gesinnungsgenossen erlaubt: Ob man ohne den lebendigen Gott überhaupt rechte Verantwortung haben kann?
»Nur ohne Gott« – würde Sartre vermutlich antworten; denn Verantwortung im Sinn des Christentums sei ja übertragene, und darum letztlich bewachte Verantwortung. Dagegen komme die Verantwortung der Nichtglaubenden aus der absoluten Freiheit, und daraus leitet sich die verantwortungsvolle Wahl, nicht allein für den Einzelnen, sondern außerdem für alle Menschen ab.
Die Möglichkeit der Christen, sich durch die übertragene Verantwortung zu beruhigen, bzw. zu trösten, falls etwas schief läuft, das kann und darf sich der Ungläubige nicht leisten. Er muss seine Wahl so verantwortlich treffen, dass alle Menschen geschützt sind, und dass die »Notbremse« Gott nicht gezogen werden braucht. Wie Sartre das im Einzelnen meint, erfahren wir in einem Satz aus seiner Feder:
»Indem wir sagen, dass der Mensch sich wählt, verstehen wir darunter, dass jeder unter uns sich wählt; aber damit wollen wir ebenfalls sagen, dass, indem er sich wählt, er alle Menschen wählt.«26
Ohne Zweifel, das hört sich gut an, aber gleichwohl kann uns solch ein Satz nicht überzeugen, besonders darum nicht, weil die Gestalten und Figuren in Sartres Romanen und Theaterstücken kaum dazu ermuntern, das Vertrauen des Menschen zum Menschen zu untermauern. Offenbar ist das philosophische Geländer fest und stabil, aber für den es entworfen ist, der kann damit nichts anfangen. Dieses Geländer passt nicht zum wirklichen Menschen. Sartre befindet sich mit seinem Entwurf seiner absolut verstandenen Freiheit in dem Paradox, dass er rein intellektuell den Menschen aus Römer 7 leugnet; ihn aber andrerseits, und zwar in seinem Leben und Verhalten, geradezu nach der Erkenntnis des Apostels Paulus gestaltet. Auch wenn es keine der Sartreschen Figuren herausschreit: »Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen aus dem Leibe dieses Todes?« (Röm. 7, 24), so empfindet der aufmerksame Zuschauer bzw. Leser, wie wirklichkeitsnah die Romanhelden dem unerlösten Menschen aus Römer 7 angepasst sind.
Anhand des berühmten Romans »Der Ekel«27 von Jean Paul Sartre und einem seiner Dramen werden wir seinen philosophischen Grundgedanken ganz neu wieder begegnen. Ganz neu in dem Sinn, dass die sonst reichlich gefrorene philosophische Sprache unter der Hand des Dichters Sartre leuchtend, feuerflüssig und im wahrsten Sinn des Wortes atemberaubend wird.
Der Ekel
Diesen Roman hat Sartre in der Form von Tagebuchaufzeichnungen verfasst. Er schildert das Leben des in Bouville lebenden Historikers Antoine Roquentin. Einsamkeit, Bindungslosigkeit und Verachtung seiner selbst und auch aller andern kennzeichnen den Alltag des nach Bouville verschlagenen Mannes. Er pendelt zwischen seiner Wohnung, zwischen Cafés und der Bibliothek hin und her, sucht sich zu zerstreuen, ohne sich fest an irgendeinen Menschen zu binden. Bereits auf den ersten Blättern seiner Aufzeichnung wird er vom Ekel überfallen. Er bekennt:
»Ich kann nicht mehr! Ich halte es nicht aus: mich hat der Abscheu gepackt – der Ekel. Und diesmal ist etwas Neues dabei: er hat mich im Café gepackt. Bis jetzt waren die Cafés mein einziger Schutz; denn sie sind voller Menschen und gut erleuchtet.«28
Was ist es um diesen Ekel, von dem Roquentin, der Romanheld Sartres, gepackt wird? Es ist der Abscheu davor, bewusst existieren zu müssen. Bewusste Existenz, das ist die Existenz des Menschen im Gegensatz zu den leblosen Dingen. Sartre unterscheidet in seinen philosophischen Entwürfen hinsichtlich der Existenz zwischen dem ruhenden kompakten Sein und dem dinglich Seienden. So abstrakt diese Gedanken in der philosophischen Einschalung auch immer sein mögen, im Gewand der Dichtung erhalten diese Gedanken eine unheimliche, geradezu tragische Dramatik. Sartre schildert das Bewusstwerden der Existenz, als Roquentins Blick auf die Wurzel eines Kastanienbaumes fällt. Diese Wurzel ist da, sie existiert, aber sie hat kein Bewusstsein zu sich selbst. Im Gegensatz dazu hat er, Roquentin, Bewusstsein. Dieses Bewusstsein treibt den Ekel wie eine Blüte aus der denkenden Existenz des Menschen hervor.
Zwischen der Überflüssigkeit des Kastanienbaumes und seiner eigenen Existenz besteht kein Unterschied. Roquentin stellt vor sich hin grübelnd fest:
»Überflüssig, da der Kastanienbaum links von mir, überflüssig auch die Velleda … Und auch ich – schlaff, träge, schamlos, verdauend, den Kopf voll finsterer Ideen –, auch ich war überflüssig.«29
Wie steht es nun angesichts dieser aufgezeigten Wertlosigkeit und Überflüssigkeit der menschlichen Existenz mit den erfundenen Werten Sartres? Der jüdische Gelehrte Martin Buber weist Sartre ohnehin einen schwerwiegenden Fehler nach, indem er die beiden Worte »finden« und »erfinden« von der Sprache her beleuchtet. Buber wendet gegen Sartre ein:
»Wenn ich Gott Vater abgeschafft habe, sagt Sartre wörtlich, muss wohl jemand da sein, um die Werte zu erfinden. Einen Sinn oder Wert kann man nur glauben, annehmen, als weisendes Licht über das eigene Leben stellen, wenn man ihn gefunden, nicht wenn man ihn erfunden hat.«30
Mit dieser eindeutigen Klärung zwischen erfinden und finden hat Martin Buber zugleich das Geheimnis der göttlichen Offenbarung angesprochen. Sartres voreilige Abschaffung Gottes unterstreicht des Menschen einzige Möglichkeit hinsichtlich des biblischen Offenbarungszeugnisses; nämlich sein Angewiesensein auf den Ruf Gottes, und zwar von Gott her zum Menschen hin. Sowohl im Alten, als auch im Neuen Testament wird Gottes menschensuchende Liebe darin bezeugt, dass Gott sich finden, aber doch nicht erfinden lässt.
Wir nehmen ein Beispiel aus dem Neuen Testament, um diese Reihenfolge zu untermauern. Gott kann nur darum gefunden werden, weil Er sich in dieser Welt offenbart hat. Zweimal lesen wir in Jesu bekanntem Doppelgleichnis vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle, »welchen ein Mensch fand«, und im Blick auf die Perle, »und da er eine kostbare Perle fand« (Matth. 13, 44+46). Da steht fand und nicht erfand.
Indes, Sartre vermag das biblische Zeugnis nicht anzuerkennen, und so hat seine Romanfigur Roquentin dieses nutzlose Dasein gewissermaßen stellvertretend auszubaden. Dieses Bewusstsein, im Gegensatz zum kompakten Sein (der unbelebten Materie), zieht noch eine andere peinigende Notwendigkeit nach sich: der Mensch kann denken. Und dieses Denkenkönnen steigert den Ekel bis an den Rand des Wahnsinns. Roquentin beobachtet seine Hand und wird sich bewusst: »Sie lebt, sie ist ich.«31
Und indem er das feststellt, wird ihm weiter bewusst, dass Existieren und Denken miteinander unlösbar verbunden sind. Selbst der stärkste Willensentschluss kann das Denken nicht abschalten; denn es ist wie ein Mechanismus in die Existenz eingebaut.
Roquentin stellt fest: »Der Körper, der lebt von allein, wenn er einmal angefangen hat zu leben.«32 Und darum wird das Denken nicht ohne, sondern nur mit der Zerstörung der Existenz erlöschen. »Mein Denken, das bin ich; deswegen kann ich nicht aufhören. Ich existiere, denn ich denke … und kann mich nicht hindern zu denken.«33 So spinnt sich dieser Roman von Seite zu Seite fort; nutzlose Zufälligkeiten, sparsames Aufflackern einer unbegründeten Lebensfreude, und immer wieder die Überfälle des Ekels.
Roquentin rechnet nicht mehr damit, dass sich irgendetwas ändern könnte. Der Ekel wird sein Lebensbegleiter bleiben, da es sonst keine anderen Begleiter geben wird. Selten ist die Nutzlosigkeit des Lebens, der menschlichen Existenz, so grauenhaft beschrieben worden, wie Sartre es in seinem »Ekel« getan hat. Das Leben hat eben keinen Wert. Auch darüber reflektiert Roquentin.
»Ich bin frei: Ich habe keinen Grund mehr, zu leben, alle Gründe, die ich durchprobiert habe, haben versagt, und ich kann mir keine anderen mehr ausdenken. Ich bin noch ziemlich jung, ich habe noch genügend Kraft, von vorn anzufangen. Aber was anzufangen?«34
Hier schließen wir ab. Roquentin lebt weiter, aber eines ist ihm zur felsenfesten Gewissheit geworden; der Ekel gönnt ihm nur ab und zu eine Erholungspause, aber er wird nie ganz verschwinden.35
Im Verhalten Roquentins wird das bekannte Wort Jesu zu einem unübersehbaren Zeichen: »… und deinen Nächsten wie dich selbst« (Luk. 10, 27). Wer sich selbst nicht bejaht, kann auch seinen Nächsten nicht bejahen und annehmen. Bemerkenswerterweise bildet die Gestalt Roquentins keine Ausnahme im Blick auf den Ekel vor der eigenen Existenz, und auch nicht in seiner Gleichgültigkeit gegenüber dem andern; vielmehr werden wir auch in dem kurzen Aufriss des Sartreschen Dramas »Bei geschlossenen Türen« ähnlichen lebensverneinenden Typen begegnen.
Bei geschlossenen Türen
In Sartres flüssigstem und wohl auch eindrücklichstem Drama »Bei geschlossenen Türen« schildert der Dichter die mitmenschlichen Beziehungen dreier Menschen, deren Schicksal es ist, in alle Ewigkeit unfreiwillig miteinander verbunden sein zu müssen. Die drei befinden sich im nachtodlichen Zustand in der Hölle.
Wie sieht diese Hölle aus? Sartre verlegt sie in ein nichtssagendes Hotelzimmer, ohne Fenster, ein dauernd grell brennendes elektrisches Licht, außerdem befindet sich kein Spiegel in dem Zimmer. Diese äußerlichen Dinge sollen zeichenhaft die Qual der darin Verbannten aussagen. Ohne Spiegel haben sie nie Gelegenheit, sich selbst anzusehen; vielmehr sind sie nur den Blicken der anderen ausgesetzt; und das dauernd brennende Licht verweigert ihnen die Erquickung des Schlafes.
Garcin, ein feiger Deserteur, betritt, begleitet von einem Kellner, als erster den Raum. Überrascht fragt er nach den Merkmalen der Hölle, so wie man sie sich im Erdenleben vorgestellt hat. Er wendet sich an den Kellner:
»Wo sind denn die Pfähle? Was? Die Marterpfähle, die Bratroste, die Blasebälge? Sie machen wohl Witze?«36