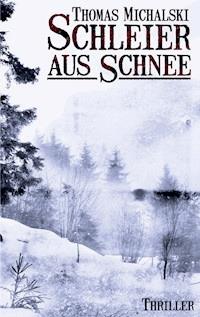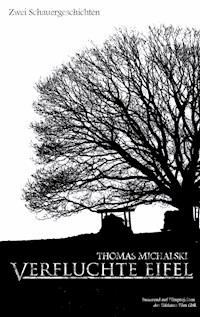Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jeder kann Filme machen! Man braucht dafür keine Multi-Millionen-Dollar-Budgets, keine aufwendigen Spezialeffekt-Werkstätten oder weltberühmte Stars. Was man braucht ist vor allem eine spannende Idee, eine Kamera und etwas Kreativität. Das nötige Hintergrundwissen hingegen findet man in diesem Buch. Vom Schreiben des Drehbuchs und Planen der Drehtage, vom Suchen und Finden von Crew und Schauspielern, über Equipment, Inszenierung, Schnitt und Spezialeffekte bis hin zum Marketing verrät einem Einfach Filme machen alles, was man wissen muss. Hier werden professionelle Theorie mit Tipps und Tricks aus Jahren des No-Budget-Filmens vereint wie es bisher noch nie geschehen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Michalski
Einfach Filme machen
Books on Demand
Für Silver. Du fehlst mir, armer, kleiner Kerl.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Einleitung
Vorproduktion
Kapitel 1: Die Idee
Kapitel 2: Das Drehbuch
Kapitel 3: Vom Drehbuch zum Filmdreh
Kapitel 4: Willkommen in der Vorhölle
Kapitel 5: Die Crew
Kapitel 6: Die Darsteller
Kapitel 7: Das Filmset
Kapitel 8: Das Equipment
Kapitel 9: Die Requisite
Einschub: Die Kamera
Produktion
Kapitel 10: Grundlagen der Bildsprache
Kapitel 11: Das Bild einfangen
Kapitel 12: Ein paar weiterführende Inszenierungsideen
Postproduktion
Einschub: Was man zur Postproduktion braucht
Kapitel 13: Der Filmschnitt
Kapitel 14: Das Spiel mit Farbe und Kontrast
Kapitel 15: Visuelle Effekte
Kapitel 16: Auf den Blauen Schirm
Kapitel 17: Der Vorspann
Kapitel 18: Der Ton
Vermarktung
Kapitel 19: Marketing
Kapitel 20: Artwork
Kapitel 21: Der Trailer
Kapitel 22: Die DVD
Kapitel 23: Sonstige Vertriebswege
Nachwort
Danksagungen
Quellenverzeichnis
Beispiel-Verträge
Index
Einleitung
Filme machen. Das ist mehr als „Filme drehen“, ist mehr als „Filme produzieren“. Einen Film zu machen, das ist die gemeinsame Hingabe verschiedenster Leute, die an einem Strang ziehen, um etwas Unmögliches zu schaffen. Einen Film zu machen, das ist in der Regel eine geradezu monumentale Aufgabe, deren Bewältigung mehr Stolz in sich birgt als man auch nur erahnen kann.
Einfach
„Einfach Filme machen“, das erscheint doch geradezu wie ein Paradoxon. So vieles muss getan, so vieles beachtet werden. Aber es ist möglich. Wer so ein Projekt mit ausreichend Planung angeht, dazu noch ein paar kleine Kniffe kennt und sie anzuwenden weiß, der kann tatsächlich einfach mal so einen Film machen.
Dieses Buch hier soll einem jeden dabei als Hilfsmittel dienen. Theorien und Philosophien gibt es zur Filmwissenschaft wie Sand am Meer, mal mit mehr, mal mit weniger Praxisbezug, aber damit wollen wir uns nur teilweise aufhalten. Weder ersetzt dieses Buch die Filmhochschule, noch möchte es das. „Einfach Filme machen“ ist ein Wegweiser durch die wunderbare Welt des NoBudget-Films, ein Ratgeber für alle Lebenslagen, ein Nachschlagewerk für jeden Schritt der Produktion.
Wer ohne Budget gerne einmal einen Spielfilm drehen will, der ist hier richtig.
Filme
Es ist dabei wichtig, dass wir hier von „Filmen“ sprechen. Es geht um die Magie des Films, um diesen Zauber, den man verspürt, wenn im Kino das Licht ausgeht, die Dudelmusik endet und die Eisverkäuferin verschwunden ist. Die freudige Erwartung, auf ein großes Abenteuer zu gehen.
Dabei muss man, wenn man ganz ehrlich ist, sich durchaus die Frage gefallen lassen, warum man eigentlich einen Film drehen will. Ich unterstelle mal jedem Leser dieser Zeilen ein generelles Interesse an dem Thema. Doch wie eingangs gesagt, einen Film zu machen ist viel Arbeit. Fragt euch ruhig, liebe Leser, warum ihr einen Film machen möchtet. Es gibt da keine richtigen und falschen Antworten, aber es gibt viele Varianten. Es kann ein schöner Zeitvertreib mit Freunden sein, es kann eine Geschichte sein, die man zu erzählen hat, kreativer Drang oder die Not, etwas der Welt mitzuteilen. Selbst „Ich wollte halt schon immer mal einen machen“ ist als Grund okay.
Dieses Wissen aber sollte man mitbringen, denn das kann dieses Buch einem auch nicht verraten. Was wir allerdings auf den folgenden Seiten finden werden, ist die Antwort auf die Frage, was einen Film eigentlich filmisch macht.
Sag’s auf Schlau: Budget
Quer durch dieses Buch verteilt werden immer mal wieder Textkästen wie dieser hier erscheinen. Darin wird eventuelles Fachchinesisch aufgelöst und kurz, aber verständlich erklärt. Das hilft dann beim Verständnis anderer Quellen zum Thema und gibt euren Erklärungen den kleinen Funken Autorität extra – am Set oder nach dem nächsten Kinobesuch.
Budget wird häufig missverstanden. Ein Budget beschreibt nicht, wie viel ein Film effektiv einmal gekostet haben wird, sondern ist laut Wörterbuch „die Feststellung des Finanzbedarfs“ im Rahmen einer Produktion.
Das ist bei großen Filmproduktionen kein großer Unterschied, bei kleinen Projekten allerdings sehr wohl. Denn auch ein NoBudget-Film kostet Geld, nur ist für die Produktion keines veranschlagt worden. Es gibt keinen großen Topf, aus dem bezahlt wird, sondern laufende Kosten werden vermieden oder im Vorbeiflug gedeckt.
Insofern unterscheidet sich ein NoBudget-Film auch erheblich von einem Low-Budget-Film, denn die spielen oft bereits in einer Liga, von der man nur träumen kann. Einige tausend Euro sind im Vergleich zum generischen Sommer-Blockbuster vielleicht ein Witz, aber sie wären die Erfüllung vieler geheimer Wünsche eines NoBudget-Filmers.
Das Gegenteil davon ist dann übrigens kein High-, sondern ein Big Budget-Film und meint die wirklichen Multimillionen-Dollar-Streifen.
Niemand käme auf die Idee, das Urlaubsvideo von Tante Hildegards Ausflug an die Nordsee mit einem Kinofilm zu vergleichen; aber warum nicht? Nach der Lektüre dieses Buches werden nun 24p, 16:9 und 2,35:1, NLE, Grading und derartige Begriffe keine kryptischen Erscheinungen mehr sein und jeder wird wissen, wie er einen „Filmlook“ hinbekommt.
Machen
Die meisten Tipps aus diesem Buch entspringen der Praxis und gehören da auch hin. Ohne Budget einen Film zu drehen ist Flickschusterei, Improvisation und Einfallsreichtum in gebündelter Form und die Lösungen, die man letztlich findet, haben oft nicht mehr viel mit dem zu tun, was ein Mediengestalter oder Filmhochschulgänger so lernt.
Der Grund dafür ist oftmals einfach: Es fehlt an allem. Wer einmal eine professionelle Lichtbatterie an einem viele Meter hohen Pfahl gesehen hat, die mal locker einen ganzen Burghof mehr als taghell werden ließ, der weiß, wovon ich rede.
Der NoBudget-Filmer hat derweil eine Hand voll Bauscheinwerfer mit Klebeband an einen Baum gewickelt und, wenn er Glück hat, sogar einen Stromgenerator, der überhaupt genug Leistung ausgibt, um damit arbeiten zu können.
Dabei hat die große Theorie der Fach- und Filmhochschulen ihren Sinn und ihre Daseinsberechtigung. Ohne die notwendige Theorie würde vieles nicht funktionieren, weshalb werde ich auch darauf eingehen, wo immer es nötig ist.
Man muss ohne Budget nur lernen, aus Wenigem Vieles zu machen. Doch genau solche Feinheiten werden wir uns in diesem Buch anschauen, denn das erspart einem nur viel Frust und Müh.
„Machen“ ist da auch durchaus wörtlich gemeint. Nirgends lernt man so viel über das Machen von Filmen wie am Set. Alle Theorie ist nichts wert, wenn man sie am Set nicht umsetzen kann. Die Botschaft dieses Büchleins ist also auch durchaus: Gehet hin und drehet Filme! Praxiserfahrung ist unersetzlich und führt vor allem im Endeffekt zu dem, was auch diesem Buch zu Grunde liegt, nämlich eben diese kleinen, aus der Not geborenen Erfindungen und Geistesblitze am Filmset.
Wie man dieses Buch benutzt
Dieses Buch ist grob in vier große Themenblöcke geordnet, die sich an den großen Abschnitten einer Filmproduktion orientieren. Anfangs steht die Vorproduktion (engl. „preproduction“), in der die Weichen gestellt, das Drehbuch geschrieben und der Film im Wesentlichen entworfen wird. Darauf folgt die Produktion, wo man tatsächlich mit Crew und Kamera ausrückt, um den Film zu drehen, also zu filmen. Danach folgt die Postproduktion, wo der Film dann geschnitten, nachbearbeitet, mit Effekten versehen und vertont wird. Zuletzt, eigentlich nicht Teil der klassischen Entstehungsphasen, folgt in diesem Buch noch der Abschnitt Veröffentlichung, in dem ich Wege präsentieren werde, wie ihr das, was ihr gedreht habt, nun auch an den Mann bekommt. Auch ohne große Werbebudgets.
Jeder dieser Abschnitte ist wiederum in zahlreiche Unterkapitel zerlegt. Die Idee dahinter ist, dass ihr zwar alles am Stück lesen könnt, aber nicht müsst. Schaut ins Inhaltsverzeichnis und sucht euch das heraus, was euch interessiert. Wenn euch die Vorproduktion nicht interessiert, fangt erst ab S. → an. Wenn euch sie schon interessiert, aber die teils eher bürokratisch anmutenden Organisationspläne nicht, dann überspringt halt die S. → bis →.
Dieses Buch soll zweierlei sein. Auf der einen Seite ist es als Lektüre gedacht. Kocht euch einen Kaffee oder Tee, macht es euch gemütlich und lest in dem Buch herum, sucht euch Anregungen, neue Idee und Problemlösungen.
Auf der anderen Seite ist es auch ein Nachschlagewerk direkt am Set. Es folgen noch manche Diagramme, Schaubilder und konkrete Tipps und es schadet sicher nicht, dieses Buch einfach mal für den Notfall in seine Kameratasche zu stecken.
Alles klar, was brauche ich?
Fünf Dinge sind es, die man eigentlich braucht, um einen Film zu drehen.
Zunächst einmal, sehr simpel, sich selbst. Fangen wir mit der wichtigsten aller Feststellungen an: Einen Film zu drehen, das ist Arbeit. Es ist eine schöne, erfüllende und kreative Art von Arbeit, aber dennoch anstrengend.
Noch da? Gut. Damit ist die größte Hürde bereits genommen. Filmproduktionen kosten Zeit und meistens auch im NoBudget-Bereich Geld, vor allem aber Nerven und Energie. Wer also plant, einen Film zu drehen, der sollte bereit sein, all dies zu investieren. Wenn das gegeben ist, folgt der Rest meist bald schon von ganz alleine.
Dann braucht man eine Kamera. Die muss nicht toll sein, aber es gibt da durchaus Unterschiede und man wird es dem Endergebnis auch ansehen, was man da treibt. Als wir anfingen, da drehten wir mit einer wackeligen und schon mächtig leidenserprobten Sony-Kamera aus dem Consumer-Bereich, mittlerweile sind wir bei einer ordentlichen Prosumer-Kamera von Panasonic angekommen und der Unterschied ist sichtbar.
Ich werde auf die Wahl der Kamera ab Seite → noch ausführlich eingehen, aber die Faustregel ist hier, dass man zumindest bis zum Eintritt in vierstellige Bereiche durchaus markante Leistungsunterschiede feststellen kann, aber für den Anfang natürlich im Grunde alles reicht, was aufnimmt und dabei jenseits der Bildqualität eines Handys ist.
Sind diese Grundvoraussetzungen geschaffen, kommt die erste Hürde: Man braucht eine Idee. Wir werden in Kapitel 1 zwar ausführlich darauf eingehen, wie man aus einem zündenden Gedanken ein verwertbares Gesamtkonstrukt erschafft, aber die ganz generelle Frage, was man drehen möchte, wiegt schon recht schwer. Denn hier wird aus Segen der grenzenlosen Möglichkeiten ein Fluch, denn man kann im Grunde nun wirklich zu allem einen Film drehen.
Sag’s auf Schlau: Consumer, Prosumer, Pro?
Niemand bekommt gerne gesagt, dass er ein „Amateur“ ist, auch kräftig zahlende Kunden von eher unprofessionellen Kameras nicht. Darum haben über die Jahre einige in meinen Augen etwas krude Bezeichnungen die Runde gemacht, um diese Bereiche zu trennen.
Am untersten Segment stehen Consumer-Geräte, sich offenbar der Ironie nicht bewusst, dass damit der Konsument an das unterste Ende der Futterkette gesetzt wurde.
Und ganz oben, klar, stehen dann Pro- oder Professional-Geräte. Phantasievolle Preise bringen hier allerdings auch wirklich bisweilen atemberaubende Qualität. Kein Wunder, denn das hier ist das Zeug, mit dem auch die Profis arbeiten.
Dazwischen stößt man noch ganz selten und meist nur fernab der Fachliteratur auf den Begriff der Prosumer-Geräte. Wirklich clever ist dieser Zusammenschluss der Wörter Professional und Consumer nun auch nicht, aber es bringt es doch ganz gut auf den Punkt: Wer ordentliche Qualität will, aber nicht in Filmstudio-Preise vordringen mag, der kauft halt hier.
Hat man nun auch diese Hürde genommen, braucht man eine letzte Zutat, damit man anfangen kann, zu drehen: Man braucht eine Hand voll Irrer. Tausend Dinge müssen am Set getan werden, wovon Kamera und Regie nur ein winziger Bruchteil sind. Selbst die Schauspieler, in Hollywood ja zumeist Zentrum der Betrachtung, sind nur Schrauben in einem riesigen Getriebe, das Filmproduktion heißt.
Die Leute sollten belastbar sein, ebenfalls Spaß an der Sache haben und natürlich bestenfalls auch noch umsonst arbeiten. Praktisch daran: Aller Wahrscheinlichkeit nach kennt ihr bereits solche Leute. Wie man sie findet und wie man sie motiviert, darauf komme ich dann später zu sprechen. Unter anderem geht es ab Seite → bzw. 41 explizit um Schauspieler respektive Mitarbeiter.
Damit ist der Filmdreh selbst abgedeckt. Doch spätestens nach der letzten Klappe braucht man dann als fünfte und letzte Zutat noch einen Computer.
Es ist heute gar nicht mehr schwer, einen geeigneten Rechner zu finden; aber auch zu diesem Thema gibt es einen eigenen Abschnitt ab Seite →.
Aber genug der einleitenden Worte, beginnen wir mit dem, womit jeder Film seinen Anfang nimmt – mit der Vorproduktion.
Kapitel 1: Die Idee
Wie eingangs gesagt, ist die Grundlage jeden Filmes eine Idee. Doch eine Idee haben ist eine Sache, etwas aus ihr machen eine andere. Hier gibt es keine Patentlösungen, wohl aber steht es in unserer Macht, ein paar gute Ratschläge zu geben – von der Ideenfindung hin zur Ideenentwicklung.
Von der Macht einer guten Idee
Am Anfang steht die Idee. Sie mag klein und unscheinbar erscheinen, oder groß und einschüchternd, je nach Projekt. Doch bevor man irgendetwas anderes an einem Film tun kann, braucht man diesen Funken, der alles in Bewegung setzt.
Das Spektrum verwertbarer Ideen für Filmemacher ohne Budget ist anders als das einer Big-Budget-Produktion. Es wäre allerdings falsch zu sagen, es sei kleiner. Denn wo die großen Studios bei horrenden Beträgen kalkulieren müssen, welche Zielgruppe wohl für welches Thema zu begeistern ist und wie viel Geld man investieren muss, welche gerade angesagten Schauspieler engagiert werden können und wie teuer die sein werden, setzt sich der NoBudget-Filmer einfach hin und kann seinen Geist wandern lassen.
Beispiele für den Erfolg solch freier Ideen gibt es zuhauf. Kevin Smiths erster Film „Clerks“ ist auch durchweg mit Freunden des Regisseurs besetzt und ebnete ihm dennoch den Weg ins große Filmbusiness und zum Kultstatus bei seinen Fans. Gleiches gilt für Robert Rodriguez, dessen „El Mariachi“ sogar noch weniger gekostet hat als Smiths Film.
Was allerdings beide Projekte auszeichnete, war, dass sie nicht auf Erfolg ausgelegt waren. Im Grunde waren es beide bereits Low- und nicht mehr NoBudget-Filme, aber grundsätzlich sind sie voll auf unserer Wellenlänge: Smith hatte eine Geschichte zu erzählen, die seiner eigenen recht nahe war, Rodriguez wollte sogar einfach nur mal einen Film machen.
Und das wollen wir ja auch, richtig?
Der Quell der Inspiration
Öfters liest man, dass gute Ideen nicht auf der Straße liegen. Nun, ehrlich gesagt: Doch, genau das tun sie. Inspiration findet man überall, man muss nur die Augen öffnen und vielleicht beginnen, quer zu denken.
Zunächst mal gilt sicherlich auch hier: Lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Ob man sich nun eine Serie, einen Film, ein Buch, ein Hörspiel, vielleicht eine regionale Sage oder ein Märchen, ein geschichtliches Ereignis oder einen Zeitungsartikel aus der Gegenwart nimmt, man kann fast überall gute Ideen finden.
Jedoch hat ein anderer Mensch einmal sehr klug gesagt, dass Kreativität bedeute, seine Quellen zu verbergen. Damit ist hier kein kreativer Diebstahl gemeint, sondern vielmehr der Ratschlag, dass man aus dem, was man sich als Quelle nimmt, etwas Neues entwerfen sollte. Das kann man schon erzielen, indem man den Ort der Handlung wechselt – vielleicht inszeniert man ein klassisches Märchen, jedoch im Weltall? Oder man verlagert eine klassische Krimi-Handlung in den Wilden Westen.
Alternativ kann man auch bei sich selbst klauen. Das eigene Leben kann spannende Geschichten beherbergen und ist nicht zuletzt eine gute Quelle von vermutlich durchaus realisierbaren Ideen. Keine Raumschlachten, keine Pferde und keine Ritterburgen, sondern einfach Menschen aus dem direkten Umfeld. Allerdings sollte man hier selbstkritisch bleiben – manches erscheint einem nun auch nur spannend, weil man selber beteiligt war. Nicht alles taugt zum Film.
Wie man eine Idee ausarbeitet
Zunächst einmal sollte man nun, wo man seinen Funken gefunden hat, beginnen, Ideen rund um diesen Komplex zu sammeln. Es gibt dazu eine Reihe recht praktischer Techniken, die nicht für jeden gleichermaßen hilfreich sind, aber auf die man mal einen Blick werfen sollte.
Der Klassiker unter den Kreativmethoden ist das Brainstorming. Man sammelt einfach einmal alle Begriffe, Themengebiete und Ideen, die einem zu seinem Hauptthema einfallen, wild verteilt auf einem Blatt. Man assoziiert und spinnt herum, wobei generell erst einmal jede Idee erlaubt sein sollte. Da es sehr ungerichtet ist, kann man sich recht gut verzetteln, aber gerade als Einstieg ist es immer ein guter Weg, den Kopf frei zu bekommen.
Etwas geordneter geht es bei einer Mindmap zu. Man notiert erneut seinen Schlüsselbegriff, also seine Idee, auf einem Blatt schön mittig. Nun zieht man davon einen Pfeil weg und ordnet mit diesem neben dem ersten Begriff eine erste Assoziation an. Entweder man geht nun von diesem „Ast“ weiter, oder aber man kehrt zur Mitte zurück und beginnt mit einer weiteren Assoziation einen zweiten „Ast“ und so weiter. Oftmals hilft diese Sortierung in Themen („Äste“) einem, Lücken und Ansatzmöglichkeiten innerhalb seiner Idee zu finden.
Eine weitere gute Methode ist eine Tabelle, um seine Gedanken zu ordnen. Im Wissenschaftsdeutsch nennt man das kompliziert einen „morphologischen Kasten“, aber im Grunde ist die Idee ganz einfach: Man ordnet zu seiner Idee bestimmte Begriffe an. In der Senkrechten ordnet man dort etwa mögliche Unterthemen an, in der Waagerechten mögliche Lösungen.
Sagen wir, man möchte einen Krimi drehen, so wären Unterthemen etwa „Art des Verbrechens“, „Ort der Handlung“ und „Art des Ermittlers“. Nun schreibt man jeweils themengebunden daneben mögliche Unterideen zu den einzelnen Gebieten und muss sich dann, wenn alles zur eigenen Zufriedenheit erscheint, nur noch jeweils für eine oder mehrere dieser Varianten entscheiden und darauf aufbauen.
Für diese Methode müssen allerdings bereits eine Reihe von Entscheidungen gefällt worden sein, um überhaupt eine Tabelle aufziehen zu können, weshalb dies eher ein geeigneter zweiter oder dritter Schritt ist.
Alleine oder im Team?
Ob man seine Idee nun alleine oder mit anderen zusammen ausarbeitet, ist in mehrerlei Hinsicht vor allem eine Entscheidung nach eigenem Geschmack. Einige der obigen Methoden – besonders das Brainstorming – funktionieren auch hervorragend in der Gruppe, aber manch einer ist kreativer, wenn er ungestört und ununterbrochen selber den Dingen nachgehen kann.
Insofern muss man halt stets den Vorteil der zusätzlichen Ideen und anderen Blickwinkel bei mehreren Personen mit dem Nachteil abwägen, dass der Koordinationsaufwand steigt. Entscheidend ist da auch, wie gut man mit anderen Leuten zusammen arbeiten kann, insbesondere denen, die nun konkret in Frage kommen.
Wer im Team arbeiten möchte, sollte allerdings auch schon mal den Abschnitt über generellen Umgang mit Mitarbeitern in diesem Buch lesen (siehe S. →), denn die dortigen Ratschläge gelten auch und teils besonders in dieser Phase.
Der One-Liner: Das erste Etappenziel
Wo wollen wir nun also hin?
Das erste Etappenziel auf der Reise hin zum eigenen Film heißt „One-Liner“ und ist die erste Vorstufe eines fertigen Drehbuchs. Dabei handelt es sich um einen einzigen Satz, der das grobe Konzept des geplanten Films zusammenfasst.
Ganz klassisch könnte ein solcher One-Liner für „Krieg der Sterne“ etwa lauten: „Luke Skywalker ist der Sohn eines Farmers, doch als er in einem gekauften Droiden auf eine geheime Botschaft stößt, wird er in den intergalaktischen Bürgerkrieg verwickelt.“
Ein One-Liner muss dabei weder die komplette Filmhandlung abdecken, noch muss er sehr in die Tiefe gehen. Er dient vor allem dazu, eine erste Marschrichtung abzustecken. Sowie das geschehen ist, ist der Weg frei zum Thema des zweiten Kapitels: Die Drehbuchentwicklung.
Warum „viel“ immer „viel Arbeit“ bedeutet
Bevor man allerdings sein Drehbuch beginnt, sollte man allerdings noch einmal eine kleine Überprüfung der Realisierbarkeit dessen vornehmen, was einem gerade so im Kopf herumspukt. Die Faustregel dafür ist immer gleich – hat man von irgendetwas viel in seinem Film, wird man in der Herstellung viel von irgendetwas dort investieren müssen.
Anders gesagt: Wer viele Darsteller gleichzeitig in einer Szene hat, kann sich darauf gefasst machen, dass die Terminkoordination die Hölle wird. Wer viele Spezialeffekte einbaut, der wird nach den Drehs viel Zeit daheim am Rechner einplanen müssen. Gleiches gilt für viele
Schnitte innerhalb des Gedrehten.
Viel Dialog bedeutet, dass man sich um viel guten Ton bemühen muss, viele Drehorte müssen erst einmal gefunden und dann auch noch immer möglichst zeitnah erreicht werden, kurzum: „viel“ bedeutet „viel Arbeit“.
Die goldene Regel der vier Eckpfeiler
Im Endeffekt ist die Planung jedes Produktionsschrittes mit vier Eckpfeilern abzugleichen: Zeitaufwand, Geldaufwand, Effizienz und Produktionsqualität.
Produktionsqualität ist das, wovon man im Endeffekt immer möglichst viel haben möchte, es sind einfach grob gesagt die Dinge, die einen Film gut machen. Man muss immer etwas investieren, um sie zu erhalten, wobei es ganz unterschiedlich sein kann, was genau die Qualität ausmacht: Tolle Darsteller, gute Effekte, schöne Dialoge oder eine packende Geschichte, ungewöhnliche Locations, schöne Musik – die Liste ist schier endlos.
Der Feind dessen ist die Frage nach der Effizienz. Damit ist hier vor allem die Kosten/Nutzen-Frage gemeint, denn die sollte man sich als NoBudget-Filmer an jedem Punkt der Produktion stellen. Und auch diese wird direkt davon beeinflusst, was man bereit ist, zu investieren.
Man investiert stets Zeit oder Geld, wenn man Pech hat auch beides. Zeit ist eine Ressource, die man normalerweise in recht großen Mengen aufbringen kann, wenn auch mit Zähneknirschen. Geld ist dagegen oftmals bequemer, weil man eben andere Leute dafür bezahlen kann, schwere oder unangenehme Arbeiten für einen zu erledigen. Nur kann man Zeit in der Regel besser aufbringen als Geld. Man kann nicht pauschal sagen, ob nun eher Geld oder Zeit zu einer Steigerung von Produktionsqualität führt, meist sind es eher vergleichbare Alternativen.
Ein Beispiel mitten aus der Produktion des NoBudget-Films Xoro: the Eifelarean, bei dem ich auch an der Produktion beteiligt war: Der Schurke dort haust in einem finsteren Magierturm. Einen Turm, so wir es uns vorstellten, gab es nicht in erreichbarer Nähe, also war klar, dass wir hier für die Außenaufnahmen mit einem Effekt arbeiten mussten.
Wir entschieden uns, ein echtes Modell zu bauen. Geld für einen Drittanbieter hatten wir nicht und mit unseren Fähigkeiten wäre keine adäquate Lösung aus dem Computer möglich gewesen, aber einen talentierten Bastler hatten wir zur Hand. So musste nun etwas Geld für die Materialien und vor allem sehr viel Zeit investiert werden, um das Modell zu bauen. Dann filmten wir es vor einem weißen Hintergrund und bauten am Computer noch eine neue Landschaft darum, was noch einmal viel, viel Zeit kostete.
War das nun effizient gearbeitet, wenn man bedenkt, dass die Außenaufnahmen des Turms im Film alle zusammen vielleicht gerade mal eine halbe Minute lang sind?
Wir kamen zu dem Ergebnis, dass es sich lohnen würde, da es eine Steigerung der Produktionsqualität sei, alleine, weil den Zuschauer eine so aufwendig gemacht Szene, wenn gut realisiert, ziemlich beeindrucken würde in einer NoBudget-Produktion wie unserer. Es wurde einer unserer Money Shots.
Alle Testvorführungen belegten, dass wir richtig kalkuliert hatten.
Sag’s auf Schlau: Money Shot
Unter einem Money Shot versteht man eine Einstellung (siehe Kapitel 10), die den Zuschauer „vom Stuhl hauen“ wird. Im Optimalfall denkt der Zuschauer danach etwas im Sinne von „Wow, das musste ich in meinem Leben noch sehen!“, in jedem Fall weiß er aber, warum er (möglicherweise) Geld für den Film ausgegeben hat.
Jeder Money Shot unterscheidet sich ganz von Fall zu Fall. Gemeinhin heißt es jedoch, der Begriff sei erstmals im Umfeld der Pornofilm-Industrie aufgekommen ... was für eine Art von Einstellungen das dort gewesen sind, kann sich wohl jeder denken.
Ein paar Faustregeln dazu
„Ist das den Aufwand wert?“
Insgesamt muss man sich diese Frage immer und immer wieder stellen, bei wirklich jedem Schritt der Produktion. Wer sich die Mühe macht und in den folgenden Schritten diese Denkweise bereits beherzigt, der wird es im Endeffekt leichter haben. Womit ich nicht sagen will, dass man nun keine aufwendigen Projekte angehen soll – im Gegenteil. Die Welt ist voll von jungen Filmgruppen, die möglichst einfache und realisierbare Projekte angehen. Nur wo ist da der Reiz, gerade auf Dauer?
Umgekehrt ist auch schon manche Filmgruppe an eindeutig zu hoch gesteckten Zielen gescheitert – vielleicht auch, weil sie die folgenden kleinen Faustregeln nicht beachtet haben.
Dreh mit dem, was du hast
Kaum ein Rat könnte leichter zu beherzigen sein als dieser: Schaut einfach einmal, was ihr bei euch so finden könnt. Sagen wir, man will einen Agentenfilm drehen. Natürlich kann man jetzt sofort die Gedanken kreisen lassen und beschließen, dass der Schurke in einer verlassenen Feste hoch oben auf einem verschneiten Berg haust, nur um dann festzustellen, dass man weder Festen noch verschneite Berge in einem Umkreis von 200 Kilometern findet.
Oder man macht es anders herum: Wenn ich etwa über Agentenfilme nachdenke, dann fällt mir sofort ein, dass wir einen Staudamm in zehn Minuten Fahrtweite von meinem Elternhaus haben – das hat schon in anderen Filmen gut funktioniert. Und ganz nah von diesem Staudamm wohnt ein Kumpel von mir, dessen Schwester ein schniekes Cabrio fährt; perfekt, dann hat der Agent also schon mal ein Auto. Und hatte der Bruder einer Bekannten nicht dieses große Arsenal von Softair-Waffen?
Wer so denkt, kommt auf sehr effiziente Weise sehr schnell an viel Produktionsqualität heran.
Bedaure nicht dauernd, das was fehlt, sondern sei optimistisch
Das oben war ein sehr praktischer und pragmatischer Ansatz, das hier ist nun eher ein Ratschlag zur eigenen Denkweise. Wer immer daran denkt, was er gerade nicht filmen kann, welches Equipment ihm gerade wieder fehlt und wie toll es doch wäre, wenn wenigstens einer in dem Agentenfilm etwas Kung-Fu könnte, der wird ewig unzufrieden sein.
Zwar gilt Zufriedenheit als der Feind des kreativen Arbeitens, aber Optimismus hat noch niemandem geschadet. Im Grunde ist der Rat hier mit dem obigen identisch, jedoch mit einer Ergänzung: Es geht nicht nur darum, clever das auszunutzen, was man hat, anstatt in die Ferne zu schweifen. Es geht ebenso darum, sich bewusst zu machen, was einem für Mittel zur Verfügung stehen, die andere Filmgruppen vielleicht nicht haben. Mehr noch: Was für Mittel stehen einem zur Verfügung, die den Film besser machen?
Ihr kennt jemanden in der örtlichen Glasfabrik und könnt so nachts mal auf das Gelände? Großartig, die Zuschauer werden baff sein von der großartigen Industriekulisse!
Dreh, was du willst
Wenn ihr die obigen anderthalb Faustregeln im Hinterkopf behaltet, dann seid ihr darüber hinaus vollkommen frei. Diese Freiheit ist auch mehr als selbstverständlich: Losgelöst von Marketingumfragen, Erscheinungsterminen, Genreempfehlungen oder auch der allgemeinen Erwartungshaltung kann man seinen Film drehen, so wie man möchte. Seid ambitioniert und setzt eure Visionen um, darauf kommt es an.
Und zielt dabei immer hoch: Versucht nicht „El Mariachi“ zu drehen, dreht „Desperado“.
Filmverweise in diesem Kapitel
Jedem Kapitel habe ich einen Textkasten wie diesen hier nachgestellt, der noch einmal als Orientierung dienen soll, wo ich worauf Bezug genommen habe – und vielleicht auch einfach als Merkzettel für den nächsten Besuch in der örtlichen Videothek.
Am Ende des Buches gibt es auf Seite → auch noch eine vollständige und alphabetische Übersicht über die in diesem Buch erwähnten Filme.
Clerks
Desperado
El Mariachi
Krieg der Sterne
Kapitel 2: Das Drehbuch
Kaum ein Thema in der Filmproduktion ist derart mit schlauen Büchern und gut gemeinten Ratgebern abgedeckt wie der Schreibprozess des Drehbuchs. Was also kann dieses Buch da bieten, was all die anderen nicht haben?
Die meisten Ratgeber richten sich entweder an ambitionierte Künstler oder Leute, die es explizit darauf anlegen wollen, ein vermarktungsfähiges Drehbuch zu schreiben. Das soll nicht unser Ansatz sein. Nähern wir uns dem Thema doch einfach mal mit ausgeprägter Nähe zur Praxis. Von der Idee zum verfilmbaren Script.
Von One-Liner zur Synopsis
Was folgt auf den One-Liner, also die ausformulierte erste Idee, die als Produkt des vorigen Kapitels enstanden ist? In der etablierten Schreibfolge ist die nächste Evolutionsstufe die Synopsis.
Das ist zunächst mal ein ganz fesches und schlau klingendes Wort für eine Zusammenfassung und im Grunde auch nicht mehr. In der Synopsis wird die eigentliche Handlungsfolge der Geschichte erstmalig grob ausgebreitet. Man überlegt sich nun, wo der Protagonist am Anfang der Geschichte steht und was für einen Weg er dann zurücklegt, konkret oder im übertragenen Sinne. Noch immer besteht keine Notwendigkeit für Details, es geht hier nur ganz grob darum, selbst herauszufinden, wie die einzelnen Erzählstränge der Geschichte sich am Anfang, Mittelpart und Ende der Geschichte verhalten.
Anfang, Mittelpart und Ende – 3 Akte
Das 3-Akt-Modell ist der Klassiker in der Drehbuchtheorie und im Grunde kommt kein Ratgeber drum herum, dieses Modell einmal zu erläutern. Erlauben wir uns also einen kleinen Ausflug.
Dem Modell zufolge gliedert sich eine gute Geschichte in drei grobe Handlungsabschnitte, die man unter verschiedenen Namen kennt, die aber stets das Gleiche meinen.
Eine Geschichte beginnt mit der Exposition, also der Einleitung, in der das Problem vorgestellt wird. Dieses Problem, der Konflikt, ist das, was die Handlung antreibt. Das kann sehr klein und charakterbezogen sein, oder es ist groß und episch. Roland Emmerichs „Independence Day“ etwa hat einen sehr eindeutigen Konflikt: Aliens greifen die Erde an.
Darauf folgen dann Lösungsversuche. Es findet eine Entwicklung statt, es wird die Konfrontation mit dem Problem gesucht. Diese Versuche sind zumeist erst einmal zum Scheitern verurteilt und die Reibung mit dem Hindernis stellt oft den größten Teil der Handlung dar. Emmerichs Film hat eine sehr ausführliche Exposition, doch bricht diese Phase mit dem Angriff der Außerirdischen ab und die nachfolgende Zeit, in der die Menschen in dieser Postapokalypse überleben müssen und zugleich nach Wegen suchen, zurückzuschlagen, bildet den zweiten Akt.
Der dritte Akt ist dann die Lösung oder Auflösung. Endlich ist der entscheidende Hebel gefunden und die Protagonisten finden einen Ansatz, der ihnen zum Überwinden des gegebenen Problems verhelfen kann. In der süßen Welt der Hollywood-Filme ist das zumeist auch gleichbedeutend mit einem Happy End, aber dass muss es gar nicht sein. Die Auflösung des Konflikts kann auch dadurch erreicht sein, dass der Protagonist stirbt oder er zumindest sein Ziel nicht erreicht.
In „Independence Day“ wird es freilich erreicht: Mittels Computervirus und Materialschlacht werden die Aggressoren dann doch überwunden.
Die drei Teile sind dabei nicht gleichberechtigt, was ihren Anteil am Film betrifft. Die Faustregel ist, dass der zweite Akt etwa zwei Viertel, die Akte 1 und 3 dagegen nur jeweils ein Viertel der Laufzeit in Anspruch nehmen.
Bei einem 120 Minuten langen Spielfilm hieße das, die Exposition fände in den ersten 30 Minuten statt, dann erfolgt eine Stunde der Lösungsversuche, gefolgt von einem dreißigminütigen Finale. Es bedarf keiner großen Filmkenntnis um zu sehen, dass das nur Richtwerte sein können.
Wer aber also einen, sagen wir, 30 Minuten langen Film dreht, was in unserem Rahmen schon realistischer ist (siehe auch „Drehbücher und Lauflänge“ weiter unten), der tut eigentlich ganz gut daran, sich an dem Modell zu orientieren: Sieben Minuten Exposition mit Vorspann und allem, eine Viertelstunde Haupthandlung und noch mal sieben Minuten für das Finale inklusive Abspann ergeben eine ganz solide Mischung.
Vom Für und Wider der drei Akte
Der Vorteil des Modells ist offenkundig seine Robustheit. Es ist bis zum Exzess erprobt und absolut unverwüstlich. Auch genügt es ziemlich sicher den Zuschauergelüsten, da das Publikum durchaus erwartet, dass ein Film so funktioniert. Eine Dramaturgiekurve entsteht fast von selbst, denn in fast allen Fällen ist die Auflösung des Konflikts auch einhergehend mit einem packenden Finale, ganz gleich in welchem Genre.
Nur liegt in dieser Vertrautheit auch das Problem. „In einer Beziehung kann man alles reparieren, außer das Aufkommen von Vertrautheit“ sagt eine Binsenweisheit. Das gilt auch hier. Filme in drei Akten sind etwas, mit dem man groß wird. Man akzeptiert es als den Status Quo und nimmt es ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr zur Kenntnis. Das heißt aber natürlich auch, dass es irgendwo einfach langweilig ist.
Wer seinen Zuschauer vom Hocker reißen will, der muss aus diesem Modell irgendwie ausbrechen und überraschen. Ridley Scott ist das damals mit „Alien“ gelungen, indem er die Kreatur nach dem eigentlichen Finale an Bord von Ripleys Raumkapsel einfach erneut auftauchen lässt. Leider ist auch dieses Vorgehen mittlerweile bereits zu oft kopiert worden, um noch wirklich effektiv zu sein.
Man muss dabei immer bedenken, dass Amateurfilme erst einmal mit anderen Augen gesehen werden als Hollywood-Filme. Die haben mittlerweile eine derartige (technische) Perfektion erlangt, dass man eigentlich hinter jeder Abweichung von der Norm Absicht vermuten muss. Im Amateur-Segment sieht das anders aus und der Grad zwischen „nicht gewollt“ und „nicht gekonnt“ ist sehr schmal.
Worauf man achten sollte
Zurück zur Praxis. Man hat nun also seine Synopsis, etwas, das sich vermutlich verdächtig wie die Texte liest, die man auf den Rückseiten einer DVD-Hülle findet. Wenn dem so ist: Richtig so!
Bevor man nun zum nächsten Schritt übergeht, sollte man allerdings noch mal innehalten. Die Schreibarbeit wird im nächsten Schritt erheblich mehr werden und jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, noch mal zu überdenken, ob das, was nun vorliegt, soweit stimmig wirkt.
Man nehme also seine Synopsis und schaue zunächst mal auf die Logik. Ist die Geschichte, so wie sie da steht, nachvollziehbar? Kann der Zuschauer dem folgen, was auf der Mattscheibe passieren wird, oder sind da Gedankensprünge drin, die nur mit Beigabe der eigenen Assoziation Früchte tragen?
Dann werfe man noch mal einen Blick auf die Machbarkeit des Ganzen, was sich in zwei Untergruppen teilt. Die eine, ganz einfach, die Kosten. Die andere, ebenso simpel, ist die Verfügbarkeit. Wie am Ende des ersten Kapitels festgehalten bedeutet „viel“ immer „viel Arbeit“ und von daher sollte man einfach sehen, ob man es nicht bisweilen zu gut gemeint hat. Sind einfach objektiv viele Requisiten, Personen oder Drehorte in der Synopsis, gibt es etwas, was jetzt schon danach schreit, dass es viel Drehzeit kosten wird? Wenn ja: Obacht.
Ich sage nicht: Streicht diese Dinge. Vielleicht werden sie sogar Elemente sein, die euren Film wirklich gut werden lassen. Aber fragt euch andererseits, ob ihr sie wirklich brauchen werdet und ob sich der Aufwand lohnt. Ihr werdet später für eure eigenen kritischen Blicke dankbar sein.
Das Treatment
Der nächste Arbeitsschritt ist ein Treatment. Das ist, wenn man es unprofessionell ausdrücken möchte, ein Drehbuch ohne Dialoge. Man nimmt seine Handlungsfolge und zerlegt sie in einzelne Szenen, plant deren Reihenfolge und Ablauf durch und macht schon mal Notizen, wo später Gespräche stattfinden werden.
Das ermöglicht es einem weitaus besser, seine Handlung zu überblicken, ohne sich dem vielleicht schwersten Teil des Schreibprozesses, den Dialogen, schon widmen zu müssen. Auf die kommen wir später noch zurück.
Hier geht es erst einmal darum, einen Ablauf zu entwerfen. Häufig wird dieser sich im Schnitt noch einmal wandeln, aber an diesem Punkt nun kann man endgültig schon mal überblicken, wie viel man drehen muss, wo man drehen wird und für wie viele Szenen man welche Darsteller am Set haben muss.
Den Zuschauer fesseln
Steht das Treatment, so sollte man erneut überprüfen, ob das, was man da hat, eigentlich was taugt. Das große Ziel ist es, den Zuschauer zu bannen und in die Geschichte eintauchen zu lassen. Sind große Lücken in der Logik drin, so wird er aus der Geschichte gerissen und nimmt ganz automatisch einen zu großen, kritischen Abstand ein. Gleiches gilt für Längen in der Handlung.
Das Treatment ist dem Drehbuch in dieser Funktion von daher überlegen, als dass man es ganz angenehm lesen kann. Die Formalia, die einerseits notwendig sind, um ein Drehbuch zu einer guten Arbeitsgrundlage zu machen, machen es andererseits zu einer sehr anstrengenden und drögen Lektüre. Ein Treatment dagegen ist ja eher eine etwas distanzierte und im Präsenz geschriebene Kurzgeschichte; so etwas kann man auch Außenstehenden zumuten.
Sag’s auf Schlau: Immersion
Immersion ist ein eher selten gebrauchter Begriff und beschreibt das Maß, in dem eine Geschichte in jedwedem Medium es dem Betrachter/Leser ermöglicht, in sie abzutauchen und in ihr aufzugehen. Die Verwendung ist aber oft auch nur ein guter Indikator dafür, dass jemand gerade möglichst schlau klingen will.
Aus dem Englischen dagegen kommt ein schöner Begriff, der sich Suspension of Disbelieve nennt. Das ist etwas schwierig zu übersetzen und heißt grob so viel wie „Aufgabe des Zweifels“. Damit wird etwas beschrieben, was ein jeder Betrachter unwissentlich macht: Er lässt sich wohlwollend auf die Geschichte ein, die vor ihm ausgebreitet wird und ist gewillt, all dass, wovon er weiß, dass es nicht echt ist, dennoch als echt zu akzeptieren.
Das ist jedoch eine Illusion, die absichtlich oder auch unabsichtlich kaputt gemacht werden kann. Französische Kunstfilmer Mitte des letzten Jahrhunderts haben versucht, diese Wirkung ganz willentlich zu erzeugen, aber auch im heutigen Popcorn-Kino können zu offensichtliche Brüche mit der Realität oder etwa schlechte Spezialeffekte (ungeplant) so wirken.
Man sollte also an jedem Punkt der Produktion darauf achten, dass der Zuschauer einem glauben kann, was er präsentiert bekommt. Und das beginnt mit der inhärenten Logik der Geschichte.
Die besten Kritiker sind übrigens Kinder. Die sind weder medial so konditioniert, dass sie Klischees als gegeben hinnehmen, noch füllen sie so wie Erwachsene ganz unterbewusst bestehende Lücken in der Geschichte. Wenn ein Testkind das erzählte Treatment „doof“ findet, sollte man vielleicht noch mal zum Schreibtisch zurückkehren und gucken, woran das liegt.
Das gilt, freilich und wie immer, nicht in allen Fällen.
Es ist soweit: Wir schreiben ein Drehbuch
Ist man mit seinem Treatment dann soweit glücklich, kann es endlich ans Eingemachte gehen. Doch ein Drehbuch gehorcht auch noch mal ganz eigenen Regeln und man erspart sich eine Menge Frust, wenn man sie vorher kennt.
Formalia
Drehbücher unterliegen einer ganz harten Reihe von formalen Vorgaben. Die erscheinen teilweise etwas willkürlich, existieren aber nicht ohne Grund. Neben einer Orientierungshilfe für Leute, die bereits ihre Filmerfahrungen haben – da halt gleiche Dinge immer am gleichen Ort stehen – sind sie auch wirklich praktisch, wenn man nachher mit dem Drehbuch zu arbeiten beginnt.
Da ein Bild mehr sagt als tausend Worte, ist auf der nebenstehenden Seite einmal eine Seite aus dem Drehbuch zu dem Kurzfilm „Verfluchte Eifel“ zu erkennen, komplett mit Anmerkungen, wie eine Drehbuchseite aufgemacht ist.
Wenn ihr euer Drehbuch nicht doch irgendwie auf den Markt werfen wollt, müsst ihr euch natürlich nicht sklavisch an diese Vorgaben halten. Doch aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, es macht Dinge im Endeffekt einfacher.
Drehbücher und Lauflänge
Eine sehr nützliche Faustregel ist an diesem Punkt übrigens, dass eine Seite Drehbuch gemäß der genormten Formatierungen in etwa einer Minute Film entspricht. Das ist natürlich nur ein Richtwert und klappt nicht für jede einzelne Seite, sondern nur für ein Drehbuch in seiner Gesamtheit.
Beispiele für diese These gibt es aber zuhauf und selbst wenn man später noch viel kürzen möchte, so bleibt es eine Orientierungshilfe. Will man 30 Seiten Drehbuch abendfüllend verfilmen oder plant einen Film von einer halben Stunde Länge, habt aber 60 Seiten Drehbuch, dann wird es vermutlich eng.
Sag’s auf Schlau: Abendfüllend
Abendfüllend ist ein ziemlich klassischer Begriff um traditionelle Spielfilme zu umschreiben. Eine exakte Minutenangabe lässt sich nicht machen, zumal der Trend derzeit ja eher hin zu langen Filmen geht.
Die Idee dahinter ist aber simpel und nach wie vor aktuell: Einen abendfüllenden Film kann man eben am Ende eines Tages gucken und wird dann unterhalten, bis es Zeit ist, ins Bett zu gehen.
Ein paar Gedanken zum Charakter einer Filmfigur
Eine gute Handlung ist die Grundlage jedes Films, doch seine Figuren sind das Mittel, das einem Drehbuchschreiber zur Verfügung steht, um diese Handlung zu transportieren. Entsprechend viel Zeit sollte man also in die Ausgestaltung der Figuren stecken, sogar über das Maß hinaus, was nachher im Film wirklich zu sehen sein wird.
Die Schauspieler werden es sein, die diese Figuren zum Leben erwecken. Manche machen das ohne große Überlegungen, doch die meisten Leute, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, wissen auch gerne, warum sie bestimmte Dinge tun. Eine Filmhandlung wird nicht zuletzt dann für den Zuschauer schlüssig und nachvollziehbar, wenn er versteht, warum die handelnden Figuren das tun, was sie tun.
Stellt euch beim Schreiben also durchaus auch immer diese Frage: Warum handeln die Personen, wie es im Drehbuch steht? „Weil es die Story voranbringt“ ist dabei durchaus auch eine gültige Antwort, aber keine, die man dem Zuschauer sagen sollte. Findet Motivationen für die Figuren, so zu agieren, wie ihr das wollt und die Handlung des Drehbuchs wird ganz von selbst zu einem gewissen Grad schlüssig bleiben.
Das war tatsächlich nicht immer so, wirklich alte Filme basieren bisweilen eher auf einer einfachen Verkettung von Ursache und Wirkung. Auf „Eine Bank wird überfallen“ folgt „Die Polizei jagt den Bankräuber“ und so weiter. Nur kriegt man damit heutzutage niemanden mehr gefesselt. Die Motivationen und kleinen psychologischen Kniffe aller Beteiligten machen den wirklichen Reiz aus.
Konflikt und Charakter
Das Zentrum aller Charakterisierung ist aber eigentlich immer ein Konflikt. Kein Filmcharakter, der in perfekter Harmonie mit sich und seiner Umwelt lebt, kann jemals Spannung erzeugen. Konflikte erzeugen Reibung, sei es nun im Inneren der Figur oder mit ihrer Umwelt.
Der klassische Weg, einer Figur in sich Tiefe und eben einen Konflikt zu geben, ist dabei gerade in Hollywood-Filmen die so genannte „Backstory Wound“, also eine seelische Verletzung, die in der Hintergrundgeschichte der Figur verankert ist.
Das muss ein tiefer, ein tragischer Einschnitt sein, der eben nicht einfach zu überwinden ist.
Doch der Film adressiert genau diese Probleme und in der Regel überwindet der Protagonist sie zum Ende hin. Manchmal aber zerbricht er auch daran. Das ist in der Regel weniger publikumswirksam, aber wie schon einmal gesagt, ein NoBudget-Film muss ja auch nichts zwangsweise massenkompatibel sein.
Solche seelischen Wunden können sehr innovativ sein, aber es reicht genauso, aus dem klassischen Fundus zu wählen, den viele hundert Filme bereits etabliert haben. Etwa der Tod von Menschen, die der Figur nahe standen, oder aber ihr Verlust durch eine Trennung. So könnte die Figur nicht mit ihrer Scheidung fertig werden, oder es ist das klassische Motiv vieler Filme mit Jugendlichen: Ein Umzug hat ihn von all seinen Freunden getrennt und er ist nun allein an einem fremden Ort.
Gewalterfahrungen aller Art bilden ein gutes Fundament für gute Charakterzeichnung. Vielleicht war die Figur im Krieg und musste dort Schreckliches beobachten, womit sie nicht fertig wird. Oder sie kehrt aus dem Krieg heim und kommt mit dem normalen Alltag einfach nicht mehr klar. Doch auch wirklich harter Stoff um die gebrochenen Opfer schwerer Gewalt muss hier natürlich genannt werden.
Es gibt jedoch auch leichter bekömmliche Themen. Die Geschichte des ambitionierten Berufsmenschen, der aber noch nicht richtig Fuß in seinem Gewerbe fassen kann, kommt ebenso in den Sinn wie Geschichten um Menschen in ihrer Midlife-Crisis, die versuchen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Diese Geschichten taugen dann, im Gegensatz zu den anderen Beispielen, sogar als Grundlage für Komödien, doch die Liste der möglichen Wunden ließe sich in verschiedene Richtungen ohnehin noch beliebig fortsetzen.
Man sollte allerdings Acht geben, nicht nur auf Archetypen und Klischees zu setzen. Die eine oder andere Ausnahme von der Regeln kann den Film sehr bereichern, nicht zuletzt, weil sie dann auch für den Zuschauer in der Form unerwartet ist.
Das Sinnbild mit der Reise
In einer typischen Erzählung durchlebt die im Zentrum der Geschichte stehende Figur eine Reise. Das ist nicht zwingend wörtlich gemeint, obwohl es immer eine Möglichkeit ist. Die Figur befindet ist in irgendeinem Sinne zu Beginn des Films an einem Punkt, am Ende des Films an einem anderen.
Das ist oft eng mit der Überwindung des oben geschilderten, inneren Konfliktes verbunden, aber auch das nicht zwingend. Vielleicht ist das „Ziel“ (oder sagen wir: das Ende) der Reise auch das Scheitern an der Herausforderung, oder halt ein Teilerfolg.
Es ist immer ein guter Schritt bei der Planung eines Drehbuchs, sich zwei Faktoren vor Augen zu führen: Wo steht meine Figur zu Beginn des Films und wo, wenn die Geschichte endet? Und darüber hinaus: Finde ich das Ergebnis gut? Ist die Entwicklung schlüssig?
Mit diesen wenigen Fragen hat man einen guten Apparat zur Hand, um weitergehend überprüfen zu können, ob man mit seiner Handlung „richtig“ liegt. Das Reise-Modell ist bewährt und generell Erfolg versprechend. Man kann sich davon lösen, aber wie schon bei den drei Akten hat es durchaus Sinn, sich die Rebellion hier gut zu überlegen.
Das gängigste Gegenmodell heißt übrigens „Kino der Attraktionen“ und basiert eher auf der Idee, den Zuschauer abseits einer Geschichte von einer imposanten Sequenz zur nächsten zu scheuchen. Das Modell allerdings ist im NoBudget-Bereich nur sehr schwer anzuwenden. In dem Maßstab, in dem man in Hollywood mittlerweile aufträgt, um den Zuschauer zu beeindrucken, kann man ohne große, finanzielle Rückendeckung gar nicht mehr arbeiten. Es lohnt sich also, Mühe in eine gute Geschichte zu stecken. Da ist der Raum, in dem man gegenüber „den Großen“ punkten kann, durchaus noch recht ausgeprägt.
Wer sich dagegen einmal vor Augen führen möchte, auf wie vielen Ebenen dieses Reise-Modell gleichzeitig ablaufen kann, der sollte sich einmal bewusst David Lynchs großartigen „Straight Story“ angucken und sich danach frage, was eigentlich gerade passiert ist. Wo war Alvin Straight körperlich am Anfang, wo steht er am Ende? Was hat sich derweil in seinem Innersten getan? Ist durch das Ende des Films seine „Backstory Wound“ behoben und falls ja, macht es das Ende zu einem durchweg positiven Ausklang?
„Straight Story“ ist ein wundervoller und dabei sehr unterschätzter Film des ansonsten noch viel seltsameren Filmemachers und ein tolles Beispiel der leisen Töne im Hintergrund.
Der Dialog haucht ihnen Leben ein
Der Figur einen tollen Hintergrund zu geben ist ein wichtiger, erster Schritt, aber doch nur ein Anfang. Die Worte, die sie sprechen wird, sind der Schlüssel dem Zuschauer auch das zu vermitteln, was man aussagen möchte.
Gerade im englischen Original ist Sylvester Stallones „Rocky“ ein hervorragendes Beispiel – sein stark genuscheltes, einfaches Englisch transportiert bereits nach wenigen Sätzen, was für eine Person dieser Rocky ist. Simpel gestrickt, aber dafür auch geradlinig und ehrlich. Er kommt aus einfachen Verhältnissen, aber er hat Ambitionen.
Doch jeder, der es einmal versucht hat, wird gemerkt haben, dass es gar nicht so leicht ist, gute Dialoge zu schreiben. Irgendwie wirkte es einfach nicht richtig, nicht so, wie Leute in Filmen reden. Der Grund ist dabei in den meisten Fällen einer von zwei beliebten Fehlern.
Monologitis
Ich weiß nicht weshalb, aber kenne es aus eigener Erfahrung auch nur zu gut: Irgendwie hat man beim Schreiben immer das Bedürfnis, den Leuten lange Sätze in den Mund zu legen. Man will ja schließlich Inhalte transportieren.
Doch das ist gefährlich, denn im Endeffekt wirkt das Ergebnis dann weder realistisch noch so, wie man es aus Filmen kennt.
Es hilft, sich mal einen gut zu schauenden, modernen Film zu nehmen. Guckt den und achtet drauf, wie viele Sätze jeder Charakter am Stück sagt. Es werden nicht viele sein. Dann nehmt euch die Sätze einzeln vor und schaut, über wie viele Nebensätze die sich erstrecken. Ebenfalls nicht viele.
Man darf natürlich auch nicht ins Gegenteil abrutschen und nur noch Hauptsatz an Hauptsatz reihen, aber wer Monologe vermeidet, wird schnell bessere Dialoge schreiben.
Personenbezug
Beachtet, was ich zuvor über Rocky schrieb. Menschen haben eine ganz eigene Art, zu reden. Die Art, wie Leute Sprache gebrauchen, ist von ihrer Herkunft, ihrem Bildungsstand, ihrem sozialen Umfeld und eben ihrem Charakter geprägt. Die Dialogzeilen, die man in sein Drehbuch schreibt, sollten das transportieren.
Der einsame, schweigsame und grausame Wild-West-Rächer sollte nicht mitten im Film in einen langen und im hohen Maße intellektuellen Diskurs abrutschen, wenn er in seiner Rolle überzeugend bleiben soll.
Ist die Figur nicht über das normale Maß hinaus gebildet, so sollten auch seine Sätze einfach sein, vermutlich noch stark von einem regionalen Dialekt durchzogen. Ist er Akademiker, so transportiert man das ganz hervorragend, indem auch seine gesprochenen Sätze umständlicher und mit Fremdwörtern angereichert sind, ist er dagegen belesen, so wird er vermutlich literarische Zitate und Verweise einbringen.
Ein Fußballspieler wird vermutlich eine Bildsprache verwenden, die bewusst „das Runde ins Eckige“ befördert, während ein Lehrer vielleicht eher einen Vergleich zur klassischen Literatur bemüht, denn er weiß „allein der Vortrag macht des Redners Glück“.
Das ist ein gefährliches Spiel mit Klischees. Einerseits sind Klischees hervorragend dazu geeignet, in wenigen Sekunden ein Bild von etwas zu vermitteln, andererseits ist es im Nachhinein schwerer, den Zuschauer noch mal von diesem ersten Eindruck loszueisen, um ihn auf die Details zu lenken, die der Figur etwas Einzigartiges geben.
Sag’s auf Schlau: Mündliche Sprache
Die Sprachwissenschaft kennt zwei Bezeichnungen für ein weiteres Phänomen, das hier sehr helfen kann. Wenn etwas konzeptionell schriftlich ist, dann ist es in Schriftsprache verfasst, also so, wie man etwa einen Brief verfassen würde. Ist etwas dagegen konzeptionell mündlich, dann ist es umgangssprachlich und so, wie man es in einem Gespräch etwa formulieren würde.
Der große Unterschied ist der, dass unsere mündliche Sprache ungeschliffen ist. Oft wirkt es Wunder, aus einem „Entschuldigen Sie?“ einfach mal ein „’tschuldigung?“ zu machen, den Dialog erneut laut zu lesen und zu schauen, ob es nicht überzeugender wirkt.
Leute reden einfacher als sie schreiben, sowohl was die Wortwahl als auch den Satzbau betrifft. Schachtelsätze sind in geschrieben Texten schon oftmals unschön, aber in einem Dialog haben sie nichts zu suchen.
Überprüfen kann man sein Werk dabei auch oftmals ganz leicht, indem man seine Dialogzeilen wirklich laut und betont liest, notfalls auch für sich alleine. So merkt man oft, wo die Haken liegen.