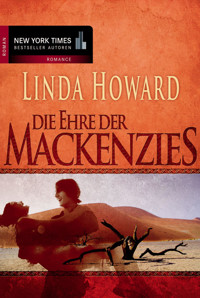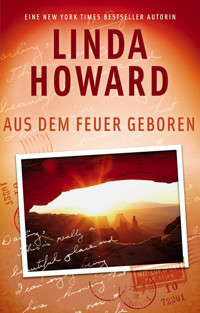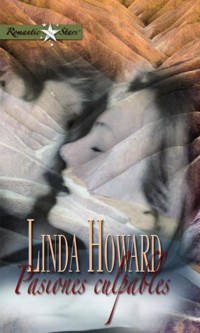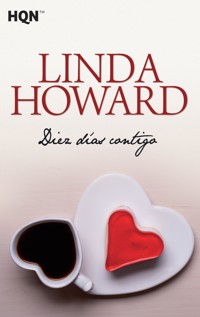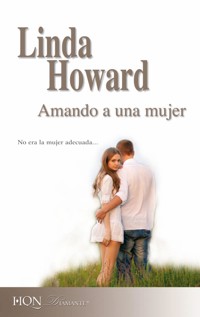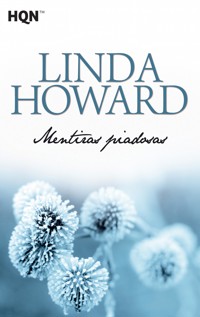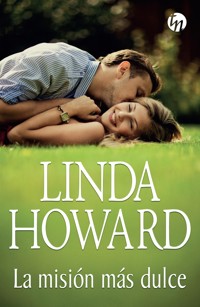7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die Mündung des Revolvers auf seinen Todfeind gerichtet - tausendmal hat Jake sich das vorgestellt. Irgendwann wird er seine Rechnung mit dem grausamen Frank McLain begleichen. Doch dann erblickt Jake zum ersten Mal McLains Verlobte Victoria, eine Frau, die trotz aller bitteren Erfahrungen standhaft an das Gute glaubt. Und Jake kann nicht anders: Vor ihrem unschuldigen Sex-Appeal kapituliert er. Er will Victoria beschützen, sie ehren und lieben! Als sein Widersacher stirbt, scheint es für Jake endlich inneren Frieden zu geben. Bis er etwas entdeckt, das ihn mit eiskalter Wut erfüllt: Auch Victoria, der er blind vertraute, hat ihn offensichtlich verraten. Sie erwartet das Kind eines anderen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Ähnliche
Linda Howard
Eiskaltes Feuer
Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Hartmann
MIRA® TASCHENBÜCHER
erscheinen in der HarperCollins Germany GmbH Valentinskamp 24, 20354 Hamburg Geschäftsführer: Jürgen Welte
Copyright dieser Ausgabe © 2019 by MIRA Taschenbuch in der HarperCollins Germany GmbH
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe:
A Lady of the West
Copyright © 1990 by Linda Howington
erschienen bei: Pocket Books, New York
Published by arrangement with Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York
Covergestaltung: pecher und soiron, Köln
Redaktion: Stefanie Kruschandl
Titelabbildung: Thinkstock/Getty Images, München
ISBN eBook 9783745751666
www.harpercollins.de Werden Sie Fan von MIRA Taschenbuch auf Facebook!
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder
auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
PROLOG
Das Land war außergewöhnlich schön. Vielleicht entschieden sich die ersten Menschen, die den Kontinent besiedelten, deshalb, dort zu leben. Fünfundzwanzigtausend Jahre plus/minus ein Jahrhundert später sollte es New Mexico heißen. Der Name reichte bei Weitem nicht aus, um eine Vorstellung vom Zauber der unberührten Bergwälder im Norden zu wecken, die durchsetzt waren mit kristallklaren Seen und allmählich in hügeliges Grasland mit vereinzelten Bergkegeln übergingen. Die Luft war so klar, dass sie Augen und Verstand besänftigte, und jeder Sonnenuntergang kam einem Farbrausch am Himmel gleich.
Die ersten Menschen in New Mexico waren die, die die Weißen später Indianer nannten, und sie lebten Tausende von Jahren erfolgreich in dem schönen Land. Doch als die kriegerischen Spanier mit ihren Rüstungen, stählernen Lanzen und temperamentvollen Pferden kamen, um in dem reichen Land nach Gold zu graben, beanspruchten sie das Land selbst für ihren fernen König. Als Belohnung für die unerschrockenen Siedler gab der König ihnen Landzuweisungen, Papiere, die ihnen den Besitz des wilden Landes bestätigten, das sie zähmen wollten.
Einer dieser frühen spanischen Siedler war Francisco Peralta, ein großer, stiller Mann mit leidenschaftlichen grünen Augen. Er steckte die Grenzen des Landes ab, das er sein Eigentum nennen wollte, und verteidigte sie mit seinem Blut. Er baute ein Haus aus Adobeziegeln und ließ die hochgeborene Frau aus Spanien kommen, die der Heirat mit ihm zugestimmt hatte.
Sie hatten nur ein Kind, einen Sohn. Aber was für einen Sohn! Juan Peralta erweiterte die Grenzen des väterlichen Landes, er förderte Gold und Silber, züchtete Pferde und Rinder und wurde reich dabei. Auch er holte sich eine Braut aus Spanien, eine Frau, die während der Indianerüberfälle an seiner Seite kämpfte und ihm drei Kinder gebar, einen Sohn und zwei Töchter. Juan Peralta baute ein neues Haus für seine Familie, bedeutend prächtiger als das seines Vaters. Es war ein harmonischer Bau mit Bogentüren, kühlen weißen Wänden und dunkel gefliesten Böden. Duftende Blumen blühten im Gartenhof.
Juans Sohn, mit Namen Francisco nach seinem Großvater, zog sogar noch mehr Reichtum aus dem rancho. Doch seine zarte Frau starb nur sechs Monate nach der Geburt ihres einzigen Kindes, einer Tochter. Der gramgebeugte Gatte heiratete nicht noch einmal und hegte seine Tochter Elena als den kostbarsten Schatz in seinem Leben.
Zu dieser Zeit, im Jahr 1831, schwärmten Amerikaner von Texas kommend in den Westen aus. Die meisten waren Pelzjäger und Männer aus den Bergen, einige waren Abenteurer. Zuerst waren es nicht viele, doch dann kamen immer mehr, harte, ruhelose Männer ohne Blick für die große Schönheit des Landes. Die Peraltas blickten auf diese groben Amerikaner herab, und Francisco verbat Elena, mit ihnen zu reden.
Doch einer von den Amerikanern, Duncan Sarratt, scherte sich keinen Deut um Franciscos Verordnungen. Er verliebte sich auf den ersten Blick in die zierliche Elena Peralta. Schlimmer noch, auch Elena verliebte sich in ihn. Francisco tobte, drohte, versuchte, seine Tochter wie auch den Amerikaner einzuschüchtern. Doch er hatte Elena so viele Jahre lang mit seiner Nachsicht verwöhnt, dass sie seine Drohungen nicht ernst nahm. Sie wollte ihren Amerikaner haben.
Sie bekam ihn, und sie heirateten mit Franciscos widerwillig gegebener Erlaubnis. Da er jedoch nicht dumm war, erkannte er bald, dass Duncan Sarratt vielleicht genau der Mann war, den Elena zur Verteidigung ihres Erbes brauchte. Der grünäugige Amerikaner verstand zu kämpfen und seinen Besitz zu verteidigen.
Francisco erlebte die Geburt seiner Enkelkinder nicht mehr. Er starb im folgenden Jahr, 1832, und Duncan Sarratt wurde Herrscher über das Land der Peraltas. Er wurde zu einem derart absolutistischen Herrscher, dass er als „König“ Sarratt bekannt wurde. Folgerichtig, wie auf die Nacht der Tag folgt, wurde das Hochtal als Sarratt’s Kingdom bekannt.
Die Erben des Königreichs wurden geboren: ein Sohn, Jacob, und zwei Jahre später ein weiterer Sohn, Benjamin.
Die Jungen wuchsen in dem eleganten Ziegelhaus auf, das ihr Urgroßvater erbaut hatte. Sie spielten auf den kühlen dunklen Fliesen, ließen sich an den Händen von den Balkonen zum Gartenhof baumeln, rangen und kämpften wie zwei Tigerjunge und liebten jeden Zentimeter des Königreichs, das einmal ihnen gehören würde.
Doch im Jahr 1845 führten die Amerikaner Krieg gegen Mexiko. Er berührte die Sarratts zunächst nur wenig, so weit hoch im Norden, wie sie lebten. Doch eine Folge des Kriegs bestand darin, dass Mexiko den Vereinigten Staaten das herrliche, schöne Land abtrat, das die Amerikaner als New-Mexico-Territorium bezeichneten. Mit einem Federstrich lebten die Sarratts plötzlich auf amerikanischem Boden.
Die Vereinigten Staaten erkannten die Gesetze und Bewilligungen der Regierung, die sie ersetzten, nicht an. Die alten spanischen Landbesitzer lebten seit hundert Jahren oder länger auf dem ihnen zugewiesenen Land, doch plötzlich waren ihre Heimstätten legal zu haben. Sie konnten ihr Land behalten, indem sie Anträge stellten, doch das wussten die meisten nicht. Duncan Sarratt, der in seinem riesigen Königreich im Tal ziemlich abgelegen lebte, wusste es auch nicht. Es machte keinen großen Unterschied; jeder, der versuchte, ihm Sarratt’s Kingdom zu nehmen, musste auf Leben und Tod dafür kämpfen.
Schüsse weckten den Jungen auf. Er wälzte sich aus dem Bett und griff nach seiner Hose. Man schrieb das Jahr 1846, und mit seinen dreizehn Jahren arbeitete er schon fast zwei Jahre lang wie ein Mann auf der Ranch. Ganz gleich, was geschehen mochte, er hatte nicht vor, sich wie ein Kind unter dem Bett zu verstecken.
Er hörte Leute rennen, und Rufe hallten durch das Haus und auch draußen über den Hof. Dann vernahm er die Stimme seines Vaters, der Befehle brüllte. Der Junge schlüpfte in seine Schuhe und lief hinaus auf den Flur. Unterwegs stopfte er sich das Nachthemd in die Hose. Er stieß mit seinem jüngeren Bruder zusammen, der ebenfalls gerade aus seinem Zimmer stürzte. Er hielt den kleineren Jungen fest, der fragte: „Was ist passiert?“
„Ich weiß es nicht.“ Dicht gefolgt von seinem Bruder, rannte er den Flur entlang.
Im Erdgeschoss hörten sie Schüsse aufpeitschen. Einen Augenblick lang herrschte Stille, dann folgten weitere Schüsse, die donnernd durch die hohen Räume hallten. Instinktiv duckten sich die Jungen seitlich weg.
„Duncan!“ Ihre Mutter Elena stürmte aus dem Schlafzimmer, das sie mit dem Vater der Jungen teilte. Nackte Angst schwang in ihrer Stimme mit, als sie nach ihrem Mann rief, der sich unten aufhielt. Sie sah ihre Söhne an, dann riss sie die beiden an sich. „Bleibt hier“, befahl sie.
Mit dreizehn war der Junge schon größer als seine Mutter. „Ich will ihm helfen“, sagte er und wandte sich der Treppe zu.
„Nein!“ Sie packte ihn am Arm. „Bleib hier! Ich befehle es dir. Gib acht auf deinen Bruder. Ich schau nach, was da los ist, und sage euch dann Bescheid. Versprich es! Versprich, dass ihr hier bleibt!“
„Ich kann selbst auf mich achtgeben.“ Ihr jüngerer Sohn reckte das Kinn. Er war genauso ungestüm wie sein Bruder. Sie sah ihn einen Moment lang an und strich ihm übers Gesicht.
„Bleibt hier“, flüsterte sie und rannte los.
Noch nie hatten sie einen direkten Befehl ihrer Mutter missachtet. Sie standen im Flur, voller Angst, weil sie nicht wussten, was genau vor sich ging, und wütend, weil sie dabei sein wollten. Das Knallen von Pistolenschüssen und das Peitschen von Gewehrfeuer erschütterten das große Haus. Von unten waren Schreie und Flüche, eilige Schritte und das Bersten von Glas zu hören.
Dann gellte ein Schrei durch den Lärm. Er ging in einen schrillen Ton über, brach dann zu einem wunden, tiefen Klagelaut. Es war ihre Mutter.
Der ältere Junge stürzte zur Treppe, doch unvermittelt hielt ihn ein warnendes Vorgefühl zurück. Er warf sich zu Boden und spähte durchs Geländer, um zu sehen, was im Erdgeschoss passierte.
In der Eingangshalle lag ein Mann auf dem Boden. Von dort, wo der Junge sich befand, war nur die obere Körperhälfte sichtbar. Obwohl das halbe Gesicht weggeschossen war, erkannte der Junge seinen Vater. Eisige Fassungslosigkeit breitete sich in ihm aus. Seine Mutter hatte sich über die Leiche ihres Mannes geworfen und stieß immer noch diese grauenhaften Klagelaute aus. Vor den Augen des Jungen packte ein Mann den Arm seiner Mutter und zerrte sie von der Leiche fort. Dabei fiel das Licht der Lampe auf sein Gesicht. Der Junge erstarrte. Es war Frank McLain, einer der Männer seines Vaters.
„Kümmert euch auch um die Kinder.“ McLain sprach leise, doch der Junge konnte ihn verstehen. „Bringt sie um.“
Elena schrie, stürzte sich auf ihn und zerkratzte mit den Fingernägeln sein Gesicht. McLain fluchte, dann holte er mit der Faust aus und schlug sie mit einem Hieb an die Schläfe nieder. „Holt die Jungen“, befahl er und neigte sich über die Frau.
Der Junge kroch zurück und packte seinen Bruder. „Lauf!“, zischte er.
Das Haus war ihnen vertraut; sie kannten jeden Winkel. Da sie wussten, dass die Männer sie zuerst in ihren Zimmern suchen würden, flüchteten sie sich stattdessen in das Eckzimmer, das Gästen vorbehalten war und über einen kleinen Balkon zum Innenhof verfügte.
„Ich springe zuerst“, flüsterte der Ältere und schwang die Beine über die Brüstung. Er hielt sich an dem schwarzen Eisengeländer fest und ließ sich herab, bis er über dem Boden hing, dann ließ er los. Er fiel höchstens zwei Meter; in ihren wilden Spielen hatten sie diesen Sturz oftmals geprobt. Leichtfüßig wie eine Katze landete er und verschwand sofort in den Sträuchern an der Mauer. Ein dumpfer Aufprall war zu hören, und sein Bruder folgte ihm.
„Was ist los?“, flüsterte der Jüngere.
„Pa ist tot. McLain war’s. Er hat Mutter in seiner Gewalt.“
Immer noch waren sporadisch Schüsse zu hören, da die Getreuen Duncan Sarratts und der Familie Peralta sich zu wehren versuchten. Die Jungen hielten sich im Schatten und schlichen um die Mauer herum. Ihre Gewehre befanden sich im Herrenzimmer, wo sie sie jeden Tag nach sorgfältiger Reinigung verstauten. Sie mussten sie holen. Immer noch breitete sich die Kälte im Inneren des großen Jungen aus; er sah seinen Vater auf dem dunklen Boden liegen, und sein halbes Gesicht war weg.
Die Schreie ihrer Mutter gellten durch die kalte Nachtluft.
Sie krochen durch die Küchentür ins Haus. Drinnen klangen die Schreie ihrer Mutter noch lauter und schmerzten in den Ohren. Sie war noch in der Eingangshalle, und jetzt waren auch gedämpfte Flüche zu hören.
Der Junge begriff, und ihm wurde noch kälter. Er war dreizehn, und er wusste Bescheid. Er erhob sich auf die Füße und bewegte sich lautlos wie ein junger Panther. Auf dem Küchentisch blitzte etwas Stählernes, und automatisch griff er nach dem Küchenmesser mit der langen Klinge.
Die Schreie waren jetzt in ein Stöhnen übergegangen, das immer schwächer wurde. Als der Junge in die Halle trat, sah er, wie McLain sich zwischen Elenas Beinen aus ihr zurückzog und sich auf die Knie erhob. Seine Hose war offen und übers Gesäß herunter gelassen, seine schrumpfende Männlichkeit glänzte nass. Die Pistole hielt er noch in der Hand. Mit einem schwachen Lächeln setzte er die Mündung an den Kopf der Frau und drückte ab.
Ein unmenschlicher Aufschrei blieb dem Jungen in der Kehle stecken, doch er wusste jetzt genau, was zu tun war. Er warf das Messer, zielsicher dank vieler im Spiel verbrachter Stunden. McLain nahm nur eine Bewegung im Dunkeln wahr und duckte sich seitlich weg, gerade genug, damit das Messer sich in seine Schulter statt in sein Herz bohrte. Er brüllte um Hilfe und versuchte aufzustehen, als der Junge sich mit seinem ganzen Gewicht auf ihn stürzte und ihn wieder zu Boden warf. Der Aufprall ließ ihn vor Schmerzen schreien; sein nackter Hintern schrammte über den kalten Boden. Der Junge riss das Messer aus der Schulter, und die blutige Klinge zielte auf das entblößte Gemächt des Mannes. McLain schrie und versuchte, sich aus der Gefahrenzone zu wälzen. Die Bewegung lenkte den Messerstoß so weit ab, dass er nur einen seichten Schnitt im Oberschenkel hinterließ. Mit dem Fauchen eines wilden Tieres holte der Junge noch einmal aus, dieses Mal mit einer flachen, seitwärts gerichteten Armbewegung. Das Messer blitzte silbern und scharlachrot auf, und McLain empfand heiße, sengende, erstickende Todesangst, als der Stahl in seinen Hodensack fuhr.
Wahnsinnig vor Schmerz und Angst, brüllte er auf. Er wälzte sich und versuchte zu treten, doch die herabgelassene Hose behinderte ihn. Vorher hatte er kein Grauen gekannt, doch jetzt ließ es ihm das Blut in den Adern gefrieren. Er konnte nicht aufhören zu schreien, während er versuchte, den Messerstößen auszuweichen. Im flackernden Licht sah er flüchtig das Gesicht des Jungen, und es wirkte erbarmungslos.
„Ich schneide dir den verdammten Schwanz ab und stopfe ihn dir ins Maul“, flüsterte der Junge mit wildem Blick, doch McLain verstand ihn trotz seiner eigenen, hysterisch-schrillen Schreie.
Ein ohrenbetäubender Schuss riss den Jungen zur Seite. Das Messer fiel klappernd zu Boden, doch der Junge war nicht tot. Er kroch unbeholfen zur Küche, und der andere Junge, der kleinere, kam ihm hastig zu Hilfe.
„Bringt sie um!“, kreischte McLain, beide Hände über seine blutenden Geschlechtsteile gepresst. „Bringt die kleinen Scheißkerle um!“ Er wälzte sich auf dem Boden, die Hose immer noch auf Kniehöhe, während der Hass auf den kleinen Sarratt ihm bitter in die Kehle stieg und ihn zu ersticken drohte. Er wimmerte, hatte zu große Angst, um die Hände wegzuziehen und nachzusehen, welchen Schaden das Messer angerichtet hatte, doch das Blut quoll zwischen seinen Fingern hindurch, und er begriff, dass er Gefahr lief zu verbluten. Immer noch wimmernd, hob er zitternd eine Hand und stöhnte laut auf. Sein Glied war unversehrt, doch der linke Hodensack war zerfleischt. Er konnte nicht erkennen, ob er den linken Hoden verloren hatte oder nicht.
Verflucht, der Mistkerl hätte ihn um ein Haar kastriert! Er würde die Sarratts vom Angesicht der Erde tilgen, er würde dem Jungen das Fell abziehen und ihn den Bussarden überlassen. Doch noch während er sich vorstellte, was er alles tun wollte, wusste McLain, dass er das würgende Entsetzen und den Schmerz, die Demütigung, sich mit herabgelassenen Hosen auf dem Boden zu wälzen, während das Messer zustieß, nie vergessen würde.
Die Jungen kauerten in der kleinen Höhle, die sie fünf Jahre zuvor an der nördlichen Grenze von Sarratt’s Kingdom entdeckt hatten. Schmerzen schüttelten den Älteren und zwangen ihn, die Zähne zusammenzubeißen, um sein Stöhnen zu unterdrücken. Sein Bruder lag still, viel zu still, neben ihm. Der ältere Junge wimmerte unter der Anstrengung, den Arm zu heben und seinem Bruder die Hand auf die Brust zu legen, die sich mit dessen Atemzügen hob und senkte.
„Nicht sterben“, flüsterte er in die kalte Dunkelheit, obwohl er wusste, dass der Jüngere bewusstlos war. „Nicht sterben. Noch nicht. Wir müssen McLain töten.“
Eine Kugel hatte seinen kleinen Bruder ziemlich weit oben in der linken Seite getroffen. Der Ältere wusste nicht, wie ihnen die Flucht gelungen war, aber wie verwundete Tiere waren sie hinaus in die Dunkelheit gekrochen. Er selbst hatte zwei Verletzungen davongetragen, eine im rechten Oberschenkel und eine Fleischwunde an der Taille. Blut tränkte sein Hemd und seine Hose, und er spürte, wie ihn die Kräfte verließen. Ihm wurde schwindlig von den Schmerzen und dem Blutverlust.
Verschwommen wurde ihm bewusst, dass sie womöglich hier sterben würden.
„Nein“, sagte er und berührte noch einmal den reglosen Körper seines Bruders. „Was auch geschieht, wir müssen McLain kriegen. Komme, was da wolle. Das schwöre ich.“
1. KAPITEL
Major Frank McLain trat hinaus in die Sonne und sah mit schmalen Augen erwartungsvoll dem Buggy entgegen.
Endlich war sie da.
Wilde, selbstgefällige Befriedigung erfüllte ihn. Bisher war er nie gut genug gewesen, doch jetzt nahm er eine verdammte Waverly zur Frau. Ihre Mutter war sogar eine Creighton – Margaret Creighton –, und das Mädchen selbst kam auch nach den Creightons mit ihrer blassen, ruhigen Eleganz und den aristokratischen Zügen.
Victoria Waverly. Vor dem Krieg hätte ihre Familie ihn höchstens angespuckt. Jetzt heiratete Victoria ihn, weil er Geld hatte und die Familie selbst nichts ihr eigen nannte als leere Mägen und einen makellosen Stammbaum. Der Krieg und der darauf folgende Hunger waren die größten Gleichmacher der Welt. Die Waverlys und die Creightons gaben ihm nun für ein behaglicheres Leben ohne mit der Wimper zu zucken Victoria zur Frau.
McLain konnte es kaum erwarten. Er hatte dieses Land den Sarratts mit Blut und Tod und purem Schneid abgerungen und es sich angeeignet; jetzt besaß er mehr Land als irgendein Plantagenbesitzer in den Südstaaten je zuvor, hatte sich einen Namen gemacht, der im Territorium etwas galt, und beschäftigte mehr Leute als jeder andere im Umkreis. Trotzdem hatte noch etwas gefehlt. Er hatte nie das bekommen, was er sich mehr als alles andere im Leben wünschte, und das war eine Dame an seinem Tisch, eine echte Aristokratin, die seinen Namen trug. Früher hatte er nie darauf hoffen können, doch nach dem Krieg war er zurück nach Augusta gegangen, zurück in die Stadt, in der er arm und verachtet als weißer Abschaum aufgewachsen war. Dort hatte er sich nach der perfekten Frau seiner Träume umgesehen und Victoria gefunden. Sein Herz schlug schneller, wenn er nur an sie dachte. Er hatte vier Monate auf ihre Ankunft gewartet, und jetzt war sie da. Sie würden noch am selben Abend heiraten.
Einer der Männer hinter ihm trat vor, um besser sehen zu können. „Wer sitzt denn da bei ihr im Buggy?“
„Ihre kleine Schwester und ihre Cousine, Emma Gann, begleiten sie“, antwortete McLain. Es störte ihn nicht, dass Victoria ihre Verwandten mitbrachte. Irgendwie gefiel ihm die Vorstellung, sie unter seinem Dach zu beherbergen. Vermutlich kamen dann Männer aus dem ganzen Territorium, um ihnen den Hof zu machen. Weiße Frauen waren immer noch eine Seltenheit, und echte Ladies waren Gold wert. Flüchtig streifte ihn der Gedanke an all die Verbindungen, die er durch die vorteilhafte Verheiratung der beiden jungen Frauen herstellen könnte. Bei Gott, er würde ein Imperium aufbauen, das die Sarratts wie hergelaufene Bauern aussehen ließ. Zwanzig Jahre waren vergangen, seit er den letzten von der Familie getötet und sich das Land angeeignet hatte, doch er hasste den Namen noch immer. Duncan Sarratt hatte ihn immer angesehen, als wäre er der letzte Dreck, und Elena, dieses Miststück, führte sich auf, als würde er die Luft verpesten, die sie atmen musste. Doch er hatte sie beide drangekriegt, hatte sie bezahlen lassen, und jetzt lebte er im Haus der Sarratts. Nein, verdammt noch mal, es war sein Haus, und es war sein Land. Die Sarratts gab es nicht mehr. Dafür hatte er gesorgt.
Die sechs Männer, die hinter ihm standen, warteten in gewisser Weise genauso begierig wie er darauf, dass der Buggy anhielt. O ja, in Santa Fe gab es ein paar weiße Huren, wenn sie den weiten Weg dorthin zu Pferde auf sich nehmen wollten, doch auf der Ranch und in der Umgebung waren alle Frauen Mexikanerinnen. Die wenigen weißen Frauen in Santa Fe, die keine Huren waren, waren mit Soldaten, einige wenige auch mit Ranchern verheiratet. Die Frauen, die jetzt eintrafen, waren angeblich anständige Damen, doch nur die Frau des Majors würde tabu sein. Zum Teufel, sie kannten ihn. Wenn er die Schwester seiner Frau nehmen wollte, würde er es ohne lange zu fackeln auch tun. So sahen sie alle dem Buggy mit begehrlichem Blick entgegen und fragten sich, wie die Frauen wohl aussahen, auch wenn das keine große Rolle spielte.
Will Garnet spie auf den Boden. „Der Major macht sich wegen dieser Frau zum Narren“, brummte er. „Keine Pflaume auf der Welt ist so ein Getue wert.“
Die wenigen Männer, die ihn gehört hatten, stimmten ihm zu, äußerten sich jedoch nicht. Nur zwei Männer von allen waren sicher vor dem Zorn des Majors, und einer von ihnen war Garnet. Er war in den frühen Vierzigern, sein dunkles Haar wurde an den Schläfen bereits grau, und er war von Anfang an beim Major gewesen. Er war der Vormann und machte mit dem Segen des Majors so ziemlich alles, was er wollte. Jeder war auf der Hut vor ihm, abgesehen von dem Mann, der sich in entspannter Haltung, den kalten Blick unter der Hutkrempe verborgen, ein bisschen abseits von der Gruppe hielt. Jake Roper arbeitete erst ein paar Monate auf der Ranch, doch auch er war anscheinend immun gegen den Zorn des Majors.
Sie alle waren als Viehtreiber angestellt, doch im Grunde waren einige von ihnen eher wegen ihrer Geschicklichkeit mit der Pistole als wegen ihrer Fähigkeiten als Viehhüter genommen worden. Ein Mann, der sein Vermögen auf McLains Art und Weise erworben hatte, musste ein wachsames Auge auf seine Feinde haben. Nicht nur das, sondern ein so großer Besitz wie der seine war auch den Diebereien und Blitzüberfällen der Komantschen ausgesetzt. Deshalb hatte McLain sich eine private Armee von Revolvermännern aufgestellt, und Jake Roper war der schnellste. Selbst die übrigen Revolvermänner gingen ihm lieber aus dem Weg. Garnet hatte vielleicht eine ausgeprägt niederträchtige Ader, aber Roper war durch und durch eiskalt. Garnet mochte einen Mann hinterrücks erstechen, Roper dagegen löschte ein Leben so gedankenlos aus, als würde er ein Insekt zertreten.
Roper selbst hatte wenig Interesse an den Frauen. Der Major machte sich zum Narren, doch das störte Roper nicht. Er streifte seinen Boss mit einem Seitenblick, verbarg seine grenzenlose Verachtung jedoch hinter seinen kalten, ausdruckslosen Augen. Diese vornehme Lady aus den Südstaaten konnte nichts Besonderes sein, nicht, wenn sie McLain heiratete. Roper konnte sich gut vorstellen, was sie erwartete. Aber sie war freiwillig hierher gekommen, dann sollte sie auch, verdammt noch mal, das Beste daraus machen.
Als der Buggy vor dem Haus angekommen war, hielt er an, und McLain trat vor. Er hob die Arme, um einer der Frauen vom Wagen zu helfen. „Victoria!“
Sie erhob sich, aber statt sich von McLain aus dem Buggy heben zu lassen, legte sie nur die behandschuhte Hand auf seinen Unterarm und stieg ab. „Major“, sagte sie ruhig und hob den Schleier ihrer Haube.
Ropers erster Eindruck von ihrem Gesicht war der einer blutleeren Porzellanpuppe, sehr korrekt und leidenschaftslos. Ja, eine richtige Lady bis zu den spitzenbesetzten Unterhosen – die um Gottes willen kein Mann je zu sehen bekommen sollte. Ihr Haar war hellbraun, soweit er es sehen konnte, und ihre Stimme klang tief. Das war ein Segen; schrille, kreischende Frauen widerten ihn an.
Die nächste Frau, die abstieg, ebenfalls mit leichter Hand auf McLains Unterarm, war eher unscheinbar mit dunkelbraunem Haar und braunen Augen. Doch Roper fand ihr Lächeln liebenswert. Er musterte sie abschätzend. Vermutlich war sie die Cousine.
Die dritte Frau wartete nicht auf Hilfestellung, sondern sprang mit einem kleinen gurrenden Lachen des Entzückens vom Buggy. Sie zog sich die Haube vom Kopf und wirbelte sie an den Bändern durch die Luft. „Oh, wie schön“, hauchte sie und sah sich mit großen Augen um.
Garnet, der neben Roper stand, straffte sich und fluchte verhalten. Sie war eher noch ein junges Mädchen als eine Frau, aber sie war hinreißend schön. Ihr Haar war eine goldblonde Mähne, und sie hatte große dunkelblaue Augen. Roper konnte sich vorstellen, dass solch ein Mädchen bei den Männern auf der Ranch viel Unruhe stiften würde. Die kleine Schwester war einfach zu schön, um die Finger von ihr lassen zu können.
„Garnet! Roper!“
Beide Männer traten mit ausdruckloser Miene vor. Der Major strahlte wie ein Idiot, als er sich ihnen zuwandte. „Victoria, meine Liebe, dies sind meine beiden rechten Hände. Will Garnet ist mein Vormann, und Jake Roper sorgt hier für unser aller Sicherheit. Jungs, sagt meiner Zukünftigen, Miss Victoria Waverly, guten Tag.“
Victorias Augen verrieten nichts, als sie dem Vormann anmutig die schmale, behandschuhte Hand entgegen streckte. „Mr Garnet“, sagte sie leise.
„Ma’am.“ Er nahm ihre Hand und musterte Victoria von Kopf bis Fuß, auf eine Weise, die sie beunruhigt zurückweichen ließ. Sie fing seinen Blick auf, und seine Augen verstärkten ihr Unwohlsein. Sie waren leer und ausdruckslos wie die einer Schlange.
So rasch wie es der Anstand erlaubte, entzog sie ihm ihre Hand und widerstand dem Drang, sie an ihrem Rock abzuwischen. Stattdessen wandte sie sich dem anderen Mann zu. „Mr Roper.“
Sie blickte zu ihm hoch und erstarrte. Er hatte sich den Hut tief ins Gesicht gezogen. Trotzdem sah sie das kalte Glitzern in seinen Augen. Bewusst langsam senkte er den Blick auf ihre Brüste und starrte sie, wie ihr schien, ewig lange an, bevor er ihr verachtungsvoll in die Augen sah.
Roper ignorierte ihre ausgestreckte Hand und hob nur kurz den Hut. Victoria ließ den Arm sinken und wandte sich voller Unbehagen ab. Wenn Garnets Verhalten beleidigend gewesen war, so machte dieser Mann ihr Angst. Sein Gesicht war völlig unbewegt, und doch hatte er sie mit solcher Missachtung angesehen, dass sie zutiefst erschüttert war. Niemand, nicht ein einziger von den Yankee-Soldaten, hatte sie je so angeschaut.
Nur unter Aufbietung all ihrer Selbstbeherrschung konnte sie den Anschein der Ruhe wahren, als sie sich zu dem Mann umdrehte, dessentwegen sie den Weg über Dreiviertel des Kontinents zurückgelegt hatte, um ihn zu heiraten. „Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Major, würden wir uns gern ein wenig frisch machen. Der Staub ist schrecklich.“
„Aber sicher. Carmita! Zeig Miss Victoria und den Mädchen, wo sie sich waschen können.“ Seine Stimme klang barsch, wenn er mit den Dienstboten sprach, und Victoria warf ihm einen raschen Blick zu. Sie war dazu erzogen, niemals grob zu einem Angestellten zu sein. Doch die kleine, rundliche Frau mittleren Alters, die dem Befehl des Majors nachkam, zeigte einen Ausdruck ständiger guter Laune.
„Bitte, hier entlang“, sagte sie mit einem warmen Lächeln.
Victoria drehte sich um. Ihre Cousine Emma stand dicht hinter ihr, doch ihre Schwester Celia war zu den Koppeln geschlendert. Victoria rief nach ihr, und als das Mädchen mit vor Entzücken strahlendem Gesicht auf sie zu hüpfte, entging Victoria nicht, wie der Großteil der Männer Celia ansah. Überall betrachteten die Männer Celia mit Wohlgefallen, doch diesmal war es anders. Sie beobachteten das Mädchen in der Art, wie eine Katze die Maus ins Auge fasst.
Victoria trieb Celia vor sich her ins Haus und fragte sich verzweifelt, ob sie das Richtige getan hatte, das Mädchen mitzubringen. In Augusta wäre sie wenigstens nicht diesen bedrohlichen Fremden ausgesetzt gewesen.
Emma ging neben Victoria, und die schönen dunklen Augen ihrer Cousine spiegelten ihre eigenen unangenehmen Eindrücke. „Diese Männer …“, flüsterte Emma.
„Ja“, sagte Victoria.
Das riesige Haus war im spanischen Stil gebaut, mit dicken, weiß getünchten Ziegelmauern. Kühle empfing sie beim Eintreten, und Victorias Stimmung hellte sich auf, als sie sich umsah. Die Wände waren weiß und sauber, die geräumigen Zimmer mit bunten Teppichen aufgefrischt. Im ersten Stock führte Carmita sie an der ersten Tür rechts vorbei, öffnete die zweite und bat Victoria hinein. „Ihr Zimmer, Señorita“, sagte sie.
Victoria gefiel, was sie sah. Der Fußboden war aus dunklem Holz, an die linke Wand gerückt stand ein großes Himmelbett. Rechts davon befand sich ein riesiger Schrank. Auf einem Waschtisch standen ein schlichter weißer Krug und eine Schüssel, und ein Frisiertisch mit Spiegel war für ihre Toilette bereitgestellt. Unter dem Fenster stand eine Chaiselongue, darauf lag eine zusammengefaltete kremfarbene Decke. „Es ist hübsch“, sagte Victoria, was Carmita ein breites Lächeln entlockte.
Celia wirbelte mit fliegenden Röcken durch den Raum. „Ein eigenes Zimmer!“, jubelte sie. Victoria und sie hatten sich, solange sie denken konnte, ein Zimmer geteilt, und ein eigenes Zimmer stellte für sie einen unvorstellbaren Luxus dar. „Und Emma und ich bekommen auch eigene Zimmer, oder?“
Victoria sah Carmita an, die nickte. „Ja, natürlich“, versicherte sie ihrer Schwester und strich Celia eine goldene Locke aus dem Gesicht. Nein, ausgeschlossen, dass sie sie bei ihren Eltern in Augusta hätte zurücklassen können, die verbittert und freudlos waren, nachdem ihr einziger Sohn im Krieg gefallen war. Celia brauchte Lachen und Sonnenschein und gab davon im Überfluss zurück. Aber sie war ein zartes, verletzliches Mädchen. Wie eine Treibhauspflanze benötigte sie sorgfältige Pflege, um zu gedeihen.
„Können wir als Nächstes mein Zimmer ansehen? Bitte?“
Ihre Begeisterung war ansteckend, und Victoria lachte mit den anderen, als sie den Flur entlanggingen. „Wie viele Zimmer hat das Haus, Carmita?“, fragte sie.
„Fünfzehn, Señorita. Acht im Erdgeschoss, sieben hier oben.“
„Sie sind die Hauswirtschafterin?“
„Sí. Dann sind da noch Lola, die Köchin, und meine Tochter Juana, die mir im Haus hilft.“
Bei ihrer Ankunft hatte Victoria flüchtig eine schwarzhaarige junge Frau bemerkt. „Das Mädchen, das ich beim Stall gesehen habe, war das Juana?“
Carmitas Miene verhärtete sich. „Nein, Señorita. Das war Angelina Garcia. Juana geht nicht in die Ställe.“
„Was ist Angelinas Aufgabe?“
Die rundliche Frau zuckte lediglich die Achseln und gab keinerlei Erklärung ab. Victoria nahm sich vor, sich später noch einmal nach dieser Angelina zu erkundigen.
Die Emma und Celia zugewiesenen Zimmer waren völlig identisch, rechteckig und schlicht, aber mit einem einfachen Charme ausgestattet. Celia hüpfte auf beiden Doppelbetten, außer sich vor Freude über ihr Glück, und Emmas Blick enthielt die leise Hoffnung, dass endlich doch alles besser würde. Victoria bemühte sich um ein wenig vergleichbaren Optimismus, doch ihr Herz schlug stattdessen langsam und schwer vor Sorge. Sie musste Frank McLain heiraten, und einzig die Verzweiflung hatte sie dazu getrieben. Nach außen gab er sich freundlich, doch sie bezweifelte, dass sie sich in seiner Nähe jemals wohlfühlen würde.
Bei der Vorstellung, ihn zu heiraten, schauderte sie. Er war breitbrüstig und stiernackig wie ein Bulle, aber nicht sehr groß, sodass er ein wenig tierhaft wirkte. Victoria glaubte zu ersticken, wenn sie daran dachte, dass sie sein Zimmer teilen sollte.
Sie hatte Emma und Celia mitgenommen, weil sie sie dadurch zumindest mit genügend Nahrung und Kleidung versorgt glaubte. Der Krieg hatte sie buchstäblich an den Bettelstab gebracht, und der Major war ihnen wie ihre einzige Hoffnung erschienen. Doch nachdem sie diesen Männern begegnet war – Garnet und Roper – und das gierige Interesse der anderen im Hintergrund gesehen hatte, hielt sie es nicht mehr für eine so gute Idee, ihre Cousine und Schwester aus Augusta fortgebracht zu haben.
Roper hatte sie mit Verachtung in den kalten Augen angesehen. Sie fröstelte und beschloss, stets einen großen Bogen um diesen Mann zu machen. Sie war froh, dass er die Hand, die sie ihm reichte, nicht genommen hatte; sie nicht berührt hatte. Trotzdem fragte sie sich, warum er sie so angesehen hatte, als wäre sie Abschaum. Niemals in den einundzwanzig Jahren ihres Lebens hatte sich jemand ihr gegenüber so verhalten; sie war eine Waverly, ihre Mutter war eine Creighton, und beide Familien konnten ihre Wurzeln über mehrere Jahrhunderte zum englischen Adel zurückverfolgen. Vor dem Krieg hatten sie an der Spitze der gesellschaftlichen Pyramide gestanden. Vor dem Krieg …
Vor dem Krieg, erinnerte sie sich, war vieles anders gewesen. Entschieden straffte sie die Schultern. Sie hatte die privilegierte Lebensart verloren, in die sie hineingeboren war, den Luxus, den Komfort und den Schutz des Reichtums. Hatte sie zuvor alles besessen, war ihr danach nichts mehr geblieben, doch sie hatte ihre Lage gemeistert. Sie hatte den Kopf hoch getragen, auch wenn sie hungerte, wenn ihre Kleider fadenscheinig waren und sie vor Kälte zitterte, weil ihr einziges Paar Schuhe Löcher in den Sohlen hatte. Kleider und Schuhe waren nie das Wichtigste in ihrem Leben gewesen, daher hatte sie um diesen Verlust auch nicht getrauert.
Aber der Krieg hatte ihre Familie zerstört, hatte hier einen Cousin genommen, dort einen Onkel. Emmas Verlobter war im ersten Winter gefallen, und der Nachhall der Traurigkeit hatte ihre Augen nie wieder verlassen. Emmas Mutter, die Schwester von Victorias Mutter, war 1863 gestorben. Da hatten die Waverlys Victorias Cousine zu sich genommen. Dann kam Victorias geliebter Bruder Robert im Wilderness-Feldzug ums Leben. Danach hatte sie auch ihre Eltern verloren. Sie lebten noch, mehr schlecht als recht, aber ihre Herzen waren tot.
Victoria hatte immer gewusst, dass Robert alle Aufmerksamkeit auf sich zog, der Mittelpunkt der Familie war, doch sie war nie eifersüchtig auf ihn gewesen, denn auch sie hatte ihn heiß und innig geliebt. Sie und Celia wurden auch geliebt, das hatte sie zumindest geglaubt. Doch nach Roberts Tod verfielen die Eltern in so tiefe Trauer, dass sie ihren Töchtern nichts mehr geben konnten.
Bedrückt dachte Victoria an das Zuhause, das sie verlassen hatte, an ihre durch den Verlust verbitterten Eltern. Erneut wurde ihr bewusst, dass sie die sechzehnjährige Celia dort nicht allein hatte zurücklassen können. Celia war anders als andere, und manchmal verloren die Menschen die Geduld mit ihr. Ihr Leben lang hatte Victoria Celia vor Problemen bewahrt, und sie würde es auch weiterhin tun.
Carmita unterbrach Victoria in ihren Gedanken, als sie Emmas Zimmer verließen, und sie erklärte: „Der Major, er sagt, die Hochzeit findet heute Abend statt. Sie haben doch ein Kleid? Ich werde es aufbügeln.“
Heute Abend! Victoria fröstelte. „Heute Abend? Sind Sie sicher?“
Die Haushälterin sah sie verwundert an. „Natürlich. Er hat nach dem Padre geschickt. Er hat es mir heute Morgen selbst mitgeteilt.“
Victoria sagte nichts weiter dazu, sondern ging mit Carmita zurück in ihr Zimmer, wohin ihre Koffer inzwischen gebracht worden waren. Mit Emmas Hilfe durchsuchten sie alles, bis das Kleid (bezahlt mit dem Geld des Majors) gefunden war, das Victoria zur Hochzeit tragen wollte. Carmita nahm es mit, um es mit Dampf zu bügeln.
Schweigend begann Victoria, ihre Kleider in den Schrank zu räumen. Emma schloss sich ihr an, faltete die Sachen geschickt oder hängte sie auf.
Nach einer Weile sagte Emma: „Weißt du, du musst das nicht auf dich nehmen. Wir können immer noch zurück nach Hause gehen.“
Victoria lehnte sich an den Schrank. „Wie denn? Glaubst du allen Ernstes, der Major würde für unsere Rückreise aufkommen? Nein, ich habe dem Handel zugestimmt und stehe zu meinem Wort.“
Emma, die gerade ein zartes Leinennachthemd faltete, das ebenfalls vom Geld des Majors gekauft worden war, hielt inne. Ihre gesamte Garderobe war neu und vom ihm bezahlt, selbst die Unterwäsche. Emmas Blick war sorgenvoll. „War es ein Fehler, hierherzukommen?“
„Hoffentlich nicht. Ich bete darum. Aber diese Männer da unten … wie sie Celia angesehen haben …“
„Ja. Ich habe es bemerkt.“
Nachdenklich ging Victoria zum Fenster. Das Land war wunderschön, unglaublich schön, aber fremdartiger als alles bisher Gesehene. Sie hatte eine ruhige, friedliche Ranch erwartet und ahnte stattdessen eine verhaltene Gewalttätigkeit, die sie sich nicht erklären konnte. „Ich habe ein ungutes Gefühl“, sagte sie leise. „Diese Männer sind so bedrohlich. Das hört sich albern an, nicht wahr? Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie Waffen tragen.“
„Das Territorium ist immer noch eine gefährliche Gegend. Vermutlich tragen die meisten Männer hier Waffen.“
„Ja, natürlich. Es ist nur so anders als zu Hause. Die Yankee-Soldaten waren bewaffnet, aber das war nur selbstverständlich.“
„Und sie sahen nicht aus wie die Revolvermänner, von denen wir so viel gehört haben.“
„Oder gelesen, wie in diesem schrecklichen Schundroman, den Celia in Texas gekauft hat.“
Die beiden jungen Frauen sahen einander an und lächelten in Gedanken an die Horrorschilderungen, die Celia mit weit geöffneten Augen verschlungen hatte. Emmas gesunder Menschenverstand wirkte beruhigend, doch Victoria konnte ihr Unbehagen nicht restlos abschütteln. Leichte Röte stieg ihr in die Wangen, als sie weiter auspackte, und sie warf einen raschen Blick auf Emma. Ihre Cousine war zwei Jahre älter als sie und verlobt gewesen. Vielleicht verfügte sie über mehr Informationen als Victoria selbst.
„Ob er wohl in diesem Zimmer schläft?“
Emma schaute sich um. „Es sieht nicht so aus. Wenn er vorhätte, ein Zimmer mit dir zu teilen, hätte er dich dann nicht in seinem eigenen Zimmer untergebracht?“
Vor Erleichterung wurden Victoria die Knie weich. „Ja, daran hätte ich denken sollen.“
„Vielleicht ist dein Zimmer mit seinem verbunden.“ Emma zeigte auf eine Tür.
Victoria ging hin und drehte den Knauf. Die Tür führte in ein weiteres Schlafzimmer, das augenscheinlich bewohnt war. Rasch schloss sie die Tür wieder. „Ich dachte, sie führt ins Bad.“
Immerhin wusste sie jetzt, dass sie ganz sicher kein gemeinsames Zimmer hatten, Gott sei Dank. Doch das war nicht ihre einzige Sorge. Geschäftig hängte sie die schlichten Röcke und Hemdblusen in den Schrank, auf die sie als Alltagskleidung bestanden hatte. „Weißt du, was heute Nacht geschieht?“, fragte sie mit leiser Stimme. „Hinterher – wenn wir allein sind.“
Emma ließ ab von ihrem Tun und biss sich auf die Unterlippe. „Nicht so richtig. Hat Tante Margaret dir vor unserer Abreise nichts gesagt?“
„Nein, nur, dass ich meine Pflicht erfüllen muss. Das ist ja schön und gut, wenn ich nur wüsste, was meine ‘Pflicht’ ist. Ich komme mir so dumm vor! Ich hätte sie fragen sollen. Du warst doch verlobt; was hat Tante Helen dir dazu erklärt?“
„Ich glaube, sie wollte bis kurz vor der Hochzeit warten, denn sie hat mir überhaupt nichts gesagt. Was ich in der Schule gehört habe …“
„Ja, ich weiß. Vermutlich habe ich das Gleiche gehört, aber ich kann nicht glauben, dass es wahr ist. Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, dass Verheiratete in einem Bett schlafen dürfen.“ Und Kinder bekommen. Bei dem Gedanken konnte sie ein Schaudern kaum unterdrücken. Sie wollte keine Kinder vom Major; sie könnte ihn nicht einmal in ihrem Zimmer ertragen.
Wieder biss Emma sich auf die Lippe und dachte an Jon, ihren Verlobten. Nach ihrer Verlobung hatte er sie oft auf eine Weise, die vermutlich unanständig war, geküsst, aber es war so wunderbar gewesen, dass sie es voll auskostete statt ihn zurechtzuweisen, wie sie es hätte tun müssen. Er hatte sie fest an sich gedrückt und ihre Brüste berührt. Er hatte beim Küssen die Zunge eingesetzt, und zuerst hatte es sie schockiert. Und wenn er sie so fest an sich drückte, hatte sie seine Härte in seiner Hose gespürt und instinktiv gewusst, dass es an dem Liebesakt von Mann und Frau beteiligt sein musste, an diesem mysteriösen, furchterregenden Unbekannten, worüber in der Schule so eifrig geflüstert wurde.
Jon. Die langen Jahre seit seinem Tod hatten den grausamen Schmerz gelindert, aber nicht die Sehnsucht. Sie hatte ihn geliebt, aber mehr noch hatte er begonnen, ihre Sinne auf eine Art zu wecken, die sie ihr Alleinsein jetzt umso schärfer spüren ließ. Dennoch wusste sie, dass sie lieber allein bleiben würde als Major McLain zu heiraten.
Victoria war die einzige Verwandte, die Emma geblieben war, denn ihrer Tante und ihrem Onkel hatte sie nie nahe gestanden. Und Celia, zwar fröhlich und liebenswert, würde nie wie Victoria und sie die Erinnerungen an das gemeinsame Aufwachsen oder die Verantwortlichkeiten des Erwachsenseins teilen können. Sie ballte die Hand zur Faust und sah ihre Cousine an, die ihrer Verheiratung mit Major McLain zugestimmt hatte, um ihre Familie zu schützen. So zerbrechlich sie auch wirkte, verfügte Victoria doch über einen stählernen Willen und wilde Entschlusskraft. Emma wusste besser als jeder andere, dass Victoria es war, die sie alle in diesen zwei schrecklichen vergangenen Jahren irgendwie ernährt hatte, als niemand in den Südstaaten genug zu essen hatte. Victoria hatte gehandelt und sparsam gehaushaltet, hatte viele Stunden in mühseliger Arbeit einen kleinen Gemüsegarten bewirtschaftet. Jetzt benötigte ihre Cousine Informationen, und ganz gleich, wie peinlich das Gespräch auch war, Emma beschloss, sie aufzuklären.
Sie räusperte sich. „Jon … er hat meine Brüste angefasst.“
Victoria blieb sehr still. Ihre Augen waren groß, ihr Blick war beunruhigt. Sie versuchte, sich auszumalen, dass der Major sie dort berührte, und schrak vor der Vorstellung zurück.
„Und er wurde hart. Sein … sein Gemächt wurde hart.“ Emma senkte den Blick auf die gefalteten Hände und konnte Victoria nicht ansehen. „Ich glaube, ein Ehemann macht damit irgendetwas zwischen den Beinen seiner Frau, und daraus entsteht ein Kind.“
Victoria glaubte, nicht mehr atmen zu können. Lieber Gott, musste sie zulassen, dass der Major sein Gemächt an ihr rieb? Er würde ihr Nachthemd hochschieben müssen, und er müsste unbekleidet sein … Übelkeit brannte ihr sauer in der Kehle, und sie schluckte. Die grauenhafte Vorstellung seiner dicken, brutal starken Hände an ihren Brüsten, wie sie ihr Nachthemd hochschoben, ließ sie herumfahren und die Hände zu Fäusten ballen.
Emma senkte den Blick. „Natürlich hat Jon nie etwas getan, was mich entehrt hätte“, sagte sie leise. „Aber ich wollte, er hätte es getan. Ich mochte es, wenn er mich küsste und mich berührte. Ich wollte, er hätte das andere auch getan, dann hätte ich vielleicht ein Kind von ihm.“
Sie waren so streng erzogen worden, dass allein der Gedanke für Emma unerhört war, doch Victoria konnte keinen Schock empfinden. Emma und Jon hatten sich geliebt, und selbst, wenn sie so etwas außerehelich taten, erschien es ihr bedeutend weniger schändlich als die Vorstellung, dass sie im Ehestand das Gleiche mit dem Major tun sollte. Diese Erkenntnis ließ sie das Ausmaß von Emmas Einsamkeit nachempfinden, und sie strich ihrer Cousine sanft über die Schulter.
„Jetzt, da ich es weiß, habe ich keine Angst mehr. Danke.“ Sie bemühte sich um einen festen Tonfall.
Emma lächelte verhalten. „Ich weiß nicht allzu viel. Das meiste ist nur geraten. Wir hätten fragen sollen.“
„Das hätte uns nicht viel genützt. Kannst du dir vorstellen, dass Mutter auch nur das ausspricht, was du mir gesagt hast?“
Emma zögerte. „Wirst du mir berichten?“ Sie errötete. „Ich meine, wenn du es genau weißt.“
Ehrbare Frauen sprachen nie über solche Dinge, doch Victoria nickte. Sie kam sich nicht kühn vor, sondern nur verzweifelt. Sie und Emma mussten einander den Rücken stärken und gemeinsam Celia beschützen, die in jedem zuerst das Gute sah und daher weder Gefahr noch Vorsicht kannte.
Victoria sah sich im Zimmer um. Es war hübsch mit seinen schlichten Farben, größer und luftiger, als sie es gewohnt war, wie alle Zimmer in diesem Haus. An diesem Abend sollte sie zur Ehefrau werden und würde nicht länger Victoria Waverly sein, sondern Mrs Frank McLain. Eines Tages würde sie Mutter sein. Das war offenbar ihre Rolle im Leben, und es war ihre Pflicht, diese gewissenhaft auszufüllen.
Sie war dazu erzogen, zunächst eine perfekte Dame und dann eine perfekte Ehefrau zu sein, ein Schmuckstück am Arm eines Mannes und seine tüchtige Hausherrin. In ihrer Welt waren Frauen sanft und anmutig, charmant und nur mit Frauendingen beschäftigt. Eine Frau fügte sich stets ihrem Mann. Sie würde versuchen, die Dame zu sein, zu der sie erzogen war, immer anmutig und anständig. Etwas anderes konnte sie nicht; es gab keinen Ausweg, also sollte sie wohl das Beste daraus machen. Viele Frauen heirateten Männer, die sie nicht liebten, und führten trotzdem ein erfülltes Leben. Victoria war überzeugt, dass es ihr auch gelingen würde.
Doch wenn sie an die bevorstehende Nacht dachte, konnte sie nicht aufhören zu zittern.
Will Garnet bekam die kleine Blonde nicht aus seinem Kopf. Ihr strahlendes Gesicht war perfekt geschnitten, und er wollte darauf wetten, dass ihre Brüste hübsch und rund waren und nicht hingen wie Angelinas. Zum Teufel, Angelina machte für jeden hergelaufenen Landstreicher, der bezahlen konnte, die Beine breit. Sie war nichts Besonderes. Aber diese kleine Blonde … sie war sicherlich noch Jungfrau, man sah es ihr an. Garnet wollte ihr Erster sein. Er wollte das schöne Gesichtchen sehen, wenn sie es zum ersten Mal besorgt bekam; bestimmt gefiel es ihr, wenn sie sich ein bisschen daran gewöhnt hatte. Anders als ihre kalte Schwester, dieser Stockfisch. Der Boss kriegte nichts weiter als einen Schürhaken in sein Bett.
Garnet warf einen verstohlenen Blick auf Roper, der in der Schlafbaracke am Tisch saß. Mit dem Mann konnte er nicht viel anfangen, und er wusste, dass die Abneigung auf Gegenseitigkeit beruhte. Doch beide würden an der Hochzeit teilnehmen. Befehl vom Boss, um sicherzustellen, dass die Zeremonie nicht gestört wurde. Garnet knurrte etwas und sprach den Revolvermann an. „An der Frau vom Boss ist nicht viel dran, wie? Aber, verdammt, ihre kleine Schwester macht das wieder wett.“
Roper reinigte und ölte gerade seine beiden großen .44er und hob nicht einmal den Blick.
Der alte Zorn erhob sich in Garnet. Wenn Roper nicht so verflixt schnell mit diesen Waffen wäre, hätte er ihm schon vor langer Zeit einen Tritt versetzt. Doch kein Mensch trat Roper zu nahe, nicht einmal der Major. Wäre dem nicht so gewesen, hätte eine Kugel in den Rücken ihm schon den Garaus gemacht. Allerdings musste ein Heckenschütze schon verdammt sichergehen, dass er Roper tödlich traf, und die meisten Männer glaubten nicht, dass Roper leicht beizukommen wäre. Er hielt sich erst seit ein paar Monaten auf der Ranch auf, und sie alle wussten noch nicht viel über ihn, außer, dass er verdammt gut mit Pferden umgehen konnte, blitzschnell mit der Waffe war und kaltblütig und tödlich wie eine Klapperschlange. Das verrieten seine Augen, diese kalten, klaren, gefühllosen Augen.
Roper war immer auf der Hut. Selbst jetzt, als er seine .44er reinigte, entlud er nur eine Waffe. Und sie waren keineswegs seine einzigen Waffen; eine großes Bowiemesser mit 35 Zentimeter langer Klinge steckte über seiner linken Niere in der Scheide und ein weiteres Messer, schmal und zum Werfen geeignet, verbarg sich in seinem rechten Stiefel. Garnet wusste nur von diesen beiden; er vermutete jedoch, dass der Kerl mindestens noch ein weiteres Messer am Körper trug.
Aber was den Männern wirklich Respekt vor Roper einflößte, war die Art, wie er vor ein paar Monaten Charlie Guest umgebracht hatte. Guest hatte schon immer eher eine große Klappe als Verstand gehabt und war, wenn er einen guten Tag hatte, bestenfalls ein missgelaunter Schläger. Garnet war es verdammt egal, dass Roper ihn umgebracht hatte. Aber wie er es getan hatte! Guest hatte eine Abneigung gegen Roper gefasst und pöbelte ihn ständig an, und als der Revolvermann ihn genauso ignorierte wie jetzt Garnet, wurde er nur noch wütender. Und dann beging Guest den Fehler, nach seiner Waffe greifen zu wollen. Doch ihm blieb keine Zeit mehr dazu. Bevor er auch nur ziehen konnte, war Roper schon über ihm. Er bewegte sich so blitzschnell, dass Garnet bis heute nicht recht wusste, was geschehen war.
Roper stieß Guest auf den Boden der Schlafbaracke und drückte ihm ein Knie in den Rücken. Den linken Arm legte er um Guests Hals, mit der rechten Hand drückte er gegen den Kopf des Mannes. Alle hörten, als Guests Genick brach, wie das eines Hühnchens. Ohne einen Tropfen Schweiß vergossen zu haben, ließ Roper den Toten liegen und wandte sich wieder seiner vorherigen Tätigkeit zu, als wäre er nie gestört worden.
Die Totenstille in der Schlafbaracke war schließlich von einem Viehtreiber durchbrochen worden, der herausplatzte: „Warum hast du ihn nicht erschossen?“
Roper blickte nicht auf. „Eine Kugel wäre zu schade für ihn.“
Der Major stellte gern Männer wie Roper ein; er war der Meinung, es würde ihm ein gewisses Format verleihen. Garnet passte es nicht, dass der Major sich mehr und mehr auf den Revolvermann verließ, doch er konnte nichts dagegen unternehmen. Nach dem, was er Guest angetan hatte, würde ihn niemand auf der Ranch mehr herausfordern.
Angeheizt durch Ropers Schweigen fauchte Garnet: „Die kleine Blonde gehört mir.“
Roper warf ihm kurz einen Blick zu. „Schön.“
Seine Gleichgültigkeit ärgerte Garnet. Roper ließ nichts an sich heran. Der Mann war kein Mensch; er nahm nicht einmal Angelinas Dienste in Anspruch. Garnet hatte schon vermutet, in dieser Hinsicht könnte etwas mit Roper nicht stimmen, bis sie einmal nach Santa Fe geritten waren und Roper sich für die gesamten drei Tage ihres Aufenthalts mit einer Frau zurückgezogen hatte. Beim Aufbruch sah das idiotische Weib ihm mit verträumtem Blick hinterher.
Leise sagte Garnet: „Eines Tages, Revolvermann, läufst du mir vor die Flinte.“
Roper hob langsam den Kopf und lächelte Garnet an, ohne dass sich sein Augenausdruck auch nur im Geringsten veränderte. „Jederzeit.“
2. KAPITEL
Victorias Kleid war weiß, langärmlig und hochgeschlossen. Der Rock war nach der Mode der Yankee-Ladies in Augusta schmal geschnitten. Celia bewunderte es ausgiebig, wenn sie nicht gerade in ihrem eigenen neuen blauen Kleid herumtanzte.
Emma bürstete Victorias hüftlanges Haar aus, schlang es geschickt zu einer Hochfrisur und steckte sie auf dem Kopf fest. An den Schläfen zupfte sie ein paar Strähnchen heraus, um Victorias Gesicht nicht so streng erscheinen zu lassen. Emmas ruhige Miene war hilfreich. Victorias Hand zitterte nicht, als sie ein Zweiglein aus Zuchtperlen in ihrem Haar befestigte. „Wie sieht das aus?“, fragte sie.
„Wunderschön!“ Celia war voller Bewunderung. Sie vergötterte Victoria und freute sich, weil sie in dem neuen Kleid so hübsch aussah. Celia begriff nicht annähernd, was diese Hochzeit für ihre Schwester bedeutete. Victoria bemühte sich vorzutäuschen, dass das Ereignis tatsächlich ein so erfreuliches wäre, wie ihre Schwester annahm.
„Es sieht wirklich wunderschön aus“, sagte Emma ruhiger. Ihr Kleid war ebenfalls blau, ein Farbton, der ausgesprochen gut zu ihrem hellen Teint passte. Ihr schweres dunkles Haar war zu einem glatten Knoten am Hinterkopf geschlungen. Ihr Blick begegnete im Spiegel dem ihrer Cousine, und Victoria brachte ein kleines, ermutigendes Lächeln zustande.
In diesem Moment klopfte Carmita, schaute ins Zimmer und lächelte breit, als sie die drei jungen Frauen sah. „Der Major ist bereit, Señorita. Sie sehen sehr hübsch aus!“
Victoria erhob sich. „Danke.“ Auch für Carmita rang sie sich ein Lächeln ab. Bevor sie das Zimmer verließen, sah sie sich noch einmal um. Das nächste Mal, wenn sie über diese Schwelle trat, war sie keine Waverly mehr. Ein weißes Nachthemd aus Seide und Spitze lag auf dem Bett bereit, und sie wandte rasch den Blick ab.
Die Männer hatten sich in einem Raum versammelt, den Victoria als Salon einstufte. Sie sah McLain, den Geistlichen, Father Sebastian, und die beiden Männer, die sie am Nachmittag kennengelernt hatte, Garnet und Roper. Rasch trat Victoria an die Seite des Majors und nickte den beiden Männern höflich zu, ohne sie mit einem Blick zu streifen. Roper stand ihr ein wenig im Weg, doch er rührte sich nicht von der Stelle, und sie musste um ihn herum gehen, damit ihre Röcke nicht seine Beine berührten. Sie spürte nahezu die Verachtung in seinem Blick, während er sie beobachtete.
Der Major strahlte, ergriff ihre Hand und legte sie in seine Armbeuge. „Du siehst wunderschön aus“, erklärte er begeistert. „Weiß Gott, ich bekomme was für mein Geld.“ Es kostete sie Mühe, nicht das Gesicht zu verziehen.
Zu dem Geistlichen sagte McLain: „Fangen wir an.“
Die Trauungszeremonie war kurz, zu kurz für Victorias Seelenfrieden. Innerhalb weniger Minuten waren sie Mann und Frau. McLain drehte sie zu sich um und presste seine feuchten Lippen auf ihre. Victoria hielt den Mund fest geschlossen und schaltete ihr Denken aus, während sie mühsam ein Schaudern unterdrückte. So schnell wie möglich wich sie zurück, wandte sich ab und begegnete dabei Ropers Blick. Erst jetzt fiel ihr auf, dass er seinen Hut nicht trug, und sie konnte sein Gesicht deutlich erkennen. Seine Augen waren klar und kalt, seine Miene so verachtungsvoll, dass sie beinahe zurückschreckte. Warum hasste er sie?
Der Gedanke ließ sie so herrisch das Kinn recken, wie es einer Creighton oder Waverly zustand. Dieser Mann war ein gewöhnlicher Schläger, ein gedungener Revolvermann. Sie zahlte seinen Blick in gleicher Münze zurück.
Ropers Mund verzog sich zu einem freudlosen Lächeln. Er nickte ihr wie zur Anerkennung ihres Mutes knapp zu. Doch erst, als er sich umdrehte, fühlte sie sich von ihm erlöst.
Der Major strich ihr über den Arm und berührte wie zufällig mit den Fingern ihre Hüfte. Victoria fuhr zusammen, zwang sich jedoch, ihren frischgebackenen Mann anzulächeln. Dass sie so auf ihn reagierte, lag nur daran, dass sie so nervös war, redete sie sich ein, und weil sie ihn im Grunde gar nicht kannte. Sobald sie Gelegenheit hatte, sich zu entspannen, würde alles gut.
„Wie findest du dein Zimmer, Mädel? Ganz hübsch, oder?“ Der Tonfall des Majors wirkte irgendwie lüstern, und er schien begierig auf ihre Zustimmung zu warten.
„Es ist sehr hübsch“, erwiderte sie, froh, dass sie ehrlich sein konnte. „Ich werde mich dort sicher sehr wohlfühlen. Besonders die Chaiselongue ist eine nette Idee.“
Wieder fasste er an ihre Hüfte. Doch dieses Mal blickte sie ihn an und sah das Glimmen in seinen Augen. Da wusste sie, dass es nicht versehentlich geschah. Eine solch öffentlich zur Schau gestellte Vertraulichkeit schockierte sie, und der Ausdruck in seinen Augen machte ihr ein wenig Angst.
„Hinterher“, sagte er mit einem Augenzwinkern, „wird dein Schlafzimmer dir noch besser gefallen.“
Sie war unfähig, etwas darauf zu erwidern. Der Gedanke an die bevorstehende Nacht reichte beinahe aus, um sie erstarren zu lassen, wenn sie ihm zu lange nachhing. Deshalb verdrängte sie ihn aus ihrem Kopf und ließ den Abend über sich ergehen.
Es war eine merkwürdig stille Versammlung, in der nur der Major redete und alle anderen ihm einsilbig antworteten. Emma, Gott segne sie, blieb stets an Celias Seite. Victoria bemühte sich, zu den angemessenen Gelegenheiten zu lächeln und beim Dinner, das Lola servierte, höflich zur Unterhaltung beizutragen, doch sie war zu verkrampft, um mehr zu tun, als die liebenswürdige Gastgeberin zu spielen.
McLain fasste sie immer wieder an. Victoria bemerkte, dass Garnet Celia nicht aus den Augen ließ. Und Roper, dessen Blick sie frösteln ließ, behielt sie selbst im Auge, doch jetzt war seine Miene undurchdringlich.
Verzweifelt wünschte sie, der Heirat mit McLain niemals zugestimmt zu haben. Ihr Hochzeitsmahl war ihrer Meinung nach das trostloseste, an dem sie je teilgenommen hatte, und sie musste fast belustigt lächeln, weil sie selbst die trostloseste Teilnehmerin war. Doch rasch wurde sie wieder ernst, als McLain mit dem selbstgefälligen Besitzerstolz, von dem ihr übel wurde, ihren Arm streichelte. Ihr war, als würde er sie vor den anderen beiden Männern zur Schau stellen.
Einen Moment lang überwältigte sie die Verzweiflung mit solcher Macht, dass sie den Blick abwenden musste, und wieder sah sie unversehens Roper an. Seine kalten Augen waren auf sie gerichtet, dann schweifte sein Blick zu McLain. Als er Victoria wieder anschaute, erkannte sie zu ihrer Beschämung ein leises Verstehen. Dass er womöglich wusste, dass sie die Nacht fürchtete und was McLain ihr antun würde, war unerträglich.
Sie wurde blass, dann rot, dann wieder blass. Sie wollte vom Tisch aufspringen und davonlaufen und schlang fest die Hände ineinander. Nie zuvor wäre ihr in den Sinn gekommen, dass ein Mann sich sie mit hochgeschobenem Nachthemd vorstellen könnte, doch sie war überzeugt, dass Ropers Gedanken in diese Richtung gingen. Jedes Fünkchen Anstand in ihr empörte sich dagegen.
Das Einzige, was ihr übrig blieb, war natürlich, so zu tun, als bemerkte sie ihn gar nicht. Es war ähnlich, als würde sie die Augen schließen und sich so für unsichtbar halten, aber es war besser als nichts.
Roper sah, wie ihr Gesicht die Farbe wechselte, und er verstand den Grund. Er verspürte sogar ein wenig Mitleid. Also war sie doch keine kalte, leidenschaftslose Puppe. Sie hatte Angst – und zwar zu Recht, auch wenn sie es nicht wissen konnte. McLain stand in dem Ruf, grob und ungestüm mit Frauen umzugehen. Und er war auch nicht wählerisch, doch dieses Mal hatte er sich offenbar eine Dame an Land gezogen. Pech für die Lady.
Und noch etwas wurde ihm bewusst: Es passte ihm nicht, dass McLain sie nehmen würde. Auch wenn diese Erkenntnis ihm ganz und gar nicht gefiel, konnte er nichts daran ändern. McLain würde ihre lichte Zartheit nicht zu schätzen wissen, und er würde sich auch nicht die Zeit nehmen, ihr Lust zu bereiten. Sie war zu fein für den Mistkerl. Sie hatte Mumm. Verdammt wenige Männer hatten ihn jemals so angesehen, ihn mit Blicken herausgefordert. Gewöhnlich wollte man ihm aus irgendeinem Grund nicht ins Gesicht sehen; man streifte ihn flüchtig mit einem Blick und wandte sich rasch wieder ab. Doch diese blasse, schlanke Frau hatte unbeirrt ausgeharrt und seinen Blick erwidert. Sie hatte sich aufgeführt, als wäre sie eine Königin und er der niedrigste ihrer Untertanen. Der Gedanke weckte einen Zorn in ihm, der ihn überraschte. Roper gestattete sich selten Gefühle, und für McLains Frau wollte er schon gar nichts empfinden.
Doch die Gefühle waren da. Zorn. Achtung. Verlangen. Herrgott, ja, Verlangen. Er durfte so etwas nicht empfinden, konnte sich solche Gefühle nicht leisten. Früher oder später musste er etwas gegen die Frau unternehmen, und er durfte nicht zulassen, dass alle diese unerwünschten Gedanken und Gefühle seinen Verstand benebelten. Er durfte nicht weich werden, nicht jetzt.
Absichtlich lenkte er seinen Blick zu der kleinen Schwester. Sie war unbestreitbar schön, und der Ausdruck in ihren dunkelblauen Augen war lieb und fröhlich, doch sie hatte etwas schwer Fassbares an sich, das er nicht verstand. Vielleicht war sie etwas einfältig. Nicht dumm, einfach nur schlicht. Sie war nur ein schönes Kind.
Doch die Suche nach Ablenkung half ihm nicht weiter. Er wandte sich wieder McLains Frau zu, und die Hassbilder drängten sich erneut in sein Bewusstsein, wenngleich er sorgsam darauf achtete, ein ausdrucksloses Gesicht zu wahren. McLain, wie er seinen Vater ermordete. McLain, der seine Mutter vergewaltigte und ihr dann eine Kugel in den Kopf schoss. McLain, der das Land stahl, das seit über hundert Jahren im Besitz der Familie seiner, Ropers, Mutter gewesen war. McLain, der den jungen Mörder Garnet aussandte, damit er zwei Jungen suchte und tötete, was ihm beinahe gelungen wäre. McLain, der in dem kühlen, eleganten Haus lebte, in dem Roper geboren war, damals, als das ganze Tal noch Sarratt’s Kingdom genannt wurde.
Jacob Roper Sarratt war zurückgekommen. Er war gekommen, um McLain zu töten und das Tal wieder in Besitz zu nehmen. Bis zum heutigen Tag hatte er mehr nicht gewollt.
Jetzt wollte er auch McLains Frau.
Victoria saß, gegen die Kissen gelehnt, aufrecht im Bett. Sie trug ihr langärmliges, hochgeschlossenes weißes Nachthemd. Ihr war kalt, bis in die Knochen, aber sie konnte nicht zittern. Ihr Körper fühlte sich zu schwer an, nicht einmal fähig zu dieser kleinen Bewegung. Sie hatte das Gefühl, an ihrem langsamen, schwerfälligen Herzschlag ersticken zu müssen.
Emma hatte gewollt, dass sie das Haar offen trug, doch Victoria bestand darauf, es wie gewohnt zu flechten, mit der Begründung, dass es sonst schrecklich verfilzen würde. In Wahrheit wollte Victoria für den Major nicht zu attraktiv aussehen. Es war ein geringfügiger Schutz, doch sie meinte, er würde ihr moralisch, wenn schon nicht tatsächlich den Rücken stärken.
Die Bettvorhänge waren zurückgezogen und an den vier Pfosten festgebunden. Das Zimmer wurde von drei Kerzen in eleganten Kandelabern auf der Kommode erhellt, und Victoria fragte sich, warum Kerzen anstelle einer Öllampe, die doch mehr Licht spendete, zur Beleuchtung dienten. Im Erdgeschoss gab es Lampen. Morgen würde sie Carmita danach fragen.
Doch in dieser Nacht war es vielleicht besser, dass das Zimmer nicht hell erleuchtet war. Vielleicht sollte sie auch die Kerzen löschen. Sie zog es in Erwägung und war im Begriff, die Bettdecke zurückzuschlagen, als die Verbindungstür sich öffnete und der Major eintrat.
Victoria erstarrte. Er trug einen dunklen Morgenmantel, doch unter dem Saum waren seine Beine nackt und haarig. Im Kontrast zu seinen dünnen Waden wirkten sein Stiernacken und die massiven Schultern noch eigenartiger.
Was sie jedoch am meisten erschreckte, war sein Gesicht. Es zeigte einen so unverhohlenen Ausdruck selbstgefälliger Vorfreude, dass Victoria am liebsten gestorben wäre. Lieber Gott, was würde er ihr antun?
Er trat ans Bett, zog seinen Morgenmantel aus und stand da in einem weißen, knielangen Nachthemd.
„Nun, Mädel, bist du bereit?“ Wieder schwang diese Lüsternheit in seinem Tonfall mit.
Sie brachte einen zustimmenden Ton heraus, doch es war gelogen. Sie würde nie bereit sein.
„Dann leg dich hin. Hattest du erwartet, dass wir es im Sitzen tun?“ Er lachte.
Sie konnte sich kaum rühren, doch es gelang ihr, sich flach auf die Matratze zu legen. Er legte sich neben sie ins Bett und stützte sich auf einen Ellenbogen auf. Victoria verspannte sich noch mehr. Ihr fiel auf, dass er braune Augen hatte. Sein breiter Kiefer war dunkel von Bartschatten, und sie nahm ein süßes, schwüles Parfüm an ihm wahr. Sie lag dicht neben ihm, und diese Mischung aus Parfüm und Schweißgeruch war so überwältigend, dass Victoria nur mit Mühe ein Würgen unterdrücken konnte. Verzweifelt sagte sie sich, dass er anscheinend recht sauber war. Er war eben ein ziemlich schwergewichtiger Mann und schwitzte deshalb natürlich.
Jetzt beugte er sich über sie und presste seinen Mund auf ihren. Sie spürte den kalten Schweiß auf seiner Oberlippe. Angewidert versuchte sie, den Kopf tiefer ins Kissen zu drücken, um ihm zu entkommen.