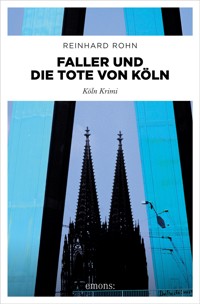9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lena Larcher ermittelt
- Sprache: Deutsch
Kommissarin Lena Larcher sieht mit Grauen dem Tag entgegen, an dem sich der Autounfall, bei dem sie Mann und Sohn verlor, zum ersten Mal jährt. Um den Erinnerungen zu entfliehen und um ihre Ängste zu bekämpfen, beschließt sie, an diesem Tag etwas Besonderes zu unternehmen. Sie meldet sich für einen Kletterkurs an. Der Trainer weist ihr eine blonde, schweigsame Frau als Partnerin am Seil zu, die sich als Tessa vorstellt. Noch am selben Abend steht eine verzweifelte Tessa vor Lenas Wohnungstür und bittet sie um Hilfe: Sie erklärt ihr, sie heiße eigentlich Dorit – und habe gerade entdeckt, dass ihr Mann ein Auftragsmörder ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Kommissarin Lena Larcher sieht mit Grauen dem Tag entgegen, an dem sich der Autounfall, bei dem sie Mann und Sohn verlor, zum ersten Mal jährt. Um den Erinnerungen zu entfliehen und um ihre Ängste zu bekämpfen, beschließt sie, an diesem Tag etwas Besonderes zu unternehmen. Sie meldet sich für einen Kletterkurs an. Der Trainer weist ihr eine blonde, schweigsame Frau als Partnerin am Seil zu, die sich als Tessa vorstellt. Noch am selben Abend steht eine verzweifelte Tessa vor Lenas Wohnungstür und bittet sie um Hilfe: Sie erklärt ihr, sie heiße eigentlich Dorit – und habe gerade entdeckt, dass ihr Mann ein Auftragsmörder ist …
Über Reinhard Rohn
Reinhard Rohn wurde 1959 in Osnabrück geboren und ist Schriftsteller, Übersetzer, Lektor und Verlagsleiter. Seit 1999 ist er auch schriftstellerisch tätig und veröffentlichte seinen Debütroman »Rote Frauen«, der ebenfalls bei Aufbau Digital erhältlich ist.
Die Liebe zu seiner Heimatstadt Köln inspirierte ihn zur seiner spannenden Kriminalroman-Reihe über »Matthias Brasch«. Reinhard Rohn lebt in Berlin und Köln und geht in seiner Freizeit gerne mit seinen beiden Hunden am Rhein spazieren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Reinhard Rohn
Engelstod
Kriminalroman
Rule 4: Compare yourself to who you were yesterday not to who someone else is today
Jordan B. Peterson, 12 Rules for Life
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Epilog 1
Epilog 2
Impressum
Kapitel 1
Wann kennen wir einen Menschen wirklich? Er redete im Schlaf, er wälzte sich hin und her. Gestern Nacht hatte er Geräusche von sich gegeben, als würde er weinen, ein Japsen und Wimmern, wie man es gelegentlich bei jungen Hunden hört. Ich lag mit pochendem Herzen neben ihm, wusste nicht, ob ich ihn wecken sollte oder nicht.
Warum weint ein erwachsener Mann im Schlaf? Er hatte auch extrem abgenommen, gut, er hatte ein paar Kilo zu viel gehabt, aber nun? Seine Rippen traten beinahe scharfkantig hervor. Gab es Bulimie bei Männern? Fast müsste ich den Verdacht haben, er leide an dieser Krankheit, aber er sprach nicht, sah mich nur an und meinte, es sei alles in Ordnung.
Vor zwei Tagen hatten wir uns gestritten. Es ging wieder um das Kind, das er nicht wollte. Du bist neununddreißig, hatte ich gesagt, ich bin achtunddreißig. Wir sind seit drei Jahren verheiratet. Nun ist unsere Zeit. Ich klang sehr vernünftig, viel vernünftiger, als ich mich selber fühlte. So lange war es noch gar nicht her, dass ich selbst ganz anders gedacht hatte.
Er lachte, und dann ging er in die Garage an sein Schweißgerät, das ist seine Zufluchtsstätte. Stundenlang stand er da und machte aus dem Metall, das er sich viermal im Jahr vom Schrottplatz holte, Figuren, die alle wie Engel aussahen – wie gebogene, gepeinigte Engel mit viel zu kleinen Flügeln. Er wollte kein Kind, er wollte Engel aus Eisen bauen, einen nach dem anderen.
Nur weil du im Kinderheim warst, dachte ich oft, weil dein unbekannter Vater dich im Stich gelassen hat, weil deine Mutter sich … weil deine Mutter gestorben ist, heißt das doch nicht, dass unser Kind unglücklich sein muss.
Er antwortete nie darauf. Wie viel Unglück trug er immer noch mit sich herum?
Dabei hatte er es doch geschafft – er war dem Elend seiner Kindheit und Jugend entflohen.
Verfassungsschutz – für manche klang das geheimnisvoll. Schlapphüte, Agenten, James Bond – ich wusste es besser, obschon er nicht viel über seine Arbeit sprach. Er fuhr um sieben Uhr morgens meistens mit dem Fahrrad hin und kehrte gegen Viertel nach fünf zurück. Er führte ein paar Informanten in der rechten Szene. Deshalb war er gelegentlich über Nacht weg. Er reiste irgendwohin, in den Osten, Halle, Halberstadt. Diese Namen hatte er zumindest mal erwähnt. Ach, ich wusste es nicht genau.
Vielleicht hätte ich nicht in die Garage, in seine Werkstatt gehen sollen, aber es war doch nur, dass ich wissen wollte, warum er im Schlaf weinte.
Ich wollte ihm nicht nachspionieren. Ich dachte nicht an eine Affäre, an Heimlichkeiten, wie sie irgendwann in jeder Ehe vorkommen. Wir hatten das letzte Mal vor fünf Monaten miteinander geschlafen, kurz und routiniert, aber das war schon häufiger passiert. Ein feuriger Liebhaber war Martin nicht einmal in unserer Hochzeitsnacht gewesen, und außerdem gab es da Chris, meinen Producer … Wenn meine Lust zu groß wurde, konnte ich zu ihm gehen, heimlich natürlich. Er ließ sich auf jedes noch so kleine Abenteuer ein. Mit ihm schlief ich regelmäßig und verließ mich darauf, dass er ein Kondom benutzte.
Die Werkstatt war schmutzig, Bierflaschen standen herum. Ich wunderte mich. Sonst trank Martin nur Rotwein, selbst im Sommer, wenn mir der deutsche Riesling besser schmeckte.
Ich hatte mich um seine Werkstatt nie gekümmert. Das war sein Reich, buchstäblich. So nannte er es auch: »Mein Reich.« Es wirkte auch ganz so, als könnte er hier ein anderer sein. Neben den leeren Bierflaschen entdeckte ich Zigaretten – Gauloises, die blaue Schachtel. Ich kannte sie noch aus meiner Kindheit.
Zwei Engel standen da auf zwei massiven grauen Metallplatten, sie beugten sich mit groben Flügeln vor, als wären sie schon alt. Sie hatten noch keine Köpfe, und doch schienen sie mich anzustarren und die Werkstatt zu bewachen.
Die Schweißgeräte hatte Martin ordentlich an einer Wand aufgereiht. Drei besaß er mittlerweile, zählte ich.
In den Schubladen entdeckte ich jede Menge Werkzeug. Schraubenzieher, Zangen, Schraubenschlüssel, andere Dinge, deren Funktion ich nicht einmal erahnen konnte.
Die Waffe lag ganz unscheinbar zwischen dem Werkzeug, ein kleines schwarzes Ding, das mich gefährlich anschaute. Ich nahm sie mit spitzen Fingern heraus. Ich hatte ein paar Mal mit Filmwaffen hantiert, aber noch nie eine echte Pistole in der Hand gehalten. .45-Auto, stand darauf, auf dem Griff das Zeichen HK. Das Magazin fehlte, erkannte ich, und so wie die Pistole an meinem Finger baumelte, sah sie schon weniger gefährlich aus, aber warum brauchte Martin eine Waffe? Und er hatte sie nicht einmal versteckt, sondern schien sie zu behandeln, als wäre sie ein ganz normales Werkzeug.
Ich legte die Waffe zurück, schob die Schublade zu. Was würde Martin tun, wenn ich die Pistole an mich nehmen würde? Würde er sie vermissen?
Ich stellte mir vor, wie er in den Wald ging, wie er Schießübungen machte. Taten Männer so etwas?
Das Radio auf dem Metallregal, auf dem er kleine Metallstücke aufbewahrte, war schmutzig und voller Öl. Als ich es anschaltete, erklang Kirchenmusik – ein Choral. Ich stellte es sofort wieder ab.
Jetzt war der Moment, die Garage wieder zu verlassen. Er würde nicht bemerken, dass ich da gewesen war. Ich war Fotografin und Köchin, ich interessierte mich nicht für Schweißarbeiten.
Doch etwas hielt mich zurück.
Ich hatte keine Erklärung gefunden, warum er im Schlaf geweint hatte.
Der Metallschrank – ich hatte noch nicht in den Metallschrank geblickt, auf dem unbearbeitete Eisenplatten vom Schrottplatz lagen.
Ein Vorhängeschloss sicherte den Schrank, registrierte ich, doch es war nicht richtig eingerastet. Ich konnte es öffnen. Der Schrank war schmutzig, ein dicker Ölfilm bedeckte die beiden Regalbretter. Handschuhe lagen da, gewiss mehr als zwanzig Handschuhe, dann Dosen – Farbdosen, Rostlöser, Ölkännchen. An manchen Dosen war das Etikett so verschmiert, dass man nicht mehr erkennen konnte, was sich in ihnen befand.
Nichts Ungewöhnliches.
Fast war ich erleichtert.
Die Segeltuchtasche klebte förmlich an der Rückwand. Sie war schwarz und ein wenig zerschlissen, keine neue Tasche, sondern gewiss etliche Jahre alt. Ich hatte sie noch nie gesehen.
Ich zögerte, sie zu ergreifen, schob dann aber doch ein paar Dosen zur Seite und holte sie hervor.
Der Reißverschluss ließ sich schwer öffnen. Anscheinend war er länger nicht benutzt worden. Doch gelang es mir mit einiger Mühe, ihn aufzuziehen.
Die Tasche enthielt eine andere, neuwertige Tasche. Zuerst glaubte ich, ein Futteral für einen Laptop in den Händen zu halten. Wieso versteckte Martin einen Laptop hier? Doch dann sah ich, dass es eine Tasche für zwei Pistolen war. Eine Pistole steckte mit Magazin in einer Vertiefung, während die zweite Abteilung leer war. Die Waffe fehlte. Wieder befand sich das Zeichen HK auf der Pistole.
Ich spürte, wie meine Hände zu zittern begannen. Martin hatte nicht einfach eine Waffe zwischen seinen Werkzeugen aufbewahrt, er hatte ein richtiges kleines Arsenal. Hastig schloss ich die Pistolentasche wieder.
Dass die Segeltuchtasche noch etwas anderes enthielt, bemerkte ich erst, als ich den Reißverschluss schon wieder schließen wollte.
Eine schmale Mappe steckte in einem Seitenfach. Sie war blau und unbeschriftet. Die acht Fotos, die zum Vorschein kamen, waren alle gleich groß – DIN A5. Sie waren schwarzweiß und zeigten drei unterschiedlich alte Männer, die eines gemeinsam hatten. Sie waren alle tot.
Kapitel 2
Was tut man an dem Tag, an dem man alles verloren hat? Vor genau einem Jahr waren ihr Mann und ihr Kind ums Leben gekommen, weil sie nicht aufgepasst hatte.
Die Unfallverursacherin hat einem Schwerlastwagen bei vereister Straße fahrlässig die Vorfahrt genommen, hatte es in dem Polizeibericht geheißen. Noch immer hörte sie im Traum das Geräusch, wie Stahl auf Stahl geprallt war. Der Lastwagen hatte sie von rechts gerammt. Robert auf dem Beifahrersitz und Simon hinten im Fond hatten keine Überlebenschance gehabt – ihr hingegen war fast nichts passiert: Prellungen, Kratzer im Gesicht von den Glasscherben.
Genau zwölf Monate war das jetzt her – der furchtbare 4. Februar.
Eigentlich hatte sie nicht in Köln sein wollen – an Flucht hatte sie gedacht. Ans Ende der Welt: Australien, Sri Lanka, aber dann war ihr Vater krank geworden. Der stolze Georg Larcher, der legendäre Polizist, drohte zu erblinden. Selbst er hatte sie gebeten, den Tag mit ihm zu verbringen. Genau wie David, der Mann, der sich Hoffnungen machte, dass sie vielleicht zusammenkamen – wie damals in der Schulzeit, als er der schönste Junge auf dem Gymnasium gewesen war.
Lena wollte all das nicht.
Tu etwas, das du noch nie gemacht hast, hatte Silvana, die Psychologin, ihr geraten. Beweise dir selbst, dass du am Leben sein willst.
Erst war Max nur der drahtige glatzköpfige Mann gewesen, den sie manchmal auf der Neußer Straße beim Bäcker getroffen hatte. Schon nach der zweiten Begegnung hatte er ihr zugenickt, und beim vierten zufälligen Treffen hatte er übertrieben galant gesagt: »Na, schöne Frau, auch wieder da!«
Er hatte sie zu einem Kaffee eingeladen. Er war Künstler, baute Plastiken aus Beton, aber weil er davon nicht leben könne – natürlich nicht –, sei er Lehrer in einer Kletterhalle. Sie solle doch einmal vorbeikommen.
Das war der Plan für den schrecklichsten Jahrestag in ihrem Leben.
Sie fuhr mit ihrem Rennrad die Innere Kanalstraße entlang, dann die Aachener Straße hinauf. »Die Kletterfabrik« stand an der Halle.
Zögernd trat sie ein. Lärm schlug ihr entgegen, nein, Musik aus Lautsprechern, dumpfe Beats, dann aufgeregte Kinderstimmen. Eine ganze Schulklasse hatte sich in der Halle verteilt, erkannte sie. Ein vielstimmiger Chor – Mädchen, die an Seilen an der Wand hingen, andere, die Kommandos hinaufriefen. Bunte Griffe an den Wänden wiesen den Weg zu einer gezackten Decke. Wäre durch ein breites Dachfenster nicht ein wenig Licht hereingefallen, hätte man sich wie in einer riesigen Höhle vorkommen können.
Die Musik dröhnte aus einem Bistro herüber, erkannte sie. Plötzlich war ihr mulmig zumute. War es das Richtige für sie? Hatte sie nicht in den Bergen oft Höhenangst gehabt und dann noch später, als sie während der Schwangerschaft mit Robert den Dom bestiegen hatte?
Als sie sich umdrehen wollte, um heimlich wieder zu gehen, stand Max vor ihr. Er trug ein schwarzes T-Shirt, das seinen muskulösen Körper zur Geltung brachte, und eine weite, ebenfalls schwarze Trainingshose.
»Lena! Schön, dass du da bist!« Er breitete die Arme aus, umfasste sie und küsste sie leicht auf die Wange. »Ich bringe dich zu deiner Wand«, sagte er dann, »aber vorher musst du dich umziehen. Schuhe kriegst du von mir.«
Bereitwillig ließ sie sich in eine Kabine führen, die offenbar Max und ein paar aus seinem Team vorbehalten war. Die Schuhe sahen aus, als wären sie für den Ballettunterricht entworfen worden. Nein, erkannte Lena dann, sie waren aus viel härterem Material, wie für Berge gemacht.
Max beobachtete wortlos, wie sie sich umzog, dann nahm er ihren Arm. »Zuerst gehst du eine einfache Route, um ein wenig Gefühl für die Wand zu entwickeln. Ich bringe dich zu Tessa. Sie wird dich sichern, während ich mich um diese schreckliche Mädchenklasse kümmern muss.«
Tessa war eine schlanke Frau mit langen braunen Haaren, die ihr kurz zunickte, während Max ihr das Seil in die Hand drückte und Anweisungen erteilte. Lena spürte sofort, dass es ihr keinen Spaß machen würde, eine Wand hinaufzuklettern. Sie fühlte sich unsicher und ungeschickt, ihr Herz begann zu pumpen. Sie war kaum zwei Meter geklettert, da rutschte sie schon ab, und als sie sich einmal umblickte, stand Tessa mit reglosem Gesicht da und starrte sie an. Dennoch versuchte sie es.
Beweise dir, dass du weiterleben willst, hatte Silvana gesagt, aber tat sie das nicht die ganze Zeit?
Sie kletterte weiter. Ein anderes Gefühl stellte sich ein. Ihre Arme begannen zu brennen, sie beanspruchte offenbar Muskeln, die sie sonst nicht trainierte, jedenfalls nicht beim Laufen und Radfahren. Vier, fünf Meter hatte sie nun in der Wand zurückgelegt. Max rief ihr etwas zu, das sie nicht verstand, weil sie ihren Herzschlag bis in die Ohren spürte. Es ging doch etwas. Sie konnte sich an einer Wand hinaufbewegen.
Ich beweise mir wirklich etwas, sagte sie sich.
Zwei-, dreimal musste Tessa sie sichern, aber sie schaffte es bis fast bis zur Decke.
»Bravo!«, rief Max von unten und reckte den Daumen in die Luft.
Simon, dachte sie für einen unvorsichtigen Augenblick, was hätte es ihm für einen Spaß gemacht, auch eine Wand hinaufzuklettern. Tränen schossen ihr in die Augen – aus dem Nirgendwo, aus der großen Trauer, die immer in ihr war. Und zwei große, übermächtige Worte: Verzeiht mir!
Dann, als hätten diese Gedankenworte sie mit einem Schlag gelähmt, fiel sie förmlich aus der Wand, und Tessa schrie vor Entsetzen auf.
Sie gönnte sich ein Abendessen im Fioretto. Fisch und Rotwein. Giovanni, der Kellner, behandelte sie ganz sanft und vorsichtig, als wüsste er um die Schwere des Tages. Einmal glaubte sie, David Bauer am Restaurant vorbeilaufen zu sehen, aber wenn er es war, hatte er sich nicht hereingetraut.
Sie war vom Klettern erschöpft. Tessa war für einen Moment wütend gewesen, weil Lena ohne jene Warnung aus der Wand gefallen war, und Max hatte sie besorgt gefragt, ob sie einen Krampf bekommen habe. Sie hatte kaum ein Wort als Erklärung herausgebracht. Ja, es habe ihr gefallen, sie werde wiederkommen, hatte sie Max zugemurmelt, dann war sie förmlich aus der Halle geflohen und zum Melatenfriedhof gefahren, der gleich um die Ecke lag. Fünf Minuten später stand sie an Roberts und Simons Grab. Stumm hatte sie ein Lied gesungen. ›Enjoy the silence‹ von Depeche Mode – Roberts Lieblingslied. Tränen hatte sie keine mehr gehabt, hatte sie überrascht festgestellt.
Enjoy the silence.
Die Wohnung war ganz still, als sie aus dem Restaurant zurückkehrte. Nur eine Kerze hatte sie angezündet, die geduldig vor sich hin brannte. Es war einundzwanzig Uhr dreizehn – dieser furchtbare Tag war fast zu Ende.
Als sie kurz einnickte, ging es ihr so wie Hunderte Male zuvor. Sie meinte, Stimmen zu hören – Simon, der ihr aus seinem Zimmer etwas zurückrief, und Robert, der aus seiner Kanzlei kam, die Wohnungstür öffnete und sie mit seinem typischen »Ich bin da!« begrüßte.
Aber all das war nur noch in ihrem Kopf.
Als es jedoch tatsächlich an ihrer Tür klingelte, schrak sie auf. Vater!, war ihr erster Gedanke. Der halb blinde Georg Larcher konnte sie an diesem Tag doch nicht zufriedenlassen. Nein, vermutlich hatte sich David nach langem Zögern doch ein Herz gefasst. Er hatte vor drei Monaten seine Frau verlassen und hatte wiederholt versucht, sie einzuladen.
Mühsam stand sie vom Sofa auf, weil es gleich noch einmal geklingelt hatte. Die Ungeduld sprach eindeutig gegen David, sondern für ihren Vater.
Auch wenn sie wenig Neigung hatte, um diese Zeit noch jemanden zu empfangen, konnte sie ihn nicht vor der Tür stehen lassen. Sie schaltete das Licht im Wohnzimmer ein und ging dann in den Flur.
Nun klingelte es ein drittes Mal. Als sie auf den Summer drückte und gleichzeitig die Wohnungstür öffnete, stand jemand direkt vor ihr. Eine Frau in einem weißen Mantel mit Kapuze. Sie brauchte einen Moment, um Tessa, die Frau aus der Kletterhalle, zu erkennen.
Tessa verzog entschuldigend das Gesicht. »Ich störe vermutlich«, sagte sie mit ihrer leicht rauchigen Stimme. »Aber ich habe gehört, dass Sie Polizistin sind. Hat mir Max erzählt.«
»Ja und?« Lena machte keine Anstalten, Tessa hineinzubitten.
»Ich heiße Dorit Zeiner«, sagte sie. »Und ich glaube, mein Mann ist ein Auftragsmörder.«
Kapitel 3
Man kann dir nicht trauen – das hatte meine Mutter oft gesagt, wenn ich ihr irgendwelche Geschichten erzählt hatte. Als Selbstschutz, weil ich mir ein wenig Freiheit erkämpfen musste. Aber ein paar Geschichten stimmten, zumindest so ungefähr. Noch immer sehe ich das Kind vor mir. Ich nenne es Raphaela, weil es ein schöner Name ist. Raphaela ist fünf Jahre alt und hat fröhliche blonde Locken. Nie ist sie in meinen Gedanken älter als fünf. Ich habe oft an Raphaela gedacht, wenn es mir schlecht ging. Sie war ein Zufluchtsort für mich, als würde sie irgendwo tatsächlich existieren, als müsste ich mich nur in ein Auto setzen und könnte zu ihr fahren, zu dem Mädchen, das nicht altert und das mich tröstet, wann immer ich will.
Dabei hatte Raphaela nie wirklich gelebt. Ich war siebzehn, als ich schwanger wurde, und ging in die zwölfte Klasse. Holger war ein Schuljahr über mir. Vertrau nie jemandem, der Holger heißt, hatte meine verrückte Mutter mir einmal gesagt, aber natürlich hatte ich nicht auf sie gehört. Was hatte ich mir damals nicht alles vorgestellt. Ein blondes schönes Kind, eine eigene Wohnung, ein Cabriolet, ein Doppelbett mit Holger – und dass ich endlich meine Mutter nicht mehr sehen müsste.
Doch dann schaffte es Holger, mich mit Engelszungen – ist das nicht ein Widerspruch? – zu einer Abtreibung zu überreden. Heimlich fuhren wir in eine Arztpraxis nach Ossendorf. Holger hatte alles arrangiert, so etwas konnte er.
Hinterher fühlte ich mich vollkommen taub, als hätte mich jemand von innen ausrasiert.
Rüdiger, mein Stiefvater, der Pfaffe, bei dem meine Mutter untergekrochen war, durfte auf keinen Fall etwas mitkriegen, also tat ich so, als hätte ich Fieber, eine Sommergrippe, und meine Mutter nahm eben wieder für ein paar Wochen in der Nervenklinik ihre Auszeit. Deshalb bestand von ihrer Seite keine Gefahr, dass sie mich durchschaute.
Raphaela, ja, so hätte ich mein Mädchen genannt. Jetzt wäre sie einundzwanzig, eine erwachsene Frau mit hübschen Locken.
Ich habe ein paar Dinge zu viel falsch gemacht in meinem Leben.
Bis ich Martin traf. Da hatte ich meinen Hafen gefunden, dachte ich zumindest.
Ich konnte sehen, dass die Polizistin mir nicht glaubte. Sie sah müde aus, eine schöne Frau mit langen blonden Haaren und tiefen Falten um den Mund. Offensichtlich war sie allein in ihrer Etagenwohnung, niemand sonst trat an die Tür, und es war auch nichts zu hören, keine Musik, keine Stimmen.
»Ein Auftragsmörder?«, fragte sie.
Ich nickte. »Ich habe den Verdacht, ja …« Ich schaute mich um. »Es gibt … Fotos … Ich habe sie mitgebracht.«
Lena Larcher sah mich an. Ich hatte sie gegoogelt, sie hatte kürzlich einen spektakulären Fall im Alleingang gelöst. Ihr Vater war schon Polizist gewesen, und in einem Zeitungsartikel war von einem Unfall die Rede, bei dem ihr Mann gestorben war. Vielleicht war ihre Wohnung deshalb so still.
»Es gibt in Deutschland keine Auftragsmörder«, sagte sie dann. Ihre grünen Augen musterten mich argwöhnisch.
Plötzlich erlosch im Treppenhaus das Licht.
»Ich habe Fotos«, wiederholte ich.
In der Dunkelheit hörte ich sie seufzen. »Also gut«, sagte sie dann, wandte mir abrupt den Rücken zu und ging in ihre Wohnung, ohne die Tür zu schließen. Ich fasste die offene Tür als Einladung auf und folgte ihr.
In ihrer Küche machte sie sich daran, wortlos Tee zu kochen.
Ich setzte mich. Die Küche war aus Kiefernholz mit allen Geräten, die man brauchte. Am Kühlschrank gab es sogar einen Eiscrusher, aber es wirkte eindeutig nicht so, als wäre Lena Larcher eine ausgewiesene Köchin.
»Sie heißen gar nicht Tessa«, sagte sie in einem vorwurfsvollen Tonfall.
»Nein«, sagte ich. »Manchmal nenne ich mich anders. Nicht jeder muss wissen, wie ich heiße … und Max schon mal gar nicht.« Eine recht lahme Erklärung – ich spürte es selbst, aber eine bessere hatte ich nicht. Oder doch vielleicht schon. »Ich war mal beim Film, Stuntfrau. Könnte sein, dass jemand meinen richtigen Namen aufgeschnappt hat.«
»Stuntfrau?«, fragte Lena Larcher. Das Wasser kochte. Sie goss es in eine altertümlich aussehende braue Kanne.
»Ich habe viele Dinge gemacht … bis ich meinen Mann kennengelernt habe – Martin Zeiner.«
Es war ein Fehler, hierhergekommen zu sein, begriff ich. Die Polizistin würde mir nicht helfen, trotzdem holte ich die Fotos hervor – Kopien von den drei Aufnahmen, auf denen am meisten zu erkennen gewesen war. Wie Spielkarten legte ich sie auf den Tisch, ohne sie mit einem Wort zu kommentieren.
Lena Larcher kümmerte sich um den Tee. Ungesüßt stellte sie mir eine große weiße Tasse mit einer gelblichen Flüssigkeit hin. Immerhin war der Tee warm.
Das erste Foto zeigte einen Mann hinter dem Steuer eines Autos. Er war über das Lenkrad gesunken. Man konnte leicht sehen, dass er ein Loch in der Schläfe hatte. Sein Profil verriet, dass er etwa vierzig Jahre alt sein musste – er hatte schüttere blonde Haare, eine große Nase und trug eine unmodische Hornbrille.
Der zweite Mann saß gleichfalls in einem Auto, er war unversehrt, nirgendwo eine Wunde, aber auch er lebte nicht mehr. Seine Augen glotzten starr vor sich hin, er hatte eine Glatze, trug einen Anzug und war recht korpulent, seine fetten Finger umklammerten das Lenkrad.
Der dritte Tote hatte kein Gesicht mehr, es war ihm förmlich weggeschossen worden. Er lag mit verschränkten Beinen, als wäre er beim Rückwärtslaufen gestolpert, auf einem sandigen Weg. Er trug ein buntes T-Shirt mit der Aufschrift »Fuck you«, seine muskulösen Unterarme waren tätowiert.
Für ein oder zwei Minuten war es still im Raum. Nur der Kühlschrank surrte.
»Woher haben Sie die Fotos?«, fragte Lena Larcher schließlich.
Nun war ihr Interesse doch geweckt.
»Mein Mann hat im Schlaf geweint … gestern Nacht … Heute Morgen ist er weggefahren. Er arbeitet beim Verfassungsschutz.« Ich beobachtete sie und sah, wie sie beim Wort »Verfassungsschutz« die Stirn runzelte. »Eine Dienstreise, und da habe ich mir seine Garage angesehen und …« Ich überlegte kurz, auch die Waffen zu erwähnen, ließ es dann jedoch. »Und dabei habe ich eine alte Tasche mit diesen Fotos gefunden.«
Sie besah sich die Fotos genauer, es war, als würde sie die Gesichter scannen. »Was macht Ihr Mann beim Verfassungsschutz?«, fragte sie, ohne den Blick zu heben.
»Ich weiß nicht … Er hat mit V-Männern zu tun, meistens im Osten, aber wohl auch hier. Manchmal fährt er nach Dortmund, wo er früher gelebt hat, oder … Großer Gott, ich weiß es nicht.«
»Wie kommen Sie darauf, dass Ihr Mann diese Männer getötet haben könnte?«
Musste ich nun doch von den Waffen sprechen? »Es ist so ein Gefühl«, sagte ich. »Ein mulmiges Gefühl.«
Wir schwiegen. Ich hörte sie atmen. Ihre Finger umklammerten ein Foto. Sie hatte sich gesetzt. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, weil die langen Haare es verdeckten. Sie hat ein Geheimnis, dachte ich. Auf keinen Fall ist sie eine gewöhnliche Polizistin. Dann kam mir der Gedanke, dass sie Martin vielleicht kannte. Gab es Ermittlungen, wo Polizei und Verfassungsschutz zusammenarbeiteten?
»Warum fragen Sie Ihren Mann nicht einfach, was es mit diesen Fotos auf sich hat?«, sagte sie. Sie klang nun noch müder. »Wenn Sie eine gute Ehe führen, dann wird er …« Sie sprach nicht mehr weiter.
Das tue ich, wollte ich sagen, ich führe eine gute Ehe, aber die Worte wollten mir nicht über die Lippen kommen. Wie oft hatte ich schon gedacht, dass ich keine gute Ehefrau war, dass ich seltsame Gedanken hegte, dass ich manchmal log, einfach nur so, aus Gewohnheit, weil die Lüge immer schon zu meinem Leben gehört hatte?
Als ein Mobiltelefon klingelte, begriff ich erst nicht, dass es mein iPhone war.
Rief Chris, mein wichtigster Auftraggeber, mich an? Ging es um einen neuen Job? Doch der Name »Martin« leuchtete auf dem Display auf.
»Wo bist du?«, fragte er atemlos.
»Wolltest du nicht erst morgen wiederkommen?«, fragte ich. Meine Stimme zitterte. »Ich bin spazieren«, schob ich nach. »Eigentlich wollte ich ins Kino, habe es mir dann jedoch anders überlegt.«
»Ich möchte noch irgendwo etwas trinken«, sagte er. »Meinen Auftrag habe ich früher erledigt als geplant.«
»Ich komme«, erwiderte ich, ganz brave Ehefrau. »In zwanzig Minuten bin ich da.«
Kapitel 4
Sie schenkte sich noch ein Glas Rotwein ein und trank es im Schlafzimmer vor dem Spiegel. Sie prostete sich zu und brachte sogar ein Lächeln zustande. Diesen schrecklichen Tag, vor dem sie sich seit Wochen gefürchtet hatte, hatte sie einigermaßen unbeschadet herumgekriegt. Sie war nicht in Simons Bett gekrochen, hatte nicht den Himmel angefleht und hatte sich auch nicht bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Silvana, ihre Psychologin, würde stolz auf sie sein.
Morgen würde sie wieder ins Präsidium gehen und so tun, als wäre nichts gewesen.
Warum war diese Frau zu ihr gekommen? Eine Stuntfrau mit einem falschen Namen. Diesen Gedanken konnte sie nicht vertreiben, bevor sie einschlief.
Robert, dachte sie, hast du mir diese Frau geschickt? Ist es eine Prüfung?
Als sie wieder aufwachte, war es vier Uhr am Morgen. Das passierte ihr in letzter Zeit häufiger – sie schlief allenfalls drei, vier Stunden, dann war sie wieder wach. Gedanken trieben wie Geröll heran.
Sie hatte wie immer kalte Füße. Das war ein heimliches Leiden, obwohl sie die Heizung die ganze Nacht durchlaufen ließ. Früher, in der anderen Zeit, hatte Robert sie gewärmt.
Warum war diese Frau zu ihr gekommen?, dachte sie wieder. Hatte diese Frage sie geweckt? Sie ging in die Küche, kochte sich einen Kaffee, hüllte sich in eine Decke und schaltete ihren Laptop ein. Eine Stuntfrau mit Namen Dorit Zeiner fand sie nirgendwo im Netz, dafür aber jemanden mit diesem Namen, der in Köln eine Firma besaß, die »Film-Catering« hieß. Auf der Homepage war ein Wagen abgebildet, der aussah, als könnte er auf einem Jahrmarkt stehen – eine lange Auslage mit belegten Broten, Salaten, Getränken und Kuchen. Ein Foto von Dorit Zeiner war nicht auf der Seite zu entdecken – überhaupt war sie recht karg und lieblos gemacht. Hatte die Frau sie erneut angelogen? Oder nein, möglicherweise war sie noch nicht verheiratet gewesen und hatte einen anderen Namen getragen, als sie Stuntfrau gewesen war.
Zu einem Martin Zeiner, der in Köln lebte, fand sich überhaupt kein Hinweis. Es gab einen Arzt mit diesem Namen in Freiburg, einen Physiker an einem Forschungsinstitut in Berlin sowie acht weitere, die bei LinkedIn angemeldet waren.
Das Wort »Verfassungsschutz« tauchte nicht auf. Auch im Telefonbuch Kölns kein Eintrag von Martin und Dorit Zeiner.
Ein Verfassungsschützer als Auftragsmörder? Absurd – oder eine perfekte Tarnung?
Nein, es war eher der Einfall einer Ehefrau, bei der ein paar Sicherungen durchgebrannt waren.
Auf dem Küchentisch lagen noch die drei Fotos der Toten.
Was hätte sie getan, wenn sie bei Robert solche Fotos gefunden hätte? Allein der Gedanke war aberwitzig. Robert hatte selbst beim Angeln die Fische wieder ins Wasser geworfen, er hätte keiner Fliege etwas zuleide tun können.
Die Männer auf den Bildern waren eindeutig tot – und der Fotograf hatte die Intimität des Todes verletzt. Er war den Toten, kurz nachdem sie ihr Leben verloren hatten, viel zu nahe gekommen. Daher wirkten diese Aufnahmen noch beklemmender als Fotos von Leichen ohnehin.
Sie würde zumindest versuchen herauszufinden, wer die Toten waren, nahm Lena sich vor.
Als es kurz nach sechs war, zog sie sich ihre Trainingssachen über und lief zum Rhein hinunter und dann weiter in Richtung Kranhäuser. Ihr Trauerjahr war vorüber, dachte sie, und wenn etwas in dieser Stadt ihr stets Trost gespendet hatte, war es dieser breite stolze Strom gewesen, der niemals gleich aussah. Ein sanftes, mattes Licht flirrte auf dem Wasser, da und dort waren Lichter von Schiffen zu sehen, die festgemacht hatten. Es war noch stockdunkel, und kaum jemand war unterwegs, keine weiteren Läufer, sondern lediglich ein paar Radfahrer auf dem Weg zur Arbeit. Am Schokoladenmuseum hatte bereits eine Bude geöffnet, wo sie einen heißen Kaffee bekam. Der Stolz über den bewältigten gestrigen Tag wollte noch nicht weichen. Ein leichtes Gefühl von Glück legte sich über sie.
Als sie sich für den Rückweg bereit machte, klingelte ihr Mobiltelefon. Wieder war der erste Impuls anzunehmen, dass ihr Vater sie vorwurfsvoll fragen wollte, warum sie sich gestern Abend nicht mehr gemeldet hatte.
Mona Beckmesser, ihre Assistentin, rief aus dem Präsidium an. Dabei war es noch nicht sieben Uhr. »Es gibt Arbeit«, erklärte sie ganz sachlich. »Eigentlich gar nicht unser Gebiet, aber bei den Kollegen in Aachen ist gerade Land unter. Die liegen alle mit einem Virus flach. Vor einer Stunde hat jemand eine Leiche an einer Talsperre in der Eifel entdeckt, unterhalb von Vogelsang. Weißt du, wo das ist?«
»Klar. Vogelsang ist die alte Nazi-Ordensburg«, erwiderte Lena. Vor einigen Jahren, bevor Simon auf die Welt gekommen war, hatte Robert an Wochenenden manchmal auf dem Rursee gesegelt, obwohl ihm das Revier eigentlich viel zu klein gewesen war.
»Umso besser. Ich sage Henning Bescheid. Er holt dich in einer Stunde ab.« Mona verhielt sich bei solchen Einsätzen seit dem Unfall äußerst rücksichtsvoll. Sie wusste, dass Lena immer noch Probleme hatte, sich hinter ein Steuer zu setzen.
Henning Mahn, ihrem Partner im Präsidium, bekam die Einsamkeit nicht. Seit ein paar Monaten, seit seine Frau ihn wegen seiner Spielsucht hinausgeworfen hatte, wohnte er allein in einer Zweizimmerwohnung in Ehrenfeld. Ob er immer noch junge Mädchen mitnahm, wusste Lena nicht, vermutete es aber.
»Ich weiß gar nicht, was das soll«, erklärte er grummelnd, nachdem er sie mit einem Dienstpassat abgeholt hatte. »Nun machen wir auch noch die Arbeit für ein anderes Präsidium. Als hätten wir noch nicht genug zu tun …«
Mahn war zweiundfünfzig. Er sah ausgezehrt aus, zu viel Kaffee, zu viel Alkohol, und vermutlich ernährte er sich lediglich von Fast Food, trotzdem war er mit seinen dichten braunen Haaren und den markanten Gesichtszügen ein attraktiver Mann geblieben.
»Ich habe gegen einen Ausflug in die Eifel nichts einzuwenden«, entgegnete Lena.
Sie brauchten eine knappe Stunde, bis sie an der Ordensburg Vogelsang angekommen waren – einem Ensemble von mächtigen Gebäuden, das während der Nazizeit innerhalb weniger Jahre errichtet worden war. Hier hatte man die Elite für Partei und Staat ausbilden wollen. Im Schwimmbad, das sich unterhalb der Burg befand, war immer noch ein Mosaik zu sehen, das den vollkommenen Arier zeigte: einen blonden, muskelgestählten Germanen.
Ein wortkarger uniformierter Polizist nahm sie in Empfang und wies ihnen den Weg. Sie mussten über eine schmale asphaltierte Straße etwa sechshundert Meter den Berg hinunter in Richtung Talsperre gehen. Henning fluchte vor sich hin. Er trug wie üblich seine abgewetzte Lederjacke, darunter nur ein Hemd. »Es ist so verdammt kalt in der Eifel. Weiß gar nicht, wie man es hier aushalten kann.«
Lena schwieg. Wenn Hennings Laune so im Keller war, ignorierte man ihn am besten. Sie bemerkte, dass der Weg zu einer Brücke führte, die sich über die Talsperre spannte. Zwei Uniformierte standen auf der Brücke, dazu eine Frau mit dunkelroten Haaren und zwei Männer in weißen Papieranzügen. Mona hatte die ganze Kavallerie hergebracht.
Doktor Margot Dreier, die Rechtsmedizinerin, sah sie an, als Henning und sie über die Brücke auf sie zukamen. »Oh, noch zwei Frühaufsteher«, sagte sie lächelnd. »Da sind ja jetzt alle Kölner zusammen.«
Henning tippte sich zum Gruß kurz an die Stirn.
»Der Tote wird gerade geborgen«, sagte Margot Dreier weiter. »So schnell sind sie hier in der Eifel nicht.«
Zwei Männer in Taucheranzügen schoben eine leblose Gestalt ans Ufer, erkannte Lena. Nun war ihr auch kalt, obschon sie zwei Pullover angezogen hatte.
Die beiden Männer von der Spurensicherung, die offenbar ebenfalls aus Köln kamen, hatten sie nur flüchtig begrüßt. Sie besahen sich das Geländer und eine Stelle auf der Brücke, an der eine Blutspur zu sehen war.
»Was genau ist passiert?«, fragte Lena. Ihr Blick glitt wieder zu den Tauchern, die nun etwa zweihundert Meter entfernt ans Ufer gelangt waren.
»Ein Angler hat heute in der Früh den Toten im Wasser ausgemacht«, erklärte die Rechtsmedizinerin. »Könnte sein, dass er sich hier auf der Brücke erschossen hat und dann in den See gestürzt ist.« Margot Dreier verzog das Gesicht. So ganz war sie mit ihrer Erklärung nicht zufrieden. »Aber Fremdverschulden können wir natürlich nicht ausschließen. Daher der ganze Aufmarsch.« Sie nickte Lena zu und wandte sich dann ab, um sich den Toten anzusehen, den die beiden Taucher nun auf einem Stück Sand am Ufer abgelegt hatten.
Henning betrachtete die beiden Kriminaltechniker bei der Arbeit. Sie fotografierten die Blutspur auf der Brücke sowie das Geländer. Dann begann einer der beiden die oberste Verstrebung des Geländers nach Fingerabdrücken zu untersuchen.
»Und deswegen haben sie uns hier rausgeschickt?«, sprach Henning vor sich hin. »Weil sich da jemand eine Kugel in den Kopf schießt und dann ins Wasser fällt?«
Ging das überhaupt?, fragte Lena sich. Man steht auf der Brücke, schießt und fällt dann über das Geländer? Doch möglicherweise hatte der Jemand, den sich die Rechtsmedizinerin nun ansah, auf dem Geländer gesessen, als er den Schuss abgefeuert hatte.
Einer der beiden Kriminaltechniker kam auf sie zu. Einen Pinsel in der Hand. »Viel Sinn hat das hier nicht«, sagte er. »Wir werden hier nichts finden. Die Nacht war kalt und frostig. Wir packen gleich wieder ein.« Er lächelte. Er war groß, ein paar blonde Haare lugten unter der weißen Kapuze hervor. »Sie sind die Tochter vom großen Larcher, nicht wahr?« Er streckte ihr die Hand hin. »Ich heiße Arne – Arne Blumfeld. Bin neu in Köln – frisch eingetroffen, sozusagen.«
Sie reichte ihm mechanisch die Hand. »Ja, packen Sie ein«, sagte sie dann.
Hennig schob sich neben sie, während sie ans andere Ende der Brücke gingen, dorthin, wo Margot Dreier den Toten untersuchte. »Hast du bemerkt, wie er dich angeschaut hat, dieser Schnösel?«, fragte er entrüstet. »Ganz hingerissen, als wärst du eine berühmte Schauspielerin.«
Sie erwiderte nichts, aber ja, diesen besonderen Blick hatte sie auch bemerkt.
Der Tote trug Outdoorkleidung, eine enge schwarze Hose und eine dunkelblaue Jacke. Er war etwa fünfundvierzig Jahre alt, mittelgroß und hatte einen Kinnbart und lange graue Haare. An der rechten Schläfe befand sich ein Einschussloch.
Margot Dreier richtete sich auf. »Ein aufgesetzter Schuss. Sieht doch ganz nach Selbstmord aus. Aber ob wir Schmauchspuren finden, bezweifle ich. Der Tote hat schon ein paar Stunden im Wasser gelegen.«
»Dann müssen wir nur noch die Waffe bergen«, sagte Lena, »und herausfinden, wer er ist.«
»Das ist ganz einfach.« Einer der beiden Taucher hatte die Brille abgestreift. Er deutete auf den Toten. »Er ist in der Eifel bekannt wie ein bunter Hund – sie nennen ihn hier spöttisch van Gogh, weil er auch Vincent heißt und Maler ist. Oben in der Burg hat er ein Atelier.«
Kapitel 5
Ich schmeckte die Lüge auf den Lippen. Ja, so genau fühlte es sich an, als ich mit meinem alten Fiat hinter Martins schwarzem Audi in der Einfahrt parkte. Unser schmales Reihenhaus war nichts als Tarnung – vor anderen, vor uns selbst. Wir gehörten hier nicht hin – nach Köln-Longerich, in eine öde Vorstadt, Geschwister-Scholl-Straße. Lebten hier nicht nur Menschen, die ein reines Gewissen hatten, die außer Falschparken und ein wenig mit der Steuer Tricksen nichts auf dem Kerbholz hatten? Ich brauchte ein paar Momente, bis ich aussteigen konnte. Einzig die Lampe über der Tür brannte. Wo wollte Martin jetzt noch etwas trinken gehen? Bei Enzo, in der Hauptstraße, unserem Stammitaliener?
Plötzlich stand er in der Tür – ganz aufrecht, mit finsterem Gesicht. Er hatte geahnt, dass ich schon da war. Er konnte so etwas.
Er lächelte mühsam, wischte die Finsternis in seinen Zügen beiseite, winkte mich dann heran.
Er ist ein Fremder. Dieser Gedanke überfiel mich. Was wusste ich von ihm? Ich wusste nicht einmal, warum er damals, vor vier Jahren, als wir uns zum ersten Mal gesehen hatten, im Krankenhaus gewesen war. Ich hatte mir ein paar Rippen und das rechte Bein ziemlich kompliziert gebrochen. Mein letzter Stunt – eine junge Frau, ausgerechnet Polizistin bei der Mordkommission, sollte über einen Zebrastreifen vor ihrem Haus gehen und wurde von dem Mitglied eines Rockerclans mit dem Motorrad angefahren. Es sollte alles möglichst echt aussehen, so hatte es sich der Regisseur gewünscht. Und das tat es auch. Seitdem hinke ich ein wenig und spüre in meinem rechten Bein, wenn das Wetter umschlägt.
Ich stieg aus.
»Cherie«, sagte Martin, »warum sitzt du im Auto?«
Cherie – so nannte er mich manchmal, wenn er etwas wollte oder ein schlechtes Gewissen hatte. Ich sah an seinen Augen, dass er getrunken hatte.
»Ich habe noch eine dringende SMS geschrieben – wegen einer Filmproduktion nächste Woche«, log ich.
Er umarmte mich, zog mich förmlich ins Haus. Was für einen Auftrag hatte er zu erledigen gehabt? Er wirkte erleichtert, geradezu gelöst.
»Ich habe eine Flasche Wein aufgemacht. Wir sollten es uns zu Hause gemütlich machen.« Er lächelte erneut, nun breiter, hoffnungsvoller.
Im Wohnzimmer brannten Kerzen – auf dem Tisch und auf der Fensterbank. Musik spielte – Keith Jarrett, Das Köln-Konzert. Seine Entspannungsmusik – ich konnte sie nicht mehr hören.
»Was ist los?«, fragte ich, und dann fiel mir ein, was die Polizistin gesagt hatte. Wenn Sie eine gute Ehe führen, dann … dann fragen Sie Ihren Mann doch einfach, was es mit der Tasche auf sich hat.
Martin holte ein zweites Glas, schenkte ein und reichte es mir. »Weißt du«, sagte er, »weißt du, dass du das Beste bist, was mir in meinem Leben passiert ist?«
Ich nickte ihm zu und trank den ersten Schluck. Der Wein schmeckte mir nicht.
Lüge, dachte ich wieder, ist das nicht alles eine große Lüge? Und war es nicht endlich Zeit für die Wahrheit?
Martin stellte sein Glas ab, er streichelte meine Wange und wollte mich küssen, doch da sah ich das lange Pflaster in der Innenfläche seiner rechten Hand.
»Was hast du gemacht?«, fragte ich. Ein wenig Panik, zumindest Unruhe lag in meiner Stimme.
Er besah sich seine Hand, runzelte kurz die Stirn, als müsse er sich erinnern. »Ach nichts«, sagte er. »Ich habe mich geschnitten. Nicht weiter wichtig.«
Zehn Minuten später lagen wir im Bett. Martin zog mich aus, er machte das ganz sanft und zärtlich, küsste meinen Bauch, meine Brust, meinen Hals, doch als er in mich eindringen wollte, wurde er nicht hart.
»Verzeih«, flüsterte er, »war vielleicht doch ein wenig zu viel Stress in letzter Zeit.«
Zehn Minuten später war er eingeschlafen. Er weinte nicht in dieser Nacht, und mir fiel unser Streit ein und dass ich eigentlich meine Periode hätte haben müssen.
Ich war eine schlechte Schülerin, nicht nur wegen der ständigen Umzüge, weil ich kaum ein Jahr auf ein und derselben Schule blieb. Meine Mutter schien ständig auf der Flucht zu sein. Wenn sie irgendwo die Miete nicht mehr bezahlen konnte, wechselten wir den Stadtteil: von Ostheim nach Deutz, nach Porz, zurück in die Stadt nach Mülheim. Unsere Möbel passten in einen Kleintransporter. Paul, meinem Bruder, machte diese Umzieherei richtig viel Spaß. Er kam an jeder Schule klar, er war zwei Jahre älter, war viel größer als seine Altersgenossen und hatte mächtige Fäuste, mit denen er alles regeln konnte. Ich war eher die Schweigsame – und mir machte es etwas aus, das Mädchen ohne Vater zu sein. Meine Mutter wusste wohl selbst nicht genau, wer mich gezeugt hatte, und irgendwelche Kerle heranzukarren für einen Vaterschaftstest – so hatte sie sich einmal ausgedrückt –, dazu hatte sie keine Veranlassung gesehen. Gezahlt hätte sowieso keiner. Erst als sie den Pfaffen kennenlernte und wir zu ihm nach Bayenthal zogen, wurde unser Leben ruhiger, aber mir ging der Pfaffe schnell auf die Nerven. Er machte einen auf jung, rauchte Zigarillos, fuhr Motorrad, und wenn er von Gott sprach, tat er so, als wäre das ein Kumpel von ihm, der in der Nähe wohnte, aber gerade nicht zu Hause war.
Und dann wurde meine Mutter von dem Pfaffen schwanger, und damit saßen wir endgültig fest. Ich nannte meine Mutter nur noch Uta. Als der kleine rothaarige Tom auf die Welt kam, tat sie dann so, als wären wir eine richtige Familie. Sie backte Kuchen für das Pfarrfest, leitete einen Singkreis in der Gemeinde, lernte Reiki und nahm sich nur noch selten eine Auszeit in der Nervenklinik.
Warum dachte ich all diese Gedanken, während Martin neben mir lag und sich hin und her wälzte?
Weil erst er meine Rettung gewesen war, der Hafen, in dem ich vor Anker gehen konnte.
Als er gegen sieben Uhr aufstand, um mit seinem Rennrad ins Amt zu fahren, rollte ich mich auf meiner Seite des Bettes zusammen und tat so, als schliefe ich noch. Ich hörte, wie er duschte, roch den Kaffeeduft, der aus der Küche durchs Haus zog. Dann klappte die Tür zu, und er war gegangen.
Auf seiner Seite des Bettes prangte auf dem Kissen ein Blutfleck. Der Schnitt an seiner Hand, fiel mir ein. Ganz eindeutig keine kleine oberflächliche Wunde.
Nur im Bademantel ging ich in die Garage hinunter. Er war hier gewesen, gestern Abend noch. An dem Metallschrank war ein neues Schloss angebracht, und die Pistole, die achtlos bei dem Werkzeug in der Schublade gelegen hatte, war verschwunden.
Nachdem ich den ersten Kaffee getrunken hatte, forschte ich im Netz nach, ob gestern irgendetwas Spektakuläres passiert war. War jemand durch einen Auftragsmörder ums Leben gekommen? Doch ich fand nichts, nichts von Bedeutung, jedenfalls nichts über einen Auftragsmord. Es gab nur einen aktuellen Todesfall: In der Eifel hatte sich ein Maler, der Vincent Schneider hieß, eine Kugel in den Kopf geschossen.
Kapitel 6
Warum denken wir immer, dass wir ein gelungenes Leben führen müssen? Aber das tun wir nicht – die meisten scheitern in ihren Familien, mit ihren Beziehungen, und für nicht wenige war Selbstmord dann ein Ausweg. Dieser Gedanke ging ihr durch den Kopf, während sie hinter Henning wieder nach Vogelsang hinauflief. Henning zog vor Kälte die Schultern zusammen. Er fluchte stumm vor sich hin. Die Kriminaltechniker waren zurückgeblieben, um die Blutspuren auf der Brücke zu sichern, und die Taucher waren auf der Suche nach der Tatwaffe noch einmal ins Wasser gegangen.
Es sah alles nach Selbstmord aus.
Ein Mann mit einem breitkrempigen Hut, ein Ranger aus dem Nationalpark, nahm sie oben vor der Verwaltung der Ordensburg in Empfang. Einer der Polizisten hatte ihn bereits informiert. Der Ranger hatte rötliche Haare und die hagere Figur eines Marathonläufers.
»Van Gogh ist tot?«, sagte er in einem keuchenden Tonfall. »Hat sich eine Kugel in den Kopf geschossen? Aber warum, großer Gott?« Er erhob die Arme, fast wie ein Priester, dann beugte er sich vor und reichte Lena die rechte Hand. »Ich heiße Born – Rainer Born. Ich leite hier das Team der Ranger. Ich habe van Gogh nach Vogelgesang gelockt. Wir waren ganz stolz, dass ein Maler hier sein Atelier eingerichtet hat. Drüben in der alten Kaserne.«
»Hören Sie«, sagte Henning recht unfreundlich. Er hatte seine Hände tief in den Taschen seiner Jacke vergraben. »Wir würden uns gerne das Atelier ansehen – ob es einen Abschiedsbrief oder so etwas gibt … und dann müssen wir zurück nach Köln. Ist eigentlich gar nicht unser Fall. Wir haben noch andere Dinge zu erledigen.«
Born nickte.
»Hatte dieser Maler einen Grund, sich umzubringen?«, fragte Lena. »Hatte er Angehörige?«
Born schaute sie an, während er mit der Hand den Weg hinauf deutete. »Van Gogh … ich meine Vincent … Er war hier eine Berühmtheit. Er hat seine Eifel-Bilder gemalt, aber die haben wohl nicht viel eingebracht. Gelebt hat er davon, dass er Bilder kopiert.«
Sie gingen auf ein mächtiges, aus groben Bruchsteinen errichtetes Gebäude zu. Eine alte Kaserne der belgischen Armee, wie Lena wusste.
»Was für Bilder hat er kopiert?«, fragte sie. Missmutig stapfte Henning neben ihr her. Der Wind war hier oben weit heftiger als unten am Wasser. Henning schnaufte. Ihn schien die Geschichte des Malers wenig zu interessieren.
»Er hat für ein Auktionshaus gearbeitet. Wenn da Leute ihre Originale verkauft haben, hat er als Erinnerung für die Verkäufer im Auftrag des Auktionshauses eine Kopie gemalt. Ich weiß das, weil ich ihn einmal danach gefragt habe. Da hat er ein Bild von Max Pechstein kopiert. ›Sitzendes Mädchen‹ – ja, so hieß das Bild. Ich glaube, das Original hat über eine Million gekostet. Vincent hat es nachgemalt. Die Farben waren vielleicht nicht ganz so strahlend, aber er war ein richtiger Künstler.«
Sie schritten unter einem Torbogen auf ein weiteres mächtiges Gebäude zu, in dem wie in einer riesigen Garagenanlage viele große Tore eingelassen waren. Wahrscheinlich war hier der Fuhrpark der belgischen Armee untergebracht gewesen, die zuletzt, allerdings bereits vor etlichen Jahren, das gesamte Anwesen genutzt hatte.
Der Ranger steuerte auf das erste Tor zu. Er holte einen Schlüssel heraus und öffnete es.
Ein Geruch von Farbe breitete sich aus. Der Raum hinter dem Tor war weitaus größer, als Lena erwartet hatte, und er war eigentlich viel zu dunkel, um als Atelier genutzt werden zu können. Sie sah in der Dunkelheit einen breiten langen Tisch, auf dem, ausgebreitet, Leinwände zu erahnen waren, dahinter befand sich ein Regal voller Dosen und Farbtuben.
»Hier hat er gearbeitet?«, fragte sie.
Der Ranger nickte. Dann griff er zu einem Schalter an der Wand, und mehrere nackte Neonröhren flammten unter der Decke auf. Hinten, mitten im Raum, gab es so etwas wie eine bewohnte Insel: ein roter Teppich, darauf zwei Stühle, ein Heizkörper mit Rollen und eine Staffelei. Zwei Meter hinter der Staffelei lag eine Matratze mit zwei grauen Decken auf dem Betonboden.
Lena trat näher. Auf dem Stuhl stand eine offene Rotweinflasche, und daneben, als hätte der Maler sich eben erst von seiner Arbeit erhoben, lagen ein halbes Baguette und ein grobes Stück Käse. Unter dem Stuhl eine Blechdose, in der in einer gelblichen Flüssigkeit mehrere filterlose Zigarettenkippen schwammen.
Auf der Staffelei befand sich ein angefangenes Bild. Wie aus einer weißen Wolke schälte sich eine nackte rothaarige Frau mit dicken bloßen Brüsten.
»Wer ist das?«, fragte Lena.
Born lächelte matt. »Das ist Sina, seine Muse. Er lebt unten in der Erkensruhr mit ihr zusammen. Sie wird noch gar nicht wissen, dass Vincent tot ist.«
»Kein Abschiedsbrief«, sagte Henning vor sich hin, während sie auf einer breiten schnurgeraden Straße die Burg Vogelsang hinter sich ließen. Es war Mittagszeit, doch der Himmel hatte immer noch nicht aufgeklart. Ein trüber, kalter Februartag in der Eifel. »Warum können wir nicht einfach mal Glück haben? Ein simpler Selbstmord mit Brief und Siegel, sozusagen.«
Lena schloss die Augen. Nun spürte sie, dass sie zu wenig geschlafen hatte, und die Arme und Beine taten ihr vom Klettern weh.
Als ihr Mobiltelefon klingelte, ahnte sie, dass es ihr Vater war, der sie vermutlich voller Zorn anrief.
»Was hast du gestern gemacht?«, fragte er mit seiner rauen, barschen Stimme, die sie ihre Kindheit und Jugend lang begleitet hatte.
»Nichts«, sagte sie. »Ich habe nichts gemacht – ein paar Dinge geordnet.«
»Warum hast du mich nicht angerufen?« Sein Tonfall wurde ein wenig sanfter. Seit er wegen des Glaukoms zu erblinden drohte, war er versöhnlicher geworden, manchmal geradezu verständnisvoll, Eigenschaften, die er bei ihrer Mutter nie an den Tag gelegt hatte.
»Ich hatte gestern eine gute Zeit, wirklich«, sagte sie bestimmt.
Henning warf ihr einen fragenden Seitenblick zu. Vermutlich hatte er vergessen, dass gestern der Jahrestag ihres Unfalls gewesen war.
Ihr Vater schnaufte. »Ich habe heute meinen Jaguar verkauft«, sagte er. »Stell dir vor – aber du wolltest ja, dass dein alter blinder Vater nicht mehr Auto fährt.«
»Ja«, sagte sie, »das wollte ich. Ich bin gerade unterwegs, ein ungeklärter Todesfall. Ich melde mich später wieder.« Mit einem kurzen Gruß unterbrach sie die Verbindung.
Henning war von der kurvenreichen Hauptstraße abgebogen. Der Passat rollte über eine unebene, schlecht geflickte Teerstraße in ein Waldstück hinein. »Wie kann man hier leben?«, fragte er. »Mitten im Wald?«
Das Navigationsgerät kündigte an, dass sie in zweihundert Metern ihr Ziel erreicht hatten. Wenig später bremste Henning vor einem Holzhaus mit einem grauen Schieferdach. Nirgendwo brannte ein Licht. In der ersten Etage waren an den drei Fenstern hässlich graue Plastikjalousien heruntergelassen.
»Na, ist ja eine echte Villa, in der dieser van Gogh mit seiner Muse gewohnt hat«, sagte Henning spöttisch, während er den Motor abschaltete. »Was war gestern?«, fragte er ernst. »War gestern der Tag?« Er betonte das letzte Wort.
Lena nickte, ohne etwas zu entgegnen. Sie stieg aus und steuerte auf eine grüne Holztür mit einem winzigen Fenster zu.