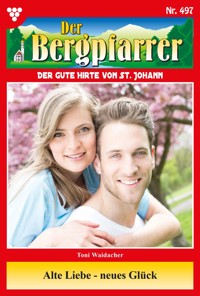Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Bergpfarrer Extra
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Mit dem Bergpfarrer Sebastian Trenker hat der bekannte Heimatromanautor Toni Waidacher einen wahrhaft unverwechselbaren Charakter geschaffen. Sein größtes Lebenswerk ist die Romanserie, die er geschaffen hat. Seit Jahrzehnten entwickelt er die Romanfigur, die ihm ans Herz gewachsen ist, kontinuierlich weiter. "Der Bergpfarrer" wurde nicht von ungefähr in zwei erfolgreichen TV-Spielfilmen im ZDF zur Hauptsendezeit ausgestrahlt mit jeweils 6 Millionen erreichten Zuschauern. Wundervolle, Familienromane die die Herzen aller höherschlagen lassen. Es war Freitagabend kurz vor acht Uhr, als Dr. Severin Kaltenecker an der Tür des Pfarrhauses läutete. Sophie Tappert, die Pfarrhaushälterin, öffnete ihm. »Guten Abend, Frau Tappert. Alles gut?« Der Sechzigjährige, der in Passau als Allgemeinarzt praktiziert hatte, lebte seit geraumer Zeit in St. Johann. Er war verwitwet und hatte sich während eines Urlaubs in den Ort und in das Wachnertal geradezu auf den ersten Blick verliebt. Bald darauf hatte er in Passau alles aufgegeben und war nach hierher umgezogen. Severin Kaltenecker, ein geradliniger Mensch mit viel Lebenserfahrung, wurde sehr schnell ein guter Freund von Sebastian Trenker. Nachdem er sich sogar in eine Cousine des Bergpfarrers verliebte und mit ihr zusammenlebte, gehörte Severin praktisch zur Verwandtschaft. »Grüaß Ihnen, Herr Doktor«, erwiderte die Haushälterin freundlich lächelnd. »Bei uns ist alles Bestens. Kommen S' nur herein. Hochwürden sitzt schon vor dem Schachbrett und denkt über seinen nächsten Zug nach. Und der Wein steht auch schon bereit.« »Danke.« Severin trat an Sophie vorbei ins Haus. »Das hört sich gut an«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Bergpfarrer Extra – 24 –
Er ist mein ganzes Glück
Beim ersten Tanz verschenkte sie ihr Herz …
Toni Waidacher
Es war Freitagabend kurz vor acht Uhr, als Dr. Severin Kaltenecker an der Tür des Pfarrhauses läutete.
Sophie Tappert, die Pfarrhaushälterin, öffnete ihm.
»Guten Abend, Frau Tappert. Alles gut?« Der Sechzigjährige, der in Passau als Allgemeinarzt praktiziert hatte, lebte seit geraumer Zeit in St. Johann. Er war verwitwet und hatte sich während eines Urlaubs in den Ort und in das Wachnertal geradezu auf den ersten Blick verliebt. Bald darauf hatte er in Passau alles aufgegeben und war nach hierher umgezogen.
Severin Kaltenecker, ein geradliniger Mensch mit viel Lebenserfahrung, wurde sehr schnell ein guter Freund von Sebastian Trenker. Nachdem er sich sogar in eine Cousine des Bergpfarrers verliebte und mit ihr zusammenlebte, gehörte Severin praktisch zur Verwandtschaft.
»Grüaß Ihnen, Herr Doktor«, erwiderte die Haushälterin freundlich lächelnd. »Bei uns ist alles Bestens. Kommen S’ nur herein. Hochwürden sitzt schon vor dem Schachbrett und denkt über seinen nächsten Zug nach. Und der Wein steht auch schon bereit.«
»Danke.« Severin trat an Sophie vorbei ins Haus. »Das hört sich gut an«, sagte er lausbubenhaft grinsend.
»Er hat den Schachtisch auf die Terrasse getragen, Herr Doktor«, gab Sophie zu verstehen. »Wie S’ hinausfinden, brauch’ ich Ihnen ja net sagen.«
»Ich weiß Bescheid, Frau Tappert«, versetzte der Arzt im Ruhestand. »Vielen Dank.«
Tatsächlich saß Sebastian grübelnd vor dem kleinen Tisch mit dem Schachbrett. Er und Severin hatten ihre Partie vor einer Woche unterbrochen und wollten sie an diesem Abend zu Ende führen.
»Servus, Sebastian«, grüßte Severin und grinste. »Wie ich sehe, bist du schon wieder dabei, dir einen kleinen Vorteil zu verschaffen.«
»Servus, Severin.« Sebastian hatte den Blick vom Schachbrett losgeeist und schaute den Besucher an. »Um gegen einen Schachgroßmeister wie dich bestehen zu können muss das erlaubt sein«, antwortete er und in seinen Augen funkelte der Schalk. »Heut’ wirst du allerdings keinen Preis gewinnen. Ich bin nämlich, nachdem ich die Konstellation der Figuren noch einmal gründlich studiert hab’, zu dem Schluss gekommen, dass du dich mit deinem König in einer denkbar schlechten Position befindest.«
»Das wollen wir doch erst mal sehen«, brummte Severin und schaute auf das Schachbrett.
Er biss sich auf die Unterlippe. Sein König war tatsächlich mehr als gefährdet.
Sebastian erhob sich. »Stoßen wir erst einmal darauf an, dass der Abend entspannend und vergnüglich wird, Severin. Der Annette geht’s hoffentlich gut.«
Severins grüblerische Miene hellte sich auf. »Ich dank’ jeden Tag meinem Herrgott, dass sie mir über den Weg gelaufen ist. Sie ist so liebevoll, so fürsorglich und verständnisvoll. Ich würd’ sie nimmer hergeben.«
»Wenn ich Annette richtig verstanden hab, will sie dich auch nimmer hergeben«, erwiderte Sebastian lachend. Sie gingen zu dem Gartentisch, auf dem die Flasche Rotwein und eine Karaffe mit Mineralwasser sowie die notwendigen Gläser standen, und setzten sich.
»Wie geht’s dem Michael Deininger?«, fragte Severin. Er hatte vor einigen Tagen dem Suchtrupp angehört, den Sebastian mobilisiert hatte, nachdem der alte Michael P. Deininger nicht von einem Ausflug zurückgekehrt war. Eine ganze Nacht lang hatten sie vergeblich nach ihm gesucht.
Der kauzige Kräutersammler Alois Brandhuber war am Morgen im Wald auf den Verunglückten gestoßen und hatte dessen Sohn Jürgen verständigt, der ebenfalls zu dem Suchtrupp gehörte, der zusammen mit dem Bergpfarrer den Ainringer Forst durchkämmte.
»Den Umständen entsprechend gut«, antwortete Sebastian. »Der Knöchel war arg verstaucht, ansonsten ist der alte Herr wohlauf.« Der Bergpfarrer schenkte etwas Wein in die Gläser und hob sein Glas. Der Rotwein funkelte wie verflüssigter Rubin. »Zum Wohl, Severin. Ich hoff’, der Wein schmeckt dir. Ein kräftiger Italienischer Barbera. Ich hab’ ihn probiert, und mir gefällt er.«
»Auf dein Wohl«, sagte Severin und stieß mit dem Pfarrer an. Dann tranken sie. Severin behielt den Wein für kurze Zeit im Mund, dann schluckte er ihn, nickte und sagte: »Köstlicher Tropfen. Sehr vollmundig und kräftig. Wenn wir die Flasche austrinken, sehen wir unsere Schachfiguren doppelt.«
»Soweit soll’s net kommen. Zu viel Wein wär’ ja auch unserer Gesundheit net zuträglich. Aber da weißt du als Arzt sicher besser Bescheid als ich.«
»Man muss kein Arzt sein, um hinsichtlich der Schädlichkeit des Alkohols Bescheid zu wissen«, erwiderte Severin. »Aber ab und zu ein Glaserl von dem köstlichen Getränk tut keinem weh. Wir können also ruhigen Gewissens das Glas leeren, während wir uns die Köpfe darüber zerbrechen, wie der nächste Zug aussehen soll. Gibt’s sonst was Neues zu berichten, Sebastian? Du kommst doch mehr unter die Leut, als so ein ruhiger Pensionist, wie ich.«
»Einer unserer Bauern will die Landwirtschaft aufgeben und auf seinem Land einen Golfplatz mit allen Extras errichten. Ich rede vom Reisnecker-Hennes. Ich kann’s mir zwar net vorstellen, dass er alles aufgeben will. Der Reisneckerhof hat doch Tradition. Die Land- und Forstwirtschaft rentiert sich für ihn angeblich nimmer. Ich hab’ keine Ahnung, was ich davon halten soll.«
»Warum fragst du den Reisnecker net selber?«
»Ich will erst mit dem Bürgermeister sprechen. Wenn der Reisnecker eine derart große Sach’ vorhat, muss er das mit dem Bruckner und dem Gemeinderat abklären. Bis jetzt bin ich noch net dazu gekommen. Aber ich wird besser gleich mal am Montagfrüh im Rathaus auf den Busch klopfen.«
»Tu das. Vielleicht ist alles wieder nur ein Gerücht.«
Sebastian wiegte den Kopf. »Wo Rauch ist, ist auch Feuer, Severin. Ich werd’ der Sach lieber auf den Grund gehen. Es würd’ mich gar net wundern, wenn der Markus schon Bescheid wüsst’. So ein nobler Golfplatz, mit Hotel und allem, was dazugehört, würd’ ihm wahrscheinlich gut in den Kram passen, wo er doch ständig bestrebt ist, den Fremdenverkehr in unserem beschaulichen Tal anzukurbeln.«
»Ein Ehrgeiz, den ein gewisser Pfarrer Trenker bisher immer in Grenzen gehalten hat«, sagte Severin grinsend. »Aber wir reden hier über ungelegte Eier, Sebastian. Hab’ ich dir eigentlich schon einmal davon erzählt, dass ich ein Mündel hab’?«
»Nein, davon weiß ich nix«, erwiderte der Bergpfarrer erstaunt.
»Es ist ein Madel, ich möcht’ fast sagen, eine junge Frau. Ihr Name ist Christina Bruischütz, sie wird demnächst achtzehn, und lebt seit zehn Jahren in einer Benediktinerabtei am Chiemsee.«
»Ich wüsst’ net, dass du St. Johann verlassen hättest, um dein Mündel länger zu besuchen«, murmelte Sebastian verwundert.
»Ich bin nie so richtig rangekommen an die Christina«, erzählte Severin und zuckte mit den Schultern. »Ich hab’ keine Ahnung, woran es gelegen hat. Früher hab’ ich sie jeden Monat mal besucht, hab’ aber jedes Mal das Gefühl gehabt, mich ihr aufzudrängen. Schließlich hab’ ich’s aufgegeben, ein engeres Verhältnis zu ihr aufbauen zu wollen. Wir haben regelmäßig miteinander telefoniert und seit etwa zwei Jahren hat das auch kaum noch stattgefunden.«
»Das ist aber schade«, meinte Sebastian. »Willst du mir net ein bissel mehr von deinem Mündel erzählen?«
»Warum net?«, erwiderte Severin und berichtete …
*
»Es ist zehn Jahre her«, sagte Severin, »dass die Eltern des Madels bei einem Verkehrsunfall starben. Meine Frau und ich waren mit dem Johannes Bruischütz, Christinas Vater, und dessen Gattin, der Elfriede, sehr gut befreundet.«
»Tragisch«, murmelte der Bergpfarrer. »Da war das Madel also sieben Jahre, als es seine Eltern verloren hat.«
Severin nickte. »Es war ein furchtbarer Schicksalsschlag. Als hätt’ der Johannes geahnt, dass es notwendig werden würd’, hat er für den Fall, dass ein solches Unglück geschieht, zusammen mit seiner Frau verfügt, dass ich im Falle des Falles die Vormundschaft für die Christina übernehmen soll. Natürlich hat er das mit mir und meiner Frau – Gott hab’ sie selig –, abgesprochen. Ich hab’ es damals für ziemlich übertrieben gehalten, wurde dann aber leider eines Besseren belehrt. Christinas Eltern haben auch verfügt, dass das Madel in dem Klosterinternat am Chiemsee aufwachsen soll. Eine weitläufige Verwandte von Johannes war in der Benediktinerinnen-Abtei Äbtissin, sie ist aber vor vier Jahren ebenfalls verstorben.«
»Dass du die Christina damals net zu dir genommen hast, ist möglicherweise der Grund dafür, dass sie kein engeres Verhältnis zu dir aufgebaut hat«, vermutete Sebastian.
»Das kann schon sein. Sie ist in dem Kloster unter strengen Regeln erzogen worden, und die Christina hat sich sehr gut in das Klosterleben eingewöhnt. Bis vor zwei Jahren hat’s für das Madel nur eines gegeben, nämlich dass es ebenfalls Nonne wird und bei den Benediktinerinnen bleibt. Sie ist seit fast zwei Jahren Postulantin. Jetzt sollte sich das Noviziat anschließen.«
»Sollte? Hat sich die Christina anders entschieden?«
»Ja. Man hat mir mitgeteilt, dass sie den Wunsch geäußert hat, das Kloster zu verlassen.«
»Dieser Wunsch kann doch net von einem Tag auf den anderen entstanden sein«, wunderte sich Sebastian.
»Ich habe keine Ahnung, was diesen abrupten Meinungswechsel herbeigeführt hat«, murmelte Severin. »Im Moment ist es so, dass ich, als ihr rechtlicher Vormund, mein Einverständnis erteilen müsste, damit sie das Kloster verlassen kann. In einem Vierteljahr wird die Christine allerdings volljährig, und dann kann sie selbst entscheiden.«
»Hast du mit ihr schon Verbindung aufgenommen?«
Severin nickte. »Ich hab’ mit ihr telefoniert und ihr angeboten, dass sie bei mir wohnt, bis sie auf eigenen Beinen stehen kann und sich ein Leben außerhalb des Klosters aufgebaut hat. Annette wär’ damit einverstanden, dass das Madel zu uns zieht, und auch die Traudl hätt’ nix dagegen, dass die Annette und ich Zuwachs erhalten. Die Wohnung wär’ groß genug, und junges Blut könnt’ unserer Hausgemeinschaft net schaden, meint sie.«
»Die Christina hat doch net etwa abgelehnt?«, kam es fragend von Sebastian.
»Sie will drüber nachdenken«, antwortete Severin.
»Und du willst abwarten, was dabei herauskommt«, folgerte der Bergpfarrer.
»Was bleibt mir denn anderes übrig? Irgendetwas hat das Madel gegen mich, was es ist, weiß ich net. Christina verhält sich mir gegenüber ausgesprochen distanziert. Ich kann sie aber auch net zwingen, mich zu mögen. Wie gesagt, in einem Vierteljahr ist sie achtzehn, und sie kann selber über ihr weiteres Leben bestimmen. Meine Vormundschaft endet dann.«
»Vielleicht solltest du zum Chiemsee fahren und unter vier Augen mit ihr sprechen«, schlug Sebastian vor. »Mach’ ihr klar, dass ein Leben außerhalb der Klostermauern für sie net einfach werden wird, wenn sie’s ablehnt, sich von dir unterstützen zu lassen. Sie kennt nix anderes als das Klosterleben. Sie hat weder einen Job noch eine Wohnung, wenn sie die Abtei verlässt. Ich vermut’, das Madel ist intelligent genug, um das alles zu bedenken und die richtige Entscheidung zu treffen.«
»Ja, intelligent ist die Christina. Ich hab’ ja die Verbindung mit dem Kloster nie abreißen lassen und war immer über ihren Werdegang informiert. Ihre Schulnoten sind hervorragend, ihr Verhalten hat nie Grund zu Klagen gegeben. Doch Christina hat vor einiger Zeit angefangen, sich auch von den Nonnen abzuschotten. Sie hat immer weniger Interesse am Klosterleben gezeigt, und die Äbtissin, mit der ich telefoniert hab’, meint auch, dass es das Beste wär’, sie herauszunehmen. Christina habe in den vergangenen Monaten mehr und mehr erkennen lassen, dass sie für ein Leben im Kloster net geeignet sei.«
»Dann hat’s auch keinen Sinn, sie überzeugen zu wollen, bei den Benediktinerinnen zu bleiben«, erklärte Sebastian. »Wie ich schon angeregt hab’, Severin: Fahr’ dorthin und red’ unter vier Augen mit dem Madel. Das ist der Rat, den ich dir geben kann. Vielleicht findest du heraus, was vorgefallen ist, dass die Christina plötzlich das Interesse an dem Kloster verloren hat. Möglicherweise braucht sie jemand, dem sie ihr Herz ausschütten kann.«
»Ja, Sebastian, das werd’ ich auch machen. Gleich am Montagfrüh setz’ ich mich in mein Auto und fahr’ zum Chiemsee. Noch ist es meine Aufgabe, mich um die Zukunft des Madels zu kümmern und gegebenenfalls in die richtigen Bahnen zu lenken.«
»Darauf trinken wir«, sagte Sebastian. »Auf gutes Gelingen!«
Sie stießen an und nippten vom Wein, dann setzten sie sich an den kleinen Schachtisch und setzten ihre Schachpartie fort.
Sophie hatte ein paar Happen gerichtet, die sie auf den Gartentisch stellte; Käsewürfel mit Weintrauben sowie Käsespießchen mit knuspriger Schinkenhülle. »Lassen S’ sich schmecken«, wünschte sie.
»Das tun wir«, erwiderte Sebastian voller Begeisterung. »Danke, Frau Tappert.«
Sie unterbrachen ihre Partie und setzten sich an den Tisch, um von den appetitlichen Happen zu kosten.
*
Am Montagmorgen machte sich Sebastian auf den Weg zum Rathaus. Als er das Vorzimmer des Bürgermeisters betrat und die Sekretärin freundlich gegrüßt hatte, sagte diese:
»Ebenfalls einen guten Morgen, Herr Pfarrer. Falls Sie zum Herrn Bürgermeister möchten, muss ich Sie leider enttäuschen. Der Herr Bruckner hat angeordnet, dass er ohne vorherige Terminabsprache nimmer zu sprechen sei. Der Wust an Arbeit, den er tagtäglich zu erledigen hat, lässt es nimmer zu, dass er – ähm, Leuten, die es net für nötig erachten, sich einen Termin geben zu lassen, seine kostbare Zeit opfert.«
»Na schön, mag ja sein, aber ich hab’ was Wichtiges mit dem Markus zu besprechen …«, versetzte Sebastian unbeeindruckt. Plötzlich stutzte er. »Sagen S’ mal, gilt das für alle, die ohne Terminvereinbarung kommen, oder hat er das nur meine Person betreffend angeordnet?«
»Na ja …« Die Sekretärin wich dem Blick des Pfarrers aus. Offensichtlich fühlte sie sich nicht sehr wohl in ihrer Haut. »Derart genau hat sich der Herr Bürgermeister dazu net geäußert, Herr Pfarrer«, druckste sie herum. »Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er an Sie gedacht hat, als er diese Anordnung herausgab. Ich kann gern mit Ihnen einen Termin vereinbaren, zu dem S’ wiederkommen können. Vielleicht sagen S’ mir auch, um was es geht, damit sich der Herr Bruckner gleich ein bissel drauf einstellen kann.«
»Das wär’ ja noch schöner«, brummte Sebastian, der sich auf diese Weise nicht ausbremsen lassen wollte. »Drum sind S’ jetzt so gut und melden mich dem Markus. Sagen S’ ihm, dass ich nur ein paar Fragen an ihn hab’ und seine kostbare Zeit net über Gebühr in Anspruch zu nehmen gedenk’.«
»Aber ich hab’s Ihnen doch gesagt, Herr Pfarrer: Ich darf niemand mehr vorlassen, der net …« Sie brach ab, denn die Verbindungstür zu Markus Bruckners Büro ging auf.
»Was ist denn los? Mit wem diskutieren … Ah, unser Pfarrer gibt sich die Ehre. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Wenn Sie höchstpersönlich zu mir kommen, dann ist irgendeine Kacke … Ich wollt’ sagen, dann kommen S’ in einer wichtigen Angelegenheit. Wo brennt’s denn, Hochwürden?«
»Besprechen wir das am Besten in deinem Büro, Markus«, erwiderte Sebastian. »Ich komm’ zwar ohne Terminabsprache, aber die paar Minuten, die ich benötige, wirst du für mich übrighaben, denk’ ich.«
»Das ist doch selbstverständlich, Hochwürden. Treten S’ näher. Für wichtige Dinge bedarf’s keiner Terminabsprachen, und wenn Sie sich zu mir ins Rathaus bemühen, dann ist das gewiss net unwichtig.«
Er erntete von seiner Sekretärin einen vernichtenden Blick. Sie wandte sich pikiert ihrem Computer zu und begann auf die Tastatur einzuhämmern.
Sowohl der Pfarrer als auch der Bürgermeister waren ab diesem Moment Luft für sie.
Bruckner war zur Seite getreten und deutete in sein Amtszimmer. »Bitte, Hochwürden«, sagte er mit öliger Stimme, »nehmen S’ Platz. Im Sitzen spricht es sich doch viel leichter und vor allem bequemer.«
›So ein scheinheiliger Patron‹, dachte der Bergpfarrer und setzte sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch.
Das Gemeindeoberhaupt ging um das schwere Möbelstück herum, ließ sich dahinter nieder und musterte Sebastian über den Rand seiner Lesebrille hinweg.
»Die Order an deine Sekretärin gilt nur für mich, Markus, net wahr?«, sagte Sebastian und schaute dem Bürgermeister dabei in die Augen.