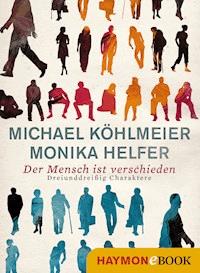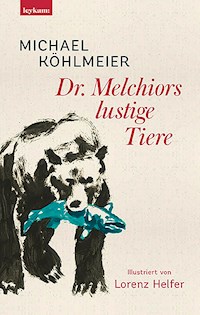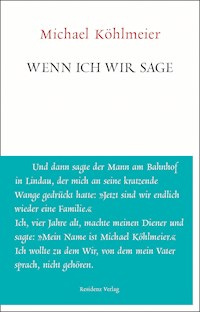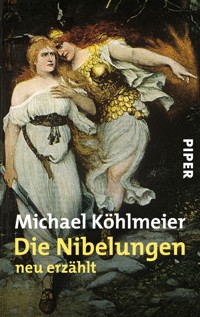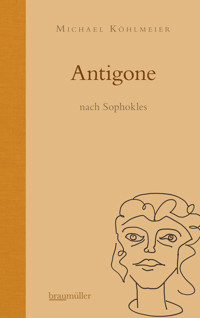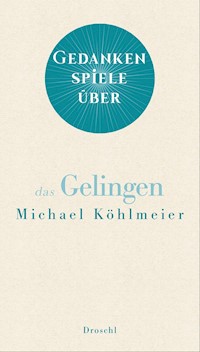6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gegen das Vergessen »Zum großen Bösen kamen die Menschen nie mit einem großen Schritt, sondern mit vielen kleinen, von denen jeder zu klein schien für eine große Empörung.« Michael Köhlmeier Nur etwas mehr als sechs Minuten sprach Michael Köhlmeier am 4. Mai in der Wiener Hofburg. Doch seine Rede hallte durch das ganze Land. Eindringlich und klar wandte er sich gegen all die Politiker, die derzeit fast im Wochenrhythmus antisemitische und rassistische Äußerungen von sich geben. Erstmals sind in diesem Band politische Reden des großen Erzählers Michael Köhlmeier zu lesen. Ein unerschrockener Kommentar zu der Politik unserer Tage, in der Verleumdung und Niedertracht hoffähig geworden sind. Ein wortmächtiger Appell, sich der Verheerungen des Faschismus bewusst zu bleiben und sich zu empören – über den schleichenden Verfall unserer politischen Kultur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Michael Köhlmeier
Erwarten Sie nicht, dass ich mich dumm stelle
Reden gegen das VergessenMit einem Nachwort von Hanno Loewy
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Erwarten Sie nicht, dass ich mich dumm stelle
Sehr geehrte Damen und Herren,
erwarten Sie nicht von mir, dass ich mich dumm stelle. Nicht an so einem Tag, nicht bei so einer Zusammenkunft. Ich möchte nur eines: den Ermordeten des NS-Regimes, von deren Leben die Schüler so eindringlich berichtet haben, in die Augen sehen können – und sei es nur mithilfe Ihrer und meiner Einbildungskraft.
Diese Menschen höre ich fragen: Was wirst du zu jenen sagen, die hier sitzen und einer Partei angehören, von deren Mitgliedern immer wieder einige, nahezu im Wochenrhythmus, naziverharmlosende oder antisemitische oder rassistische Meldungen abgeben, entweder gleich in der krassen Öffentlichkeit oder klamm versteckt in den Foren und sozialen Medien – was wirst du denen sagen? Willst du so tun, als wüsstest du das alles nicht? Als wüsstest du nicht, was gemeint ist, wenn sie ihre Codes austauschen, einmal von »gewissen Kreisen an der Ostküste« sprechen, dann mit der Zahl »88« spielen oder wie eben erst den Namen George Soros als Klick verwenden zu Verschwörungstheorien in der unseligen Tradition der Protokolle der Weisen von Zion? Der Begriff »stichhaltige Gerüchte« wird seinen Platz finden im Wörterbuch der Niedertracht und der Verleumdung.
Gehörst du auch zu denen, höre ich fragen, die sich abstumpfen haben lassen, die durch das gespenstische Immer-Wieder dieser »Einzelfälle« nicht mehr alarmiert sind, sondern im Gegenteil das häufige Auftreten solcher »Fälle« als Symptom der Landläufigkeit abtun, des Normalen, des »Kenn-ma-eh-Schon«, des einschläfernden »Ist-nix-Neues«? Zum großen Bösen kamen die Menschen nie mit einem großen Schritt, sondern mit vielen kleinen, von denen jeder zu klein schien für eine große Empörung. Erst wird gesagt, dann wird getan.
Willst du es dir, so höre ich fragen, des lieben Friedens willen widerspruchslos gefallen lassen, wenn ein Innenminister wieder davon spricht, dass Menschen konzentriert gehalten werden sollen?
Willst du feige die Zähne zusammenbeißen, wo gar keine Veranlassung zur Feigheit besteht? Wer kann dir in deinem Land in deiner Zeit schon etwas tun, wenn du die Wahrheit sagst?
Wenn diese Partei, die ein Teil unserer Regierung ist, heute dazu aufruft, dass die Juden in unserem Land vor dem Antisemitismus mancher Muslime, die zu uns kommen, geschützt werden müssen, so wäre das recht und richtig – allein, ich glaube den Aufrufen nicht. Antiislamismus soll mit Philosemitismus begründet werden; das ist genauso verlogen wie ehedem die neonkreuzfuchtelnde Liebe zum Christentum. Sündenböcke braucht das Land. Braucht unser Land wirklich Sündenböcke? Wer traut uns solche moralische Verkommenheit zu? Kann man in einer nahestehenden Gazette schreiben, die befreiten Häftlinge aus Mauthausen seien eine Landplage gewesen, und sich zugleich zu Verteidigern und Beschützern der Juden aufschwingen? Man kann. Mich bestürzt das eine, das andere glaube ich nicht. Wer das glaubt, ist entweder ein Idiot, oder er tut, als ob, dann ist er ein Zyniker. Beides möchte ich nicht sein.
Sie haben die Geschichten gehört, die von den Schülern gesammelt wurden, und haben sich vielleicht gedacht, ach, hätten diese armen Menschen damals doch nur fliehen können, und Sie wissen doch, dass es auch damals solche gegeben hat, die sich damit brüsteten, Fluchtrouten geschlossen zu haben.
Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich heute vor Ihnen sagen soll. Mir wäre lieber gewesen, man hätte mich nicht gefragt, ob ich hier sprechen will. Aber man hat mich gefragt, und ich empfinde es als meine staatsbürgerliche Pflicht, es zu tun. Wie leicht wäre es, all die Standards von »Nie-Wieder!« bis zu »Nie-Vergessen!«, diese zu Phrasen geronnenen Betroffenheiten aneinanderzuhängen, wie es für Schulaufsätze vielleicht empfohlen wird, um eine gute Note zu bekommen. Aber dazu müsste man so tun, als ob. Das kann ich nicht und will ich auch nicht, schon gar nicht an diesem Tag, schon gar nicht bei so einer Zusammenkunft. Ich möchte den Opfern, die mithilfe der Recherchen und der Erzählungen der Schüler und mit Ihrer und meiner Einbildungskraft zu mir und zu Ihnen sprechen und mir zuhören, ihnen möchte ich in die Augen sehen können – und auch mir selbst.
Mehr habe ich nicht zu sagen.
Rede am 4. Mai 2018 in der Wiener Hofburg zum Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Schriftsteller stellt sich vor, was sein könnte. Er imaginiert. Das tut jeder Mensch. Der Schriftsteller tut es in einem Buch, damit seine Vorstellungen in die Welt hinausgehen, und er tut es beruflich. Es ist sein Beruf, und manchmal ist es seine Berufung. Jedes Buch ist ein Blick in den Kopf eines Menschen, und dort lebt und webt eine ganze Welt. Wenn ein Mensch stirbt, stirbt eine ganze Welt. Und wenn niemand da ist, der an diesen Menschen erinnert, dann ist es, als ob er ein zweites Mal stirbt. Bücher sind dazu da, um uns beim Erinnern zu helfen. Ich möchte an dem Tag, an dem wir uns an die Verbrennung von Büchern erinnern sollen, an ein Kind erinnern.
Elfriede Frischmann wurde am 10. November 1933 geboren. Bis zu ihrem sechsten Lebensjahr lebte sie mit ihren Eltern Geza und Ella Frischmann in St. Pölten in der Franziskanergasse. Bald übersiedelte die Familie nach Wien in den 1. Bezirk, in die Dorotheergasse 6/13. Am 26. Jänner 1942 wurden Elfriede und ihre Eltern nach Riga deportiert und kurz nach der Ankunft ermordet. Elfriede Frischmann hat neun Jahre gelebt.
Mehr weiß ich nicht über dieses Kind. Von den Eltern weiß ich nur die Namen. Elfriede ist siebzehn Jahre jünger als meine Mutter und elf Jahre jünger als mein Vater. Mein Vater wurde zweiundsechzig Jahre alt, meine Mutter zweiundsiebzig. Sie hatten kein abenteuerliches Leben, aber ein gutes Leben. Sie konnten zusehen, wie Hoffnungen erfüllt wurden, wie Illusionen sich in Luft auflösten. Wenn man ihr Lachen und ihr Weinen messen könnte, würden sie Wochen füllen, vielleicht Monate. Sie hatten Zeit, über so vieles zu staunen, und konnten ihr Staunen an meine Schwester und mich weitergeben. Sie hatten genügend Zeit, um etwas Böses zu tun, und hatten genügend Zeit, um sich dafür zu entschuldigen und es wiedergutzumachen. Sie hatten genügend Gelegenheit, Gutes zu tun, und sie haben die Gelegenheit genützt. Elfriede Frischmann hat nur neun Jahre gelebt. Und alles, was ich über sie weiß, ist in sieben Zeilen gesagt.
Es gibt ein Bild von Elfriede Frischmann, ein einziges Bild, eine Fotografie. Das Mädchen schaut mir direkt in die Augen. Ich denke, es ist auf dem Bild nicht älter als vier Jahre. Die kleine Elfriede weiß nicht, dass ein Bild von ihr gemacht wird. Vielleicht hat ihr Vater, vielleicht hat ihre Mutter zu ihr gesagt: »Und nun, Elfriede, halte still, schau uns an und halte still.« Ihr Mündchen ist ein wenig offen, sie staunt, ist neugierig und will gehorchen. Ein rundes Gesichtchen hat sie. Die Haare sind auf der Stirn zu einem Pony geschnitten. Sie trägt ein ärmelloses Kleid mit Blumenmuster. Das Foto ist wohl im Sommer gemacht worden. Die molligen Ärmchen hält sie verschränkt. Dann sagt die Mutter oder der Vater: »Das hast du gut gemacht, Elfriede, sehr gut hast du das gemacht.« Und sie läuft auf die beiden zu und lacht und kichert, weil sie ihr Vater am Rücken kitzelt. Nach einer kleinen Zeit holen die Mutter oder der Vater das Bild beim Fotografen ab und zeigen es ihrem Töchterchen. »Das bist du, schau doch, Elfriede.« Und das Mädchen schüttelt den Kopf. Sie weiß ja nicht, wie sie aussieht. Es interessiert sie doch nicht, wie sie aussieht. Oder doch?
Im Talmud und im Koran heißt es in ähnlichem Wortlaut: »Wer einen Menschen tötet, für den soll es sein, als habe er die ganze Menschheit getötet. Und wer einen Menschen rettet, für den soll es sein, als habe er die ganze Welt gerettet.«
Nach dem 20. Jahrhundert ist uns kein Begriff des Bösen mehr geblieben, erst recht nicht eine archetypische böse Figur. Mephisto hat jeden Schrecken verloren, die Ungeheuer an den mittelalterlichen Kathedralen ebenso. Es ist uns keine unheimliche Vision geblieben, der wir entgegentreten könnten als etwas Fremdem, dem die Verworfenheit im Gesicht abzulesen ist, etwas Fremdem, das anders aussieht als wir. Selbst die schrecklichen Aliens aus den Werkstätten von Hollywood haben uns nie wirklich erschrecken können und waren doch erfunden worden, um den Schrecken mit dem Schrecken zu beschwichtigen. Wir sind begriffslos, seit wir das Böse nicht mehr von dem unterscheiden können, das uns ansieht, wenn wir in den Spiegel schauen. Im Gesicht von Adolf Eichmann ist nur Harmlosigkeit auszumachen, nichts als langweilige, humorlose Harmlosigkeit. Nun wissen wir es fest: Das Böse ist banal, wie Hannah Arendt schrieb. Aber diese Erkenntnis entsetzte uns nicht so sehr wie jene, die uns zugleich erreichte, nämlich, dass wir es immer schon wussten. Die Teufel, die wir erfunden hatten, dienten tatsächlich der Beschwichtigung und der Ablenkung. Die Teufel, die uns in der Literatur, in Märchen und Sagen begegnen, diese luziden Ungeheuer, sie wären angesichts des banalen Bösen nicht weniger erschrocken als wir einst vor ihnen.
Dies waren lange Zeit meine Gedanken, nachdem mir mein Vater das Buch Der gelbe Stern gegeben hatte. Zum ersten Mal sah ich Bilder von der Shoah. Ich war fünfzehn. Die Bilder der Halden von Leichen, die mit dem Caterpillar in Massengräber geschoben wurden, mochte ich nicht anschauen, ich ertrug es nicht, sie anzuschauen; und die Bilder der Überlebenden, ausgemergelt und verzerrt bis ins Monströse, auch diese Bilder mochte ich nicht ansehen, ich ertrug es nicht. Sie waren Helden, allein, weil sie Opfer waren. So, dachte ich, sehen die Helden unserer Zeit aus. Über mich wusste ich, dass ich kein Held bin. Mit den Opfern konnte ich mich nicht identifizieren. Ihr Leid war zu groß für mich. Also suchte ich in den Gesichtern der Täter, der Lageraufseher und -aufseherinnen, im Gesicht von Rudolf Höss, der konzentriert über Kopfhörer seinem Prozess lauscht, im Gesicht von Heinrich Himmler. Aber was suchte ich? Es waren verbitterte Gesichter, hämische Gesichter, böse Gesichter, und es waren harmlose Gesichter. Nichts in diesen Gesichtern wies über das Menschliche hinaus. Ich wusste, wenn ich verbittert war, wenn ich hämische Gedanken hegte, wenn ich auf jemanden böse war, würde mein Gesicht nicht anders aussehen. Das Ungeheuerliche, Unvergleichliche hatte in den Gesichtern dieser Menschen keine tiefen Spuren hinterlassen. Dorian Gray im gleichnamigen Roman von Oscar Wilde behält sein reines Gesicht, während sein gemaltes Portrait alle Spuren des Bösen, das er begeht, aufweist; und das Böse, das er begeht, ist doch nur ein bisschen im Vergleich zu …
Und dann hörte ich auf, mich mit den Tätern zu beschäftigen. Schwarze Heldenverehrung wollte ich nicht betreiben. Aber wie sollte ich mich erinnern an jene, die ausgelöscht wurden? Was sind das für Zeiten, wo die Erinnerung an einen Menschen ersetzt werden muss durch die Imagination, wo die Frage »Wer war er?« ersetzt werden muss durch die Frage »Wer hätte er sein können, wenn nicht …?«
Wer hätte Elfriede Frischmann sein können?