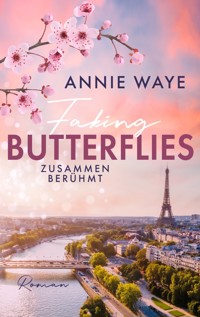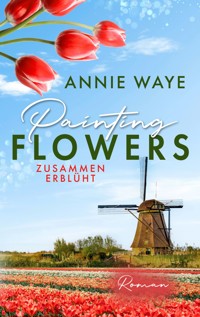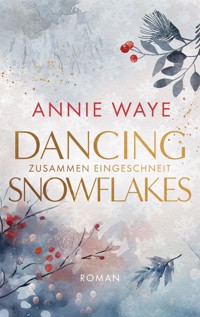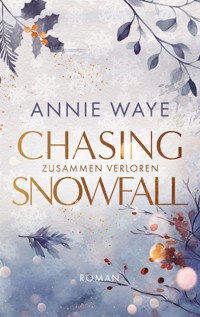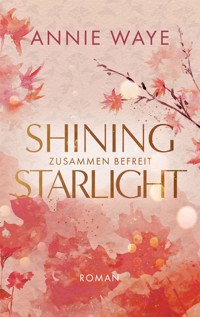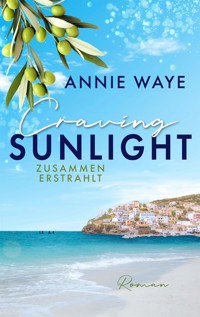2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Annie Waye
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist seine letzte Hoffnung, er ihre letzte Chance ...
Lea arbeitet schon ihr ganzes Leben lang auf ihren großen Traum hin: Endlich als Malerin und Bildhauerin bekannt zu werden. Als sie die Zusage für ein Kunstförderprogramm in der Toskana erhält, ist sie fest entschlossen, das Stipendium als Chance für ihren großen Durchbruch zu nutzen. Gemeinsam mit anderen Geförderten ein Kunstwerk erschaffen, das die Massen begeistert – das sollte sie doch hinbekommen, oder?
Wäre da nur nicht ihr Mitstipendiat Remo, der ihr von Anfang an das Leben schwermacht. Remo, der abgehobene italienische Bestsellerautor, mit dem sie sich ständig in die Haare bekommt. Remo, der die zugeknöpfte Lea regelmäßig aus der Reserve lockt und ihr einfach nicht aus dem Kopf geht …
***
Etwas in seiner Miene veränderte sich. Sein Blick nahm einen undeutbaren Ausdruck an, und eine kaum merkliche Falte bildete sich zwischen seinen Brauen. Es hielt mich nicht davon ab, meine Fingerspitzen in Richtung seines Munds schweben zu lassen und sanft seine perfekten Lippen nachzufahren. Diese teilten sich leicht, und als Remos Hand meine fester umschloss, war es um mich geschehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Falling Leaves
Zusammen geträumt
Impressum
Annie Waye
c/o JCG Media
Freiherr-von-Twickel-Str. 11
48329 Havixbeck
© 2024 Annie Waye
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Emily Bähr
Lektorat: Lektorat Tintenglanz
Korrektorat: Franziska Hornhues
Am Ende dieses Buchs findest du ein Glossar.
Lovely Fall:
Falling Leaves: Zusammen geträumt
Shining Starlight: Zusammen befreit
ANNIE WAYE
Annie Waye ist eine junge Autorin mit einer alten Seele. Sie ist auf der ganzen Welt zu Hause und seit jeher der Magie der Bücher verfallen. Sie schreibt, um fremde und vertraute Welten zu erschaffen, sympathischen und zwiespältigen Charakteren Leben einzuhauchen und Dunkelheit und Stille aus den Herzen der Menschen zu vertreiben. Wenn sie nicht gerade an Romanen arbeitet, veröffentlicht sie Kurzgeschichten und bereist die Welt auf der Suche nach ihrem nächsten Sehnsuchtsort.
Instagram * TikTok * Newsletter * WhatsApp
Folge der Autorin auf Amazon, um keine Neuerscheinung zu verpassen!
Für alle, die den Herbst nicht nur mit Dunkelheit, sondern vor allem mit Licht verbinden wollen.
1. L'Opportunità
Wenige Stunden bis zum Beginn des Programms
Ich war fix und fertig. Und zwar ausnahmsweise nicht nervlich. Denn zum ersten Mal seit Jahren, vielleicht sogar in meinem ganzen Leben, schienen die Dinge endlich nach Plan zu laufen. Ich hätte mich beinahe so weit aus dem Fenster gelehnt, zu behaupten, dass ich meinem großen Traum ein winziges Stück näherkam. Ich, Lea, die zweiundzwanzigjährige Schulabbrecherin, die sich vor Jahren in den Kopf gesetzt hatte, Künstlerin werden zu wollen.
Nein, das stimmte nicht. Im Grunde genommen war ich schon Künstlerin. Es wusste nur noch niemand davon. Aber vielleicht würde sich das bald ändern.
Es war der frühe Nachmittag an einem Septembersamstag. Ich saß in meiner winzigen Wohnung am äußersten Rande Hamburgs vor meinem aufgeklappten Laptop, meine braunen Haare zu einem ordentlichen Seitenzopf geflochten, den ich an diesem aufregenden Tag jederzeit in Windeseile neu machen konnte, um nicht wie dahingerotzt auszusehen. Das hatte ich wahrscheinlich auch nötig – schließlich stand mir noch eine mehrstündige Reise bevor.
Seit geschlagenen zehn Minuten starrte ich die E-Mail an, die ich vor zwei Monaten bekommen und seither so sehr verinnerlicht hatte, dass mich ihr Text sogar bis in meine Träume verfolgte.
Ihr unglaublich irreführender Betreff: Congratulazioni! Die Mail war völlig zu Recht in meinem Spam-Ordner gelandet, wo ich sie erst mit Tagen Verspätung entdeckt hatte – und beinahe ungeöffnet dort gelassen hatte. Im letzten Sekundenbruchteil, bevor ich das Fenster geschlossen hatte, war mir plötzlich der Absender aufgefallen: Deutsch-italienische Kunstfördergesellschaft. So kreative Spammer konnte es unmöglich geben!
Auch Wochen, nachdem ich die Mail gelesen hatte, schlug mein Herz schier nonstop bei einem Puls von hundertachtzig. Es war die Zusage für ein Stipendium, das ich vor einem halben Jahr auf ihrer deutschsprachigen Website gefunden und für das ich mich beworben hatte – mit einem verdammten Papier-Portfolio, das mir beinahe den letzten Nerv geraubt hatte! Und das internationale Porto mein letztes Kleingeld.
Doch es hatte wirklich geklappt. In wenigen Stunden würde ich das Aufenthaltsstipendium offiziell antreten und nach Florenz fliegen – der Künstlerstadt schlechthin! Donatello, Leonardo da Vinci, Michelangelo – alle großen Namen waren untrennbar mit dieser Stadt verbunden. Und womöglich ja bald auch meiner.
Entschieden klappte ich den Laptop zu und packte ihn als Letztes ein. Ich war viel zu früh dran, wurde aber trotzdem vom nagenden Gefühl befallen, als dürfte ich keine Zeit verlieren. Mein Traum wartete schließlich auf mich. Mein Traum, für den ich gut und gern ein paar Jahrhunderte zu spät geboren worden war.
Ich war Malerin und Bildhauerin. Zumindest, wenn es nach meiner selbstgebastelten Website ging, auf der ich versuchte, mich als genau solche zu präsentieren – mit unzähligen Fotos meiner neuesten Werke, die die Marke Lea Miller stärken sollten.
Um mir einen letzten Motivationsschub zu verpassen, öffnete ich auf meinem Handy meine Homepage und scrollte durch meine neuesten Fotos. Zumindest eines konnte man anhand dieser problemlos erkennen: dass ich nicht die geborene Fotografin war. Meine Zeichnungen von Möwen an der Alster, kleinere Lehmskulpturen von Feen und Elfen, mit den buntesten Farben bemalte Leinwände – all diese Dinge sahen im echten Leben so viel schöner aus, als es ein Foto jemals darstellen könnte.
Nicht, dass meine Fotografie-Skills auf der Website einen Unterschied machten. Ich konnte froh sein, wenn ich drei Aufrufe pro Monat bekam. Und ich konnte schwören, dass alle drei von meiner Mutter stammten. Nicht, dass die das jemals zugeben würde – die Frau, die mich über alles geliebt hatte, bis ich die Schule abgebrochen hatte. Die meine Ziele erst belächelt und mich dann, als es ernst geworden war, für wahnsinnig erklärt hatte.
Entschieden schloss ich meine Website. Meine Mutter würde mich nie verstehen. Dennoch wünschte sich ein Teil von mir, dass sie es war, die meine Updates verfolgte und vielleicht doch ein klein wenig stolz auf mich war. Wenn nicht auf meine Kunst, dann auf den bodenständigen und ehrbaren Beruf, den ich nach meinem Schulabbruch erlernt hatte: Ich war Steinmetzin. Der absolut weiblichste und modernste Job überhaupt.
In drei Jahren Ausbildung hatte ich alles gelernt, was ich über die Bildhauerei wissen musste – na ja, in der Theorie zumindest. Denn genau wie früher im Kunstunterricht war es nur darum gegangen, andere nachzumachen. Keinen einzigen Tag über hatte ich Wert auf das legen können, was ich verwirklichen wollte.
Ach ja, und ich war nur für Grabsteine zuständig. Das war auch ein Problem.
Es war Mitte September, aber noch ziemlich warm, als ich mit einem riesigen Koffer bepackt meine Wohnung verließ und zu dem Taxi marschierte, das ich mir gerufen hatte. Zum Glück wurden die Reisekosten von der DIKFG erstattet – eine Abkürzung so lang, dass man genauso gut beim vollständigen Begriff bleiben könnte. Ich war so was von auf ihre Unterstützung angewiesen, denn es hatte sich herausgestellt, dass meine Geldquellen erschöpft waren. Und damit meinte ich nicht zuletzt meine Eltern, die mir in dem Moment den Geldhahn zugedreht hatten, in dem ich die Schule geschmissen hatte.
Ich war froh, dass mir der Taxifahrer den Koffer abnahm und ich mich auf den Rücksitz sinken lassen konnte. Ich warf einen Blick aus dem Fenster und fragte mich, ob es auch nur einen einzigen Menschen in diesem ganzen Land gab, dem ich fehlen würde – oder dem wenigstens auffallen würde, dass ich weg war. Wenn das Leben einer Künstlerin kein einsames war, dann das einer Person, die sich in ihrem Alltag mehr mit Toten beschäftigte als mit allem anderen.
Ein kleines Trostpflaster: Zumindest mein Chef hatte ein Problem damit gehabt, dass ich ging. Aber nicht meinetwegen. Er hatte mir einfach nur keine zwei Wochen Urlaub am Stück genehmigen wollen – und das auch noch im September! Die Aussage verstand ich bis heute nicht. Starben im Herbst besonders viele Leute? Oder wirkte sich das nahende Halloween nächsten Monat auf irgendeine verquere Weise auf das Bestattungsgeschäft aus?
Jedenfalls hatte mein Chef meinen Urlaubsantrag für meinen Aufenthalt in Florenz abgelehnt. Also hatte ich gekündigt.
Der bloße Gedanke daran sorgte dafür, dass sich mir der Magen umdrehte. Was ist nur in dich gefahren, Lea?!, hatte mir meine Mutter an den Kopf geworfen, aber da ich seit der fünften Klasse selten etwas anderes von ihr gehört hatte, hatte es nicht sonderlich viel in mir ausgelöst.
Ich atmete tief durch und setzte mich aufrechter in den Sitz - erhobenen Hauptes und voller Stolz. So, wie ich mich der DIKFG präsentieren wollte.
Das hier war eine Chance. Nicht umsonst trug das Stipendium den klangvollen Namen L'Opportunità. Mit dieser Förderung sollte aufstrebenden Künstlern eine einmalige Gelegenheit gewährt werden, sich mit ihrem Können zu verwirklichen. Sie bestand aus einem zweiwöchigen Aufenthalt in einem Künstleratelier, das sich auf einem Weingut nahe Florenz befand - mitten in der Toskana! Was gab es Inspirierenderes?
Die Taxifahrt zum Flughafen und der Flug vergingen vollkommen ereignislos. Es gab keine Staus oder Verspätungen, keine verschwundenen Gepäckstücke, streikenden Piloten oder Massenpaniken – nicht einmal schreiende Kinder im Flieger. Die einzige Sache, die mir den Tag zu verderben drohte, war eine Textnachricht meiner Mutter, die mich fragte, was sie falsch gemacht hätte, dass ich mein Leben nun um jeden Preis wegwerfen wollte.
Ich antwortete nicht.
Vielleicht hätte mir die geradezu traumhafte Anreise eine Warnung sein sollen. Eine stille Warnung, dass die Dinge für meine Verhältnisse viel zu gut liefen und es nur eine Frage kürzester Zeit wäre, bis ich die Retourkutsche dafür bekam.
Es war die Ruhe vor dem Sturm.
Die Utopie entfaltete sich umso mehr, als ich am Flughafen von Florenz tatsächlich von einem Fahrer erwartet wurde – das Schild, auf dem groß und fett LEA MILLER stand, verriet ihn. Wie durch ein Wunder war er wirklich von der DIKFG angeheuert worden und kidnappte mich nicht im Namen der Mafia. Stattdessen fragte er mich zuerst auf Englisch, wo ich herkam, nur um mich dann in ein Gespräch in gebrochenem Deutsch zu verwickeln, weil ihm mein Englisch offenbar nicht gut genug war. Und das von einem Italiener.
»Und hatte Sie gute Reise?«, fragte er über die Schulter hinweg.
Es war inzwischen nach sechzehn Uhr. Wieder saß ich auf dem Rücksitz, den Blick aus dem Fenster gerichtet. Hier in Flughafennähe sah Florenz aus wie jede andere Stadt auch, aber ich konnte es kaum erwarten, die imposanten Bauwerke, die ich schon bei Google abgecheckt hatte, mit eigenen Augen zu sehen. »Sehr gut«, antwortete ich. »Überraschend gut. Zu gut, um wahr zu sein«, verpasste ich den richtigen Moment, den Mund zu schließen, und erntete einen irritierten Blick über den Rückspiegel.
Das Auto verließ gerade das Flughafengelände. Wir bogen einmal rechts ab – und dann trat der Mann mit einem Mal aufs Gas. Ich erschrak und kam mir von jetzt auf gleich doch gekidnappt vor.
Wir gewannen schnell an Tempo. Ich schluckte und kämpfte den Anflug von Panik herunter, der in mir aufsteigen wollte. Ich hatte hoch oben am Himmel keine Flugangst entwickelt, also würde ich jetzt nicht mit einer Autoangst anfangen!
Ich versuchte, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren: auf meinen Aufenthalt in der Toskana. Und auf die Kohle, die ich bekommen würde, wenn ich hier ablieferte: Allen Stipendiaten winkte eine halbjährige finanzielle Zuwendung von tausend Euro monatlich. Geld, das ich dann als Arbeitslose definitiv brauchen könnte. Einzige Voraussetzung war, während des Aufenthalts alle Bedingungen zu erfüllen, die an das Stipendium geknüpft waren. Ich hatte sie mir so oft durchgelesen, dass ich sie inzwischen sogar im Schlaf aufsagen könnte:
1.1 Verfolgen Sie während Ihres Aufenthalts ein künstlerisches Projekt.
1.2 Erarbeiten Sie Natur, Form und Umfang dieses Projekts gemeinsam mit den anderen Stipendiaten.
1.3 Nehmen Sie an der Auftaktveranstaltung, der Zwischen- und Abschlusspräsentation teil.
1.4 Zeigen Sie in der Zwischenpräsentation den aktuellen Stand Ihrer künstlerischen Tätigkeit.
1.5 Zeigen Sie im Rahmen der Abschlusspräsentation das fertige Werk, das gemeinsam mit den anderen Stipendiaten erarbeitet wurde. Das Objekt soll einen starken persönlichen und regionalen Bezug zu Ihrem Aufenthalt in der Toskana haben.
... und so weiter und sofort. Unter vielen der Punkte konnte ich mir kaum etwas vorstellen – angefangen mit den anderen Stipendiaten, mit denen ich mir das Atelier teilen würde.
Bisher hatte ich keine Details über meine zukünftigen Mitbewohner erhalten, aber rein rechnerisch gesehen war es wahrscheinlicher, dass ich dort auf andere Maler und nicht auf Bildhauer treffen würde. Mein Herz schlug höher, als ich mir vorstellte, wie wir gemeinsam die größte Leinwand bemalten, die die Welt je gesehen hatte. Jeder würde seine eigene Persönlichkeit, seine Lebenserfahrungen, Wünsche und Träume, seinen Stil im Gesamtkunstwerk einbringen, und ich fragte mich, wie mein Anteil darin aussehen würde.
Vielleicht begann mein Puls aber auch nur deshalb zu rasen, weil mein Fahrer wie der letzte gesuchte Verbrecher durch Florenz' Straßen hetzte.
»Erste Mal in Firenze?«, fragte er weiterhin freundlich und interessiert und entspannt, völlig ungeachtet der Tatsache, dass wir jetzt schon zwanzig Stundenkilometer zu schnell fuhren. Das Bein ließ er immer noch durchgedrückt.
Ich atmete tief durch, um mich zu entspannen. Schließlich sollte das hier die beste und vielleicht entscheidendste Zeit meines Jahres (oder Lebens) werden. Von so etwas durfte ich mich nicht aus der Ruhe bringen lassen! »Ja, es ist sogar mein erstes Mal in ...« Wir bretterten um eine Kurve, und ich verschluckte mich an mir selbst. »... I-Italien!«
Inzwischen bewegten wir uns durch den interessanten Teil der Stadt. Ältere, beinahe kunstvoll aussehende Gebäude reihten sich an modernere Bauten und kämpften um das sanfte Licht der Nachmittagssonne. Ihr Zustand war teilweise strahlend schön, teilweise glichen sie Ruinen – kein seltener Anblick in Südstaaten, wie ich gehört hatte. Nur zu gern hätte ich sie genauer in Augenschein genommen, doch inzwischen kam es mir so vor, als wären wir so schnell, dass die Gebäude miteinander zu verschwimmen schienen.
»Oh, dann soll ich etwas erzählen!«, verkündete mein Fahrer gut gelaunt, während er mit vollem Karacho über eine Kreuzung rauschte, gerade so zwischen zwei Autos hindurch, die uns um ein Haar in beide Seiten gekracht wären.
Ich schluckte. »M-müssen Sie denn so schnell fahren?«, würgte ich doch noch hervor und fühlte mich sofort, als hätte ich ihn gerade persönlich beleidigt.
Mein Fahrer lachte in sich hinein. »Warte Sie, bis ich aus Stadt bin!«
»Was?« Mir dämmerte nur langsam, dass er meine Worte in den falschen Hals bekommen hatte. Genauer gesagt dann, als sich die Häuser allmählich lichteten und der Mann auf die Tube trat. Ein Ruck ging durch meinen ganzen Körper, und mein Herz drohte aus meinem Rücken zu springen und in meinen Sitz gedrückt zu werden.
Zu allem Übel glaubte mein Fahrer auch noch, jetzt wäre ein guter Augenblick, um sich nach mir umzusehen. »Wo in Deutschland komme Sie?«
Ich widerstand dem Drang, mich am Türgriff festzuklammern - oder die Tür zu öffnen und rauszuspringen, solange ich noch konnte. Warum sah der Kerl nicht nach vorne? So was passierte normalerweise nur in Katastrophenfilmen, ehe sich ein riesiger Riss im Boden auftat. Oder in Science-Fiction-Filmen, Augenblicke bevor die Aliens landeten. Oder in Zombiefilmen, wenn sich die sonst so langsamen Zombies mit einem Schlag vor das Auto beamten und alle Insassen in Stücke rissen!
Kurz gesagt: Das hier fühlte sich ganz und gar nicht gut an.
Ich räusperte mich. »Ähm, könnten Sie -«
»Ich war eine Mal in Deutschland.« Der Mann renkte sich halb den Kopf aus wie eine eingerostete Eule. »Kenne Sie Monaco?«
Verzweifelt ließ ich die Schultern hängen. Wie kam er denn jetzt von Deutschland auf Monaco? »Klar kenne ich Monaco. Könnten Sie –«
»Die hatte sehr gute Bier. Aber Essen war furchtbar!«
Ich schnappte nach Luft, als wir geradewegs auf eine rote Ampel zurasten. »K-könnten Sie bitte nach vorne sehen?«
Der Fahrer lachte nur, drehte dann jedoch endlich den Kopf in die richtige Richtung. Die rote Ampel überfuhr er trotzdem.
Dass wir an unserem Ziel ankamen, bahnte sich in meiner Wahrnehmung gar nicht erst an. Der Fahrer fuhr ohne Navi und wurde nicht einmal dann langsamer, als wir den Parkplatz des imposanten, im Renaissance-Stil erbauten Gebäudes erreichten. Stattdessen trat er in dem Moment hart auf die Bremse, in dem wir vor der Tür ankamen, und mein Körper wurde so abrupt nach vorne geworfen, dass ich mir die Stirn beinahe an seiner Kopfstütze angeschlagen hätte.
Mein Herz schlug mir bis zum Hals, und ich riss meine Finger regelrecht in Richtung Gurt, ohne den ich bestimmt schon zwischen den Sitzen hindurch durch die Frontscheibe gekracht wäre. Meine Hände waren so zittrig und unruhig, dass ich drei Versuche brauchte, um die Vorrichtung zu öffnen. Ich hechtete förmlich aus dem Auto und riss meinen Koffer an mich, als der Fahrer ihn gerade so aus dem Kofferraum gehoben hatte.
Ich bedankte mich, hauptsächlich deshalb, weil ich noch am Leben war, und rollte mit meinem Gepäck auf das Gebäude zu, in dem die Auftaktveranstaltung von L'Opportunità stattfinden würde. Dabei handelte es sich um ein jahrhundertealtes Theater, das dem Internet zufolge nur noch für Veranstaltungen und Empfänge der Florentiner Stadtverwaltung genutzt wurde. Trotzdem sorgten die hellen Außenmauern mit ihren feinen, geradezu dürren Säulen, die ausladende Balkonbrüstung in einem der oberen Stockwerke und die bläulich anmutende Kuppel, von der aus ein Kreuz in den Himmel stach, dafür, dass mir Schauer des Respekts über den Rücken liefen. Dieses Theater war ein Kunstwerk für sich, und auf einmal fühlte ich mich nicht würdig, es auch nur zu betreten.
Doch in diesem Augenblick brauste der Fahrer davon, und ich hatte keine andere Wahl mehr.
Vor der zweiflügeligen Tür blieb ich noch einmal stehen und ging in mich. Das hier war der Anfang eines ganz besonderen Kapitels in meiner Biografie. Es war meineOpportunità. Meine ultimative Chance, etwas aus mir zu machen. Meinen Traum in Erfüllung gehen zu lassen – oder zu scheitern und ihn für immer aus meinem Leben zu verbannen.
Ab jetzt würde ich vierzehn Tage in Florenz verbringen. Und ich würde das Beste daraus machen. Wenn ich diese Stadt verließ, wäre ich ein neuer Mensch. Und ich konnte die bevorstehende Zeit kaum erwarten.
Das glaubte ich zumindest, als ich mich mit dem ganzen Körpergewicht gegen die schwere Tür stemmte und meinem Schicksal entgegentrat.
2. A teatro
14 Tage bis zum Ende des Programms
2.1 Die Auftaktveranstaltung
Die Auftaktveranstaltung dient in erster Linie dem gegenseitigen Kennenlernen der Stipendiaten. In einer zwanglosen Atmosphäre werden diese ausgewählten Mitgliedern der Deutsch-Italienischen Kunstfördergesellschaft vorgestellt. Bei entsprechender Anreise ist ein direkter Transfer vom Flughafen zum Veranstaltungsort und anschließend zum Atelier möglich. Es ist nicht erforderlich, eigene Schaustücke mitzubringen.
Ich hatte die Stipendiumsvereinbarung mehr als einmal gelesen. Ich hatte sie auswendig gelernt, sie regelrecht inhaliert. Ich hatte jede einzelne Zeile in mich aufgesogen und verstanden. Das hatte ich zumindest geglaubt. Bis jetzt, wo mir nach und nach klar wurde, dass ich die Welt nicht mehr verstand.
Es begann bereits am Eingang des Theaters. Bewaffnet mit meinem Reisegepäck, ließ ich mich von der Beschilderung geradewegs durch zwei menschenleere Gänge in Richtung Garderobe führen. Die Wände links und rechts von mir waren von prunkvollen Streben und vorhangartigen Konstruktionen geprägt, die nur hier und da Platz für alte Porträts von Adeligen ließen, deren Namen und Lebensdaten unter den Bilderrahmen vermerkt waren. Nachdem ich den Kopf mehrmals herumgerissen hatte, um auch ja alle Namen erhaschen zu können, stellte ich fest, dass es sich dabei ausschließlich um Medicis handelte. Und von denen hatte es offenbar mehr als genug gegeben.
Die Garderobe befand sich in einem kleinen, länglichen Raum und bestand im Kern aus einem Tresen, hinter dem sich unzählige Kleiderstangen und spindartige Möbelstücke erstreckten. Die beiden Mitarbeiterinnen waren dunkelhaarig, trugen imposante Dutts zu kurzen, schwarzen Kleidern und hatten ihre Gesichter bis zur Unkenntlichkeit mit Schminke zugekleistert. Trotzdem waren sie diejenigen, die mich geradezu betroffen anstarrten, als ich mit meinem Koffer und meiner roten Lederjacke auf dem Arm an den Tresen trat.
»Hi«, piepste ich vielmehr, als dass ich sprach, weil ihre mich musternden Blicke meine Lunge regelrecht zu durchbohren drohten. »Ähm ...« Ich öffnete den Mund, um mich auf Englisch vorzustellen, aber wenn es eine Sache gab, die mir überhaupt nicht lag, dann waren es Fremdsprachen. Oder Reden im Allgemeinen. Schließlich hatte ich in meinem Hauptberuf hauptsächlich mit Toten oder ihren seelisch gebrochenen Angehörigen zu tun.
Ich räusperte mich. »Lea Miller«, stellte ich mich vor und hoffte, dass sie mich auf dem Schirm hatten.
Die beiden Frauen wechselten einen irritierten Blick. »Cosa vuole da noi?«, fragte die eine in gedämpfter Stimme, als würde ich auf einmal perfekte Italienischkenntnisse entwickeln, wenn sie auch nur ein Dezibel zu laut sprach.
Sie hatten keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie viele Stipendiaten sie ausgewählt hatten, aber da sie zumindest schon mal aus zwei Ländern stammten, könnten es mehr als genug sein, um den Überblick zu verlieren.
»Forse si è persa«, antwortete die andere und schenkte mir ein gefrorenes Lächeln. »Where do you want to go?«, erkundigte sie sich schließlich in gebrochenem Englisch.
Ich spürte einen Stich in meiner Brust. »Here«, erwiderte ich unbeholfen, wollte noch etwas hinzufügen und tat es dann doch nicht, weil ich nicht wusste, wie. Es endete damit, dass die beiden Frauen und ich uns mit wachsender Verzweiflung anstarrten, ohne dass jemand auch nur einen ganzen Satz herausbekam.
»Buonasera«, ertönte plötzlich eine männliche Stimme in meinem Rücken. Mit einer Mischung aus Angst und Hoffnung wirbelte ich herum und blickte einem großgewachsenen, brünetten Italiener entgegen, der durch die Tür auf uns zustolzierte. Er hielt seine Jacke im einen Arm, in der anderen einen Geigenkoffer, und lächelte in die Runde, bis sein Blick auf mich traf. »Ciao.«
Ich spürte, wie mir das Blut in den Kopf lief. »Hi«, antwortete ich und betete, dass sie in Italien Ciao auch zur Begrüßung benutzten und ich nicht gerade auf galante Weise rausgeworfen wurde.
Die Miene meines Gegenübers erhellte sich. »Bist du auch Stipendiat?«, fragte er mit starkem italienischem Akzent, und ich stieß erleichtert die Luft aus meinen Lungen.
Eifrig nickte ich. »Ja!«, antwortete ich eine Spur zu überschwänglich. »Das bin ich!«
»Schön, dich kennenzulernen.« Er reichte seine Jacke über den Tresen und hielt mir eine Hand hin. »Ich heiße Benedetto.«
Gelöst schüttelte ich sie und war wahrscheinlich noch nie zuvor so froh gewesen, einen anderen Menschen kennenzulernen. Zum Glück, ein anderer Stipendiat! »Lea.« Benedetto – wenn das nicht mal der italienischste Name war, den ich je gehört hatte!
Er deutete auf mein Gepäck. »Der Koffer?« Wieder nickte ich, und er übersetzte für die beiden Angestellten. Eine Minute später war ich mein Gepäckstück und meine Jacke losgeworden und verließ, nur noch mit meiner dünnen Handtasche bewaffnet, Seite an Seite mit Benedetto die Garderobe. Schweigend. Er sagte kein Wort mehr, genauso wenig wie ich. Und aus irgendeinem Grund fühlte ich mich, als wäre ich allein verantwortlich für die Stille.
Mein Magen zog sich zusammen. Bis gerade eben hatte ich mich auf die anderen Stipendiaten gefreut, aber jetzt, wo ich einen von ihnen getroffen hatte, versetzte mich der Gedanke daran, dass es noch viel mehr geben könnte, in Angst und Schrecken. Wie sollte ich nur damit klarkommen?
Der Künstlerberuf war einsam. Mindestens so einsam wie der Beruf einer Steinmetzin. Ich konnte stundenlang die Inschriften auf den großen und kleinen Grabsteinen anstarren, die wir fertigten – meistens im Auftrag von Angehörigen, manchmal für die Nutzer selbst, weil man offenbar nie früh genug vorsorgen konnte. Ich verbrachte den lieben langen Tag damit, mir das Leben der Menschen auszumalen, für die die eingravierten Namen standen. Konnte über ihre Namensherkünfte und -klänge philosophieren und mich fragen, welchen Weg die dazugehörigen Menschen wohl hinter sich hatten. Konnte anfangen zu träumen, an fremde Orte fortzugleiten, die ich nicht in Worte, dafür jedoch umso mehr in Farben und Formen fassen konnte.
Zu alldem war ich fähig, weil ich eine Künstlerin war. Doch mehr als zwei Sätze am Stück mit ein und demselben Menschen zu wechseln? Ein Ding der Unmöglichkeit!
Und genau so ging es mir jetzt, als ich Seite an Seite mit Benedetto in der absoluten Totenstille durch den Gang schritt, ständig begleitet von den strengen, tadelnden Blicken von mindestens zwei Dutzend Medici, die die angespannte Stimmung nicht gerade auflockerten.
Ich schluckte. Ich besaß das Feingefühl eines Autounfalls und die Sozialkompetenz eines weißen Hais, der Blut roch. Meine letzten engeren Freundschaften und meine letzte Beziehung lagen schon mehrere Jahre zurück. Am Anfang meiner Ausbildung hatte ich noch geglaubt, ich könnte einfach alles im Leben haben, doch nach und nach war mir klar geworden, dass Erwachsene niemals alles haben konnten. Wer Kontakte pflegen wollte, musste insbesondere eines tun: Zeit investieren. Und über andere Dinge als seinen Job sprechen können.
Ich hatte nichts davon getan. Aber immerhin hätte ich jetzt zwei Wochen Zeit, und meine Gesprächspartner steckten alle in derselben Situation wie ich. So schwer konnte das doch nicht sein, oder? Zu sozialisieren? Kontakte zu knüpfen? Nicht wie der letzte Eisblock zu wirken?
Streng dich an, Lea!
Immer wieder schielte ich in Benedettos Richtung, bis sein Geigenkoffer einmal mehr in den Vordergrund meines Bewusstseins rückte. Ich ging keine Sekunde davon aus, dass das nur ein außergewöhnliches Transportmittel für seine liebsten Pinsel und Acrylfarben war.
»Du bist also Musiker, ja?«, würgte ich eher hervor, als dass ich Benedetto wie ein normaler Mensch ansprach.
Dieser ließ sich zum Glück nichts anmerken. Vielleicht weil er es im Gegensatz zu mir schaffte, nicht unglaublich viel in unglaublich wenig hineinzuinterpretieren. »Seit ich vier bin.«
»Wow.« Ein leichtes Lächeln erhellte meine Miene. Ein Musiker, kein Maler. Eigentlich keine Überraschung – welche Art von Kunst die DIKFG förderte, hatte sie auf ihrer Website ziemlich offengelassen. Und anscheinend hatten sie sich nun auch für einen Mix aus Kunstformen entschieden. Was Musik und Malerei betraf, bot die Verbindung so unglaublich viel Potenzial, dass ich es kaum erwarten konnte, im Atelier loszulegen. Denn wenn es eine Sache gab, die unumstritten war, dann, dass eine Kunstform die andere inspirierte. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, Musikstücke aufzuzählen, die von Malerei inspiriert worden waren - und andersherum.
Das hier würde etwas ganz Großes werden. Das konnte ich nur zu deutlich spüren.
Was ich aber auch spüren konnte, war meine wachsende Unsicherheit. Denn jetzt, wo ich allmählich auftaute, wurde mir eines schlagartig bewusst: Benedetto hatte einen Anzug an. Ich wiederum trug einen fusseligen schwarzen Pullover und eine Jeanshose, auf der ich im Flieger ein paar Tropfen Tomatensaft verteilt hatte.
Ein mulmiges Gefühl machte sich in mir breit. »Sag mal ... Gab es etwa einen Dresscode, von dem ich nichts weiß?«
»Dresscode?« Er blickte an sich herab. »Oh, nein, das ist nur für mich. Deinen Dresscode weiß ich nicht.«
Ich runzelte die Stirn. »Meinen Dresscode?« Hatten die verschiedenen Künstler unterschiedliche Verträge bekommen?
Ich wollte mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das würde ein toller Abend werden. Mit Benedetto kannte ich wenigstens schon einen meiner Mitstipendiaten, und ich hätte es wirklich schlechter treffen können.
Ich war guter Dinge – so lange, bis wir um die letzte Ecke bogen und in den Festsaal traten. Der Festsaal, in dem ich regelrecht erschlagen wurde von Farben, Formen, Lichtern und vor allem Menschen.
Menschen in Abendkleidern und auf hochhackigen Schuhen. Menschen in Anzügen und mit Krawatten. Menschen, die sich Sekt und Häppchen auf Tabletts bis kurz vor ihre Münder bringen ließen. Menschen, die sich nach mir umsahen und die Nase rümpften, weil ich angezogen war wie die letzte Hamburger Obdachlose.
Die Welt um mich herum hörte auf, sich zu drehen. Hatte ich irgendeinen Newsletter, eine Rundmail verpasst? Wo war ich hier gelandet? Kein Wunder, dass die Garderobenfrauen keine Sekunde lang davon ausgegangen waren, dass ich rechtmäßig hierhergehörte. In diesem Moment fing ich sogar selbst an, es anzuzweifeln.
In einer zwanglosen Atmosphäre, hatten meine Unterlagen angekündigt. Was hatte das zu bedeuten gehabt? War das ein Übersetzungsfehler gewesen oder so? Denn nichts an dem Anblick, der sich mir bot, war auch nur im Entferntesten zwanglos. Im Gegenteil. Binnen Sekunden hatte ich das Gefühl, als würde mir die Luft zum Atmen weggesaugt werden. Meine Kehle war wie zugeschnürt, und ich fühlte mich von Dutzenden Blicken durchbohrt, als ich mich zwischen den Stehtischen und den Häppchen- und Sekt-tragenden Bedienungen vorbeiquetschte.
Dies war kein zwangloses Kennenlerntreffen. Es war ein verdammter Gala-Empfang. Wo in aller Welt war ich hier gelandet?
Reiß dich zusammen, Lea!, versuchte ich mich zu beruhigen. Schließlich waren all diese Menschen einzig und allein meinetwegen hier. Na ja, und wegen der anderen Stipendiaten. So etwas Großes hatte ich noch nie erlebt, geschweige denn, dass ich in dessen Mittelpunkt gestanden hätte.
Dies war etwas ganz Besonderes. Und wenn der Aufenthalt in Florenz so lief, wie ich hoffte, dann könnte das hier zukünftig Teil meines Alltags werden. Dann würde ich noch viele Empfänge besuchen, Vernissagen abhalten, Künstler und Kunstbegeisterte kennenlernen, meinen Traum leben.
Mein Versuch, positiv zu denken, glückte, und mein Herz schlug wieder höher. Das hier würde einfach nur super werden! Und was meine Kleidung betraf ... gab es jetzt kein Zurück mehr. Was soll's.
Der Festsaal bestand aus einer erhöhten Bühne mit weinroten Vorhängen auf der mir gegenüberliegenden Seite. Bis dorthin erstreckte sich ein Meer aus Stehtischen, festlich gekleideten, gut betuchten Männern und Frauen jeden Alters - jedes Alters über fünfzig – und einem riesigen Kronleuchter, der von der Decke hing und unter dem ich nicht guten Gewissens hindurchlaufen konnte. Schon nach wenigen Schritten wurde ich langsamer, und Benedetto tat es mir gleich. »Okay, ähm, wo müssen wir denn jetzt hin?«
Ratlos sah er mich an. »Non lo so. Ich muss da hin.« Er hob eine Hand wie zum Abschied und marschierte dann einfach davon.
Irritiert sah ich ihm nach. Warum lief er denn jetzt weg? Wenn er irgendwo zu sein hatte, war die Wahrscheinlichkeit doch verdammt groß, dass für mich dasselbe galt!
Inzwischen war ich fest davon überzeugt, dass ich eine Seite des Vertrags übersehen hatte. Dass zwei Blätter zusammengeklebt gewesen waren (in der PDF!), dass sie eine vergessen hatten, dass ich sie inhaliert und dann im Schlaf wieder ausgehustet hatte – irgendetwas. Eine andere Erklärung gab es nicht.
Schlagartig fiel mir auf, dass ich mutterseelenallein in einer Menge aus deutsch-italienischen Fördermitgliedern stand, die mich mit den unterschiedlichsten Gesichtsausdrücken beäugten, und mir wurde angst und bange zumute. Unbeholfen stolperte ich Benedetto hinterher – bis zu den Stufen, die zur Bühne hinaufführten.
Ich war die Einzige, die davor Halt machte. »Was machst du denn da?«
Er warf mir einen verwirrten Blick über die Schulter zu, setzte seinen Weg jedoch fort. Weil mich keine zehn Pferde dazu bringen könnten, ohne Einladung ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu treten, blieb ich, wo ich war, und beobachtete ihn dabei, wie er die Bühne überquerte. In dessen hinteren Teil stand bereits ein Klavier, das vielleicht für einen anderen Stipendiaten aufgestellt worden war – und das, obwohl wir doch keine Werkstücke hatten mitbringen sollen! Klar, Benedetto war kein Geigenbauer – zumindest nicht, dass ich wüsste –, also war sein Instrument gewissermaßen kein Werkstück. Aber gehörten unsere Fähigkeiten nicht irgendwie auch dazu?
Dort angekommen, packte er seine Geige aus, deponierte ein paar Notenblätter auf einem Ständer neben dem Klavier und begann einfach zu spielen. Ohne, dass ihn jemand begrüßt, aufgefordert oder auch nur eines Blickes gewürdigt hätte. Als wäre er ein verdammter Geist.
Meine Schultern sackten herab. Gehörte das noch zum Vertrag? Sollten die Stipendiaten unkontrolliert die Bühne stürmen und ihr Können zur Schau stellen? Aber was in aller Welt sollte ich dann machen? Dort oben befand sich weder eine Staffelei noch ein Klumpen Lehm oder ein Stein noch irgendwas, womit ich etwas anfangen könnte.
»Ciao!« Ich fühlte mich schon wieder unglaublich rausgeworfen, als die männliche Raspelstimme in meinem Rücken ertönte.
Ich erblickte einen alten, dicken Mann, der mich mit seinem Vollbart an einen italienischen Weihnachtsmann erinnerte. Ehe ich auch nur versuchen konnte, ihn wiederzuerkennen oder zu begrüßen, hatte er mich plötzlich bei den Schultern gepackt und mir einen Kuss auf die Wange gehaucht.
Ich versteifte mich am ganzen Körper, zuckte zurück - und konnte doch nicht verhindern, dass er auch meine andere Wange behandelte.
Bevor ich meinem Impuls folgen konnte, mich loszureißen und ihm eine zu klatschen, ließ der bebrillte Mann von mir ab. »Lea Miller!«, begrüßte er mich und gab mir endlich den Moment der Erlösung, zu wissen, dass mich der Fahrer im Eifer des Gefechts nicht in der falschen Stadt ausgesetzt hatte. »Wie schön, dass Sie hier sind!« Genau wie der Rest der Mannschaft trug er einen Anzug, und jetzt, wo er mich nicht mehr abknutschte, erkannte ich ihn von den Website-Fotos als einen der Vorsitzenden der DIKFG wieder. »Vittorio Bianchi«, stellte er sich überschwänglich vor und ignorierte die Hand, die ich ihm zum Schütteln hinhielt, geflissentlich. Wahrscheinlich war das Abküssen bereits genug der Begrüßung gewesen. »Dann haben wir schon mal Nummer eins von zwei.«
Meine Augen wurden groß. »Zwei?« Es gab nur zwei Stipendiaten? Das bedeutete doch ...
Mein Herz machte einen Satz. »Nummer zwei ist –« Ich drehte mich um und hob den Arm, um auf Benedetto zu zeigen.
Benedetto, der nicht länger allein war. In diesem Augenblick setzte sich jemand zu ihm ans Klavier. Die beiden nickten einander zu, dann stieg der Pianist ins Stück ein.
Hä? Jetzt kam ich nicht mehr mit. Zählten die vielleicht als eine Person, weil sie immer als Duo auftraten, oder ...?
Auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Etwas, das mir von vornherein hätte auffallen können. Die Tatsache, dass er Musiker war. Seine Geige dabei gehabt hatte. Sich deutlich besser ausgekannt hatte als ich. Einem Dresscode unterlag. Keinen Plan gehabt hatte, wovon ich die ganze Zeit gefaselt hatte. Und wie selbstbestimmt er auf die Bühne gegangen war, um zu spielen.
Benedetto war kein Stipendiat. Die hatten ihn einfach nur für die musikalische Untermalung des Abends gebucht.
Augenblick. Warum hatte er mich dann gefragt, ob ich auch Stipendiat sei? Etwa nur, weil er meine bessere Hälfte bereits getroffen hatte? Und ich hatte ihn völlig falsch verstanden.
Mir lief es eiskalt den Rücken runter. Ich war seit fünf Minuten hier und hatte mich schon mehrmals bis auf die Knochen blamiert.
»Ah!«, sagte Bianchi plötzlich, den Kopf halb zur Seite gedreht und den Blick in die Menge gerichtet. »Da haben wir ihn ja! Damit kann es auch schon losgehen.«
»L-losgehen?«, fragte ich verdattert, doch Bianchi war bereits an mir vorbei und auf die Bühne gestürmt.
Was dann passierte, würde ich im Nachhinein nur noch als einzigen Albtraum bezeichnen können. Er begann damit, dass Bianchi Benedetto und den Pianisten zum Schweigen brachte, wo sie doch gerade erst angefangen hatten zu spielen. Er schleppte einen Mikrofonständer ins vordere Zentrum der Bühne und klopfte auf das Mikro, das sich mit einem lauten Quietschen beschwerte, das im ganzen Saal widerhallte – und somit auch alle anderen Leute verstummen ließ.
Wie bestellt und nicht abgeholt stand ich neben der Bühne, zupfte meinen Seitenzopf zurecht und suchte die Menge nach dem zweiten Stipendiaten ab. Da es ein Höchstalter von dreißig Jahren für die Bewerbung gegeben hatte, ging ich davon aus, dass es nicht schwer wäre, in dieser Seniorengesellschaft fündig zu werden, aber Fehlanzeige.
Bianchi auf der Bühne begann indes zu reden, und zwar auf Italienisch. Und er machte immer weiter damit. Auf Italienisch. Wie gebannt starrte ich in seine Richtung und wartete darauf, dass eine Übersetzung folgte: aus seinem Mund, dem eines Dolmetschers oder von mir aus von Siri, Alexa oder welches Programm sie auch immer benutzten.
Aber das geschah nicht. Alles, was auf Bianchis Worte folgte, war ein tosender Applaus, der meinen Puls ins Stocken brachte und einen Schub der Nervosität durch meinen Körper jagte. Mir schwante, was gleich folgen würde.
»E ora posso presentarvi ...«, wurde Bianchi umso lauter, um den Beifall ja zu übertönen. »... la pittrice e scultrice.« Als er den Kopf drehte und mich ansah, war es, als würde mich Jupiters Blitz treffen. »Lea Miller.«
Wieder applaudierten die Leute, und auf einmal bekam ich das Gefühl, als läge die Aufmerksamkeit des gesamten Saals erneut auf mir und meinen Gammelklamotten. Umso mehr noch, als mich Bianchi eifrig zu sich nach oben winkte.
Mein Kopf musste wie eine übergroße Tomate anlaufen. Mit bleischweren Beinen stieg ich die drei Stufen zur Bühne hinauf – und schaffte es irgendwie, auf halber Strecke auszurutschen. Bevor ich wirklich fallen konnte, fing ich mich mit meinen ausgestreckten Armen ab, und Schmerz zuckte durch meine Hände.
Mehrere Gäste sogen erschrocken die Luft ein, und ich wünschte, ich würde an Ort und Stelle sterben. Umständlich versuchte ich, mich aufzurappeln, doch mein rechter Fuß hatte es irgendwie geschafft, sich im Leerraum zwischen zwei Stufen zu verhaken. Mit einem Ruck zog ich daran ... und bekam ihn einfach nicht heraus.
Scheiße!, schrie ich mich innerlich selbst an - und spürte einen Griff an meinem Fußgelenk.
Instinktiv wollte ich um mich treten, aber nicht mal das bekam ich hin. Ich riss den Kopf herum – und sah in die braunen Augen eines Mannes in meinem Alter, der meinen Fuß mit einer einfachen Bewegung aus der Stufe befreite. Mein Blick wollte an seinen hohen Wangenknochen und seiner unglaublich markanten Kieferpartie hängenblieben, an seinen wilden braunen Haaren oder seinen Klamotten, die auf die Schnelle nicht annähernd so festlich wirkten wie die der anderen Leute hier. Doch er haftete lediglich am Ausdruck in seinen Augen: ein entgeisterter Ausdruck, weil er sich wohl fragte, aus welcher Anstalt ich ausgebrochen sein mochte.
Was gerade abging, realisierte ich erst, als der Applaus abebbte. Jetzt war ich mir ziemlich sicher, dass alle Blicke auf mich gerichtet waren, in der Totenstille, die einzig und allein mir galt, dem deutschen Fremdkörper auf einer durch und durch italienischen Veranstaltung.
Hastig kam ich auf die Füße und stolperte zu Bianchi hinüber – wie durch ein Wunder, ohne nochmal hinzufallen und ihn mit mir von der Bühne zu werfen. Dieser schenkte mir einen Blick, als bereute er es, mich überhaupt eingeladen zu haben. Dann wandte er sich erneut den Gästen zu.
»È ora il mio più grande piacere presentarti il nostro ospite d’onore«, ratterte er so schnell herunter, dass ich ihn wahrscheinlich nicht mal mit fließenden Italienischkenntnissen verstanden hätte. Plötzlich machte er eine ausschweifende Armbewegung in meine Richtung und verpasste mir beinahe einen saftigen Schlag mit der Rückhand. Im letzten Moment lehnte ich mich zur Seite und entging dem Hieb, als er förmlich brüllte »Salutami con me: Remo de Luca!«