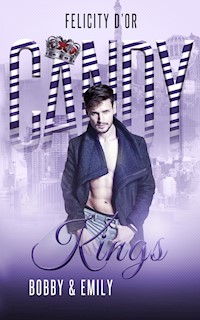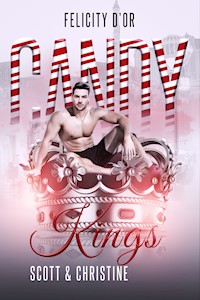4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was passiert, wenn ein berüchtigter Lord und eine mittellose Arzttochter aufeinandertreffen? Sie gehen in die Luft! Als Henry Digbys langjährige Freunde von den Fortuna‘s Lovers plötzlich Heirat und Familie planen, statt sich den von ihm erdachten skandalösen Wetten zu widmen, ist er mehr als verärgert. Er will seine Aufgabe unbedingt lösen, um es den Lords zu zeigen. Doch dazu ist er auf Hilfe angewiesen. Hilfe, die er nur bei Winifred Masterson, einer verzweifelten jungen Frau aus der Mittelschicht, findet. Ohne über die Konsequenzen nachzudenken, macht Henry ihr ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Während er und Winifred sich über ihre gemeinsame Arbeit näherkommen, zieht sich um Henrys Hals eine Schlinge zusammen. Unbemerkt ist er zum Zentrum einer Intrige geworden, die ihn alles kosten könnte. In einem rasanten Showdown über den Wolken findet Henry heraus, wer seine wirkliche Liebe und seine Freunde sind. Eine Regency-Romance über Freundschaft und wahre Aristokratie, die aus dem Herzen kommt, gewürzt mit prickelnden Szenen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Fortuna's Lovers
Band 4
Vollendung
Von Felicity D'Or
Impressum
1. Ausgabe Februar 2024
© Felicity D’Or 2024
Alle Rechte vorbehalten.
Covergestaltung: Holly Perret, The Swoonies Romance Art
Korrektorat: Sabine Klug
Herausgeberin:
Veronika Prankl
Auenstraße 201
85354 Freising
felicitydor.books@gmail.com
Sämtliche Texte und das Cover dieses Buches sind urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung oder Weitergabe ohne Genehmigung des jeweiligen Urhebers oder Rechteinhabers ist nicht zulässig und daher strafbar.
Fortuna's Lovers
Band 4
Vollendung
Von Felicity D'Or
Inhalt
Kapitel 14
Kapitel 211
Kapitel 316
Kapitel 422
Kapitel 527
Kapitel 633
Kapitel 738
Kapitel 842
Kapitel 948
Kapitel 1055
Kapitel 1162
Kapitel 1267
Kapitel 1373
Kapitel 1480
Kapitel 1585
Kapitel 1690
Kapitel 1796
Kapitel 18101
Kapitel 19106
Kapitel 20111
Kapitel 21117
Kapitel 22124
Kapitel 23130
Kapitel 24135
Kapitel 25142
Kapitel 26147
Kapitel 27152
Kapitel 28160
Kapitel 29166
Kapitel 30172
Kapitel 31178
Kapitel 32183
Kapitel 33189
Kapitel 34194
Epilog200
Kapitel 1
So hatte er sich das nicht vorgestellt!
Charles-Henri Digby, üblicherweise als schlichter Mr Henry Digby bekannt, betrat sein Stadthaus nach einer langen und ereignisreichen Nacht. Das milchige Grau eines frühen Aprilmorgens kroch hinter ihm über die Straßen, erreichte aber sein abgedunkeltes Schlafzimmer nicht. Die dunkelgrünen Samtgardinen hielten das Tageslicht erfolgreich fern.
Henrys Kammerdiener Stone half ihm gewohnt effizient aus seinen Kleidern und erkundigte sich, ob sein Herr ein Bad wünsche.
„Nein danke, Stone. Jetzt nicht. Wecken Sie mich bitte zur Mittagszeit, sobald Sie ein Bad vorbereitet haben.“ Henry entließ den Kammerdiener und wusch sich über einer Waschschüssel den gröbsten Dreck der vergangenen vierundzwanzig Stunden vom Körper.
Seine Bediensteten waren daran gewöhnt, dass ihr Herr spät zu Bett ging und erst wenn die Sonne im Zenit stand, wieder zum Vorschein kam. Alles war wie immer, außer dass Henry dieses nagende Gefühl plagte, dass nichts wie immer war, nichts für immer währen konnte.
Er legte sich zu Bett und versuchte, seinen seltsamen Gedankengängen durch erholsamen Schlaf zu entkommen. Es wollte ihm nicht gelingen. Das Land der Träume entzog sich ihm ebenso wie die Gründe für seine Melancholie der letzten Wochen. Er hatte es auf Langeweile geschoben, hatte sich tagelang den Kopf zermartert, wie er und seine Freunde, die allseits nur Fortuna’s Lovers genannt wurden, ihrem Ruf gerecht werden konnten. Früher hatte ihn jedes Mal ein Fieber gepackt, wenn sie sich einer neuen Herausforderung stellten, hatte er sich enthusiastisch in ihre Expeditionen gestürzt, Partys und Wettkämpfe organisiert.
Die Freunde, namentlich Simon, Viscount Ingleford, Quentin, Baron Trent und Alexander Sidwell kannte Henry aus Cambridge. Sie waren bekannt dafür, dass sie durch die Katakomben von Edinburgh krochen, an einem Steinkreis, der zu Inglefords Besitz gehörte, eine druidische Orgie nachgestellt hatten und einen verheerenden Brand gemeinsam überlebt hatten. Wettrennen mit ihren Phaetons, Boxkämpfe, Schießwettbewerbe und dazwischen die schönsten Frauen des Landes. Daraus bestand ihr Leben.
Und sie gewonnen immer.
Sie waren die Geliebten der Schicksalsgöttin. Fortuna war ihnen gewogen.
Trotzdem konnte Henry das Gefühl nicht loswerden, dass sich etwas verändert hatte, dass das Schicksal plötzlich etwas anderes mit ihnen vorhatte.
Es fraß ihn förmlich auf.
Genau deshalb hatte er Ingleford, Trent und Sid in dieser Nacht – oder eher an diesem Morgen – in ihrem Clubraum bei Salter’s die Wetten vorgeschlagen. Erotische Aufgaben, ein Wettstreit unter ihnen, das musste doch dafür sorgen, dass sich dieses ungute Gefühl legte. Die Begeisterung seiner Freunde sollte ihn mitreißen, sollte die altbekannte Vorfreude auf außergewöhnliche Erlebnisse in den vier Gentlemen zum Brennen bringen.
Stattdessen hatten die anderen sich nur zögernd darauf eingelassen und Ingleford hatte zu allem Überfluss auch noch dafür gesorgt, dass die Wetten schier unerfüllbar wurden. Als wollte der Viscount Henrys Idee auf diese Weise torpedieren. Statt sich fleischlichen Genüssen hinzugeben, wurden sie mit ihren Schwächen und Fehlern konfrontiert.
Sidwell sollte sich von einer Dame nackt malen lassen. Das fand Henry noch einigermaßen amüsant, vor allem, weil sie das Gemälde irgendwann zu Gesicht bekommen müssten. Aber was hatte Sid davon, Modell zu sitzen? Wo blieb da der Spaß, die Herausforderung?
Dass Trent, dem sie alle in Cambridge mit seinen Aufsätzen helfen mussten, weil es ihm so schwerfiel, Texte zu schreiben, eine erotische Geschichte veröffentlichen sollte, war allerdings ein Schlag unter die Gürtellinie. Henry hätte nicht zulassen dürfen, dass dem Freund diese Aufgabe zugeteilt wurde. Quentin Trent war viel zu ehrenhaft, um zu schummeln und einen Schreiber dafür zu bezahlen. Alleine konnte er es nicht schaffen, ohne sich lächerlich zu machen. Einen Freund der Demütigung preiszugeben sollte unter ihrer Würde sein.
Was Henry zu seiner Aufgabe brachte. Die anderen verlangten von ihm, eine Dame in einem Heißluftballon zu beglücken. Die an sich positive Tatsache, dass er im Gegensatz zu Sid und Trent in der Tat Sex haben sollte, um seine Wette zu gewinnen, wurde dadurch aufgehoben, dass Henry unter schrecklicher Höhenangst litt. Außer seinem Kammerdiener wussten nur die drei Freunde davon, die seine Schwäche nun gegen ihn ausspielten. Allein der Gedanke an den wackligen Korb eines Heißluftballons löste bei ihm Schweißausbrüche und Atemnot aus. Ganz ohne festen Boden zu verlassen.
Nein, so hatte er sich das nicht vorgestellt.
Die Wetten hätten völlig anders laufen sollen.
Aber er wollte verflucht sein, wenn er es nicht schaffte, diese Wette zu gewinnen! Es war seine Idee gewesen und er würde niemals zulassen, dass sie dazu führte, dass sie sich gegenseitig herunterzogen. Sie waren Freunde! Die besten Freunde. Seit sie vor Jahren in Cambridge aufeinandergetroffen waren, hatten sie ihre Zeit miteinander verbracht.
Nichts konnte Fortuna’s Lovers trennen.
Fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass ihre kleine Gruppe als solche siegreich aus der Herausforderung hervorging, fiel er in den Schlaf, als auf den Straßen hinter den Vorhängen bereits hektische morgendliche Betriebsamkeit Einzug hielt.
Bis Henry Digby sein Stadthaus verließ, hatte sich in Mayfair, dem noblen Quartier im Westen der Stadt, nachmittägliche Gediegenheit eingestellt. Jetzt fuhren elegante Kutschen zu Besuchen vor, Gentlemen ritten aus und aristokratische Kinder wurden von ihren Nannys zu den privaten Parks geleitet, wo sie lernten, zu spielen, ohne Lärm zu verursachen oder sich zu beschmutzen.
Henry spazierte in den Herrenclub Salter’s und setzte sich dort in den großen Salon. Er ließ sich Wein und eine Tageszeitung bringen. Selbstverständlich hätte er sich in den Raum im ersten Stock des Clubs zurückziehen können, der Fortuna’s Lovers vorbehalten war. Aber um diese Zeit fand sich keiner seiner Freunde dort ein. Da zog er die Gesellschaft der öffentlichen Clubräume vor. Hier wurde gespeist, über Politik diskutiert, oder Karten und Billard gespielt. Über allem hingen der sanfte Dunst von Pfeifenrauch und die beruhigende Melodie der leisen Gespräche.
Gentlemen zogen sich hierher zurück, um ihren Stadtresidenzen zu entfliehen. Dort gingen um diese Zeit Besucher zum Tee ein und aus und die Damen tratschten darüber, welcher Aristokrat heiratswillig war und wo man die modischsten Hüte auf der Bond Street erwerben konnte. Debütantinnen hofften darauf, dass ihre Gäste sie um Tänze für die Abendveranstaltungen baten, und Mitgiftjäger befanden sich auf der Pirsch nach reichen Erbinnen.
Wer konnte es den Herren verdenken, diesen mannigfaltigen Fallen für Geld und Frieden aus dem Weg zu gehen, indem sie sich im Gentleman’s Club mit Gleichgesinnten trafen?
Wenn man nicht gerade eine Parlamentssitzung zu besuchen hatte, musste man schließlich sehen, was ein Herr mit seiner Zeit anfangen sollte. Einer Arbeit ging hier niemand nach. Dass Henry in der besten Gesellschaft akzeptiert wurde, als Sohn eines Bankiers, hatte mehr mit seinen Freunden zu tun als mit ihm selbst. Ohne Fortuna’s Lovers würde ihn Lord Brethwaite nicht grüßen, würde ihm Baron Hartwell nicht seine jüngere Tochter als Ehefrau anpreisen, und niemand würde ihn um seine Meinung zu dem Paar Kutschpferde bitten, das Tattersall’s morgen Vormittag versteigern wollte. Kurz gesagt, ohne seine Freunde würde Henry nicht das Leben eines müßigen Lebemannes des Tons führen.
„Digby. Guten Tag!“ Der ehrenwerte Timothy Renfield, zweiter Sohn eines Viscounts und bekannt für seine hohen Einsätze am Spieltisch, tauchte neben Henry auf. „Lust auf eine Runde Whist? Brethwaite, Farley und ich bräuchten einen vierten Mann.“
„Warum nicht?“ Henry faltete die Zeitung und legte sie beiseite, bevor er Renfield folgte. Er hatte gegen alle drei am Tisch schon gespielt und konnte ihre Fertigkeit beim Kartenspiel einschätzen. Brethwaite war der schlechteste Spieler und glücklicherweise wurde Henry Lord Farley zugelost, einem älteren Earl, der als aufmerksamer Spieler bekannt war.
Die Partie begann ausgeglichen, dann setzten sich Henry und sein Partner ab. Brethwaite wurde nervös, Renfield waghalsig. Eine Partie Whist, wie sie hier so oft gespielt wurde. Renfield konnte es sich nicht leisten, Hunderte von Pfund zu verspielen. Henry überlegte, ob er frühzeitig aussteigen und sich nach oben zurückziehen sollte, als erhobene Stimmen an ihre Ohren drangen.
„Verdammter Froschfresser!“
„Es tut mir leid, Monsieur!“
Zwei Herren standen sich gegenüber, einer davon Yardley, ein stiernackiger Landbesitzer und Abgeordneter aus der Gegend um Nottingham, der andere ein schlanker älterer Herr, den Henry bisher nie bei Salter’s gesehen hatte.
„Das ist mein Platz. Verschwinden Sie!“
Smithson, der Lakai, der sich um Fortuna’s Lovers kümmerte, wenn diese im Hause waren, hatte an diesem Nachmittag Dienst und gab Henry mit einer Geste zu verstehen, dass er Hilfe benötigte.
„Seit wann dürfen diese französischen Hungerleider in unsere Clubs? Bei White’s gäbe es das nicht.“ Brethwaite murrte auch vor sich hin. Natürlich. Keiner von Fortuna’s Lovers konnte den jungen Lord leiden, der sich so gerne auf Kosten anderer aufspielte.
„Dann gehen Sie doch dorthin, Brethwaite. Niemand zwingt Sie dazu, Salter’s zu beehren.“ Henry hatte sich erhoben, die Karten auf dem Tisch verdeckt liegen gelassen und trat zu den beiden Streitenden.
Smithson nickte ihm dankbar zu und verließ den großen Salon, zweifellos, um Mr Salter, den Clubmanager, zu holen.
„Na, Yardley, ich meine doch, dass hier genügend Plätze frei sind. Mister ...“
„De Fourquette. Chevalier de Fourquette“, ergänzte der Franzose mit einer knappen Verbeugung.
„Monsieur de Fourquette konnte nicht wissen, dass Sie jeden Nachmittag hier sitzen, Yardley. Kein Grund, ausfallend zu werden.“
„Je m’excuse. Selbstverständlich wähle ich mit Freuden einen anderen Platz, Sir.“ Henry sah dem Chevalier an, dass er sehr viel lieber einen Degen gezogen und den groben Engländer zu einem Duell gefordert hätte.
„Ein verdammter Froschfresser in einem anständigen englischen Herrenclub? Wo gibt es denn so was?“ Yardley wollte keine Ruhe geben. Er hätte sich setzen und die Entschuldigung des Chevaliers annehmen können, aber natürlich reichte ihm das nicht. Der Engländer an sich war nun mal davon überzeugt, die Krone der Schöpfung zu sein, und sah auf alle anderen Nationen herab. Ganz besonders auf den Erzfeind Frankreich.
Henry nahm stoisch eine Prise Schnupftabak, bevor er Yardley antwortete. „Der Comte d’Anjou ist regelmäßig Gast des Prince of Wales.“
Bevor Yardley seinen Gefühlen gegenüber dem Prinzregenten und dessen Freunden Ausdruck verleihen konnte, erschien Smithson in Begleitung von Mr Salter, der erleichtert wirkte, als er sah, dass niemand Möbel zertrümmerte oder sich prügelte. „Gentlemen, Sie konnten Ihre kleine Meinungsverschiedenheit klären?“
Der Chevalier nickte und zog sich an einen Tisch am anderen Ende des Salons zurück, während Yardley sich mit einem bösen Blick und einem gemurmelten Fluch an seinem Stammplatz niederließ.
Henry beruhigte den Clubmanager und begleitete ihn in die Halle. „Alles in Ordnung, Salter. Aber womöglich sollten Sie die Gäste vom Personal an die Tische führen lassen, um Stammplätze und Präferenzen zu beachten.“
Salter, ein leicht übergewichtiger Herr mit ergrauten Schläfen, der Henry und dessen Freunden einen Großteil seines Erfolges verdankte, seufzte. „Einige unserer Kunden, Mr Digby, würden vorschlagen, keine Exilfranzosen aufzunehmen.“
„Einige unserer Kunden sind bornierte Bauern, die alles hassen, was nicht aus ihrem County stammt. Das Problem dürfte sich in Grenzen halten, da der Großteil der exilierten Franzosen sich die Aufnahmegebühr für Salter’s nicht leisten kann.“ Diejenigen Aristokraten, die vor der Schreckensherrschaft der Revolution nach England geflohen waren, hatten oft kaum mehr mitgebracht als das, was sie am Leibe trugen. Wer nicht schon Güter hier besessen hatte oder rechtzeitig Wertgegenstände außer Landes hatte schaffen können, war in England auf die Milde von Verwandten und Freunden angewiesen. So einfach war die Sache. Leute, die nichts zu essen hatten, gaben ihr Geld nicht für Clubmitgliedschaften aus.
Henrys Mutter, die geborene Comtesse Marie-Héloise d’Aubières, hatte einige Jahre lang Verwandte in einem Cottage der Digbys in Sussex untergebracht, bis diese beschlossen, während des Friedens von Amiens nach Frankreich zurückzukehren. Henry war erstaunt, dass der Chevalier überhaupt in einem englischen Gentleman’s Club Mitglied war. Er musste einer der wenigen Glücklichen sein, die über Vermögen verfügten.
„Es verursacht nur Probleme, Ausländer aufzunehmen. Glauben Sie mir, Sir.“
Henry seufzte. Er wusste das zu gut. „Vielleicht können wir aus diesem Problem Profit schlagen? Zumindest vermögende Ausländer können sich als gute Kundschaft erweisen, Salter. Nicht nur Franzosen, sondern Diplomaten oder Reisende. Lassen Sie mich darüber nachdenken. Bis dahin engagieren Sie einen weiteren Lakaien.“
Niemand wusste, dass der Club von den vier Fortuna’s Lovers finanziert wurde und dass Henry Digby bei der Führung mitsprach. Die noblen Herrschaften und Landbesitzer verachteten jegliches Streben nach Profit, das mit Arbeit einherging. Wer schlau war, hänge es nicht an die große Glocke, dass er Geschäfte machte.
„Außerdem sind da die beiden kleinen Lagerräume, Sir, die wir nicht mehr brauchen, seit der Keller ausgebaut wurde. Wir könnten weitere Räume für die Mitglieder ausbauen, sodass sich manches entzerren ließe.“
„Gute Idee, schicken Sie mir Ihre Vorschläge, Salter, ich werde das prüfen.“
Der Chevalier und die Renovierungen waren schnell vergessen, als Trent und Sidwell auftauchten, die Henry für die gestrige Idee mit den Wetten zwar lauthals verfluchten, um sich alsdann mit ihm gemeinsam so viel Schikane für Ingleford zu überlegen wie möglich. Da waren sie sich einig, Simon sollte genauso leiden wie sie, wenn es um die Erfüllung seiner Aufgabe ging.
Wie er selbst die Sache mit dem Heißluftballon erledigen sollte, erschloss sich Henry nicht. Das musste er erst einmal verdauen. Eine willige Frau zu finden, war kein Problem für ihn, bloß wie sollte er die Panik überwinden, die ihn unweigerlich erfasste, wenn er nur ein paar Schritte über dem Boden stand? Er konnte ja nicht einmal eine Leiter nutzen ohne Schwindel und Herzrasen.
Diese Zweifel ließ er sich nicht anmerken und feierte stattdessen bis in die Nacht, so wie alle es von ihm gewöhnt waren.
Kapitel 2
„Ich biete Ihnen zweihundert Pfund, Miss Masterson!“
Winifred riss ungläubig die Augen auf. „Zweihundert Pfund für Vaters Instrumente und die Möbel?“ Womöglich bestand doch noch Hoffnung für sie. Mit dieser Summe käme sie eine Zeit lang gut über die Runden und musste sich nicht der Gnade ihrer unbekannten Verwandten unterwerfen.
Doch sie hatte sich getäuscht. Dr. Heppley lachte trocken. „Selbstverständlich nicht. Ich biete Ihnen zweihundert Pfund für das Haus und alles, was sich darin befindet.“
„Dieses Haus ist mein Zuhause. Es steht nicht zum Verkauf!“, zwang sich Winifred scheinbar gefasst zu erklären, statt, wie sie es gerne getan hätte, ihm an den Kopf zu werfen, ob er sie für dumm hielte. Das Haus war zwar nicht groß, zwei Räume im Erdgeschoss, die ihr Vater als Arztpraxis genutzt hatte, und eine Wohnung darüber sowie eine Küche nach hinten hinaus zu einem Innenhof. Aber eine Immobilie in dieser Gegend im Norden Londons war deutlich mehr wert als zweihundert Pfund. Außerdem stand das Haus nicht zur Disposition. Sie würde eher vermieten, als selbst irgendwo zur Miete zu wohnen. Eine alleinstehende Frau mit etwas Besitz war zwar nicht gut versorgt, aber eben nicht so vollkommen auf andere angewiesen wie eine arme Frau. Sie hatte es zu oft gesehen, wenn die verzweifelten Personen an die Tür ihres Vaters geklopft hatten, weil sie krank und elend waren. Eine ledige Frau ohne Rückzugsmöglichkeit wurde im besten Fall von einem Vermieter übers Ohr gehauen, aber meist gnadenlos ausgenutzt oder schlimmstenfalls gar geschändet.
Das Dach über ihrem Kopf war Winifreds letzte Mauer gegenüber skrupellosen Männern.
Männern wie Dr. Heppley, der meinte, er könne sie über den Tisch ziehen.
„Nun, wenn Sie bald hungernd in diesem Haus sitzen, Miss Masterson, behaupten Sie nicht, ich hätte Ihnen meine Hilfe nicht angeboten. Was wollen Sie denn tun? Wovon möchten Sie leben ohne Ihren Vater und sein Einkommen? Sie können von diesem Dach nicht abbeißen. Nehmen Sie Vernunft an, akzeptieren Sie mein Angebot und ziehen Sie zu Freunden oder Verwandten mit etwas Geld in der Tasche. Selbst eine alte Jungfer findet mit etwas Besitz einen Ehemann.“
Sie presste die Lippen aufeinander. Bei der Familie ihrer Mutter anzukriechen, kam nicht infrage. Und Freunde hatte sie keine, denen Winifred ihren Lebensunterhalt zumuten wollte. Geschweige denn, sich einem Gatten auszuliefern. Überhaupt, was fiel diesem Mann ein, ihr zu erklären, was für sie vernünftig sei? Er kannte sie nicht einmal, war nur ein Kollege ihres Vaters gewesen, der sie nach der Beerdigung angesprochen hatte, weil er gerne die Sachen des seligen Dr. Masterson übernehmen wollte. Heppley wirkte seriös mit seiner dezenten Kleidung und entsprach dem Bild eines gelehrten Mannes. Schmal und blass und von mittlerem Alter.
Sie hatte geglaubt, er würde die Einrichtung der Praxis erwerben wollen, die Tasche voller Werkzeuge und die vielen Arzneigläser, die ihr gegenüber sauber in einem Regal verräumt standen. Dies war das Behandlungszimmer, in dem ihr Vater nachmittags seine Patienten empfangen hatte. Morgens hatte er Besuche gemacht, bevor er mit Winifred seinen Lunch eingenommen hatte. Sobald der letzte Patient gegangen war, hatte er im zweiten Zimmer seine Beobachtungen notiert und an seinem großen medizinischen Werk gearbeitet. Ein Buch, das nun niemals vollendet würde.
Der Gedanke riss die tiefe Wunde wieder auf, die sein Ableben ihr geschlagen hatte. Nein, sie musste sich zusammenreißen, Weinen konnte sie heute Abend, wenn sie im Bett lag. Diesem Mann gegenüber durfte sie keine Schwäche zeigen.
„Ich bin bereit, Ihnen die Praxis zu vermieten, Dr. Heppley.“
Heppley setzte den runden Hut auf sein schütteres, helles Haar und musterte sie verächtlich. „An einer Praxis zur Miete bin ich nicht interessiert. Kein vernünftiger Mensch wird sich irgendwo niederlassen, wo man nicht weiß, wann der Mietvertrag gekündigt wird.“
„Mir liegt an einer langfristigen Vermietung, das versichere ich Ihnen.“
„Ja sicher, das sagen Sie jetzt, und wenn Sie in ein paar Monaten heiraten oder doch zu Verwandten gehen, stehe ich dumm da. Nein, entweder alles oder nichts. Aber überlegen Sie nicht zu lange, Miss Masterson.“
Dann verließ er die Praxis.
Winifred brauchte einen Moment, bis sie die fest zu Fäusten geballten Finger lockerte. Erschöpft ließ sie sich auf die Liege sinken, auf der ihr Vater bis vor zwei Wochen Patienten behandelt hatte. Ohne das Einkommen des Arztes war dieses Haus für sie nicht zu halten, da lag Heppley nicht falsch. Aber sie war kein unvernünftiger Mensch! Ganz im Gegenteil. Die Praxis zu vermieten, war ein überaus vernünftiger Plan. Sicher fände sich jemand, der das Erdgeschoss übernehmen wollte, wenn nicht als Behandlungsräume, so für einen Laden vielleicht?
Könnte sie selbst ein Geschäft eröffnen?
Winifred bezweifelte es. Was konnte sie schon? Sie hatte ihrem Vater assistiert und den Haushalt geführt, nachdem die Mutter verstorben war. Und selbst wenn sie etwas fände, um Geld zu verdienen – leider glich der Großteil der Männer Dr. Heppley – eine alleinstehende Frau wurde als Geschäftspartner nicht akzeptiert. Also blieb ihr nur, einen Mieter zu finden.
Ein scharfes Klopfen riss sie aus ihren Gedanken. Sie strich ihr schlichtes, graues Kleid glatt und steckte sich ohne viel Erfolg eine ihrer widerspenstigen Locken hinter das Ohr, bevor sie die Haustür öffnete.
„Lydia?“ Winifreds Blick fiel auf die Nachbarin, die ein Kind im Arm trug.
„Bitte Winifred, du musst mir helfen, meine Lucy ist krank.“
Win bat die junge Frau ins Haus. Es war besser, wenn nicht die ganze Straße sah, dass sie Patienten empfing. Im Behandlungszimmer bat sie Lydia Webster, das kleine Mädchen auf die Liege zu legen, bevor sie die Vorhänge zuzog. Die vierjährige Lucy sah fiebrig aus. Ihre Augen glänzten und die Wangen waren gerötet.
„Lydia, du weißt doch, dass ich keine Ärztin bin!“
Mr Webster, Lydias Gatte, arbeitete in der City als Buchhalter und seine junge Ehefrau war mit dem Kind oft bis in die Nacht hinein alleine. Außer einem Dienstmädchen für das Grobe hatte sie keine Gesellschaft. Zwei Straßenecken weiter in Richtung Westen wurden die Häuser geräumiger, die Bewohner reich und aristokratisch. Hier bei ihnen im Viertel lebten diejenigen Menschen, die darum kämpften, ihren Platz in der respektablen Mitte zu behalten. Buchhalter wohnten hier, und gediegene Handwerksbetriebe florierten zwischen Wohnhäusern von Witwen und alleinstehenden Akademikern. Mr Webster nahm es in Kauf, täglich mehr als eine Stunde bis in die City zu laufen, damit seine Familie eine derartige Adresse ihr Eigen nennen durfte.
„Aber Winifred, du hast uns vor Weihnachten so gut geholfen, als Lucy diese Ohrenschmerzen hatte!“
Da hatte Winifreds Vater noch gelebt und der Ruf seiner Praxis war tadellos gewesen. Jetzt würden Männer wie Heppley nicht zurückschrecken, sie anzuzeigen oder die Menschen aufzuwiegeln, weil Win nicht über eine medizinische Ausbildung einer Universität verfügte. Wie auch? Frauen wurden nicht zum Studium zugelassen. Patienten zu behandeln bedeutete für sie ein enormes Risiko, selbst in diesem unscheinbaren Fall.
Lucy jammerte und verlangte nach ihrer Mama. Schnell strich ihr Win die feuchten Strähnen aus der Stirn. Sie konnte ein kleines Mädchen nicht so leiden lassen. Lydia hatte weder Ahnung von Hausmitteln noch von Krankenpflege und keine Nanny, die ihr helfen könnte. Die junge Nachbarin war die Tochter einer Hutmacherin, die mittlerweile verstorben war. Lydia konnte jede erdenkliche Art von Federn aufzählen, aber in Haushaltsführung oder Krankenpflege war sie völlig auf sich gestellt.
Winifred untersuchte Lucy und kam zu dem Schluss, dass das Mädchen nur einen Infekt hatte. Das würde vorübergehen. „Sie muss sich ein paar Tage ausruhen und diesen Tee trinken.“ Ein geübter Handgriff fand die Weidenrinde. „Erinnerst du dich, wie man Wickel macht, Lydia?“
Ein zaghaftes Nicken. „Gut, dann lege ihr Wadenwickel um und sorge dafür, dass die Kleine genug trinkt. Kinder in diesem Alter haben oft solche Infekte. Aber Lucy ist stark und gut genährt, sie wird das gut wegstecken.“
Erleichterung zeichnete sich auf dem Gesicht der Nachbarin ab. „Ich danke dir, Winifred. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich gemacht hätte.“
„Ich werde nicht als Arzt praktizieren können, Lydia. Du musst dir einen anderen Arzt suchen.“ Diesen Besuch konnte Winifred als Freundschaftsdienst erklären. Sie wollte von Lydia auch kein Geld annehmen.
„Aber ich vertraue dir!“
Win zwang sich, gelassen zu bleiben. Lydia war die falsche Person, um ihr Leid zu klagen. „Ich versuche, einen Arzt zu finden, der die Räume übernimmt, aber falls nicht, muss ich das Schild abmontieren und die Patienten fortschicken. Es ist besser für dich, wenn du eine Alternative suchst, Lydia.“
Nur die Verzweifelten baten Win um Hilfe. Die reichen Herrschaften, die Dr. Masterson für seine Forschung behandelt hatte, hatten es nicht in Betracht gezogen, sie um Rat zu bitten. Neben dem Schock über das plötzliche Ableben ihres geliebten Vaters hatte Winifred in den letzten Tagen all seinen Patienten schreiben und die Termine absagen müssen. Einige waren sogar frech geworden, weil sie einen neuen Arzt suchen mussten, und hatten ihr nicht mal kondoliert. Winifreds persönliche Tragödie stellte für diese Leute lediglich eine Unannehmlichkeit dar.
Eine Unannehmlichkeit, die Winifred zur fast mittellosen Waise gemacht hatte.
„Weißt du was, Lydia, komm doch wieder vorbei, wenn es Lucy besser geht. Dann werde ich dir Grundzüge der Krankenpflege beibringen. Damit du dich nicht so hilflos fühlst.“ Niemand konnte etwas dagegen einwenden, wenn Winifred mit einer Nachbarin Tee trank und sie über Krankenpflege sprachen. Das half ihr zwar nicht aus ihrer prekären Finanzlage, aber es würde ihre Gedanken ablenken. Solange sie die Praxis hier hatte, konnte sie die Räume genauso gut nutzen.
Sie verriegelte die Tür hinter Lydia und Lucy. Die Dunkelheit brach herein. Als Tochter eines Arztes hatte sie zu oft mitbekommen, wie schutzlos Frauen in dieser Stadt lebten. Sie brühte sich Tee auf und richtete sich ein Abendmahl aus Brot und Käse, das sie mit in das Studierzimmer nahm.
Der Raum war kalt, aber sie wollte kein Feuer machen. Stattdessen legte sie einen Schal um. Solange sie kein Einkommen hatte, musste Win sparsam sein. Dr. Masterson hatte kaum Vermögen hinterlassen, weil ihre Familie immer den Notleidenden geholfen hatte. Außerdem hatte der Doktor von einigen der Patienten, an denen er forschte, kein Honorar genommen. Die Wissenschaft war wichtiger gewesen, als ein Sparkonto zu füllen. Winifred hatte das nie gestört. Schließlich rechnete man nicht damit, dass jemand so plötzlich stirbt.
Der heiße Tee musste daher reichen. Ihr Blick fiel auf das Regal voller Patientenakten und Nachschlagewerke. Wie sollte sie das ordnen? Was sollte sie damit anfangen? Diese Notizen betrafen Menschen, die Dr. Masterson vertraut hatten mit ihren Krankheiten und Ängsten. Papa hatte ihr stets eingeschärft, dass nichts wichtiger war für einen Mediziner als Diskretion. Sollte sie die Schriften vernichten?
Nein, das brachte sie nicht übers Herz. Ein ganzes Leben, das gesamte medizinische Wissen ihres Vaters steckte in diesen Unterlagen. Würde sie die Papiere verbrennen, käme es ihr vor, als würde sie sein Vermächtnis zerstören.
Kapitel 3
Henry starrte verblüfft auf den Zettel mit der Adresse, den ihm Smithson an diesem Nachmittag in die Hand gedrückt hatte. Lange genug hatte es gedauert. Zwei Wochen hatte Henry damit zugebracht, unauffällig zu recherchieren, wie man Höhenangst besiegen konnte. Unauffällig, weil das Letzte, was er gebrauchen konnte, war, dass seine bedauerliche Schwäche allgemeines Wissen wurde. Schlimm genug, dass seine Freunde Bescheid wussten. Wenn diese schon ihre Kenntnis darüber nutzten, um ihm das Leben schwer zu machen, was würden dann seine Feinde mit dieser Information anfangen?
Nicht, dass Henry Digby Feinde hatte im engeren Sinne. Niemand hatte ihm blutige Vergeltung geschworen oder eine Fehde mit ihm. Selbst die verheirateten Damen für seine amourösen Eskapaden gehörten einer Gruppe an, in der die Ehepartner beide Augen zudrückten. War die Erbfolge gesichert, so hatten viele, deren Ehe auf praktischen Gründen basierte, kein Problem mit Untreue, solange ein gewisses Maß an Diskretion gewahrt wurde.
Dennoch hatte er keine Lust, zu einer Lachnummer zu werden, sollte die Öffentlichkeit erfahren, dass er nicht einmal einen Balkon betreten konnte, ohne in Panik zu geraten.
All die medizinischen Bücher, die er in den letzten Tagen gewälzt hatte, hatten ihn leider nicht vorwärtsgebracht. Zwar kannte er nun den Begriff Akrophobie und wusste, dass laut Titus Livius einige römische Soldaten auf den Leitern bei der Eroberung Carthagos von Schwindel geplagt gewesen waren. Ein guter Ratschlag, wie diese Misere innerhalb der nächsten Wochen bei ihm abgestellt werden konnte, fehlte immer noch.
Wieder fiel sein Blick auf die Adresse. Er musste es schaffen und dieser Arzt war seine einzige Chance.
Leider war es für diesen Tag zu spät, denn Henry war mit seinen Freunden verabredet. Er verließ Salter’s und marschierte die paar Blocks zu seinem Stadthaus. So unglaublich es schien, Ingleford hatte sein Zielobjekt geheiratet. Da beauftrage man Simon damit, eine skandalumwitterte Lady zu verführen, und was tat der Kerl? Er zog los und ehelichte die Dame! Henrys Freund pervertierte ihre Wetten, indem er aus einer frivolen Eskapade die wenig amüsante Angelegenheit einer Ehe schuf. An diesem Abend wurden die frisch vermählten Inglefords auf dem Verlobungsball von Lucille Ramsey, einer Cousine der neuen Viscountess Ingleford, erwartet.
Das würde sich niemand in London entgehen lassen.
Entsprechend überfüllt war das Haus der Ramseys, die keineswegs üppig lebten. Unter normalen Umständen würden nur halb so viele Menschen diesen Ball beehren. Henry schob sich durch die Menge auf der Suche nach den anderen Fortuna’s Lovers, als ihn jemand grüßte.
Er brauchte einen Moment, bis er das Gesicht zuordnen konnte. „Chevalier de Fourquette, nicht wahr?“
„Bonsoir, Mr Digby. Ich schulde Ihnen noch Dank wegen neulich.“
Henry winkte ab. „Ich hoffe, Sie hatten keine Probleme mehr mit Yardley?“
Der Franzose zuckte nonchalant mit den Achseln. „Ich sorge dafür, kein Problem zu haben.“
Henry wollte sich empfehlen, als eine junge Dame neben den Chevalier trat. Sie war eine ausnehmend auffallende Erscheinung. Groß und schlank, mit einer zu scharfen Nase, um als hübsch zu gelten, aber mit der natürlichen Arroganz geborener Aristokraten. Niemand würde diese Frau übersehen.
„Darf ich vorstellen? Meine Nichte, Mademoiselle Hortense de Bally-Armagnac.“
„Enchanté Mademoiselle.“ Eine weitere Exilfranzösin. Er machte sich eine mentale Notiz, seine Mutter nach der Familie des Chevaliers zu fragen.
„Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Monsieur Digby.“ Sie klang zu spröde, um das ernst zu meinen. Tat sie ihn etwa aufgrund seiner bürgerlichen Geburt als unwichtig ab? „Ich höre, Sie konnten meinem Onkel behilflich sein. Haben Sie Dank dafür.“ In der Tat. Ihre Augen schweiften durch den Saal, als wäre Henry ein Bekannter, dem man Höflichkeit zukommen lässt, weil es sich so gehörte. Nicht weil man es wollte.
Henry war bereit, sie eines Besseren zu belehren. Zwei konnten dieses Spiel spielen „Mademoiselle, darf ich um diesen Tanz bitten?“
Eine Lady konnte die Aufforderung nur ablehnen, indem sie überhaupt nicht tanzte oder weil sie bereits einem anderen Partner versprochen war. Ihre grauen Augen waren ausdruckslos, aber sie drehte sich zu ihm und hielt ihm stumm die Hand hin, damit er sie zur Tanzfläche führen konnte. Sie stellten sich einander gegenüber auf, wie es dieser Tanz erforderte.
„Ihr Englisch ist ausgezeichnet. Sind Sie schon lange in London, Mademoiselle?“
„Seit ich mich erinnern kann, lebe ich in England. Mein Onkel, der mich aufgezogen hat, ist allerdings erst kürzlich mit dem Haushalt nach London übergesiedelt. Zuvor haben wir in der Nähe von Nottingham gelebt.“
Henrys Blick glitt an ihrer eleganten Figur entlang. Das Kleid war fein, wenn auch nicht übermäßig elegant. Es war ihre Haltung, die von der mangelnden Opulenz ihrer Ausstattung ablenkte. Eine bewundernswerte Eigenschaft, wie er fand. Die meisten Damen überspielten einen Mangel an Contenance und Selbstbewusstsein mit zu vielen Juwelen und üppigen Kleidern. Hier schien die Sache andersherum zu liegen.
„Ich kann mir vorstellen, dass London dann eine aufregende Erfahrung für Sie ist.“
Sie drehten sich und wechselten die Partner. Bis sie sich wieder gegenüberstanden, dauerte es ein paar Minuten.
„Nun, Monsieur Digby, London ist nicht Versailles, nicht wahr?“
Henry unterdrückte ein Lachen. „Keineswegs. Weder das Ancien Régime noch Napoléons neue herrschende Klasse sind mit London vergleichbar.“
„Die Engländer sind speziell, aber vermutlich ist das unvermeidbar, wenn man auf einer Insel lebt.“ Was wollte sie ihm damit sagen? Dass seine Landsleute spleenig waren? „Nehmen Sie nur einmal ihre Kleidung. Die Damen kopieren die französische Mode, aber angeblich verachten sie die Franzosen. Unsere Gastgeber haben einen französischen Koch engagiert für diesen Abend, aber sie würden ihre Tochter niemals einem Ausländer zur Frau geben.“
Das war nichts als die Wahrheit, wie Henry genau wusste. Die Engländer liebten exotische Waren, allen voran der Prinz of Wales, der seine Paläste mit Chinoiserien und ägyptisch inspirierten Möbeln ausstatten ließ. Man trank französischen Champagner und trug Seide aus dem Feindesland, die über den Ärmelkanal geschmuggelt wurde, um die Kriegsblockaden zu umgehen.
Das alles, obwohl die Franzosen als Todfeinde galten. Nicht nur wegen Napoléon und dessen Feldzügen in Spanien, wo sich Engländer und Franzosen erbittert gegenüberstanden, sondern bereits seit Jahrhunderten. Es ließ ihn diese Frau mit anderen Augen sehen. Vermutlich war es nicht leicht, als französische Aristokratin in England zu leben. Henrys Mutter hatte die Bürgerlichkeit seines Vaters umarmt und ihrer französischen Familie nie eine Träne nachgeweint. Etwas, das ihm teilweise seltsam vorgekommen war. Aber Mary Digby, wie sie sich schlicht nannte, sagte stets nur, dass sie das ruhige Leben mit ihrem Ehemann jederzeit den Ausschweifungen des Adels vorzog. Der Tanz endete und Henry geleitete die junge Französin zu ihrem Onkel zurück, wo er sich empfahl.
Er stieß zu Sidwell und Trent, die ihrerseits auf die Inglefords warteten. Es war nicht zu übersehen, als das junge Ehepaar den Ball erreichte, obwohl man in der Menschenmenge kaum vorwärtskam. Ein Raunen ging durch die Menge und Köpfe drehten sich in eine Richtung, wie eine Woge, die überschwappte. Henry vernahm Wortfetzen über den ersten von Fortuna’s Lovers, der in den Stand der Ehe getreten war und über seine skandalöse Braut.
„Ich fasse es nicht.“ Trent schüttelte den Kopf und sprach leise. „Emma Falworth ist die unwahrscheinlichste Person, die ich mir als Lady Ingleford vorstellen kann! Was man alles über sie erzählt, und dann ihre bekannte Tollpatschigkeit. Wo lagen wir falsch, als wir gegen Simon gewettet haben, dass er sie nicht verführen kann?“
Diese Frage stellten sie sich alle drei. Anfangs hatte es noch so ausgesehen, als würde Miss Falworths Ungeschicklichkeit sämtliche Avancen ihres Freundes im Keim ersticken. Dann waren beide verschwunden. Weil sie nach Gretna Green durchgebrannt waren, wie mittlerweile ganz London wusste.
Simon erreichte sie und alle bemühten sich, freundlich zu sein zu Lady Ingleford. Die Gentlemen beglückwünschten das Paar. Henry bemerkte, dass sich die junge Lady an Simons Arm krallte, als sei er ihr Anker. In ihren Augen lag definitiv Heldenverehrung, während Simons Blick seinen Freunden zu verstehen gab, dass sie sich gefälligst zu benehmen hatten. Was glaubte der denn? Hier auf diesem Ball würden sie die Wette sicherlich nicht besprechen.
Genauso wenig wie Simons Verrat an ihrer Junggesellengruppe. Er hatte sogar die leichteste Aufgabe von ihnen allen gehabt: eine ausgewählte Lady auf einem Ball verführen.
Stattdessen hatte er die Frau geheiratet.
Und wenn Henry einige Zeit später die Abwesenheit der Inglefords korrekt interpretierte, dann verführte Simon im Garten seine frisch angetraute Gattin auf dem Verlobungsball ihrer Cousine. Damit gewann er seine Wette.
„Ist das überhaupt konform mit den Regeln?“
Quentin Trent antwortete Henry, da Sid auch den Saal verlassen hatte. Sicher war der hinter einem Stelldichein her. Auf Alexander Sidwell war Verlass. Er musste, genau wie Henry, keinen Erben zeugen und die Frauen liebten ihn mindestens so sehr wie er sie. „Vermutlich, ja. Schließlich haben wir nirgends Ehefrauen ausgeschlossen.“
„Aber das war nicht Sinn der Sache! Was sollen wir bloß machen?“
„Wir machen gar nichts, Henry. Simon sieht glücklich aus und würde es überhaupt nicht schätzen, wenn wir uns da einmischen.“
„Eins sage ich dir, Quentin, ich werde diese Wette gewinnen und wenn es das Letzte ist, was ich mache. Ich stehe zu meinem Wort.“
„Niemand ist hier wortbrüchig geworden, Henry. Kann es sein, dass du diese Sache ein wenig zu ernst nimmst? Ich rate dir, diese Wetten nicht zu überbewerten.“ Dann erregte etwas in Henrys Rücken die Aufmerksamkeit des Barons. „Du entschuldigst mich bitte, ich muss nach meinen Damen sehen.“
Während Quentin sich um seine Schwester kümmerte und sich die anderen anderweitig vergnügten, beschloss Henry, dass es an der Zeit war, von dieser Veranstaltung zu verschwinden. Solche Bälle dienten nur dazu, weitere Ehen zu schließen oder zu tratschen. Er überlegte kurz, dem Club oder Madame Jeannettes Bordell einen Besuch abzustatten, verwarf die Idee dann aber. Gleich morgen Vormittag wollte er diesen Arzt aufsuchen. Da er augenscheinlich der Einzige ihrer Gruppe war, der ihr Spiel ernst nahm, hatte er keine Zeit zu verlieren.
Stone ließ sich die Verblüffung nicht anmerken, seinen Herrn kurz vor Mitternacht anzutreffen statt erst gegen morgen. Als Henry um acht Uhr erwachte, stand das Rasierzeug bereit und daneben eine dampfende Tasse Kaffee. Henrys Vorliebe für Kaffee stammte von seiner Mutter. Auch Mrs Digby pflegte morgend nur Kaffee zu trinken. Das einzige Merkmal ihrer Nationalität, das geblieben war.
„Das Frühstück wird in einer Stunde serviert, Sir. Der Koch wird zukünftig früher anfangen.“
„Danke, Stone, legen wir los.“
Gesättigt und gekleidet in ein Ensemble, das ihn seriös und gediegen wirken lassen sollte, bestieg Henry eine Droschke für die kurze Strecke zur Adresse des Arztes in Bloomsbury. Gerade weil diese in einer so respektablen Gegend lag, erhoffte er sich viel von seinem Besuch. Laut Smithson hatte der Mann einem Aristokraten geholfen, der Angst vor großen Menschenmengen gehabt hatte.
Die Hoffnung, dass er von seinem Leiden geheilt werden könnte und damit den anderen beweisen würde, dass es nur auf die Einstellung ankam, die seine Freunde in bemerkenswerter Weise vermissen ließen, erhellte Henrys Gemüt. Er hatte wirklich nur diese Wetten gebraucht, um sich von der Melancholie zu befreien. Sie waren eine gute Idee gewesen, ganz gleich, was die anderen sagen mochten.
Er ließ sich, um seine Anonymität zu wahren, ein paar Häuser entfernt absetzen und sah sich in der Straße um. Alles hier schrie förmlich respektable Bürgerlichkeit. Die geputzten Wege und die Vorhänge hinter den Fenstern der zweistöckigen Häuser genau wie die einfachen Läden. Hier gab es Bücher zu kaufen und robuste Stiefel, eine Taverne pries Sonntagsbraten an und sauber, aber schlicht gekleidete Menschen gingen ihrem Alltag nach.
Ein paar Schritte weiter sah er das Schild des Arztes und klopfte an die grün lackierte Tür.
Eine Dienstbotin öffnete. „Sir, ich fürchte, ...“
Er ließ sie nicht ausreden und trat an ihr vorbei in den dunklen Flur. Niemand würde ihn abwimmeln und niemand durfte ihn dabei beobachten, wie er auf der Schwelle einer Arztpraxis mit dem Personal diskutierte.
„Mir ist bewusst, dass ich keinen Termin habe bei Dr. Masterson, aber ich versichere Ihnen, dass es Ihrem Herrn zum Vorteil gereichen wird, mich zu empfangen.“ Henry nahm den Hut ab und streckte ihn der Frau entgegen.
Kapitel 4
Dieser Kerl versetzte Winifreds letztem Rest guter Laune den Todesstoß.
Es reichte nicht, dass ihre Bemühungen, das Erdgeschoss zu vermieten, bisher keine Früchte trugen. Oder dass Dr. Heppley gestern wieder geklopft und ihr eine Frist gesetzt hatte, sich zu entscheiden. Die er, wenn es nach ihr ging, komplett vergessen konnte, denn sie würde eher an die Gesellschaft zur Rettung der Waisenkinder Londons verkaufen als an diesen Halsabschneider.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: