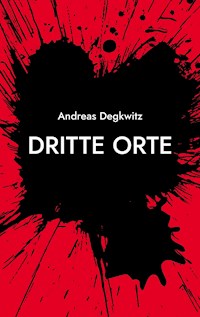Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Dorit möchte sich frei entfalten. Sie geht ihre Wege eigenständig und selbstbestimmt. Bekannte und Freunde weiß sie zu schätzen. Ihr Gemeinsinn ist aber nicht immer sehr ausgeprägt; das erweist sich bisweilen als Hindernis, allerdings auch als Stärke, die zu Erfolgen führt. Dorit weiß stets, was sie will. Rechenschaft glaubt sie nur sich selbst gegenüber schuldig zu sein. Wird Dorit frei in Beruf und Partnerschaft handeln können? Sie übernimmt Verantwortung für sich, vergisst aber ihr Umfeld nicht. Um ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen, setzt Dorit auf Freiheit und Selbstständigkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
ERWACHEN
ENTDECKEN
ERKENNEN
ERWACHEN
Dorit war in der Siedlung mit den weißen, immer gleichen Einfamilienhäusern groß geworden. Ihre Eltern waren dorthin gezogen, als die Mutter Dorit erwartete. Offenbar sollte die Familie größer werden. Denn das Haus, das die Eltern bezogen, hatte im ersten Stock zwei Kinderzimmer und das Elternschlafzimmer – darüber lag ein Spitzdach mit einem Speicher. Dorit war für die Mutter ein Glück gewesen, dem das Unglück folgte, nicht mehr als ein Kind gebären zu können. In den späten neunziger Jahren kam Dorit zur Welt und ist deshalb beinahe ein Millenniumskind geworden. Doch das wäre das Geschwister gewesen, das tot geboren wurde und ein Bruder gewesen wäre. Da war Dorit etwa zwei Jahre alt. Die Eltern mussten erleben, dass ihnen dieser Wunsch nicht in Erfüllung ging, was ihnen nicht leicht fiel. Seither war Dorit das Projekt der Mutter, um zu beweisen, eine Familie auch mit nur einem Kind etablieren zu können. Der Vater sah hingegen mit Dorit seine Investition für das Haus legitimiert. Das überzählige Zimmer konnte als Arbeitszimmer genutzt werden, wenn seine Frau wieder arbeitete. Doch ihre Enttäuschung, kein weiteres Kind mehr zur Welt bringen zu können, wie ihre Sorge um das Wohlergehen von Dorit hielten die Mutter davon ab, gleich nach der Elternpause wieder beruflich tätig zu werden. Als Mitglied einer gut laufenden Anwaltskanzlei für Insolvenzrecht verdiente der Vater für seine Familie genug.
Noch waren die Büsche an den Zäunen nicht hochgewachsen und auch noch nicht alle Häuser bewohnt. Vor den Häusern verlief eine Straße, die über Vorplätze Abzweige zu den Garagen hatte. Hinter den Häusern schlossen Wiesenstücke und Blumenbeete an die Terrassen an. Der Gartenausgang führte zu einem nicht-asphaltierten, breiten Sandweg, der die Gartengrundstücke zur rechten und linken Seite zerschnitt. Waren die Büsche an den Zäunen und die Zierbäume an den Gartenecken zum Weg einmal hochgewachsen, würde ein grüner Vorhang aus Blättern und Zweigen die Sicht auf das, was im Garten geschah, verdecken. Doch so weit war es noch nicht, als Dorit ein Baby war und sich die Eltern vor den Augen ihrer Nachbarn als Familie zelebrierten. Dorit wurde zwischen den Eltern beim Frühstück hin- und hergereicht, geherzt, geküsst und mit besten Trockenmilchprodukten und viel Zärtlichkeit verwöhnt. Wenn sie dann bei Sonnenschein im Kinderwagen schlief, fragten die Nachbarn am Gartenzaun, ob sie die „kleine Maus“ einmal sehen dürften. Das versagten ihnen die stolzen Eltern nicht, die überglücklich waren, als Familie so viel Anerkennung zu finden. Dies verstärkte sich, als Dorit im Garten erste Gehversuche im Laufstall machte und mit ihren Fans zu sprechen schien. Auch wenn niemand ein Wort verstand, glaubten alle frohe Botschaften zu vernehmen, die Dorit verlautbaren ließ.
„In Kürze läuft sie und wird sprechen“, teilte der Vater den Nachbarn mit.
„Ja, in der Tat“ seufzte die Mutter beinahe beglückt, „wir sind bald aus dem Gröbsten heraus.“
„Dann bekommt sie bestimmt bald ein Geschwisterchen“, gaben die Nachbarn zurück.
Dazu sagten Dorits Eltern: „Wir sind so froh, dass sie bei uns ist“, und strahlten ihr „Christkind“ an. Mitte Dezember wurde Dorit geboren.
In der Siedlung gab es auch Familien, die größer waren; eine davon war die Familie von Max, der zwei Brüder hatte und aktuell der dritte war. Die zwei Schwestern, die ihm folgten, waren Zwillinge, Waltraud und Hildegard. Max war auf Maximilian getauft und seine Brüder hießen Philipp und Ferdinand; die beiden waren sieben und neun und gingen bereits zur Schule. Der Vater dieser Familie hieß Otto und war Orthopäde und mit einer großen Praxis sehr vermögend; er freute sich an seiner Kinderschar. Seine Frau war die Mutter dieser Kinder und bereit, diesen Fulltimejob zu übernehmen, solange die Kinder zu Schule gingen – danach wollte sie wieder berufstätig sein.
„Was ist schöner als Familie?“, sagte der Orthopäde oft, „meine Jungs sind supersportlich. Ja, immer sind wir in Bewegung und bestimmt nicht faul.“
„… wir sind ein gutes Team“, ergänzte seine Frau, die ebenfalls sportlich war und nach fünf Geburten noch immer recht jung erschien.
Max war in demselben Alter wie Dorit. Im Kindergarten lernten sie sich kennen; da waren sie beide vier Jahre alt. Sie spielten gern miteinander und freundeten sich an. Max hatte als Jüngster der drei Brüder schon früh erfahren, der Kleinste und nicht der Stärkste zu sein. Deshalb verstand er, sich zu versöhnen statt sich zu verstreiten, und fand so viel Vertrauen bei den Kindergarten-Jungs und –Mädchen – so auch bei Dorit, die auf ihn zuging und ihn begrüßte, wenn er morgens in das Spielzimmer des Kindergartens trat.
„Endlich bist du da“, rief sie ihm zu, „willst du mit mir spielen? Ich baue gerade eine Puppenstube mit Lego. Du kannst mir helfen.“
„Dazu habe ich keine Lust“, antwortete er, „draußen im Garten will ich eine Sandburg mit Hanno bauen.“
„Du bist gemein. Warum hilfst du mir nicht bei meiner Lego-Puppenstube? Wenn du nicht kommst, mache ich alles wieder kaputt.“
„Das ist doch blöd, Dorit“, gab Max zur Antwort, „ich helfe dir heute Nachmittag.“
Da trat Dorit wütend ein, was sie gebaut hatte. „Das hast du nun davon“, keifte sie ihn an.
„Dann komm mit uns in den Garten und baue die Sandburg mit uns!“
Das tat sie dann auch und nahm Max an der Hand.
Hanno war meistens schlecht gekleidet und roch ungewaschen. Wenn Dorit in seine Nähe kam, rümpfte sie die Nase. „Du musst dich öfter waschen, Hanno“, sagte sie ihm, wenn sie seinen schlechten Geruch nicht ertragen konnte, „aber ich mag dich trotzdem.“ Dass sie jede und jeden mochte, sagte Dorit allen, mit denen sie spielte; das tat sie, um sich für alle Fälle entschuldigt zu haben, wenn sie, warum auch immer, schlechte Laune hatte oder verärgert war und ihre Umgebung vor den Kopf stieß. Denn sie war sehr darum bemüht, sich mit allen gut zu stellen, ohne sich deshalb allzu sehr anzustrengen.
Hanno wohnte an einer Zufahrt zur Siedlung im Wald in einem Anwesen, das ganz anders aussah als die adretten Siedlungshäuser: ein flacher, mit Dachpappe gedeckter Bau, der eigentlich eine Baracke war – grau verputzt und mit trüben Fenstern. Von Hannos Vater hieß es, dass er ein Säufer sei, wenn er nicht LKW fuhr oder im Wald Holz schlug. Seine Mutter betrieb in einem Wohnwagen, der etwa hundert Meter von der Baracke entfernt war, ihr Privatbordell. Dem einen oder anderen aus der Siedlung, aber auch aus der Stadt war Hannos Mutter, die sich Jadwiga nannte, bestens bekannt. Mit den Reizen ihrer Oberweite und ihrer Top-Figur fiel es ihr nicht schwer, Männer für sich zu gewinnen. Vor dem Wohnwagen fanden die Hunde, die die Freier manchmal mitbrachten, um ein Alibi für einen langen Spaziergang zu haben, stets zwei Näpfe mit Chappi und Wasser. Gebell sollte so vermieden werden.
Hanno war der „Unfall“ eines Freiers. Der für seinen Vater gehalten wurde, war sein Vater nicht. Das wussten aber weder dieser noch Hanno, sondern allein seine Mutter. In der Siedlung wurde viel getuschelt, was Hannos wahre Herkunft und den Lebenswandel seiner Mutter betraf. Manch einer behauptete allerdings, dass der, der für seinen Vater gehalten wurde, möglicherweise gar nicht sein Vater war.
Zudem war Hanno bisweilen Opfer von Philipps und Ferdinands Spott – sie hänselten ihn, da er ein Außenseiter war und aus dem Rahmen der Siedlungsbewohner fiel. Im Gegensatz dazu zeigte sich Max solidarisch mit ihm, da er wusste, was es bedeutete, der Kleinste und Schwächste zu sein. Zudem war Hanno ein guter Spielkamerad, den Max durchaus mochte; er war kein Streithahn, der entweder eifersüchtig oder neidisch auf alle war, denen es besser erging als ihm. Trotz großer Verwahrlosung hatte er etwas sehr Feines, das er weder von seiner Mutter noch von dem, der sich sein Vater nannte, hatte.
Plötzlich ging Dorit zur Schule – so empfanden es ihre Eltern jedenfalls. Eine neue Phase begann, die für sie und Dorit mit einer Schultüte begann, die die größte aller Erstklässler war, die eingeschult wurden. Wie eine Prinzessin schritt Dorit in das Klassenzimmer und war überrascht, dass ihr niemand gleichsam zu Füßen lag, war sie doch, wie sie glaubte, vor Ort die Schönste und Wichtigste. Als sie merkte, dass die Eltern nicht mit ihr ins Klassenzimmer gingen, fühlte sie sich verlassen, obwohl der Raum voller Schüler war. Sie weinte, denn sie fürchtete, dass sie im Trubel des Klassenzimmers untergehen und den Anforderungen, die sich ihr mit der Schule stellten, nicht gewachsen sein würde. Als alle Erstklässler Platz nahmen, wusste Dorit nicht, wo sie sich hinsetzen sollte und landete ganz allein auf einer der Bänke ganz vorne. Max saß fünf Reihen hinter ihr neben Hanno. Als die Lehrerin den Schulalltag zu erklären begann, starrte Dorit sie an, als wolle sie fragen, wann sie zum Spielen wieder heimgehen dürfe – für heute habe sie genug von der Schule. Doch die Lehrerin sprach in einem fort. Dorit begann sich nach Max umzudrehen, konnte ihn aber nicht gleich entdecken.
„Hast du etwas verloren?“, fragte die Lehrerin, „oder willst du woanders sitzen?“
„Ich habe für heute genug von der Schule und möchte nach Hause“, war die Antwort.
„Nun sei nicht ungeduldig und warte, bis wir hier fertig sind“, sagte die Lehrerin, „wir haben noch den Stundenplan vor uns – dann ist für heute Schluss.“
„Ich will aber keinen Stundenplan“, schluchzte sie leise vor sich hin, „kann ich mich neben Max setzen?“
Darauf ging die Lehrerin nicht ein. Dorit schmollte auf ihrem Platz in der ersten Reihe, bis die Pausenglocke erklang. Dann sprang sie auf, rannte zur Tür des Klassenzimmers und drehte sich um in die Richtung, in der sie Max vermutete.
„Komm, Max! Wir gehen zusammen nach Hause!“
„Bin gleich da“, rief er zurück, „ich muss Hanno noch was zum Stundenplan erklären.“
„Wenn dir niemand die Wäsche macht“, flüsterte Max, „kannst du mir deine T-Shirts bringen. Die stecke ich dann bei uns in die Wäsche – das fällt nicht auf.“
„Danke, Max!“, antwortete Hanno auf dieses Angebot, nachdem ihm Max den Stundenplan nochmals erklärt hatte.
„Jetzt muss ich zu Dorit“, sagte Max, „die will nicht alleine nach Hause gehen und ist schon ganz ungeduldig. Komm doch mit!“
So gingen sie zu dritt nach Hause zurück.
„Wie war der erste Schultag“, fragte die Mutter die drei, als sie auf das Haus zugingen, in dem Dorit wohnte. Ihre Mutter stand in der offenen Haustür und hieß Dorit willkommen, die auf sie zu rannte.
„Schrecklich“, antwortete sie, „hier hast du meine Schultüte wieder – in die Schule gehe ich nicht.“
„Was ist denn passiert? Die Klassenlehrerin ist doch nett.“
„Die ist gar nicht nett. Ich musste ganz allein in der ersten Reihe sitzen - sie hat mich nicht neben Max sitzen lassen.“
„Habt ihr euch denn nicht gleich zusammen gesetzt?“, fragte die Mutter.
Max schwieg und sah Dorit und Hanno an.
„Hanno hat sich vorgedrängelt und neben Max gesetzt“, sagte sie, als sei sie beleidigt, „aber ich will nicht in die Schule gehen; denn die sind alle doof dort – außer Max und Hanno natürlich.“
„Na, dann komm rein ins Haus“, gab die Mutter zurück, um sie zu beruhigen, „tschüss, Max und Hanno!“
Die beiden winkten ihr zum Abschied zu und gingen. Was war denn mit Dorit los, fragten sie sich, im Kindergarten hatten sie doch so oft miteinander gespielt. Warum wollte sie nicht in die Schule? Hatte sie etwa Angst?
Da kamen Philipp und Ferdinand um die Ecke und fuhren mit ihren Fahrrädern auf die beiden zu.
„Ihr sitzt in der Schule nebeneinander“, äußerte Ferdinand.
„Wen interessiert das?“, sagte Max.
„Uns interessiert das“ erwiderte Philipp, „es wäre besser, wenn du neben jemand anders sitzen würdest als neben einem wie Hanno mit solchen Eltern und immer schmutziger Wäsche.“
„Ihr seid gemein. Hanno kann doch für seine Eltern nichts und dafür, dass ihm niemand die Wäsche macht.“
„Darum geht es doch gar nicht“, warf Ferdinand ein, „der passt nicht zu dir und hat keinen guten Einfluss auf dich, dieser Loser.“
Hanno blieb stehen und fing an zu weinen.
„Ihr kennt ihn ja gar nicht – ich spiele gern mit ihm“, erwiderte Max und versuchte Hanno zu trösten.
„Pass auf dich auf, Max“, sagte Philipp, „Hanno ist nicht deins und sein Zuhause erst recht nicht.“
Dorits Mutter war sehr besorgt, dass sich ihre Tochter schon beim Schulstart so schwertat. Das beunruhigte sie sehr.
„Ich verstehe nicht, was da passiert ist“, sagte sie Dorits Vater, ihrem Mann, „bald jeden Morgen ist Dorits Theater groß, in die Schule zu gehen, obwohl ich sie hinbringe. Nachmittags weigert sie sich ihre Hausaufgaben zu machen. Das geht jetzt schon sechs Wochen so. Besserung ist nicht in Sicht.“
„Willst du auch ein Glas Bier?“, fragte der Vater, „Dorit muss sich noch an die Schule gewöhnen – das war doch bei uns nicht anders.“
Sie nickte, er schenkte ihr Bier ein – dann prosteten sie sich zu.
„Max erzählte neulich von einem Streit mit einer Klassenkameradin, die Thea heißt. Thea ist offenbar strebsam und Dorit öfter ins Wort gefallen, obwohl sie gar nicht dran war.“
„Das ist doch Sache der Lehrerin und nicht deine, sich darum zu kümmern und für Ordnung zu sorgen …“
„… es ist komplizierter“, unterbrach sie ihn, „die beiden stehen in einem Wettbewerb, den Thea, wie Dorit mir sagte, angezettelt hat. Denn Thea möchte beweisen, alles besser zu wissen als Dorit, da Thea, so Dorit, nicht so hübsch ist wie sie. Thea ist pummelig und hat eine Brille.“
„Ist es dein Ernst, dass Dorit deshalb nicht in die Schule will? Das glaube ich nicht.“
„Gehört habe ich auch, dass sie wieder und wieder schmollt und unbeteiligt auf ihrem Stuhl sitzt.“
„Vielleicht bist zu streng und erwartest zu viel von ihr. Denn die Umstellung ist für sie offenbar größer als wir es vermutet haben …“
„… dann habe ich etwas falsch gemacht. Soll ich die Hausaufgaben mit ihr machen? Ist das eine gute Idee?“
„Genau! Das wird Dorit helfen. Das tut ihr bestimmt gut.“
„Sie hat es nicht leicht“, sagte die Mutter mit vielsagender Miene und dachte dabei an Geschwister, die Dorit nicht hatte und niemals haben würde, wofür sie, die Mutter, der Grund war - das stimmte sie traurig. Noch mehr warf sie sich vor, sie falsch erzogen und damit zu Dorits Problemen beigetragen zu haben, obwohl sie als Grundschullehrerin tätig gewesen war.
Andernorts gab es Zwillinge – Max hatte plötzlich zwei Schwestern, war nun ein älterer Bruder und nicht mehr der Jüngste von dreien. Das war eine völlig neue Erfahrung für ihn. Auf die Zwillinge war er sehr stolz; denn er fühlte sich fast schon erwachsen, wenn er in ihre Bettchen sah oder sie mit dem Kinderwagen durch die Siedlung schob. Ferdinand fand das lustig und nannte Max „unseren zweiten Papa“. Philipp war dagegen ein wenig eifersüchtig, da sich alles um Max und die Zwillinge zu drehen schien und er offenbar an den Rand der Aufmerksamkeit geriet – so empfand er es jedenfalls.
„Immer nur Max darf Waltraud und Hildegard ausfahren“, beklagte er sich, „das ist ungerecht.“
„Dann einigt euch!“, sagte die Mutter, „das ist doch kein Problem. Heute du und morgen Max – immer abwechselnd.“
„Immer will Philipp mir wegnehmen, was ich gerade bekommen habe – jetzt sind es Waltraud und Hildegard“, jammerte Max.
„Aber die beiden Babys gehören dir nicht. Ihr könnt euch doch abwechseln. Oder ist das zu schwierig?“
„Heute wollte ich mit den beiden zu Dorit und zusammen mit ihr spazieren gehen. Aber jetzt soll Philipp die beiden haben dürfen …“
„Einigt euch!“, rief die Mutter, „doch dafür braucht ihr mich nicht.“
Sie verschwand für eine kleine Siesta im Wohnzimmer und ließ die beiden Jungen mit ihrem Streit allein.
„Also gut“, sagte Philipp ungeduldig zu Max, „heute du und morgen ich.“
Max nahm den Kinderwagen, in dem seine Schwestern lagen, und schob ihn zu Dorits Haus.
„Willst du mit uns spazieren gehen?“, rief er ihr von der Gartenseite zu.
Dorit saß mit ihrer Mutter auf der Terrasse und hatte gerade begonnen, Hausaufgaben zu machen.
„Oh ja“, antwortete sie, „Mama, darf ich mit Max und seinen Zwillingsschwestern im Kinderwagen Familie spielen?“
Die Mutter schluckte und fragte: „Was ist mit deinen Hausaufgaben? Sollten wir die nicht noch erledigen, bevor du mit Max unterwegs bist?“
„Ach, Mama! Das dauert doch noch so lange. Ich will jetzt mit Max und seinen Schwestern Familie spielen. Die Hausaufgaben mache ich später mit dir.“
Während Dorit dies sagte, sprang sie auf und lief zu Max. „Tschüss, Mama!“, rief sie der Mutter zu, die unwillig aufstand und sich ins Haus zurückzog.
„Ich schiebe den Kinderwagen“, sagte Dorit zu Max, „Väter schieben keine Kinderwagen – das machen nur Mütter“, sie lachte auf, „du bist der Papa, ich die Mama und unsere Kinder sind Waltraud und Hildegard.“
„In Ordnung“, erwiderte Max, „so machen wir es.“
Dorit war glücklich und kam so spät wieder nach Hause zurück, dass für die Hausaufgaben gar keine Zeit mehr blieb. Denn sie hatte mit Max und seinen Brüdern noch Verstecken gespielt und wollte dann noch erleben, wie Waltraud und Hildegard gefüttert und gewickelt wurden – das hatte sie begeistert.
„Wo bist du so lange gewesen?“, fragte sie ihre Mutter, „hast du die Hausaufgaben vergessen, die ich mit dir machen wollte?“
„Ich war bei Max“, antwortete Dorit schnippisch.
„Was hast du da so lange gemacht?“
„Erst haben wir zusammen gespielt und dann habe ich beim Füttern und Wickeln der Zwillinge mitgeholfen.“
„Und was ist jetzt mit deinen Hausaufgaben? Ich habe mir Zeit dafür genommen und auf dich gewartet.“
„Mama, du nervst“, gab Dorit zurück, stapfte ein Stockwerk höher in ihr Zimmer und schloss die Tür hinter sich.
Thea wohnte nicht in der Siedlung. Sie war die älteste Tochter eines Oberstudiendirektors und wohnte im ehemaligen Pfarrhaus neben der evangelischen Stadtkirche. Ihre Schwester war zwei Jahre jünger als sie und sie sollte bald einen jüngeren Bruder bekommen, der sieben Jahre jünger als sie ein echter Nachzügler war. Thea konnte schon lesen und schreiben, als sie mit der Schule als Erstklässlerin begann. Sie war wissbegierig wie sonst niemand in ihrer Klasse und zugleich äußerst mitteilsam, wenn es darum ging, der Klasse zu zeigen, was sie alles schon wusste. Ein hübsches Mädchen oder ein schönes Kind war Thea allerdings nicht. Man hätte glauben können, dass dies der Preis für ihre intellektuelle Begabung war, die sie mit dem für ihr Alter ungewöhnlich großen Wissen bewies. Doch deshalb war sie nicht überheblich und sah auf niemanden abschätzig herab. Gerade für Schwache hatte Thea ein großes Herz. Die Not, die sie bei schwachen Menschen sah oder vermutete, ging ihr nah. So freundete sie sich mit Hanno an und erklärte ihm auf einer der Bänke im Schulhof oft, was er im Unterricht nicht verstanden hatte.
„Sind deine Eltern da, wenn du nach Hause kommst?“, fragte sie ihn wieder mal, als sie auseinandergingen.
„Das weiß ich nicht“, antwortete er, „mein Vater wahrscheinlich nicht und meine Mutter, die zu Hause arbeitet, wird hoffentlich merken, dass ich daheim bin.“
„Was arbeitet deine Mutter?“, fragte Thea, deren Mutter ausschließlich Hausfrau war und zusätzlich keinen Beruf ausübte.
„Das weiß ich nicht so genau. Wenn ich in der Schule bin, schläft sie sich aus. Nachmittags arbeitet sie in dem Wohnwagen, der in der Nähe der Baracke steht. Oft ist sie dort auch bis spät in die Nacht. Mir sagt sie, dass sie dort Näharbeiten macht, die aus der Siedlung kommen. Aber sie hat gar keine Nähmaschine im Wohnwagen.“
„Merkwürdig“, äußerte Thea, „bis morgen – pass‘ auf dich auf!“
Dorit war ihr fremd – das spürte Thea, als sie Dorit am ersten Schultag allein auf der Schulbank ganz vorne sitzen sah. Beruhte dies darauf, dass Dorit die Hübschere von den beiden war und Thea mit Schönheit nichts anfangen konnte? Ein unterschwelliger Konflikt zwischen ihnen begann, ohne dass sich die beiden dessen wirklich bewusst waren. Wenn Dorit nicht gleich eine Antwort auf eine Frage fand, die ihr die Lehrerin stellte, kam ihr Thea zuvor und fiel ihr bisweilen sogar ins Wort. Umgekehrt sparte Dorit nicht an Spott, wenn es um Theas Kleidung ging. Da sich die Situation nicht beruhigte, und Dorit darunter litt, schlug ihre Mutter vor, ausschließlich Thea zu ihrem Geburtstag einzuladen, der Mitte Dezember gefeiert wurde, und von der Einladung weiterer Klassenkameraden zu ihrer Geburtstagsfeier abzusehen.
Die Einladung zu Dorits Geburtstag löste bei Thea Befremden und Zurückhaltung aus. Auf was ließ sie sich ein, wenn sie ihr folgte? Begeistert war sie nicht. Ihre Mutter ermutigte sie allerdings, an Dorits Geburtstagsfeier teilzunehmen; denn solche Einladungen schlage man doch nicht aus. Schließlich überwog bei Thea die Neugier, Dorits Zuhause bei dieser Gelegenheit kennenzulernen. Sie fand sich pünktlich bei Dorit ein, war aber etwas verlegen, als ihr Dorits Mutter die Tür öffnete – damit hatte sie nicht gerechnet.
„Hallo, Thea! Wie schön, dass du gekommen bist …“
„… ist Dorit nicht hier? Bin ich falsch?“
„Nein, du bist richtig, Thea, alles gut. Dorit zieht sich noch um und ist gleich da.“
Während die Mutter dies sagte, hörte sie Dorit die Treppe herunterschreien: „Wo sind meine Schuhe, Mama?“
„Thea ist gerade gekommen“, antwortete die Mutter, „gleich bin ich bei dir – Augenblick.“
„Dann gehe ich eben auf Strümpfen“, erwiderte Dorit und rannte die Treppe herunter.
„Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, Dorit, und vielen Dank für deine Einladung“, sagte Thea und überreichte ihr ein Geschenk.
„Ich habe dich gar nicht eingeladen – das war meine Mutter.“
„Du hast mich nicht eingeladen?“, fragte Thea verwirrt, „deine Mutter hat das gemacht? Dann möchtest du nicht, dass ich hier bin …“
„… ist total O.K., dass du hier bist“, unterbrach Dorit, „was hast du mir denn geschenkt?“, dabei riss sie die Verpackung auf und rief: „Ein Buch? Aber ich kann doch nicht lesen …“
„Du kannst nicht lesen?“, sagte Thea, „aber das lernen wir doch.“
„Warum soll ich lesen lernen, wenn meine Mutter mir vorliest“, gab Dorit zurück.
„Willst du nicht lesen lernen, damit du es selber kannst?“
„Keine Ahnung“, antwortete Dorit, „ich zeige dir jetzt die Geschenke, die ich zum Geburtstag bekommen habe.“
Sie nahm Thea an die Hand und führte sie in ihr Zimmer, über das Thea äußerst erstaunt war.
„Ein so großes Zimmer nur für dich?“
„Warum nicht?“, erwiderte Dorit, „hast du kein eigenes Zimmer?“
„Doch – zusammen mit meiner Schwester, ist aber nicht so groß wie dieses.“
„Hier sind meine Geschenke. Die beiden Kleider sind von meiner Mutter, das Smartphone von meinem Vater, die Schuhe von meiner Oma, die Computerspiele von meinem Onkel – so viel wie dieses Mal habe ich noch nie zum Geburtstag bekommen,“
„Ich bekomme meistens nur Bücher“, sagte Thea leise und sah sich in Dorits Zimmer um, das voller Spielzeug und nicht aufgeräumt war; das ging bei ihr zu Hause gar nicht.
„Bücher sind so langweilig“, erwiderte Dorit, „oder hast du an Büchern Spaß?“
„Doch, Bücher finde ich gut. Ich lese gern“
„Ich nicht – ich mag auch die Schule nicht.“
„Willst du nichts lernen?“
„Doch! Aber nicht in der Schule – das macht mir keinen Spaß, das finde ich schrecklich.“
„Ich verstehe dich nicht. Wo willst du denn etwas lernen, wenn nicht in der Schule?“
„Keine Ahnung! Können wir bitte aufhören, über die Schule zu reden – ich mag das nicht. Komm, wir gehen jetzt raus“
„Ja“, sagte Thea, „zeig mir mal die Siedlung, in der du wohnst!“
Die beiden Mädchen stürmten aus Dorits Zimmer die Treppe hinunter, griffen nach ihren Windjacken und rannten nach draußen.
„Wollt ihr nicht noch Geburtstagskuchen?“, rief Dorits Mutter den beiden hinterher.
Aber da waren sie schon aus ihrem Blickwinkel verschwunden und hörten die Mutter nicht mehr. Dann soll ich wohl den Kuchen allein essen, sagte sie sich, und sah etwas traurig auf die mit Sahne verzierte Torte. Dass Dorit ständig auf dem Sprung war, verstand sie nicht und beunruhigte sie. In der Schule hatte sie weiterhin große Schwierigkeiten, sich an den Unterricht zu gewöhnen und richtig zu lernen. Dorit schien sich für nichts zu interessieren, was dort geschah. Trotz der ständigen Unterstützung, die ihr die Mutter gab, machte sie ihre Hausaufgaben nur sporadisch. Alle Versuche, sie zu motivieren, selbst lesen, schreiben und rechnen zu lernen, schlugen fehl. Ihre Versetzung in die zweite Klasse, zu der es noch lange hin war, schien gefährdet, wenn es so weiter ging wie jetzt. Dorits Mutter schnitt sich ein Stück von der Geburtstagstorte ab und verwöhnte sich, indem sie das Stück genussvoll in sich hineinlöffelte – ein süßer Trost, der ihr Problem aber nicht löste.
„Hast du hier viele Freunde?“ fragte Thea.
„Max wohnt nicht weit von hier“, sagte Dorit, der hat zwei Zwillingsschwestern bekommen – so süß! Wollen wir Max besuchen?“
Thea blickte sie etwas unentschlossen an.
„Komm, wir besuchen Waltraud und Hildegard“, rief Dorit, „die sind so süß.“
„Na gut“, antwortete Thea, „ich bekomme auch bald ein Geschwisterchen.“
Dorit eilte voraus, und Thea lief ihr hinterher. Nach ein paar Minuten hatten sie das Haus erreicht, in dem Max mit seiner Familie wohnte.
„Thea will Waltraud und Hildegard sehen“, sagte Dorit zu Max, der ihnen die Tür öffnete, „können wir rein?“
„Das war Dorits Idee, dich und die Zwillinge zu besuchen“, warf Thea ein, „Dorit hat heute Geburtstag.“
„Sag das doch nicht“, entgegnete Dorit, „das interessiert doch nicht.“
„Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag!“, rief Max, “leider schlafen die beiden jetzt, Habt ihr Lust, mit Philipp, Ferdinand und mir im Wald zu spielen?“