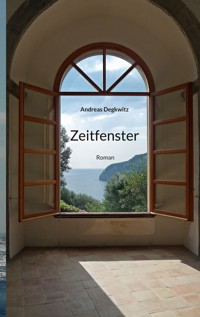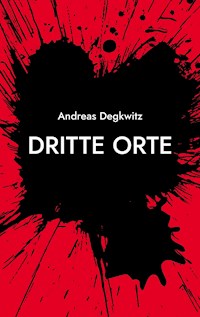Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem Urlaub stößt ein Bibliothekar aus Neugier auf einen Ort, der im Verfall begriffen ist. Ursache dafür ist eine Explosion in der Fabrik, die den Ort zu einem Industriestandort machte. Keira, die Tochter des Fabrikbesitzers, versucht den Ort, der ihre Heimat ist, vor seinem Untergang zu bewahren. Sie erzählt ihr Schicksal, das sie mit dem Ort verbindet, und fragt den Bibliothekar, ob und auf welche Weise ihr Gestern fortbestehen und gegenwärtig bleiben kann. Er möchte sie mit seinen Antworten auf ihre Fragen ermutigen. Doch dabei wird ihm klar, dass Keiras angstvolle Sorge um ihre Heimat auch seine ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mit Urlaub verbinden sich meistens Reisen. Am liebsten sind mir Reisen, die mir Erlebnisse vermitteln, die ich nicht für möglich hielt und die außerhalb meiner Alltagserfahrungen liegen. Plötzlich tut sich etwas auf, was mich neugierig macht, anzieht und so stark involviert, dass ich mich nur schwer wieder davon lösen kann. Mit Tourismus haben meine Erlebnisse nichts zu tun. Denn im Unterschied zu Abenteuern gängiger Urlaubsroutinen sind meine Erlebnisse nie geplant, selten vorherzusehen und absolut einzigartig. Zugleich führen mich meine Erlebnisse zu Erkenntnissen allgemeiner Natur, zu Zusammenhängen, die mir neue Aufschlüsse bieten, oder zu Antworten auf Herausforderungen und Fragen, die mich schon lange beschäftigt haben. Oft spielt Vergangenheit eine entscheidende Rolle. Denn Vergangenheit lebt immer fort und ist nichts, was für immer vorbei ist. Meine Erlebnisse machen mir gegenwärtig, wie viel Zukunft in Vergangenheit steckt. So gesehen, geben mir meine Reisen Zukunft. Anders gesagt, kann ich auf meinen Urlaubsreisen Vergangenheit und Zukunft miteinander zu Gegenwart verschmelzen. Zu meiner Profession als Bibliothekar passt dies sehr gut.
In einem Sommer Ende der 2010er Jahre bin ich an das große Binnenmeer unseres Landes gereist – dort, wo sich die Berge aus dem Wasser erheben und sich die Täler hin zu den Buchten des Gewässers strecken. Die Landschaft war in ihrer Vielfalt wunderschön – das sonnige Sommerwetter, satte Wiesen, belaubte Wälder, blauer Himmel, Schäfchenwolken. In den ersten Tagen habe ich gebadet und bin am Strand gelegen. Dann habe ich die Gegend mit Wanderungen näher erkundet und mich an der Natur erfreut. Schließlich entdeckte ich die Möglichkeit, mit der Eisenbahn in die nächste größere Stadt zu fahren – das stellte ich mir als ein schönes Erlebnis vor. So stieg ich nach zehn Urlaubstagen in den Zug, der mich zu einem „Gestern“ brachte. Mit quietschenden Rädern fuhr der Zug die Anhöhe hinauf. Die Diesellokomotive, die drei Personenwaggons zog, füllte die Berglandschaft mit Lärm und stampfte um die weit gestreckte Kurve, die die wenigen Fahrgäste in eine Bucht blicken ließ, die einen kleinen Hafen hatte. Am Ufer der Bucht erstreckte sich eine Industrieanlage, die mit einem Wohngebiet eine Ortschaft mit eigenem Bahnhof für Personen- und Güterverkehr bot. Die Lokomotive pfiff und verlangsamte ihre Fahrt, als sie sich dem Bahnhof der Ortschaft näherte, auf dem kein Schild mit dem Namen des Ortes zu sehen war.
„Wo sind wir hier?“, fragte ich laut in den Waggon hinein, erhielt aber keine Antwort. Mit einem plötzlichen Ruck hielt der Zug an. Der Schaffner lief aufgeregt durch die Wagen und verkündete, dass die Lokomotive einen Schaden habe und die Weiterfahrt frühestens in drei Stunden, also voraussichtlich gegen Mittag erfolge. Es war Sonntagvormittag. Nur wenige Reisende befanden sich in dem Zug – mehrheitlich solche, die von einer Nachtschicht kamen. Denn die meisten hatten geschlafen, bevor der Zug anhielt, und schienen dies fortsetzen und damit den ungeplanten Halt überbrücken zu wollen. Mich als Urlauber interessierte hingegen der Ort, an dem der Zug zum Halten gekommen war. Ich war bereit, diesen Ort, der allem Anschein nach völlig verlassen war, in der dreistündigen Wartezeit zu erkunden.
„Was war das hier früher?“, fragte ich einen Mann, der auf dem Bahnsteig stand, um eine Zigarette zu rauchen.
„Dieser verlassene Bahnhof macht Sie wohl neugierig“, entgegnete er mir mit einem Lachen, „das war eine Gummi- und Vulkanisierungsfabrik, die in den frühen 90er Jahren hier mit großem Erfolg aufgebaut wurde und für die Region der wichtigste Arbeitgeber war. Ende der 2000er Jahre kam es zu einer gewaltigen Explosion, die zu rund 30 Toten und fast hundert Verletzten wie auch zu großen Zerstörungen des Fabrikgeländes führte. Der Vorfall ging damals durch die Presse und sorgte für einige Schlagzeilen. Vielleicht erinnern Sie sich? Als sich dann eine weitreichende Kontaminierung des Areals auftat, waren die Chancen für den Wiederaufbau und die erneute Inbetriebnahme der Produktion so gut wie aussichtslos. Die gut 1000 Beschäftigten bekamen Angst, ihren Job zu verlieren, und waren in Sorge, eine neue Beschäftigung in der Gegend zu finden. Als die Explosion schließlich als Folge grober Fahrlässigkeit erklärt wurde, war es um die Fabrik geschehen. Eine Fluchtwelle setzte ein und binnen eines Jahres war die Ortschaft so gut wie geräumt. Bald zogen sich auch die Inhaberfamilie und alle Abteilungsleiter von dem Unternehmen zurück und flüchteten mit sämtlichen Geldreserven und Wertpapieren in die USA und nach Südamerika. Der Bürgermeister, der sich mit hohem Engagement für Erhalt und Wiederaufbau der Fabrik eingesetzt hatte, erhängte sich in seinem Amtszimmer, als er von der Flucht der Firmenleitung erfuhr. Selbstmorde gab es auch bei den Beschäftigten, die keine Perspektive mehr für sich erkennen konnten. Mit den Toten, die Familien hinterließen, wie mit den Verletzten, die für lange Zeit nicht arbeiten konnten, verbanden sich für die Hinterbliebenen schwere Schicksale, die noch immer nachwirken. Die Explosion war angeblich der Sabotageakt eines der Mitbewerber, der auf diese Weise seine Marktposition verbessern wollte. Zwei Jahre ist es her, dass dies behauptet wurde. Doch beinahe zehn Jahre danach waren alle Messen zum Fortbestand der Fabrik gelesen. Die Zeit war nicht mehr zurückzudrehen. Die zerstörte Fabrik ist noch immer eine offene Wunde.“
„Waren Sie auch in der Fabrik beschäftigt?“
„Das zum Glück nicht. Aber ich bin aus der Gegend und habe die Entwicklung verfolgt“, dabei drückte er seine Kippe aus und sagte, „passen Sie auf sich auf, wenn Sie den Ort erkunden möchten und verpassen sie die Weiterfahrt unseres Zuges nicht. Das Gelände ist weiterhin in vieler Hinsicht vergiftet.“
„Wohnen noch Menschen hier?“
„Davon wird immer wieder erzählt. Doch Näheres weiß ich nicht. Heimat- und Obdachlosen bieten Orte wie dieser eine willkommene Zuflucht.“
Mit einem „Danke schön“ und „Bis bald“ verabschiedete ich mich und machte mich rasch auf den Weg, um rechtzeitig zur Weiterfahrt des Zuges wieder zurück zu sein.
Ich trat aus der kleinen Bahnhofshalle, die mit Scherben und Abfällen übersät war, auf einen Vorplatz, von dem die Hauptstraße des Ortes zum Werkstor ging. Die Platten des Trottoirs hatten sich gelöst, auf dem Asphalt grünten Gras und kleine Sträucher. Die Fenster der Gebäude, die die Straße rechts und links säumten, waren überwiegend zerschlagen, so dass graue Tauben dort aus- und einfliegen konnten. Eine Reihe von Haustüren schienen verschlossen zu sein. In die Häuser, deren Haustüren offen standen oder fehlten, gingen magere Katzen aus und ein – bei Nacht waren es wahrscheinlich Ratten. Schaufensterscheiben von Geschäften gab es nicht mehr. Balkone hingen teilweise von den Hauswänden herab. Einige Dächer waren abgebrannt, andere hatten ihre Ziegel verloren. Ich erschrak, als ein Telefon in diese Stille hinein klingelte: Wurden etwa in diesen verfallenen Häusern noch Ansprechpartner vermutet? War diese Ortschaft gar nicht verlassen, wie es mir bei meinem Gang durch die Hauptstraße vom Bahnhof zum Werkstor zu sein schien? Vor dem Werkstor war eine Kreuzung, in deren Mitte sich eine Verkehrsinsel mit einer Bogenlampe befand, die sechs Arme mit hellen Leuchten gehabt hatte. Zwei Arme ragten noch in die Luft, zwei baumelten an dem hohen Laternenpfahl, der sich in leichter Schieflage zur Straße hin beugte: Eine Skulptur, die unter dem Einfluss von Sonne, Regen und Wind im Laufe der Zeit zu neuen Formen gekommen war. Die zwei zerborstenen Leuchtkörper, die abgerissen am Boden lagen, glotzten mich gleichsam an, als ich mein Smartphone aus dem Rucksack holte, um dieses Kunstwerk zu fotografieren. Dann streckte ich den beiden Leuchtkörpern die Zunge heraus und ging auf das geschlossene Werkstor zu.
Ob ich das Gelände betreten könne, fragte ich mich, oder die Exkursion wegen der stehen gebliebenen Zeit hier beendet sei. In der Pförtnerloge hing eine Kamera, die der Wind hin und her pendeln ließ, als gehöre sie zu der Uhr, die dahinter an einer Wand hing und auf halb elf stand, wie es die Zeiger zu erkennen gaben. Denn das Zifferblatt der Uhr war nicht mehr lesbar: Die Zeit, die sich die Menschen mit Uhren geben, war stehen geblieben. Die Zeitlichkeit, die die Natur den Dingen verlieh, war sichtbar, aber nicht den Einflüssen ausgesetzt, die wir Menschen den Dingen geben – so jedenfalls stellte sich die Situation für mich dar. Ein Knacken vernahm ich, mit dem das Werkstor zu meiner Überraschung aufsprang. Ein Windstoß schlug den rechten Torflügel zur Seite und hieß mich gleichsam willkommen. Ich sah auf die Uhr meines Smartphones, das – für mich unerwartet – nicht in Betrieb war. Hatte ich es versehentlich ausgeschaltet, nachdem ich die Lampenskulptur fotografiert hatte? Noch eineinhalb Stunden hatte ich Zeit, bis der Zug wieder fahren sollte. Für einen Gang über das Werksgelände genügte das, wenn ich mich etwas beeilte. Die Werkshallen, die links und rechts an der Straße standen, schienen bis auf die Fenster so weit intakt zu sein, wie sie nach über zehn Jahren ohne Betrieb intakt sein konnten. Die Werkbänke waren jedenfalls überwiegend in einem Zustand, in dem Arbeiter zum Feierabend ihre Werkbank verlassen, um am nächsten Tag ihre Arbeit dort wieder aufzunehmen. Ich erinnerte mich an den Raucher, der mir von einer Kontaminierung des Geländes erzählt hatte, und erklärte mir die zurückgelassenen Werkbänke mit der Flucht aus Angst vor Vergiftungen. Denn nicht weit von den Hallen waren die Gasbehälter und Öltanks explodiert, wie ein riesiges Loch und die Trümmer der in unmittelbarer Nähe befindlichen Gebäude zu erkennen gaben. Hier war geschehen, was zum Niedergang der Gummi- und Vulkanisierungsfabrik geführt und was die Katastrophe als industrielle Errungenschaft in der Region an die Natur zurückgegeben hatte, so dass ein „Heute“ vor über zehn Jahren in ein unwiderrufliches „Gestern“ versank.
Ich sah zurück zum Werkstor und stellte fest, dass der rechte Flügel, der mich willkommen geheißen hatte, geschlossen war. Noch eine halbe Stunde hatte ich Zeit, war mir allerdings sicher, dass die Lokomotive bis Mittag noch nicht repariert sei und der Zug nicht abfahren würde, solange ich noch unterwegs war. Eine halbe Stunde werde sicher auf mich gewartet, so dass mich der Zug aus dieser Grabstätte der Zivilisation auf jeden Fall ins pralle Leben zurückbringen würde und ich mich schon jetzt auf den Sonntagskaffee um fünf und das Bier zum Abendessen freute, als sei ich dem „Gestern“ menschlichen Strebens wieder einmal erfolgreich entkommen. Doch um das Schicksal nicht über die Maßen zu provozieren, trat ich nach einer Runde um das „offene Grab“ der Explosion den Rückweg zum Bahnhof an.
Ich eilte auf das geschlossene Werkstor zu und sah die Hallen nun von der anderen Seite. Die Wände, die sich mir nun offenbarten, waren sehr viel stärker zerstört, als ich das auf dem Hinweg zum Ort der Explosion vermutet hatte. Lange Risse zogen sich durch die Seiten und Vorderfront der Gebäude – das war mir schlicht entgangen, als ich die Werkshallen eine halbe Stunde zuvor passierte. Plötzlich wurde mir klar, dass die Fassaden einen guten Erhaltungsstatus der Gebäude vorgaben, der aber tatsächlich nicht existierte: Das zerstörte „Gestern“ war einsturzgefährdet und stellte große Risiken für mich dar. Ich rannte auf das Werkstor zu, um mich in Sicherheit zu bringen, ergriff den Knauf des nun linken Torflügels, der vorher offen war, und erhielt einen Stromschlag, der mir durch den Körper fuhr. Das Tor zu öffnen, bedeutete Lebensgefahr. Was nun, fragte ich mich, lief den Zaun