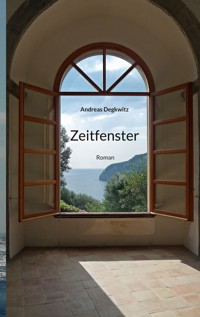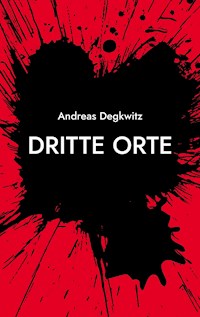Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer Zeit, die auf Individuen setzt, ist es nicht selbstverständlich, den Anspruch an sich selbst in einer Partnerschaft zu finden. Nur das Ego zählt, nur mit dem Ego wird gerechnet und auf das Ego allein kommt es an. Auf ein solches Selbstverständnis lassen sich viele Individuen ein, denen dabei entgeht, dass sie sich so verlieren. Wer aus der Dynamik dieses Prozesses ausbrechen will, hat keine andere Wahl, als sich seiner Person zu stellen. Das ist Anlass, aber auch Chance für eine Partnerschaft. Ohne Partner erlebt sich kein Individuum selbst. Um sich zu finden und zu entwickeln, ist ein Ego auf Zuwendung angewiesen. Das will jede und jeder. Doch der Weg dorthin ist nicht einfach, wie der "Bericht eines Ego" zeigt. Sich kein Bild von anderen und sich selbst zu machen, wird dabei zur Maxime, die Orientierung und Sinn gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wäre ich jemand, der sich treiben lässt, wüsste ich nicht, was mir geschieht. Denn wer sich treiben lässt, ist in der Lage, loszulassen, auf Orientierung zu verzichten und sich zu verlieren – das kann ich nicht. Denn ich will wissen, was mir geschieht. Leichter fällt mir das Leben deshalb nicht. Doch ich kann nicht anders. Meine Ansprüche an mich selbst lassen mir keine andere Wahl. Das wirft die Frage auf, welche Ansprüche an mich ich eigentlich stelle. Dabei komme ich zu einer recht eigentümlichen Antwort, die zu finden ich lange brauchte, bis ich mir bewusst wurde, wie sehr ich von etwas entfernt war, was andere für selbstverständlich erachteten.
Weihnachten war zu den Zeiten, als ich ein kleiner Junge war, nicht nur das Fest der Familie und des Friedens auf Erden, sondern in den Augen vieler das Fest der elektrischen Eisenbahn, die ich natürlich nicht besaß. Jahr für Jahr drückte ich mir an der Fensterscheibe des größten Spielzeugladens der Stadt die Nase platt, dessen Hauptattraktion eine aus meiner Sicht beachtliche Berg- und Tallandschaft war, die von einer Märklin-Lokomotive mit Personen- und Güterwagen befahren wurde. Die Sehnsucht, den Kosmos der Eisenbahnwelt im Miniaturformat zu gestalten und zu steuern, begeisterte mich und ließ den Wunsch nicht ruhen, ein solches Abbild schienenbasierter Mobilität im Weichbild von Städten und Landschaften zu besitzen. Berge, Tunnel, Brücken, Weichen, Signale, Bahnhöfe, Innenstädte links und rechts von den Schienentrassen lösten Begeisterung bei mir aus. Nicht, dass ich mich als Bahnhofsvorsteher oder Schaffner gesehen hätte – nein, ich bediente den Trafo und stellte Weichen und fühlte mich als Herr über eine Welt, die in Wirklichkeit über Dimensionen verfügte, an die ich niemals heranreichen konnte. Alle Jahre wieder bat ich meine Eltern, mich mit diesem Wunderwerk zu beschenken, aber mein Wunsch wurde nie erfüllt.
Das sei nichts für mich, wurde mir wieder und wieder entgegnet. Denn dieses Spiel mit der Welt en miniature werde mir schnell zu langweilig, könnte ich mir doch mit Legosteinen alles bauen, was die elektrische Eisenbahn biete, und sei dabei viel freier, als dies Faller-Häuschen und Märklin-Bahnen zuließen. Auch sei die Elektrifizierung dieser kleinen Welt durchaus komplex und dürfte mich ohne weitere Unterstützung absehbar überfordern. Aber dies sei meinen Freunden und Schulkameraden möglich oder bereits ermöglicht worden, erwiderte ich, warum nicht mir. Was war der Grund dafür?
Als ich zwölf Jahre alt war und sich Weihnachten wieder näherte, wurde mir mitgeteilt, dass ich nun alt genug sei, um mit dem Spielzeug vernünftig umzugehen. Dass ich nun so rasch gereift sein sollte, eine elektrische Eisenbahn besitzen zu dürfen, konnte ich mir nicht erklären, wagte allerdings nicht, diesen Sachverhalt zu hinterfragen. Denn nicht auszuschließen war, dass darin fehlende Einsicht erkannt werden würde, was mir das wunderbare Geschenk wieder entziehen könnte. Meine Freunde lachten mich aus oder vermittelten mir ihr Unverständnis mit Bedauern, dass ich „erst jetzt“ meine „elektrische Eisenbahn“ bekomme. Sie alle hatten längst eine und waren nun dabei, sich mit Autorennbahnen auszustatten – damit wurde Wettbewerb simuliert.
„Bekommst du eigentlich nie etwas geschenkt?“, fragte mich mein damals bester Freund, Hans-Peter, „hast du Stress mit deinen Eltern?“
„Eigentlich nicht“, gab ich zur Antwort, „ich verstehe sie nur manchmal nicht.“
„Habt ihr eine Glotze?“
„Eine was?“
„Einen Fernseher …?
„… ach so – nein, haben wir nicht. Warum fragst du?“
„Dann hast du ja gar keine Ahnung, was eigentlich abgeht.“
„Was meinst du damit?“
„Filme, Serien, Talkshows und Sport – davon bekommst du nichts mit.“
„Fehlt mir da wirklich was?“
„Jetzt verstehe ich, warum du immer so schweigsam bist, wenn es um etwas geht, was in der Glotze gewesen ist. Mitreden kannst du nicht.“
„Meine Eltern sind fest davon überzeugt, dass wir keinen Fernseher brauchen. Also gibt es bei uns nichts, was euch die Glotze bietet.“
„Wenn du Lust hast, kannst du gerne bei mir fernsehen – wenn deine Eltern dir das erlauben.“
Hans-Peter war wirklich großzügig. Von seinem Angebot habe ich oftmals Gebrauch gemacht, ohne meine Eltern um Erlaubnis zu fragen. Erfahren habe ich dabei auch, dass sich „Familie“ ganz anders abspielen kann, als ich „Familie“ mit meinen Eltern und Geschwistern erlebte. Hans-Peter hatte sogar noch mehr Geschwister als ich. Dazu gehörten auch zwei Schwestern, in die ich mich bald verliebte – so bringt die Glotze die Menschen einander näher. Hans-Peter war nicht so gut in der Schule, aber deutlich beliebter als ich. Denn er ging in Kameradschaft auf, sah gut aus und war für alle Sportarten zu haben. Sport war kein Thema für mich, so dass ich trotz mancher Ermutigung auch auf dem Bolzplatz nicht zu gebrauchen war. Dort stand ich am Rand, wie ich mich auch am Rand des Interesses meiner Freunde und Schulkameraden mit der Musik befand, die ich auf dem Klavier praktizierte. Für Musik hatten mich meine Eltern ausersehen und nicht für Fußball mit allem, was damit zusammenhing. Spielen war für sie das Primat der Musik, nicht das einer Kameradschaft, die sich aus einer Gruppe von Individuen zu einer Mannschaft um einen Ball herum entwickelte und danach in den Bierhimmel aufstieg. Anders gesagt: Streichquartett mit Klavierbegleitung und Champagner versus Kampf um den Rasenball mit Pils aus der Flasche. Ich hätte glauben können, dass mein Anspruch an mich meine kultivierte Erziehung begründe, ein Anspruch, der zu einer Debatte um Werte führe, der ich mich allerdings nicht gewachsen fühlte.
„Meine Eltern haben endlich einen Fernseher gekauft“, teilte ich Hans-Peter nach langen Monaten, doch voller Stolz mit, als hätte ich mich damit durchgesetzt.
„Na, super“, gab er zur Antwort, „ab sofort kannst du mitreden. Darfst du denn alles sehen?“
„Das Wichtigste darf ich sehen“, gab ich mit Selbstbewusstsein zurück, „das ist doch klar.“
„Nur ‚Wertvolles‘ wolltest du sagen“, erwiderte er bedeutungsvoll, „und das ist fast nichts.“
Es ging also um Niveau, gab mir Hans-Peter zu verstehen. War Niveau der Anspruch, dem ich genügen wollte? Das erschien mir plausibel. Niveau für sich zu beanspruchen, kann nicht verkehrt sein. Aber welchen Maßstab legte ich für das Niveau an, das ich erstrebte? Welche Kriterien waren leitend für mich, um die Gewissheit zu haben, dass, was ich erreichte, meinem Anspruch genügte? Das konnte doch nicht allein in meinem Ermessen liegen. Das war doch gerade der Unterschied zu denjenigen, die sich nach meiner Wahrnehmung selbst genügten, weil sie sich ohne jede Orientierung treiben ließen. Darauf gründete doch das Niveaudefizit, das so weit verbreitet war. Dabei wurde mir plötzlich eine Fehlentwicklung bewusst, der ich mit meinem Anspruch an Niveau entgegenzuwirken vermochte – jedenfalls bot sich diese Chance. Denn offensichtlich wurde mir die Ehre zuteil, mit meinem Anspruch an mich selbst einen beklagenswerten Missstand auszuräumen. Ausgewählt war ich, Niveau zu beweisen, um die Menschheit ihrem Abgrund sinnbefreiten „Nicht-Niveaus“ zu entreißen und auf den Höhepunkt wahrer Mündigkeit und Verantwortung zu führen.
Ein starker Impuls ergriff mich und brachte mich zu heftigen Auseinandersetzungen mit meinen Eltern, als es um die Auswahl der „wichtigsten Sendungen“ ging.
„Ich weiß, was für mich wichtig ist“, fuhr ich sie an, „ich lasse mir das von euch nicht vorschreiben.“
„Du möchtest gerne wissen, was für dich wichtig ist“, versuchte meine Mutter mich zu beschwichtigen.
„Aber warum weißt das denn du?“
„Ich bin deine Mutter …“
„… die mir sagt, wo ich langgehen soll, was ich ihrer Auffassung nach noch nicht weiß?“
„Eltern wissen, was für ihre Kinder richtig und wichtig ist“, pflichtete mein Vater ihr bei, „das gehört zu den Aufgaben von Eltern.“
Ich sah mich mit der Haltung meiner Eltern einer Niveaulosigkeit ausgesetzt, die das „Nicht-Niveau“ derjenigen noch übertraf, die nicht zu wissen schienen, was Niveau denn eigentlich ist. Die Beurteilung dessen, was richtig und wichtig ist, als Bestandteil elterlicher Fürsorge zu erklären, hielt ich für ein starkes Stück – das ging zu weit, das konnte ich nicht akzeptieren. Auch wenn ich nicht wusste, nach welchem Maßstab ich Niveau für mich beanspruchen konnte, mir dies von meinen Eltern diktieren zu lassen, konnte es ja nicht sein. Doch in Ermangelung von Kriterien, die ich zur Bewertung meines Niveaus vor mir hertragen konnte, nahm ich von diesem Selbstanspruch Abstand. Allerdings hielt mich das nicht davon ab, die träge Selbstzufriedenheit meiner privaten Umgebung, diesen Mainstream der Wertevergessenheit, als niveaulos zu charakterisieren. Als Herabsetzung dessen, was ich auf keinen Fall für mich wollte, ohne zu wissen, was ich denn wollte, war diese Bezeichnung bestens geeignet. „Völlig niveaulos“ war wie ein Fluch, mit dem ich alles aus meinem Gesichtskreis zu entfernen versuchte, womit ich mich nie mehr wieder befassen wollte.
Die Glücksgefühle meiner Freunde, die ihnen ein Jahr später von stolzen Gesichtern abzulesen waren, entgingen mir nicht. Heranwachsend wie ich ließen sie sich auf den Kosmos der fülliger werdenden Mädels ein und verstanden, diese mit Erfolg zu erobern. Was sie als Gefühl der Liebe und Zuwendung artikulierten, war nichts anderes als Begehren, das in üppigen Oberweiten und drallen Popos seinen Ausgang nahm. Ging es in der Öffentlichkeit vorrangig darum, die geilste Puppe im Schlepptau zu haben, wurde das Ziel der Zweierbeziehung auf das Fortpflanzungspotenzial beschränkt, das mit Lust zwar bereicherte, aber im Regelfall ohne Folgen blieb. Vor dem Lauf der Natur wussten sich inzwischen jede und jeder zu schützen. Ob sich daraus ein Selbstanspruch für die Beziehung ergab, blieb meistens offen und entsprach damit einem Orientierungsverlust, der auch in diesem Kontext zu beobachten war.
Ging ich mit meinen Ansprüchen an mich selbst in meinen Bemühungen um das „zarte Geschlecht“ zu weit? Was konnte ich bieten? Wie sollte ich mich präsentieren? Womit konnte ich überzeugen? Denn ohne eine Idee, die mich vielversprechend erscheinen ließ, würde ich absehbar scheitern. Sich einfach auf jemanden einzulassen und abzuwarten, was sich daraus ergab, war meine Sache nicht. Das war mir zu wenig ambitioniert und ließ mich keine Leidenschaft spüren. Beruhte Erfolg in der Liebe nicht auf Aufopferung, Gefühlen und Leidenschaften als Voraussetzung, sie für mich zu gewinnen?
Dann trat Nicola in meine Gefühlswelt ein, die deshalb in Aufruhr geriet und keinen klaren Gedanken mehr zuließ. Wenn ich an sie dachte, ergriff mich Begeisterung und, weil ich bald nur noch an Nicola dachte, war ich in einem Zustand leidenschaftlicher Euphorie, die mich allerdings nicht mit ihr zusammenbrachte. Wie kam ich zu ihr? Wie konnte ich mich ihr erklären? Und wer war der Kerl, mit dem ich sie kürzlich sah? Hatte sie etwa einen, der mir den Weg versperrte? Doch dann stand sie plötzlich in der Straßenbahn vor mir. Sie fuhr zur Schule, ich fuhr zur Schule – ich brachte ein leises „Hallo Nicola“ über die Lippen und suchte ihr Lächeln.
„Hallo“, gab sie mir zur Antwort, „das Wetter ist heute schlecht.“
„Ich habe einen Schirm dabei“, äußerte ich beflissen.
„Das trifft sich ja super“, sagte sie, „ist denn noch Platz unter deinem Schirm?“
„Na klar“, gab ich zurück und spannte mit großer Geste den Schirm auf, während wir aus der Straßenbahn ausstiegen.
Als Nicola sich bei mir einhakte, blühte ich regelrecht auf und dachte „Geschafft!“. Doch davon war ich weiter entfernt, als ich es für möglich hielt – ich hatte mich also doch nicht getäuscht, was die Schwierigkeit, sie zu erobern, betraf. Nicola blieb für mich unerreichbar, obwohl ich immer wieder mal auf sie stieß. Doch sie sagte mir ab.
Mein nächster Schwarm hieß Mandy und weckte Hoffnungen auf Erfolg - doch daraus wurde nichts. Dieses Mal war ich es, der auf die Bremse trat. Mandy war hübsch und hatte Sinn für Humor. Aber ich konnte ihre Gießkannenstimme nicht ertragen. Außerdem unterbrach sie mich immer, wenn ich ihr etwas erklären wollte, da ihr meine Erklärungsversuche zu umständlich waren. Dann bemühte ich mich um Angelika, die ich auf einer Party kennenlernte und mit der ich mich gut unterhielt. Endlich jemand, der auf derselben Wellenlänge lag wie ich. Wir trafen uns öfter und tauschten uns über alles aus, was uns beschäftigte. Mein gesamtes Mitteilungs- und Verständnispotenzial bot ich auf, um ihrer Erwartung entgegenzukommen. Doch nach einem halben Jahr erklärte sie mir, dass sie nun einen Freund habe und wir künftig nicht mehr so oft zusammenkommen könnten wie bisher.
Corinna dagegen war sehr freizügig und hatte, im Gegensatz zu mir, schon Erfahrung, was auch mir zugute kam. Sie beglückte mich mit ein paar heißen Nächten, gab mir aber nach fast zwei Wochen zu verstehen, dass ich nicht ihr Typ sei, obwohl ihr der Sex mit mir allerhand Spaß gemacht habe.
Laura zeigte ich mich von meiner fürsorglichen Seite, indem ich ihr meine Hilfe für ihre Probleme mit Mathematik anbot. Irritiert und ziemlich ernüchtert ob meines mäßigen Erfolgs versuchte ich die Einflüsse zu analysieren, die diesem Ergebnis zugrunde lagen. Meine Bemühungen um Liebe, Partnerschaft und Zuwendung gingen offenbar an den Personen vorbei, die ich dafür auserwählt hatte. Meine Begabung, über das Ziel hinauszuschießen oder schlicht danebenzuliegen, war bedrückend. Einfühlsam, hilfsbereit, großzügig und was auch immer an Edelmut, es interessierte offenbar nicht. Mit meinen Ansprüchen an mich selbst und den Ansprüchen derer, die ich für eine erfolgreiche Partnerschaft in Erwägung gezogen hatte, lag offenbar eine tiefe Kluft. Mit meinen Annahmen einer Seelenbeziehung lag ich bisher komplett falsch. Das überraschte mich vor allem mit Blick auf meine Freunde und Kameraden, die sich nach meinem Eindruck deutlich weniger schwertaten, ohne sich sonderlich anzustrengen. Wie Ehegatten gingen sie nach recht kurzer Zeit mit ihren Freundinnen um, die gleiches taten, als seien sie eheerfahrene Gattinnen. War eine Partnerschaft vermeintlich gefunden, führten die nächsten Schritte in einen bezähmenden Alltag, der mir zu phantasielos erschien, um meine „Ehepaare“ zu beneiden. Zugleich musste ich mir eingestehen, dass mich meine Bemühungen bisher nicht annähernd dorthin gebracht hatten. Was machte ich falsch? Warum stand ich mir selbst im Weg?
Hans-Peter begann sich um mich zu sorgen.
„Hast du vielleicht andere Erwartungen mit deinen Nachhilfestunden verbunden oder stellst du dich einfach nur dämlich an?“, fragte er mich, als ich ihm mitgeteilt hatte, dass Laura mir einen Laufpass mit der Bemerkung gegeben habe, es sei jetzt genug, sie brauche mich nun nicht mehr.
„Deine Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat.“
„Was hast du dir denn von deinem Einsatz versprochen? War es Zuneigung von deiner Seite oder hast du mit Liebe als Gegenleistung gerechnet, weil du so nett warst, Laura unter die Arme zu greifen?“
„Über mehr Zärtlichkeiten als Ergebnis der Kurvendiskussionen hätte ich mich schon gefreut.“
„Hattest du denn einen Plan B für den Fall, dass die Kurvendiskussion nicht zu einem solchen Ergebnis führte?“
„Nein, das hatte ich nicht – abgesehen davon, dass ich Laura auf den Mund küsste, wenn ich kam und wieder ging ...“
„… und du hofftest, dass sich daraus so etwas wie eine Liebesbeziehung ergeben würde?“
„Ich hatte keinen Anlass zu glauben, dass Laura dieses Techtelmechtel als unangenehm empfand – im Gegenteil: Sie hatte Spaß daran und ging manchmal auch etwas weiter …“
„… und was heißt das?“
„Manchmal schmuste Laura so richtig und ließ sich von mir an die Brüste fassen.“
„Das hast du ernst genommen?“
„Ja, ich hatte den Eindruck, dass sie Spaß daran hatte, weil es ihr ernst mit mir war.“
„So hat sie dich bezahlt, mein Lieber“, sagte Hans-Peter und schmunzelte, „denn um Geld ging es dir ja nicht.“
Damit hatte Hans-Peter zusammengefasst, was ich bei meinen Bemühungen um Partnerschaften tat und warum ich dabei nicht erfolgreich war. Ich bemühte mich, mir eine Partnerschaft zu verdienen. Doch die von mir Verehrte fühlte sich deshalb von mir gekauft. Bei Laura wurde mein Modell, mich um Partnerschaft zu bemühen, wie auch die Ursache meines Scheiterns besonders deutlich. Aus welchen Gründen und in welcher Weise auch immer verstand ich das Glück einer Partnerschaft als Leistung. Anders sah ich keine Möglichkeit, eine Beziehung einzugehen – ganz gleich, ob ich als Begleiter, Freund, Kamerad, Retter oder Verliebter auftrat oder mich so inszenierte. Doch dass ich damit den Eindruck erweckte, mir meine „Objekte des Begehrens“ zu kaufen, das hatte ich nicht bedacht – das hatte ich nie in Betracht gezogen oder als Grund meines Scheiterns gesehen.
Doch Hans-Peter, der sich ganz anders verhielt als ich, hatte Recht. Für ihn war einfach, was sich für mich als kompliziert erwies. Umgekehrt war dies allerdings nicht der Fall: dort, wo ich mich mit Leichtigkeit in komplizierte Gedankengebilde über Seelenverwandtschaft, Niveau und Ansprüche in idealisierten Liebesbeziehungen verstieg, schien Hans-Peter einfach zu passen. Denn er fand für sich immer einen einfachen Weg, so dass er sich selbst gegenüber anspruchslos wirkte, aber dennoch erfolgreich war. Denn er setzte sich nicht mit hohen Selbstansprüchen von allen anderen ab, sondern wurde aufgrund seiner Teamfähigkeit ausgesprochen geschätzt. Hans-Peter konnte vernetzen, versöhnen, ausgleichen, Kompromisse schließen und sich schlussendlich dabei wohlfühlen. Er ging in der Gemeinschaft mit anderen auf und trat ge