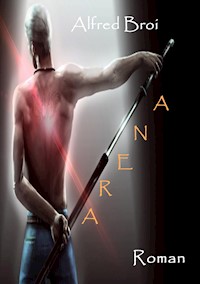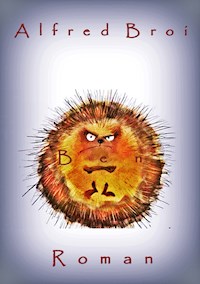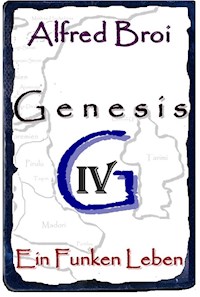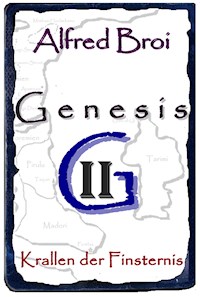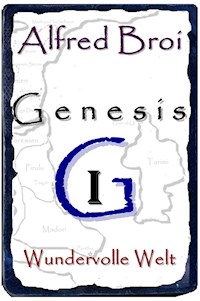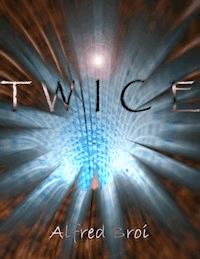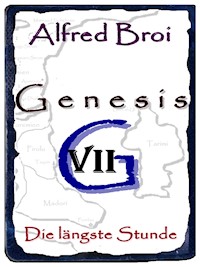
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Genesis
- Sprache: Deutsch
Das große Doppelfinale endet in einer epischen Schlacht um den Planeten Santara… Gelitten, gehofft, ertragen, gebangt… Schmerzen, Wunden, Tod, Verlust… Alles versucht, alles gegeben und doch … alles verloren? Der Verlust des Teleskops auf dem Mos Iridas zerstört alle Hoffnungen auf die Errettung des Planeten. Bis Vilo in einer zufälligen Entdeckung eine letzte…allerletzte Chance auf Hoffnung erkennt. Schnell ist klar: Um sie zu verwirklichen, müssen alle nochmals über alle Grenzen gehen. Erneut ist die Trennung der Gemeinschaft erforderlich: Während der Trupp um Jorik und Marivar zum Imrix-Gelände aufbricht, um dort das Wunder zu starten, finden sich die anderen in einem finalen Showdown auf dem größten Schlachtfeld des Planeten wieder. Doch der Feind ist wachsam und entfesselt nochmals all seine grauenvolle Macht. Am Ende ist sicher: Genesis ist auf dem Weg – doch noch ahnt niemand, wie hoch der Preis für das Wunder wirklich sein wird… Genesis VII – Die längste Stunde ist das finale Kapitel und der würdige Abschluss der großen Saga um das Schicksal eines ganzen Planeten – mega spannend, brutal schonungslos und hochemotional
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 845
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
I – Das Genesis-Projekt
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
II – Das Ende einer Illusion
XXI
III – Die längste Stunde
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
IV - Genesis
XLII
XLIII
XLIV
Epilog - Leben
I
Das Genesis-Projekt
I
Im Inneren der Talura war es sehr still geworden.
Kabus flog das Schiff zurück nach Westen, um dann in das galpagische Meer einzutauchen und nach Süden abzubiegen. Niuri war bei ihm und saß auf dem Kopilotensitz. Beide hingen ihren Gedanken nach, sodass niemand von ihnen etwas sagte.
Mavis und Melia hatten das Cockpit verlassen und waren in einer der Kabinen verschwunden. Mavis hatte keinerlei Anweisungen hinterlassen, es schien, als wäre ihm zumindest im Moment alles vollkommen egal.
Leira und Dek waren zurück in die Krankenstation gegangen, die der Sergeant so überstürzt hatte verlassen müssen, als die Lawine all ihre Hoffnungen zerstört hatte. Während Leira einfach nur still dasaß und ihm zusah, untersuchte er den ausgewachsenen Bären abschließend auf innere Verletzungen, die jedoch nicht vorhanden waren und gab ihm anschließend eine Vitaminspritze und ein leichtes Schlafmittel.
Hiernach sah er nochmals nach dem Jungtier, doch das schlief ruhig und entspannt in seiner Decke und Leira schien es, als würde bereits wieder etwas Farbe in das ausgemergelte, geschundene Gesicht zurückkehren.
Dek nickte zufrieden und sackte dann förmlich in sich zusammen. Tiefe Verzweiflung zeigte sich in seinem Gesicht und Hoffnungslosigkeit. Er wirkte um Jahre gealtert. Zu Leira sagte er, dass mit den beiden Bären soweit alles okay wäre und er im Moment nichts weiter für sie tun könne. Dann schlurfte er mit leerem Blick aus der Krankenstation und ging zu Captain Tibak, der in einer anderen Kabine saß und ebenfalls seinen Gedanken nachhing.
Als Leira allein war und nichts Anderes zu hören war, als die tiefen Atemzüge des ausgewachsenen Bären und das monotone Brummen der Triebwerke, spürte auch sie sehr schnell die Anstrengungen der letzten Stunden und Müdigkeit befiel sie.
Während der Einschlafphase sah sie vor ihrem inneren Auge nochmals die Ereignisse der letzten Stunde, speziell die Geschehnisse im Garagengebäude rund um die beiden Bären.
Eigentlich war es reiner Zufall gewesen, dass Leira – obwohl ausgestattet mit einem sehr feinen Gehör – die Stimme des Jungtiers trotz der Wind- und anderer Nebengeräusche vernommen hatte. Vielleicht – so kam es ihr in den Sinn – war es ja kein Zufall gewesen, sondern etwas Anderes…Schicksal.
Dann sah sie den ausgewachsenen Bären vor sich. Ein Männchen. Offensichtlich der Vater des Jungtiers, der seine Tochter unter Einsatz seines eigenen Lebens beschützen wollte, obwohl Hunger, Kälte und körperlicher Verfall durch die beiden vorgenannten Punkte ihn so sehr geschwächt hatten, dass er sich kaum noch selbst auf den Beinen hatte halten können. Nur der angeborene Instinkt zum Schutz der eigenen Familie hatte ihm diese Kräfte verleihen können, gegen die es selbst Leira anfangs schwer gehabt hatte. Wenn sie sich vorstellte, dass dieses Männchen im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen wäre, hätte sie echte Probleme bekommen, sich gegen ihn durchzusetzen.
Denn obwohl dieser Bär etwas kleiner war, als sie, war er dennoch ein überaus stattliches Exemplar. Sein markanter männlicher Duft – den sie unter den anderen, weniger angenehmen Düften noch schmecken konnte und der ihr auch jetzt noch in der Nase hing – war sehr interessant und…anregend…gewesen.
Im nächsten Moment war Leira etwas verwirrt, denn ein solches Gefühl hatte sie schon sehr lange nicht mehr empfunden. Doch musste sie zugeben, dass dieses Männchen Eindruck auf sie gemacht hatte und sogar ziemlich attraktiv wirkte, trotz seines allgemein schlechten Zustands.
Mit diesem letzten Gedanken war sie dann schließlich eingeschlafen.
Ihr Schlaf verlief traumlos, wohl auch, weil sie ziemlich erledigt war.
Plötzlich aber hörte sie die Rufe des Jungtiers wie aus weiter Ferne zu ihr hindurch dringen. Sofort spürte sie eine aufkommende Unruhe, weil etwas in ihr, sie zu diesen Rufen hinzog. Das Jungtier war doch so schwach und brauchte dringend Hilfe und sie allein hörte es und konnte dafür sorgen, dass es ihm wieder besserginge.
Leiras Unruhe stieg weiter an.
Mit einem Male hörte sie auch das tiefe Brummen und Knurren des Männchens. Nein nicht, hörte sie sich rufen. Du brauchst nicht zu kämpfen. Ich bin nicht dein Feind! Doch das Knurren und Fauchen wurde immer lauter und vermischte sich mit einem Hämmern, ganz so, als wäre das Männchen irgendwo eingesperrt und versuchte sich daraus zu befreien.
Und dann riss Leira ihre Augen auf, konnte die Unruhe und den Lärm dieses Alptraums nicht mehr ertragen – und musste erschrocken feststellen, dass sie gar nicht geträumt hatte!
Das Jungtier, das noch tief und fest geschlafen hatte, als sie selbst eingenickt war, war wach, aus dem warmen, weichen Handtuch gekrabbelt und saß jetzt noch immer ein wenig zittrig und wackelig, aber schon deutlich besser und aufrechter, als zuvor, auf ihm und quickte lauthals vor sich hin.
Der Grund war denkbar einfach: Als es erwacht war, fühlte es sich einsam und suchte nach seinem Vater, konnte ihn aber nicht finden. Deshalb war es hektisch geworden, hatte Angst bekommen und sich freigestrampelt. Dabei hatte es geschrien und nach einiger Zeit auch eine Antwort bekommen, denn ihr Vater war schließlich ebenfalls erwacht. Natürlich wollte er sofort zu seiner Tochter, doch als er feststellen musste, dass er sich kaum bewegen konnte, weil er angebunden war, wurde auch er nervös und zornig. Er fauchte und brummte und brüllte und versuchte sich loszureißen. Weil ihm das jedoch nicht gelang, wurde er noch nervöser und zorniger. Diese Gefühle sprangen letztlich auch auf das Jungtier über, dass sich noch verlorener, hilfloser und ängstlicher fühlte, weil es seinen Vater zwar hören und auch sehen konnte, er aber nicht zu ihm kam.
Und genau in diesem Moment öffnete Leira ihre Augen und war sofort hellwach. Mit einem überraschten Brummen schoss sie auf die Beine, während sie noch versuchte, die Situation zu überblicken. Als sie glaubte, das geschafft zu haben, erschien es ihr sinnvoll, zunächst das Männchen zu beruhigen. Sie machte also ein paar Schritte auf ihn zu, bis sie sicher war, dass er sie sah und begann dann ihrerseits zu brummen und ihm zu erklären, wo er war, was geschehen war und dass es keinen Grund gab, ängstlich oder besorgt oder zornig zu sein. Es dauerte ein paar Sekunden, bis sie sich Gehör verschaffen konnte, doch dann zuckte der Kopf des Männchens zu ihr herum und er starrte sie in einer Mischung aus Hass und Angst an.
Leira konnte ihn verstehen, daher redete sie immer weiter erklärend und beruhigend auf ihn ein. Das Männchen verstummte tatsächlich und hörte ihr zu. Das gab Leira Mut und sie machte zwei weitere Schritte auf das Tier zu, stand jetzt beinahe direkt vor ihm. Doch mitten hinein in ihre nächste Erklärung zuckte plötzlich der Schädel des Männchens mit weit aufgerissenen Kiefern und einem wütenden Fauchen auf sie zu. Leira erschrak sichtlich und sie konnte ihre Schnauze gerade noch im letzten Moment zurückziehen, bevor die Kiefer nur wenige Zentimeter vor ihr mit einem lauten Knall zusammenkrachten. Ihr Gegenüber sah ihre Verwirrung, fletschte die Zähne und versuchte nochmals nach ihr zu schnappen.
Da erkannte Leira, dass sie die Sache falsch angegangen war. Ohne zu zögern ging sie zu dem Tisch, auf dem das Jungtier saß. Das erzeugte bei dem Männchen beinahe einen Tobsuchtsanfall und er gebärdete sich wie toll. Doch Leira ließ sich nicht beirren. Sie nahm das Jungtier in ihre Schnauze, hob es an und setzte es auf ein kleines, fahrbares Tischchen. Gleich danach schnappte sie sich die Decke und warf sie dem Tier über den Körper. Dann schob sie das Tischchen langsam in Richtung Männchen. Das verstummte zusehends, die Wut wich zu Sorge und schließlich brummte es seiner Tochter beruhigende Laute zu. Leira schob das Tischchen direkt neben die Liege, auf der der ausgewachsene Bär festgeschnallt war und wartete geduldig. Nach ein paar Augenblicken sah das Männchen sie an und verlangte, losgebunden zu werden. Leira nickte, doch gab sie ihm klar zu verstehen, dass sie das nur tun würde, wenn er versprach, sich ruhig zu verhalten und ihr endlich zuzuhören. Das akzeptierte er.
Doch Leira war ziemlich sicher, dass das Männchen es nicht vollkommen ehrlich meinte. Dennoch ging sie zu seinem linken Hinterlauf – glücklicherweise waren alle Gliedmaßen einzeln mit kurzen, ziemlich stabilen Eisenketten an die Liege gefesselt – und löste die Fessel. Das Männchen beobachtete sie mit Argusaugen, doch blieb es ruhig. Dann ging Leira zu seiner linken Vorderpfote. Das Männchen fragte sofort, warum sie nicht auch seinen rechten Hinterlauf löste, doch Leira erwiderte nichts, und löste die Fessel an der Vorderpfote.
Dann trat sie einen Schritt zurück. Das Männchen erkannte jetzt, dass Leira nicht vorhatte, es gänzlich zu befreien und reagierte sofort ungehalten, doch Leira erwiderte nur, er solle seine neue Freiheit nutzen und sich um seine Tochter kümmern, anstatt ständig nur miese Laune zu verbreiten. Schließlich hatte sich seine Situation und die des Jungtiers gegenüber der auf dem Mos Iridas doch wohl sichtlich verbessert und Leira ihn nur deshalb nicht vollständig losgebunden, weil er sich gebärdete, wie eine zickige Diva.
Unerwarteter Weise zeigten diese Worte Wirkung bei dem Männchen. Es starrte Leira in einer Mischung aus Verblüffung und Überraschung an, dann brummte es noch einmal, drehte sich schließlich aber zu seiner Tochter herum, legte ihr seine linke Pfote um den Körper, zog sie zu sich und konnte sie so schnell beruhigen.
Leira schaute sich die traute Zweisamkeit einen Moment lang an, dann kam ihr ein Gedanke. Sie brummte und gab dem Männchen zu verstehen, dass sie sich um etwas Essbares kümmern würde und bat ihn, in der Zwischenzeit Ruhe zu bewahren, nicht wieder auszurasten und schon gar keinen Fluchtversuch zu unternehmen, der ohnehin sinnlos wäre, da das Flugboot kaum Versteckmöglichkeiten bot. Wenn es Leira nicht gelang, ihn davon zu überzeugen, sich ihr und den anderen anzuschließen, könne er mit seiner Tochter ohnehin am Ende ihrer Reise gehen, wohin er wolle. Es würde ihn weiß Gott niemand aufhalten.
Das Männchen hörte ihr aufmerksam zu und brummte dann mit einem Nicken.
Daraufhin verließ Leira die Krankenstation.
Sie hatte kaum die Tür geschlossen, da trat Melia zu ihr. Sie lächelte Leira zu, doch konnte das Bärenwesen erkennen, dass sie geweint hatte. Das Gesicht ihrer Freundin wirkte eingefallen und farblos. „Ich habe Lärm gehört!“ sagte sie mit schwacher Stimme. „Ist das Männchen aufgewacht?“
Leira nickte.
„Brauchst du Hilfe?“
Leira schüttelte den Kopf und brummte sanft.
Melia hörte ihr aufmerksam zu, lächelte zwischendrin einmal müde und nickte dann, als Leira fertig war. „Ich glaube, ich habe in der Küche etwas Brauchbares gesehen!“
Leira brummte dankbar und gemeinsam gingen sie in die Bordküche.
Melia öffnete einige Schränke, bis sie schließlich fand, was sie gesucht hatte. „Hier!“ Sie holte zwei handtellergroße Plastikbeutel hervor, die prall gefüllt waren und an einer Seite einen Klappverschluss besaßen. Melia las kurz, was auf der Hülle stand und nickte dann erneut. „Ja, das ist Nahrung. Ich schätze, dass gehört noch zur Standardausführung, als das Schiff in Dienst gestellt wurde. Damals, als…!“ Ihr Blick wurde für einen Augenblick sehr traurig. Dann aber riss sie sich zusammen und atmete mit einem Lächeln durch. „Na ja, ich schätze, es ist noch essbar. Musst es halt versuchen!“ Leira brummte sanft. „Hier!“ Melia gab ihr zwei weitere Tüten. „Das ist was mit Fleisch und das…!“ Sie deutete auf eine der Tüten, die sie zu Beginn herausgeholt hatte. „…ist ein Obstmus! Das passt doch, oder?“ Leira nickte und lächelte. Sie nahm die Tüten in ihre rechte Vorderpfote.
„Und hier!“ Melia fischte eine Wasserflasche von der Anrichte. „Flüssigkeit!“
Leira brummte dankbar und gemeinsam verließen sie die Küche wieder.
Auf dem Weg zurück zur Krankenstation brummte Leira erneut.
„Schlecht! Wir waren so nah dran und jetzt ist alles vorbei!“ erwiderte Melia und ihr Blick wurde ernst. „Seit der ersten Sekunde, als wir uns wiedergefunden hatten, habe ich gespürt, wie sehr Mavis für die Zukunft dieser Welt gekämpft hat. Er hat sich nie geschont, nie aufgesteckt, nie den Mut verloren. Das Glas war für ihn stets halbvoll…!“ Sie lächelte müde. „…und dafür habe ich ihn immer bewundert!“ Schlagartig wurde ihr Blick wieder sehr, sehr traurig. „Davon ist jetzt nichts mehr übrig!“ Sie sah Leira direkt an. „Ich glaube, etwas in seinem Inneren ist zerbrochen!“ Eine einzelne Träne rann ihr über die Wange.
Leira war sichtlich berührt von Melias Worten, doch fühlte sie sich ähnlich und konnte deshalb kaum eine Hilfe sein. Sie brummte und gab Melia zu verstehen, dass sie in Gedanken bei ihnen war.
Dann hatten sie die Krankenstation erreicht.
„Ich wünsche dir viel Glück mit den beiden!“ sagte Melia, lächelte und strich Leira über die Schulter.
Das Bärenwesen brummte sanft und rieb ihren mächtigen Kopf kurz an Melias Brust. Dabei gab sie ihr zu verstehen: Mavis hat mir dir die Frau an seiner Seite, die er immer haben wollte. Gemeinsam…! Leira wartete, bis Melia sie ansah. …werdet ihr die noch verbleibende Zeit unvergesslich machen. Dessen bin ich sicher! Sie stupste Melia nochmals sanft an.
„Danke!“ erwiderte ihre Freundin, dann drehte sie sich um und machte sich auf den Weg zurück zu ihrer Kabine.
Leira schaute ihr noch hinterher, dann drehte sie sich zurück zur Eingangstür in die Krankenstation. Melias Worte hatten sie sehr betroffen gemacht. Auch sie hatte Mavis stets als den Mann gekannt, den ihre Freundin beschrieben hatte. Ihn jetzt zusammenbrechen zu wissen, schmerzte ihr in der Seele.
Um sich davon abzulenken, kam ihr die Sache mit den beiden fremden Bären gerade recht und sie zwang sich, sich voll darauf zu konzentrieren, bevor sie ihr eigener Schmerz erreichte und mitriss. Sie beschloss, ihn so lange wie möglich zu verdrängen, da sie wirkliche Angst davor hatte, dass er ähnlich auf sie wirken würde, wie bei Mavis.
Leira atmete mit einem tiefen Brummen durch, dann lauschte sie. In der Krankenstation war es ruhig…eigentlich fast schon zu ruhig. Sofort befürchtete sie, dass das kein gutes Zeichen sein könnte, doch dann glaubte sie doch so etwas wie Gelächter zu hören. Daraufhin öffnete sie entschlossen die Tür und war sogleich erleichtert.
Vater und Tochter befanden sich noch immer dort, wo sie sie zurückgelassen hatte. Offensichtlich hatten sie gerade über etwas gelacht, denn als Leira eintrat, hatten beide noch ein Lächeln auf den Lippen. Doch während es bei dem Jungtier anhielt, verschwand es bei dem Männchen wieder und wich einer ernsten, abwartenden Miene.
Leira trat in die Mitte des Raumes und legte ihre Mitbringsel ab. Dabei ließ sie das Männchen nicht aus den Augen, blieb jedoch auch stumm. Dann trat sie zu einem weiteren Tisch an der Wand und holte zwei Schalen hervor. Beide stellte sie neben die Wasserflasche und den Nahrungsbeuteln. Sie öffnete die Flasche und füllte die kleinere Schale etwa zur Hälfte damit. Dann öffnete sie den Beutel mit dem Obstmus, legte ihn in die größere Schale und drückte einmal fest darauf, sodass ein großer Teil des Inhalts in die Schale quoll.
Als das erledigt war, kam sie zu den beiden fremden Bären und fragte das Jungtier, ob es Hunger habe. Das Mädchen nickte mit einem kläglichen Stöhnen. Leira lächelte kurz und schaute dann das Männchen fragend an. Anfangs konnte sie in seinen Augen noch Misstrauen erkennen, doch dann wurde sein Blick deutlich weicher, bis er schließlich mit einem dünnen Lächeln nickte.
Daraufhin packte Leira das Jungtier im Nacken, hob es vorsichtig an und stellte es vor die Schale auf den Boden. Das Mädchen stand etwas wackelig da und schnüffelte zunächst unsicher. Doch dann gewann der Hunger die Oberhand und es machte sich schmatzend und zufrieden stöhnend über den Brei her.
Leira musste bei dem Anblick lächeln und stellte beim Aufblicken fest, dass dies auch der Vater tat. Als er jedoch erkannte, dass Leira ihn ansah, verflog es wieder. Dennoch konnte Leira den Blick des Männchens für einen längeren Moment fixieren. Sie sah Stolz in ihm, Misstrauen, dass jedoch eher wie Unsicherheit wirkte, vielleicht etwas Furcht, aber keinen Zorn mehr und so war sie sicher, dass sie es wagen konnte.
Wortlos ging sie zu ihm und löste auch die beiden anderen Fesseln. Dabei nahm sie jedoch nicht den Blick von ihm, um im Zweifelsfall schnell reagieren zu können. Auch das Männchen ließ sie nicht aus den Augen, doch blieb es ruhig, wenn auch etwas angespannt. Als Leira fertig war, ging sie zurück zur Raummitte, öffnete einen der anderen Nahrungsbeutel, trat mit der linken Vorderpfote darauf, sodass etwas Brei herausquoll und leckte ihn auf.
Dann schaute sie zu dem Männchen, in dessen Augen sie jetzt deutlich Hunger sehen konnte. Im nächsten Moment sprang das Tier von der Liege. Beim Aufprall musste es stöhnen, verzog kurz das Gesicht unter Schmerzen und hatte in den ersten Sekunden Mühe, sich aufrecht zu halten.
Leira beobachtete das Männchen, dann öffnete sie einen zweiten Nahrungsbeutel und schob ihn mit der Nase in seine Richtung.
Im ersten Moment bewegte der Bär sich nicht, doch dann kam er langsam und vorsichtig näher, drückte mit der rechten Vorderpfote auf den Beutel, schnupperte an dem hervorquellenden Brei und machte sich schließlich mit einem Stöhnen daran, ihn aufzulecken.
Leira war zufrieden, schaute den beiden beim Fressen und auch Trinken zu und lächelte.
Nach einer Minute hatte das Männchen seinen Beutel komplett geleert, doch Leira schob ihm auch noch ihren zu. Bevor ihr Gegenüber sich darüber hermachte, trafen sich wieder ihre Augen und er nickte Leira dankbar zu.
Während er an dem Fleischbrei leckte, brummte er.
Wie heißt du? fragte Leira.
Das Männchen hielt inne und sah sie finster an. Wie heißt du?
Leira!
Puruh, brummte das Männchen.
Und deine Tochter?
Mina!
Leira nickte. Ein hübscher Name!
Wieder brummte das Männchen und fraß etwas von dem Brei. Also gut! begann es dann unvermittelt. Ich war vorhin wohl nicht ganz bei der Sache. Erzähl mir noch einmal, was genau hier los ist!?
Und das tat Leira dann.
II
„Sag etwas!“ Marivars Stimme war leise, schwach und ihre Worte klangen zittrig. Sie lag neben Jorik auf einer Decke in einer der kleineren Höhlen, in die sie sich zurückgezogen hatten. Keiner von beiden hatte bisher ein Wort gesprochen. Wenn Marivar in Joriks Augen schaute, dann sah sie dort Schock, Entsetzen und eine derart furchtbare Hoffnungslosigkeit, dass ihr eine Gänsehaut über den Rücken kroch und ihr war klar, dass ihr Partner ganz sicher nicht reden wollte. Und wenn Marivar ehrlich war, hätte sie auch nicht gewusst, worüber, denn eigentlich gab es nichts mehr zu sagen, was auch nur im Entferntesten sinnvoll gewesen wäre.
Also hatte sie sich neben Jorik auf die Decke gelegt, sich an ihn geschmiegt, ihren Kopf auf seine Brust gelegt und hing ihren Gedanken nach, die ihr einige stumme Tränen brachten. Obwohl sie anhand seines Atemrhythmus erkannte, dass auch er nicht schlief, traute Marivar sich nicht, sich aufzurichten und Jorik anzusehen.
Nach einiger Zeit aber wurde sie innerlich sehr unruhig. Der Schmerz schien sie schier zu überwältigen und sie spürte den Drang, mit Jorik darüber zu reden. Doch kaum hatte sie ihre Worte ausgesprochen, da wurde ihr klar, dass sie nicht von ihm verlangen konnte, sich mit ihr auszutauschen – zumindest noch nicht. Deshalb fügte sie kleinlaut hinzu: „Bitte!“
Im ersten Moment dachte sie allerdings, sie hätte sich getäuscht und Jorik wäre doch eingeschlafen. Dann aber atmete er tief durch und sagte: „Ich wüsste nicht…?“ Seine Stimme klang furchtbar kratzig und schwach. „…was?“
Instinktiv drehte sich Marivar zu ihm und als sie ihn ansah, zuckte er in den Achseln. Sie hatte wohl noch niemals zuvor in solch traurige Augen geschaut. In diesem Moment spürte sie, wie eine heiße Welle purer Verzweiflung in ihr überzuschwappen drohte. Sie konnte sich gerade noch zusammenreißen und es verhindern. Dennoch musste sie die Zähne fest zusammenbeißen und schlucken, um den Kloss im Hals zurück zu drängen. Dabei spürte sie heißkalten Schweiß auf ihrer Stirn. Ihr Puls erhöhte sich schlagartig und hämmerte gegen ihre Schläfen. Nach außen hin aber schaffte sie es, dass nur eine einzelne Träne über ihre Wangen lief. „Ich weiß nicht?“ Das Sprechen fiel ihr schwer. „Über alles!“
„Ist da wirklich noch etwas, das es zu sagen gibt?“ Joriks Blick war leer, Marivar merkte, dass er am liebsten still geblieben wäre.
„Aber?“ Die Ärztin war jetzt etwas hilflos. „Wie soll es weitergehen?“
„Du meinst, außer dass wir nur noch auf den Tod warten können?“
„Ich…!“ Marivars Verzweiflung gewann wieder die Oberhand. „Gott Jorik, das darf doch nicht…!“
„Was?“ unterbrach sie ihr Partner sanft und lächelte säuerlich. „Das Ende sein?“ Sein Blick wurde wieder traurig. „Doch Marivar!“ Er sah sie direkt an. „Genau das ist es: Das Ende unseres Weges! Wir haben einfach zu lange gewartet…oder besser zu spät gehandelt. Wir hatten daher von Beginn an keine andere Wahl, als alles auf diese eine Karte zu setzen. Doch unser Blatt war nicht gut genug!“ Er lächelte wieder traurig. „Und deshalb haben wir das Spiel verloren…endgültig!“ Tiefe Hoffnungslosigkeit spiegelte sich in seinem Blick wider.
Marivar war kurz davor aufzuschreien, so hilflos fühlte sie sich. „Aber…?“ Mehr brachte sie nicht über ihre Lippen, dann schossen Tränen aus ihren Augen.
Plötzlich nahm sie ein Geräusch wahr. Es kam vom Eingang in diese Höhle, der lediglich mit einem dicken Stoffvorhang abgetrennt war. Jemand hatte gegen den Stein dort geklopft. Einen Augenblick später wurde der Vorhang etwas nach innen gedrückt. Marivar konnte zwei Beine in dem Bodenspalt erkennen.
Dann räusperte sich ein Mann. „Darf ich reinkommen?“ Es war Shamos! Marivar erkannte die Stimme des Wissenschaftlers sofort. Irgendwie war sie erfreut, sie zu hören.
„Klar!“ erwiderte Jorik ausdruckslos, ohne zum Eingang zu blicken.
Shamos schien einen Lidschlag zu warten, dann trat er ein. Er vermied sofort längeren Blickkontakt zu den beiden, seine Augen zuckten unstet über den Boden und die Wände. Marivar konnte dennoch erkennen, dass er geweint hatte. Sein Gesicht war rotfleckig und wirkte eingefallen, sein Blick war leer. „Ich…!“ Er räusperte sich nochmals, weil seine Stimme kaum mehr als ein Krächzen war. „Ich könnte einen größeren Beutel gebrauchen. Habt ihr sowas?“ Wieder nur der Hauch eines Blickes.
„Einen…?“ Jorik furchte die Stirn und verzog angesäuert die Mundwinkel. „…Beutel?“ Er sprach dieses Wort aus, als wäre es eine Krankheit.
Shamos nickte jedoch nur.
Marivar erinnerte sich an einen Wäschesack, den sie in der Ecke gesehen hatte. „Ich habe…!“ Sie deutete in die entsprechende Richtung. „…einen Wäschesack. Würde der gehen?“ Sie sah ihren Freund mit einem traurigen Lächeln an.
Shamos nickte erneut. „Ja, das wäre…perfekt!“ Er warf ihr einen dankbaren Blick zu, bevor er den Kopf wieder senkte.
Marivar stand auf und ging in die Ecke.
„Wozu…?“ Joriks Stimme klang wenig freundlich. „…brauchst du den?“
Shamos antwortete nicht. Marivar schaute kurz zu ihm herüber, doch stand er nur mit hängendem Kopf da. Irgendetwas stimmte nicht, das spürte sie. Deshalb bückte sie sich und hob den Wäschesack auf, ohne den Blick von dem Wissenschaftler zu nehmen. Dabei merkte sie, wie sich ihr Herzschlag erhöhte.
„Kannst du oder willst du mir nicht antworten?“ fragte Jorik, richtete seinen Oberkörper auf und schaute seinen Freund direkt an.
Marivar konnte sehen, dass Shamos sofort nervös und rot im Gesicht wurde. „Ich…will nicht!“ Dann hob er seinen Kopf, sah Marivar, von der er gar nicht gemerkt hatte, dass sie zu ihm gegangen war, für einen kurzen Augenblick direkt an, lächelte dabei dankbar und griff nach dem Wäschesack.
„Was?“ Joriks Blick verdunkelte sich nochmals, während er sich gänzlich auf die Beine drückte.
Marivars Puls stieg weiter an. Etwas stimmte ganz und gar nicht, dessen war sie jetzt mehr als sicher. Im Gesicht des Wissenschaftlers konnte sie all jene Gefühle sehen, die auch sie gerade empfand: Trauer, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung! Doch sein Lächeln war vollkommen anders: Offen, frei und…fröhlich? Marivars Herz stockte für einen Augenblick. Konnte das sein? Ausgerechnet Shamos, der sicher noch ein wenig mehr unter dieser unerträglichen Situation litt, als sie alle? Nein, dafür kannte sie ihn zu gut! Shamos litt Höllenqualen, da war für Fröhlichkeit kein Platz! Marivar hatte sich getäuscht. Aber dennoch: Etwas an seinem Lächeln ließ sie nicht zur Ruhe kommen. Sie konnte absolut nicht sagen, was, doch plötzlich kam ihr ein Gedanke: Shamos litt. Zuallererst war er es doch gewesen, für den die Situation des Krieges und der Zerstörung Santaras derart unerträglich war, dass er fieberhaft nach einer Lösung gesucht hatte. Nur ihm hatten sie es zu verdanken, dass sie alle jetzt hier waren. Er allein hatte ihnen Hoffnung gegeben. Und er hatte dieses furchtbare Nein, das jetzt über ihnen allen hing, sicherlich ebenfalls nicht akzeptieren können. Er hatte in der letzten Stunde bestimmt nachgedacht, fieberhaft, überlegt, nach einem weiteren Ausweg gesucht. Und wenn Marivar eines noch mit Sicherheit wusste, dann das: Wenn noch irgendjemand von ihnen die Katastrophe verhindern konnte, dann war es Shamos, dieses unfassbar brillante Genie, wie es kein zweites je auf diesem Planeten gegeben hatte.
Augenblicklich stockte ihr Atem. Natürlich, Shamos hatte nachgedacht und – sie sah noch einmal sein Lächeln und ein Schauer fuhr über ihren Rücken – eine Lösung gefunden!?
Ein leiser Schrei entfuhr ihrer Kehle, als sie abrupt einatmete und hinter dem Wissenschaftler, der gerade den Vorhang zurückschob, um die Höhle zu verlassen, herschaute. „Shamos, hast du…?“ Sie konnte nicht verhindern, diese Worte zu sagen, doch erschrak sie sofort und stoppte ab. Für einen winzigen Moment schalt sie sich eine dumme Pute, weil sie glaubte, sich nur etwas vorzumachen, doch Shamos verharrte für einen Augenblick in seiner Bewegung, schien sich umdrehen zu wollen, bevor er hörbar durchatmete und den Raum dann doch verließ. Marivars Puls erhöhte sich sofort wieder schlagartig und unwillkürlich drehte sie ihren Kopf zu Jorik.
Der war sichtlich angefressen, aber auch verwirrt. „Was hat er?“
„Eine…!“ Marivar wollte es gar nicht, doch konnte sie ein kurzes Lächeln mit leuchtenden Augen nicht verhindern. „…Idee!?“
„Eine…?“ Joriks Stirn legte sich in Falten, dann plötzlich wurden seine Augen riesengroß und er holte tief Luft. „Oh verdammt!“ Ruckartig zuckte sein Körper nach vorn und während er Marivar anstarrte, hastete er zum Ausgang. „Shamos!“ rief er, als er den Vorhang beiseite fegte und in den Gang trat. Er erkannte seinen Freund keine drei Meter weiter. „Shamos!“ rief er nochmals.
Marivar stand schräg hinter Jorik, konnte sehen, dass der Wissenschaftler stehen blieb, sich zunächst aber nicht zu ihnen herumdrehte. Gleichzeitig trat Esha aus dem Nebenraum und schaute ihren Partner und dann Jorik überrascht an. Marivar spürte, wie ihr Puls erneut zu rasen begann.
„Was?“ hörte sie Shamos fragen, ohne dass dieser sich bewegte.
„Antworte mir!“ hob Jorik an und in seinem Gesicht konnte Marivar deutlich einen Hoffnungsschimmer erkennen. Seine Stimme zitterte. „Hast du...?“ Er schluckte. „...eine Idee?“
Für eine gefühlte Ewigkeit erstarrte der Moment zu Eis. Keiner bewegte sich, keiner sagte etwas. Es herrschte Totenstille, die so laut war, dass sie Marivar in den Ohren schmerzte.
Dann – endlich - hob Shamos seinen Kopf und drehte ihn zu Esha. Seine Frau sah ihn mit feuchten Augen an. Doch konnte Marivar keine Freude in ihrem Blick erkennen, nur Mitgefühl und Verzweiflung. Sofort war da wieder das furchtbare Gefühl, dass etwas nicht stimmte.
Einen Augenblick später drehte sich der Wissenschaftler mit einem tiefen Atemzug zu ihnen herum und auch ohne seine Worte wusste sie, dass es doch Niemanden mehr gab, der die Katastrophe noch aufhalten konnte. Shamos hatte seine Augen noch für eine Sekunde geschlossen, dann schaute er Jorik mit einem so gnadenlos hoffnungslosen Blick an, dass Marivar Mühe hatte, sich nicht zu übergeben.
„Nein!“ Shamos schüttelte den Kopf. „Ich habe keine…Idee!“ Seine Augen wurden blicklos. „Wir haben alles versucht! Es gibt…!“ Er schüttelte erneut den Kopf. „…nichts…!“ Die besondere Betonung dieses Wortes unterstrich deutlich seine Endgültigkeit und verursachte bei Marivar erneut eine Gänsehaut. „…was wir noch tun könnten!“ Shamos atmete nochmals tief durch, dann blickte er Jorik für einen Augenblick direkt an, bevor er sich schließlich wieder umwandte.
„Aber…?“ Marivar wollte eigentlich nur noch schreien, konnte sich nur schwer beherrschen, ihrer Verzweiflung freien Lauf zu lassen. „Der Beutel?“
Shamos hielt in seiner Bewegung inne, schaute auf den Gegenstand in seiner Hand hinab, dann hob er den Blick und sah seine Freundin mit einem mitfühlenden Lächeln an. „Tut mir leid, aber der wird uns auch nicht retten können!“
„Was willst du dann damit?“ fragte Jorik.
Shamos sah ihn einen Moment stumm an, dann sagte er. „Sachen packen!“
„Sachen…?“ Joriks Stirn legte sich in Falten. „…packen?“
Shamos nickte, schaute dabei kurz zu Esha. „Ja, wenn du so willst, hatten wir doch eine Idee!“
„Welche?“ fragte Marivar mit erstickter Stimme, doch kannte sie die Antwort eigentlich schon.
„Zu gehen!“
Die Worte zu hören, war dennoch ein absoluter Schock.
„Was?“ rief auch Jorik total entsetzt auf.
Marivar schaute zu Esha, vielleicht in der schwachen Hoffnung, sie würde ihren Mann zurechtweisen und irgendwie doch noch alles zum Guten wenden, doch das tat sie nicht.
Stattdessen sagte sie. „Du weißt es, Jorik!“ Sie sah ihren Freund direkt an. Ihre Stimme klang sanft und fest. „Ich sehe es in euren Augen!“ Sie sah auch Marivar an. „Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Immer hatten wir noch einen Ausweg gefunden, eine Möglichkeit, eine Chance, die Hoffnung zu erhalten!“ Ihr Blick wurde traurig. „Doch nicht dieses Mal!“ Sie schüttelte den Kopf. „Heute nicht!“
Jorik schaute Esha einen Moment stumm an, dann nickte er.
„Was also bleibt noch zu tun?“ fragte Esha und ihr Blick zeigte Verzweiflung. „Was bleibt jetzt überhaupt noch?“
„Die Liebe!“ hauchte Marivar, die erkannte, weshalb Esha und Shamos gehen wollten…gehen mussten.
Esha nickte. „Ja!“ Sie lächelte. „Die Liebe! Aber nicht an diesem Ort!“ Sie schüttelte wieder den Kopf und ihr Lächeln verschwand. „Nicht hier!“
„Aber…?“ Joriks Stimme wurde zittrig, als er einen Schritt auf Shamos zumachte. „…wo dann?“
Der Wissenschaftler sah ihn einen Augenblick an. „Du weißt, es gab immer etwas, dass ich fast so sehr geliebt habe, wie die Wissenschaft!“
Jorik lächelte und nickte. „Sonne, Strand und Meer!“
Jetzt lächelte auch Shamos und nickte. „Ja!“ Seine Stimme hatte eine solche Sehnsucht in sich, dass Marivar bereits wieder die Tränen in die Augen schossen. „Und ich will das alles noch einmal sehen, Jorik, bevor…!“ Er schüttelte den Kopf. „Ich kann nicht hier sitzen und auf das Ende warten. Ich habe alles für Genesis gegeben, einschließlich meines gesamten Glaubens. So wie ihr alle es auch getan habt. Ich bin so unsagbar stolz auf uns…!“ Plötzlich brach seine Stimme ab und erste Tränen liefen über seine Wangen. „Und es tut mir so leid, dass es nicht funktioniert hat. Aber so ist es!“ Sein Bick verhärtete sich. Er atmete tief durch und richtete seinen Körper wieder auf. „Und es ist nichts geblieben, außer eben der Liebe zu Esha und dem Wunsch, es nicht hier enden zu lassen!“ Er sah seine Frau an, die längst neben ihn getreten war. Auch sie weinte stumme Tränen und schmiegte sich jetzt an ihn und küsste ihn sanft.
„Wo…?“ Jorik musste schlucken, um den Kloss im Hals wegzudrücken. Außerdem war seine Stimme nur noch ein Krächzen, weil auch er gegen Tränen ankämpfte. „Wo wollt ihr hin?“
„Ich werde Captain Cosco oder Kendig fragen, ob sie uns bringen können. Es gab da ein paar ganz bezaubernde, kleine Inseln südlich von Adi Banthu im südlichen parulischen Ozean!“ Wieder blitzten seine Augen sehnsüchtig auf. „Ich hoffe, dass sie noch unberührt sind, denn wir haben uns entschlossen…!“ Er warf Esha einen Seitenblick zu, den seine Frau mit ernster Miene erwiderte, dann wartete er, bis Jorik ihn ansah. „…keine Waffen mitzunehmen!“
„Was?“ Marivar traute ihren Ohren nicht. „Aber…?“
„Die Zeit des Kämpfens ist vorbei!“ sagte Esha jedoch. „Wir können und wir wollen es nicht mehr! Wir werden eine passende Insel finden und dort die Zeit miteinander verbringen, die für uns noch vorgesehen ist. Mehr nicht!“ Ihr Blick wurde wieder traurig.
„Dann…?“ Wieder hatte Jorik Mühe zu reden. „…heißt das jetzt Abschied?“
Shamos nickte und kämpfte gegen Tränen an. „Ja!“
Jorik sah erst ihn, dann Esha und schließlich wieder seinen Freund an, dann schüttelte er den Kopf. „Ich will mich nicht verabschieden!“ Sofort konnte er sehen, dass Shamos ein Stück in sich zusammensackte, weil er eigentlich nicht mehr die Kraft hatte, es Jorik nochmals zu erklären. Doch Jorik schaute zu Marivar und als diese in seinem Blick erkannte, was er vorhatte, konnte er daraufhin in ihrem Blick tiefste Zustimmung sehen.
„Ach, Jorik!“ begann Shamos mit einem tiefen Seufzer. „Es war mir die denkbar größte Ehre, an eurer Seite…!“
„Dürfen wir euch begleiten?“ fragte Jorik rundheraus.
Zur Überraschung aller reagierte Shamos nahezu unverzüglich auf diese Änderung und fügte beinahe nahtlos weiter aus. „…und es ist uns eine noch größere Ehre, den letzten Weg mit euch gemeinsam zu gehen!“ Er musste immer breiter grinsen.
Das mussten dann auch Jorik, Marivar und Esha.
„Oh, ich hatte nicht gewagt, es zu hoffen!“ meinte Shamos und war sichtlich zufrieden mit der neuen Situation.
„Na wart es nur ab!“ erwiderte Jorik mit einem traurigen Lächeln. „Ich denke mal, deine Idee wird noch mehr Zuspruch finden!“
III
Pater Matu war sicherlich ebenso geschockt von den Vorkommnissen auf dem Mos Iridas, wie alle anderen auch.
Noch kurz vor der vernichtenden Nachricht über die Zerstörung der Funkstation hatte er den Herrn in einem flammenden, leidenschaftlichen Gebet um seine Hilfe, seinen Schutz, sein Wohlwollen angefleht, doch die Tatsache, dass er es ganz offensichtlich nicht erhört hatte, schmeckte jetzt sehr bitter in ihm nach und er brauchte zunächst einige Zeit einsam und allein im Inneren der Kamarulu.
Als er sich dann ein wenig besser fühlte, beschloss er, zurück in die Höhlen zu gehen, um dort möglicherweise Anderen Beistand und Trost geben zu können, wenngleich ihm das Wort Trost fast schon wie Hohn vorkam, denn welchen Trost sollte es geben, wenn der verzweifelte Versuch zu leben doch nur den sicheren Tod gebracht hatte?
Dennoch war er sich seiner Verantwortung bewusst. Er selbst lebte mit Gott, doch gab es andere, die das nicht taten. Und diesen Menschen galt es, ihre Verzweiflung zu lindern und ihnen das Licht am Ende des letzten Weges näher zu bringen.
Er hatte jedoch erst zwei Gänge in dem riesigen Schiff hinter sich gebracht, als er ein Schluchzen aus einem dunklen Raum hörte, an dem er gerade vorbeiging.
Instinktiv stoppte er ab, drehte sich herum und spähte hinein. Während sich seine Augen an das wenige Licht im Inneren gewöhnten, hörte er weiteres, leises Schluchzen. Im hinteren Bereich schien es eine schwache Lichtquelle zu geben, denn dort konnte er die Umrisse einer Gestalt erkennen, die zusammengesunken auf einer Bank saß. Er trat näher und blieb plötzlich stehen, weil er überrascht, aber auch sichtlich erschrocken feststellen musste, dass es sich hierbei um Chalek handelte.
Herrgott, der Junge! Matu hatte ihn vollkommen vergessen. Er war sofort tief betroffen. Jeder hatte Jemanden, um seinen Schmerz zu teilen, nicht aber Chalek. Er war ganz allein, gerade auch jetzt, wo Melia nicht anwesend war. Dem Pater war klar, dass er nicht einfach wieder gehen konnte und so beschloss er, sich zu ihm zu setzen.
Dabei erinnerte er sich plötzlich an das, was er und Shamos aus den alten Schriften übersetzt hatten: Chalek war ein Auserwählter, der Nachfahre des Mannes, dem Gott Genesis anvertraut hatte. Über Jahrtausende war die Legende weitergegeben worden. Ob der Junge sie in all ihrer Tragweite kannte, konnte Matu nicht sagen. Nur eines wusste er: Der Junge wäre der letzte Schlüssel zur Aktivierung des Kristalls gewesen. Er allein hätte Genesis letztlich überhaupt erst möglich machen können. Und er hätte diese Aufgabe am Ende mit dem Leben bezahlt.
Es wäre seine Bestimmung gewesen, es zu tun. Das wusste Chalek, seitdem er denken konnte. Und dieser Junge, gerade einmal an der Schwelle zum Erwachsenwerden, hatte diese Bürde mit einer solchen Kraft und Tapferkeit angenommen, mit einer solchen Anmut, dass es Matu eiskalt den Rücken herunterlief.
Chalek wusste um sein Schicksal und er hätte keinen Augenblick gezögert, es zu erfüllen, dessen war sich der Pater absolut sicher.
Matu verspürte den allergrößten Respekt vor ihm, doch hatten er, Shamos und Esha ihm versprechen müssen, ihr Wissen nicht mit den anderen zu teilen.
Dies war Chaleks einzige Bedingung gewesen.
Und Matu hatte ihm seinen Wunsch erfüllt, ebenso wie die beiden anderen.
Es nicht zu tun, hätte unter Umständen geheißen, die Mission zu gefährden, denn natürlich hätte zum Beispiel Melia diese Tatsache nicht so ohne Weiteres hingenommen.
Doch Matu war sich bewusst, dass dieses Argument nur eine schale Ausrede für die wirkliche Wahrheit gewesen war: Er wollte nicht sterben, sondern leben, wie alle anderen auch. Sie waren lange Jahre durch die wahrhaftige Hölle eines gnadenlosen Krieges gegangen und hatten so vieles gegeben, um ihn zu beenden. Mit Genesis hatten sie noch eine allerletzte Möglichkeit dazu gehabt. Die Tatsache, dass es dann aber doch nur Chalek gewesen wäre, der alles hätte abschließen können, war ein letzter Fluch, der einen überaus bitteren Nachgeschmack in ihm verursachte. Wenn es eine Chance gegeben hätte, dem Jungen dabei zu helfen oder ihm diese Bürde gänzlich abzunehmen, hätte Matu es getan. Doch diese Wahl hatte niemand von ihnen. So wäre Chalek nur der vorbestimmte Weg geblieben. Und wenn er ihn gegangen wäre, hätte er nicht nur diesen Planeten, sondern auch viele Menschen und andere Lebewesen, und eben auch Matu gerettet.
Das Leben des Jungen für das von so vielen.
Und Matu spürte, obwohl er wusste, dass es falsch war, dass er egoistisch genug gewesen war, um fast schon zu erwarten, dass Chalek sein Schicksal auch einlösen würde.
Doch all das war jetzt belanglos geworden.
Nichts von alldem würde noch geschehen und Generationen und Aber-Generationen seiner Vorfahren hatten die schwere Last dieses gewaltigen Geheimnisses vollkommen umsonst auf sich genommen. Mit Santara würde auch Chalek sterben und Genesis somit zerstört werden. Alles, wofür der Junge bisher gelebt hatte, war eine einzige, sinnlose Lüge gewesen.
Kein Wunder also, dass er verzweifelt und entsetzt war. Matu spürte, dass der Junge Hilfe brauchte.
Er bemühte sich, ein paar Geräusche zu machen, um ihn nicht zu erschrecken. Das gelang auch. Während er in einem Abstand von rund zwei Schritten um Chalek herum zu einer weiteren Bank ging, die ihm gegenüberstand, blickte der Junge zu ihm auf und sein Schluchzen verebbte. Gleichzeitig spannte er seinen Oberkörper an und richtete ihn auf.
Matu setzte sich und blickte den Jungen zunächst stumm an. Dabei konnte er sehen, wie sehr Chalek geweint hatte. Sein Blick war leer und dennoch voller Verzweiflung. Der Priester fühlte sofort mit ihm. Im ersten Moment wusste er jedoch noch nicht so recht, wie er das Gespräch beginnen sollte, also kam ihm zunächst nicht mehr als ein freundliches „Hallo!“ über die Lippen.
Chalek nickte knapp. Hallo!
„Du solltest hier nicht allein sein! Möchtest du nicht mit mir zu den anderen gehen?“
Der Junge schüttelte nur den Kopf.
„Jeder von uns ist verzweifelt, so wie du!“ Matu wartete, bis Chalek ihn ansah. „Teile deinen Schmerz mit den anderen, dann tut es nicht mehr so weh!“
Wieder schüttelte Chalek nur den Kopf.
„Okay!“ Matu nickte. „Dann teile ihn aber wenigstens mit mir!“ Er sah, dass der Junge keine Reaktion zeigte. „Ich weiß, ich bin nicht Melia, aber du kannst auch mir vertrauen!“ Er versuchte ein Lächeln.
Ich vertraue dir!
Jetzt musste Matu richtig lächeln und einmal nicken. „Ich weiß...!“ Sein Blick wurde wieder traurig. „Ich kann an der Situation nichts ändern. Ich kann die Zerstörung der Funkstation nicht rückgängig machen, um uns allen die Hoffnung auf Leben zurück zu bringen. Genesis war alles, was uns hätte erretten können und ich bin ebenso geschockt wie du…wie alle hier…dass dies nun doch nicht geschehen wird. Die Vorstellung zu überleben war einfach...!“ Er lächelte wehmütig. „…wundervoll, aber…!“ Sein Blick verdunkelte sich wieder. „…allzu trügerisch!“ Er atmete einmal tief durch. „Ich verstehe deinen Schmerz, doch können wir ihn…!“
Weiter kam er nicht, denn Chalek unterbrach ihn mit einer vehementen Geste. Nein!
Matu schüttelte den Kopf. „Ich kann verstehen, dass du…!“
Der Junge unterbrach ihn abermals. Nein, du verstehst nicht!
Matu nickte. „Okay, ich ver…!“ Er stoppte jetzt selbst ab und lächelte traurig. „Vielleicht tue ich das wirklich nicht!“ log er, um dem Jungen das Gefühl zu geben, sein Schmerz wäre tatsächlich einmalig oder anders, als der der anderen, um so sein Vertrauen zu gewinnen. „Aber dann hilf mir, es zu verstehen!“ Er sah den Jungen direkt an. „Erklär es mir!“
Vilo war eingeschlafen.
Die vernichtende Nachricht hatte ihn ebenso zerrissen, wie jeden anderen hier und Verzweiflung, Schmerz und Hoffnungslosigkeit mussten seine Kräfte dann förmlich ausgesaugt haben.
Nachdem er Kaleena getröstet und sich mit ihr einfach vor eine Wand der Kommandozentrale gesetzt hatte, hatte ihn der Schlaf schlicht übermannt.
Die Ruhe, die um ihn herum herrschte, weil alle gegangen waren und das monotone, leise Rauschen des Wassers rund um die Brücke taten ihr Übriges.
Kaleena neben ihm war noch vor ihm eingeschlafen. Sie lehnte an seiner linken Seite, ihr Kopf lag auf seiner Schulter, ihre Tränen waren längst getrocknet, sie wirkte um Jahre gealtert.
Vilos Kopf war zur Seite gekippt und seine Wange lag auf dem Kopf seiner Frau. Seine Arme hingen schlaff an ihm herab, er wirkte eingesunken, seine Haut war blass. In seinem Gesicht konnte man noch immer die Verzweiflung erkennen, die ihn quälte. Dennoch atmete er ruhig und tief, die Erschöpfung schien einfach viel zu groß zu sein, als dass sie quälende Gedanken oder gar Alpträume zugelassen hätte.
Plötzlich aber war in der Stille der Kommandozentrale ein Geräusch zu hören. Nur kurz und nicht einmal sonderlich laut, dafür aber rau und unnatürlich. Vilo konnte sich später nicht mehr erinnern, was das gewesen sein mochte, doch reichte es aus, dass er einen kurzen, halb erschrockenen Atemzug tat, sein Oberkörper dabei einmal zuckte, sodass sich sein Kopf aufrichtete und er schließlich erwachte.
Ich weiß nicht mehr, wann mein Vater mich in die Geheimnisse des Wunderseingeweiht hat…begann Chalek. Aber es muss sehr früh gewesen sein, denn in meinen ersten Erinnerungen sehe ich mich bereits, wie ich mich auf meine Aufgabe vorbereite. Wie ich meditiere, lerne, meine Kräfte im Inneren zu spüren, sie zu aktivieren und zu kontrollieren.
Matu saß da, schaute Chalek an und war sofort fasziniert von seinen Ausführungen, die ihn sichtlich in seinen Bann schlugen. Dass er eigentlich mit einer vollkommen anderen Reaktion des Jungen gerechnet hatte, vergaß er ganz schnell.
Ich sehe mich sitzen, so wie uns jetzt... Er lächelte offen. …und meinem Vater zuhören, wie er mir alles über dieses Wunder erzählt, über seinen Ursprung, seine Wirkung, seine Auswirkungen und über meine Aufgabe dabei.
Matus Blick wurde schlagartig ernst, denn ihm war klar, was Chalek damit meinte und er nickte traurig.
Ich erinnere mich daran, dass es mir verboten war, mit anderen darüber zu reden. Es musste ein Geheimnis bleiben, nur dann würde es die Zeit überdauern können. Vielleicht würde das Wunder niemals benötigt werden, sagte er, doch wenn es bekannt werden würde, würde es ganz sicher missbraucht oder gar zerstört werden und am Ende niemals seine Bestimmung erfüllen können.
Wieder nickte Matu und sein Blick wurde immer dunkler. Die Geschichte der Menschheit war stets auch von Gier, Habsucht, Verrat und Hass durchzogen, die alles und jeden missbrauchten oder zerstörten, was sie in die Finger bekamen.
Auch durften wir unsere Kräfte nicht einsetzen…oder nur so, dass niemand es bemerkte! Plötzlich grinste der Junge. Das war immer sehr aufregend!
Matu lächelte sanft.
An eines aber…, Chalek wurde wieder ernst. …was mein Vater sagte, erinnere ich mich noch ganz besonders!
Matu zog neugierig die Augenbrauen in die Höhe. „Und das wäre?“
Wenn es soweit ist, wird das Wunder dich finden!
Vilo öffnete die Augen und sah im ersten Moment alles nur verschwommen, einen milchigen, konturlosen Mix aus dunklen Farben.
Während sich der Rest seines Körpers nicht rührte, blinzelte er einige Male, bis das Bild vor seinen Augen klarer wurde. Dabei hatte er noch immer den Nachhall des Geräusches in seinem Kopf, dass ihn aufgeweckt hatte und er fragte sich, ob es real gewesen war oder nur ein Produkt seiner Fantasie.
Mittlerweile sah er die kaum erleuchtete Kommandobrücke deutlich vor sich und betrachtete das Schattenspiel des Flusswassers, das an den Fenstern vorbeirauschte, an den Wänden. Sein Blick fiel auf Kaleena. Seine Frau schlief noch immer. Die Spiegelung des Wassers warf einen grauen Schleier auf ihr Gesicht und es wirkte unglaublich alt und eingefallen. Vilo spürte, wie sich ein Kloss in seinem Hals bildete, weil die Verzweiflung zurückkehren wollte, doch stemmte er sich dagegen und zwang sich, seinen Kopf zu drehen.
Wenigstens für ein paar Augenblicke noch wollte er die Ruhe und Stille hier genießen, bevor er Kaleena wecken musste, damit sie sich um Jovis kümmerten. Sie mussten festlegen, ob sie es ihm überhaupt sagen würden und wenn ja, was und wie. Und dann mussten sie beschließen, was sie mit dem Rest der Zeit, die ihnen noch bleiben würde, anstellen wollten.
Oh Gott, Vilo spürte, wie ihn diese Gedanken immer weiter herunterzogen.
Mit einem Mal blieb sein Blick an einem Bild haften, dass Jemand seitlich gegen einen der Terminals geklebt hatte. Es war nicht sonderlich groß und Vilo erkannte auf den zweiten Blick, dass es eine Postkarte sein musste. Das Bild darauf war sichtlich verblasst, die Pappe, auf der es gedruckt war, wellte sich an den Rändern.
Und doch erkannte Vilo den Ort, den das Bild zeigte, nur zu genau…
„Ich verstehe!“ Matu nickte. „Du durftest dich also nicht auf die Suche nach Genesis machen!“
Der Junge nickte. Genau! Trotz meines Wissens um das Wunder, durfte ich nur abwarten. Vielleicht mein ganzes Leben, ohne dass etwas geschehen würde. Vielleicht… Und jetzt wurde sein Blick wieder traurig. …aber auch nicht! Chalek atmete einmal tief durch und sah den Pater direkt an. Und genau das ist mein Problem!
Ara Bandiks!
Vilo war sofort sicher, dass er Recht hatte. Das Bild auf der Postkarte zeigte einen Teil der einst grandiosesten Metropole des gesamten Planeten: Die Innenstadt mit ihren gewaltigen Hochhäusern, den glitzernden Glasfassaden und den leuchtenden Reklametafeln. Die atemberaubende Architektur aus freitragenden Dächern, geschwungenen Betonbauten und komplexen Stahlkonstruktionen.
Ara Bandiks war die Stadt Santaras gewesen!
Dann aber hatte sich alles auf so grausame Art und Weise geändert. Aus der schillerndsten Metropole aller Zeiten wurde das größte Massengrab aller Zeiten. 23 Millionen tote Seelen!
Und von dem, was er auf dem Bild sehen konnte, war nichts mehr geblieben, außer… einem. Und es war genau das, was jetzt seine Aufmerksamkeit in den Bann zog!
„Ich…!“ Matu war verwirrt. „…verstehe nicht!“ Er sah den Jungen mit großen Augen an. „Wie meinst du das?“
So wie ich es gesagt habe! Chalek erwiderte seinen Blick mit ernster Miene. Es war mir verboten, es zu suchen. Das Wunder musste mich finden! Er sah den Priester jetzt mit großen Augen an, als wäre damit alles erklärt.
Doch der Pater war noch immer verwirrt. „Und?“
Schlagartig sackten alle Muskeln in Chaleks Gesicht herab und Sorge, Angst und Verzweiflung waren deutlich in ihnen zu sehen. Es hat mich gefunden!
Oh, Vilo wusste es nur zu genau:
Ara Bandiks war ein furchtbares Schlachtfeld gewesen, das größte und gnadenloseste, dass man sich nur vorstellen konnte. Endlose feindliche Fliegerstaffeln waren über die Stadt hinweg gedonnert, hatten Tausend und Abertausende von Bomben, Granaten und Raketen herabregnen lassen. Ungeheure Explosionen, gewaltige Flammenfäuste, immense Erschütterungen hatten für eine Zerstörung gesorgt, wie sie Menschen zuvor noch niemals erlebt hatten.
Alles war zu Staub zerfetzt worden.
Alles…bis auf eines!
Matus Gehirn arbeitete auf Hochtouren, dass konnte man deutlich sehen. Seine Augen zuckten unstet umher und seine Lippen bewegten sich immer wieder, als wolle er etwas sagen. Doch blieb er zunächst noch stumm.
Irgendetwas tief in seinem Inneren sagte ihm, dass etwas an dem, was der Junge ihm mitzuteilen versuchte, unendlich wichtig war, doch noch konnte er es nicht erkennen. „Es hat dich gefunden!“ wiederholte er Chaleks letzte Worte, aber mehr für sich selbst, als würde ihm das neuerliche Hören das Geheimnis darin offenbaren. „Und doch…!“ Plötzlich hielt er inne, sein Blick verdunkelte sich schlagartig. „…hat es nicht funktioniert!“ Er blickte auf und schaute Chalek geradewegs in die Augen.
Der Junge erwiderte seinen Blick mit ernster Miene und schüttelte den Kopf. Unmöglich!
Er war so dünn, so schmal und schien so unendlich zerbrechlich.
Und doch war er das höchste je von Menschenhand erschaffene Gebäude. Über eintausend Meter hoch, mitten im Stadtzentrum von Ara Bandiks, hatte es alles um sich herum überragt und war aufgrund seiner fast schon zierlichen Form jedoch immer eher unscheinbar geblieben.
Um es überhaupt in diese Höhen schrauben zu können, mussten die Ingenieure und Techniker vollkommen neue Wege in Sachen Fertigungstechniken, Materialien und Bauweise gehen.
Niemand – am allerwenigsten die Einwohner Ara Bandiks – glaubte daran, dass es jemals fertiggestellt werden konnte und doch geschah es eines Tages.
Und ausgerechnet dieses so zierlich und zerbrechlich wirkende Gebäude hatte alle Angriffswellen nahezu unbeschadet überstanden und ragte nun noch immer und erst recht über die südliche Ebene Poremiens.
Doch war es früher das I-Tüpfelchen einer grandiosen Metropole gewesen, so wirkte es jetzt wie das grausige Mahnmal des Scheiterns der Menschheit.
Sein offizieller Name lautete Paliavith-Tower. Die Bewohner Ara Bandiks aber hatten ihm - halb verächtlich, halb liebevoll - einen anderen Namen gegeben: The Stripe!
„Du meinst…!“ Matu musste schlucken. Eine heiße Welle überrollte ihn förmlich, schien in seinem Inneren explodieren zu wollen und sein Puls schoss in die Höhe, denn allmählich begriff er, was Chaleks Worte zu bedeuten hatten. „…Genesis hat dich gefunden!“ Er nickte, spritzte plötzlich in die Höhe, weil es ihn nicht mehr auf der Bank hielt. „Es hat dich gefunden, also muss es auch funktionieren!“ Er blieb abrupt stehen und starrte den Jungen an. Chalek nickte mit versteinerter Miene. „Wenn es nicht funktionieren würde, hätte es dich auch nicht gefunden!“ Wieder nickte der Junge.
Vilos Gesichtszüge fielen wie in Zeitlupe herab, seine Augen öffneten sich dabei immer mehr. Sein Herzschlag setzte für einen winzigen Moment aus, er wagte nicht zu atmen.
Vollkommen egal, wie dieser gewaltige Turm auch immer genannt worden war und wie man zu ihm stehen mochte, etwas an ihm war in diesem Moment umso vieles wichtiger als alles andere: Er stand noch immer dort!
„Das heißt…!“ Matu stockte der Atem. Kalter Schweiß lag auf seiner Stirn. Er musste erneut schlucken, sein Mund war knochentrocken. „…es muss…!“
„Großer Gott!“ Vilos Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Seine Gesichtszüge entgleisten jetzt vollkommen und fast schien es so, als wolle er losheulen. Seine Worte aber klangen derart hoffnungsvoll, wie er niemals wieder geglaubt hatte, sein zu können. „Aber natürlich…!“
„…noch einen Weg geben!“ Matus Worte waren kaum mehr als ein Flüstern und ließen seinen Körper leicht erzittern. Fast erschrocken schaute er zu dem Jungen.
Chaleks Blick war noch immer wie versteinert, denn auch er musste diese Erkenntnis verdauen.
Dann aber nickte er.
IV
Er musste sich so sehr zusammenreißen, wie wohl noch niemals zuvor in seinem Leben.
Aber es gelang ihm.
Langsam und in einer sehr flüssigen Bewegung, als würde alles nur in Zeitlupe ablaufen, drückte sich Vilo von Kaleena, obwohl sein Innerstes zum Zerreißen gespannt war und er am liebsten einfach nur aufgesprungen wäre.
Doch Vilo war klar, dass er nichts hatte, außer einem…unendlich hoffnungsvollen… Gedanken und seine Frau deshalb nicht wecken durfte. Zumindest noch nicht.
Nachdem er sich vorsichtig von ihr gelöst hatte, wobei er ihren Kopf mit der linken Hand gestützt hielt, war er für einen Augenblick ratlos, was er weiter tun sollte. Währenddessen kippte Kaleena fast wie automatisch in seine Richtung und ihm blieb nichts Anderes übrig, als sie langsam und sehr sanft gänzlich zu Boden sinken zu lassen. Seine Frau stöhnte einmal leise, wachte jedoch nicht auf. Sie lag jetzt auf der linken Seite, ihr Atem ging tief und regelmäßig. Ihre linke Wange lag direkt auf dem alten, zerschlissenen Betonboden. Instinktiv zog Vilo blitzschnell seine Jacke aus, faltete sie und schob sie ihr vorsichtig unter ihren Kopf. Wieder stöhnte Kaleena leise, regte sich aber nicht.
Vilo betrachtete sie einen Moment, doch sie blieb ruhig. Das brachte ihm ein Nicken zustande und während er leise seine Beine durchdrückte und sich somit aufrichtete, drehte er seinen Rumpf um einhundert achtzig Grad in den Kontrollraum hinein.
Zu seiner Überraschung musste er feststellen, dass sie doch nicht allein waren. Fünf Personen – drei Männer rund zwei Frauen - konnte er hinter unterschiedlichen Terminals erkennen. Eine junge Frau saß am Funkterminal. Vilo steuerte direkt auf sie zu.
Als er hinter ihr stand, konnte er sehen, dass sie reglos vor dem Bildschirm saß, den Kopf gesenkt. Fast glaubte er, sie würde schlafen, doch dann schreckte sie auf und drehte ihren Kopf zu ihm. Vilo sah sofort ihre tränenfeuchten Augen und den Schmerz in ihnen. Als sie erkannte, dass er es erkannte, wurde sie etwas nervös und wischte mit den Handrücken über ihre Wangen.
Vilo lächelte sanft und nickte ihr zu. „Darf ich sie stören?“
Die junge Frau nickte sofort. „Ja natürlich!“ Ihre Stimme klang rau und zittrig.
„Wie heißen sie?“
„Tiali!“
Vilo nickte wieder. „Das mit Captain Milaú tut mir sehr leid!“
Tiali nickte, jedoch blitzten ihre Augen kurz verlegen auf, sodass Vilo sicher war, dass sie Milaú gemocht hatte.
„Okay, Sergeant Tiali. Mir ist gerade etwas eingefallen, was ich für sehr wichtig halte!“ Er beugte sich zu ihr herab. „Könnten sie mir helfen, es zu überprüfen?“
Die junge Frau nickte. „Natürlich!“
Vier Minuten später richtete sich Vilos Oberkörper ruckartig wieder auf, während er einen tiefen Atemzug tat. „Und das geht?“ fragte er erstaunt. Er konnte seine Aufregung und Nervosität kaum noch verbergen
Tiali schien noch einen Augenblick zu überlegen, doch dann nickte sie. „Ja, das geht!“ Sie lächelte.
Mehr brauchte Vilo nicht. Mit einem „Oh, geil!“ wirbelte er auf der Stelle herum und hastete zu Kaleena.
Seine Frau lag noch immer dort, wo er sie zurückgelassen hatte und schlief. Zu gern nur hätte er ihr diese Ruhe weiterhin gegönnt, doch konnte er das nicht mehr. Und er war viel zu aufgeregt, um es auf die sanfte Tour zu machen. Er musste sein Wissen jetzt mit den anderen teilen.
„Kaleena!“ Er war kaum neben ihr auf die Knie gefallen, da rüttelte er bereits an ihrer Schulter. „Kaleena!“ rief er erneut, ohne mit dem Rütteln aufzuhören. „Schatz! Schatz, wach auf! Kaleena!“ Seine Worte waren wir ein Bombardement und sie zeigten allmählich Wirkung. Seine Frau stöhnte, drehte sich auf den Rücken, öffnete die Augen, sah ihn schlaftrunken an. „Bitte! Du musst aufwachen, Kaleena!“
Im ersten Moment sah sie alles nur verschwommen, doch schon einen Wimpernschlag später erkannte sie nicht nur seine aufgebrachte, hektische Stimme, sondern konnte auch die Erregung in seinem Gesicht sehen. Und beides zusammen jagte ihr einen solchen Schrecken ein, dass sie ihren Oberkörper mit einem Aufschrei aufrichtete. „Ja! Ja!“ rief sie. „Ich bin hier! Ich bin wach!“ Sie starrte Vilo an, doch sah man ihr deutlich an, dass ihr Gehirn mit der Situation absolut noch überfordert war. „Was ist los?“ Sie krallte sich in Vilos Schultern und drückte sich schwankend und zittrig auf ihre Beine. „Ich bin hier! Was ist los?“
Vilo packte sie ebenfalls an den Schultern und hielt sie fest, dass sie nicht umkippen konnte. Während er in ihre glasigen Augen sah, sagte er. „Du musst mir helfen, Schatz. Jetzt, sofort!“
„Ja!“ Kaleena nickte. „Ja…!“ Plötzlich brach sie ab, ihr Oberkörper klappte vorn über, sie musste ihren rechten Arm auf den Oberschenkel stützen, um das zu stoppen, während sie ihre linke Hand noch fester in Vilos Schulter krallte. Dann atmete sie tief durch und stöhnte. „Was ist denn nur los?“ Sie starrte ihren Mann wieder an, dieses Mal aber schon klarer und fordernd.
„Du musst mir helfen! Du musst zu den anderen gehen, schnell!“
„Himmel ja!“ Sie atmete nochmals tief durch. „Mach ich ja! Ist etwas passiert? Was ist geschehen?“
Unvermittelt zuckten Vilos Hände in die Höhe und er nahm ihren Kopf sanft in ihre Mitte. Er wartete, bis Kaleena ihn ansah, dann lächelte er. „Ich habe eine Idee gehabt!“
„Eine…?“ Sie furchte die Stirn. „Was für eine?“
„Eine, die die Hoffnung zurückbringen kann!“
Kaleena sah ihn noch einen Lidschlag verwirrt an, dann weiteten sich ihre Augen schlagartig. „Oh, mein Gott!“ Sie schnappte nach Luft. „Das ist ja…!“ Sie schaute Vilo an, der lächelnd nickte. „Ich bin schon weg!“ Sie drückte sich schnaufend von ihrem Mann.
„Schatz!“ Vilo hielt sie zurück und als sie ihn ansah, sagte er. „Ich liebe dich!“
Doch Kaleena fuchtelte mit den Armen. „Nicht jetzt!“ Sie schüttelte den Kopf, wandte sich um und rannte davon. „Doch nicht jetzt!“ Vilo sah ihr mit einem Lächeln hinterher, bis sie die Kommandobrücke verlassen hatte. Dann ging er zurück zu Sergeant Tiali. Bis die anderen eintreffen würden, galt es noch ein paar Dinge zu klären.
Seine Erkenntnis musste er mit den anderen teilen.
Matu hatte sich daher umgehend auf den Weg aus dem Inneren der Kamarulu in die Stollen gemacht. Chalek begleitete ihn.
In der großen Halle konnten sie jedoch niemanden von ihren Freunden ausmachen, also begaben sie sich in die angrenzenden Gänge zu den Höhlen von Jorik und Shamos.
Als sie um die letzte Ecke bogen, konnten sie die beiden Männer, sowie ihre Frauen zusammenstehen sehen. Die Stimmung war irgendwie gelöst, wenn auch noch immer nicht fröhlich.
„Jorik!“ rief der Pater sofort und hob seinen rechten Arm. „Shamos!“ Er spürte, wie die Aufregung in seinem Inneren sprunghaft anstieg.
Seine Freunde und deren Frauen drehten sich zu ihm und schauten ihn mit großen Augen überrascht an.
„Pater!“ begrüßte ihn Jorik mit einem müden Lächeln, dann schaute er zu dem Jungen. „Chalek!“ Er nickte auch ihm zu.
„Was gibt es?“ fragte Shamos sofort. „Du wirkst...erregt!“
Matu nickte. „Allerdings!“ Dann atmete er einmal tief durch. „Wir müssen reden!“
„Reden?“ Joriks Blick verlor seine Freundlichkeit und er schaute den Priester mit ernster Miene an. „Worüber denn?“
„Über Genesis!“ erwiderte der Pater rundheraus.
Sofort sackte die Stimmung bei allen spürbar in den Keller.
Jorik sah den Priester direkt an. „Genesis ist Geschichte!“ Seine Worte klangen hart. „Es war ein wundervoller Traum, der leider nicht real wurde. Er war jede Mühe wert, aber jetzt nicht mehr!“
„Was?“ Matu verstand nicht.
„Wir müssen versuchen aus der Zeit, die uns noch bleibt, das Beste zu machen!“ führte Shamos weiter aus. „Wir haben für uns entschieden, von hier fort zu gehen, an einen Ort, der uns Trost spenden wird und an dem wir das Ende erleben wollen. Vielleicht möchtest du ja mitkommen? Vielleicht auch die anderen? Wenn nicht, werden sich hier und heute unsere Wege trennen!“
Matu sah Shamos fast schon entgeistert an. „Aber...!“ rief er beinahe hilflos. „Das könnt ihr nicht!“
„Doch!“ erwiderte Esha mit ernster Miene. „Und wir werden!“
„Nein!“ beharrte Matu jedoch. „Ihr könnt nicht gehen, ihr dürft nicht gehen!“ Er wartete, bis Shamos ihn ansah. „Nicht, bevor wir nicht alles versucht haben!“
„Hör auf!“ raunte Jorik sofort mit finsterer Miene. „Wer glaubst du, wer du bist, dass du uns vorwerfen kannst, wir hätten nicht alles versucht?“ Jorik wurde sauer und trat direkt vor den Pater. „Du warst dabei, du hast es gehört! Es ist vorbei. Wir können nichts mehr tun. Und uns kann auch niemand mehr helfen, auch nicht…!“ Er verzog die Mundwinkel zu einer säuerlichen Grimasse. „…deinGott!“
„Nein!“ Matus Stimme wurde leise, klang erschöpft und sein Körper sackte ein wenig in sich zusammen. „Das kann er nicht!“ Er senkte seinen Blick zu Boden. „Aber das muss er auch gar nicht!“ Unvermittelt hob er seinen Kopf wieder an und schaute Jorik geradeheraus an. „Wir können es noch immer selber tun!“
Jorik sah man an, dass seine Verärgerung schon wieder zunahm.
Doch Shamos kam ihm zuvor. „Wie meinst du das?“ fragte er den Priester und trat direkt vor ihn.
„Chalek!“ erwiderte Matu. „Der Junge!“ Er deutete auf ihn.
„Was ist mit ihm?“ fragte Marivar.
„Er hat es mir erklärt!“ Matu nickte. „Er musste stets Stillschwiegen über sein Wissen bewahren. Und er durfte nicht aktiv nach Genesis suchen. Wenn es soweit sein würde, würde das Wunder ihn finden!“
„Ja, und?“ raunte Jorik.
„Es hat ihn gefunden!“ Matu lächelte. „Versteht ihr?“
Doch Jorik schüttelte mit verzogenen Mundwinkeln den Kopf. „Nein!“
Shamos aber schaute Chalek an und als der Junge das registrierte und den verwirrten, fragenden Gesichtsausdruck des Wissenschaftlers sah, nickte er zunächst mit ernster Miene, dann mit einem sanften Lächeln. „Du meinst also…!“ Shamos blickte jetzt Matu an. „Weil das Wunder ihn gefunden hat, muss es auch funktionieren, ansonsten…!“
„…hätte es ihn nicht gefunden!“ Esha war sichtlich überrascht über diese Erkenntnis und blickte noch immer ziemlich ungläubig.