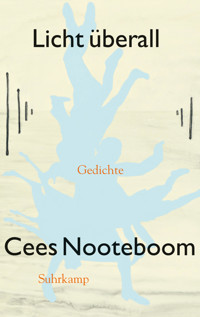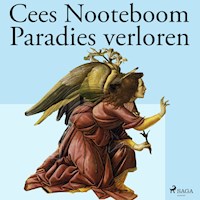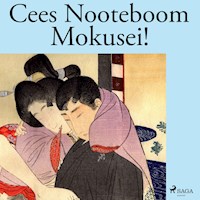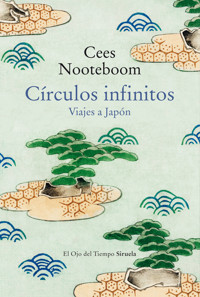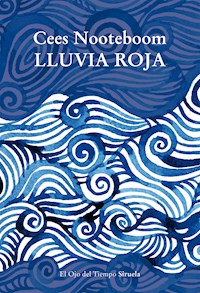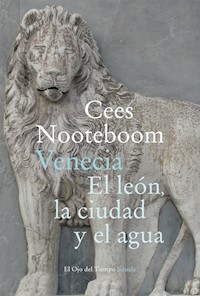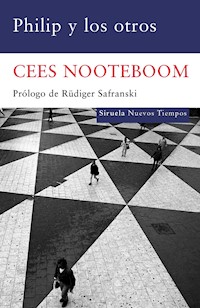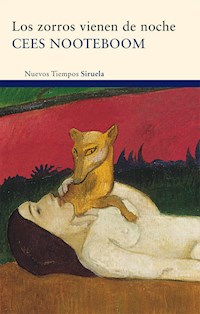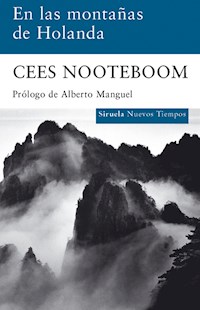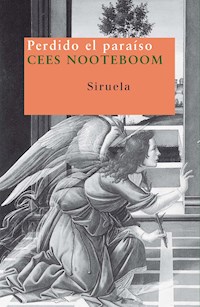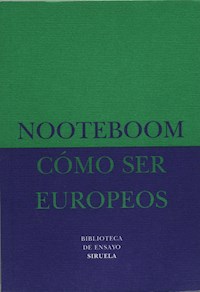59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als 2008 der neunte Band der Gesammelten Werke Cees Nootebooms vorlag, wünschte sich die FAZ voll Begeisterung: »Mögen diesem Band viele folgen.« Nun erscheint Band 10, der sich auf die Prosa des großen niederländischen Autors zwischen 2008 und 2015 konzentriert und dabei die außerordentlichen Facetten seines Schaffens zeigt. In dieser Zeit entstand etwa der hochgelobte Erzählungsband Nachts kommen die Füchse, der mit seiner »inständigen Erzählkunst« (FAZ) und »staunenswerten Helligkeit« (Süddeutsche Zeitung) beeindruckt, außerdem die heiter-geheimnisvollen Briefe an Poseidon sowie das Schiffstagebuch, das von fernen Reisen berichtet.
Ein leidenschaftlicher, undogmatischer Reisender ist Nooteboom immer gewesen, und eben diese unvoreingenommene Neugier und Entdeckerlust zeichnen auch seine luziden Essays und Reden aus. Sei es Saigoku, der Bericht einer Pilgerreise zu Japans Tempeln, dem die subtilen Fotos von Simone Sassen zur Seite gestellt sind; seien es die hier zum Teil erstmals auf Deutsch erscheinenden Texte zur Literatur, zur Kunst und Politik – der wahre Reisende, so Nooteboom, befindet sich immer im Auge des Sturms. Lebendiger, welthaltiger kann Literatur nicht sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1255
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Auf die Prosa zwischen 2008 und 2015 konzentriert sich Band 10 der Gesammelten Werke Cees Nootebooms und zeigt damit die außerordentlichen Facetten im Schaffen des großen niederländischen Autors. In dieser Zeit entstand etwa der Erzählungsband Nachts kommen die Füchse, der mit seiner »inständigen Erzählkunst« (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und »staunenswerten Helligkeit« (Süddeutsche Zeitung) beeindruckt, außerdem die heitergeheimnisvollen Briefe an Poseidon sowie das Schiffstagebuch, das von fernen Reisen berichtet.
Ein leidenschaftlicher, undogmatischer Reisender ist Nooteboom immer gewesen, und ebendiese unvoreingenommene Neugier und Entdeckerlust zeichnen auch seine luziden Essays und Reden aus. Sei es Saigoku, der Bericht einer Pilgerreise zu Japans Tempeln, dem die subtilen Fotos von Simone Sassen zur Seite gestellt sind; seien es die hier zum Teil erstmals auf deutsch erscheinenden Texte zur Literatur, zur Kunst und Politik – der wahre Reisende, so Nooteboom, befindet sich immer im Auge des Sturms. Lebendiger, welthaltiger kann Literatur nicht sein.
Cees Nooteboom
Gesammelte Werke
Band 1: Gedichte
Band 2: Romane und Erzählungen 1
Band 3: Romane und Erzählungen 2
Band 4: Auf Reisen 1
Band 5: Auf Reisen 2
Band 6: Auf Reisen 3
Band 7: Auf Reisen 4
Band 8: Essays und Feuilletons
Band 9: Poesie und Prosa 2005-2007
Band 10: Prosa 2008-2015
CEES NOOTEBOOM
GESAMMELTE WERKE BAND 10
Prosa 2008-2015
Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen Herausgegeben von Susanne Schaber
Suhrkamp Verlag
Die Ersterscheinungsorte der in diesem Band enthaltenen Werke sind in der Editorischen Notiz nachgewiesen. Übersetzung der Essays »Die Augen des Krieges« und »Terra Incognita«: Waltraud Hüsmert; Übersetzung von »Meine deutsche Stimme«: Christiane Kuby; Übersetzung der »Wandgedichte«: Barbara Jung; Übersetzung der Gedichte: Ard Posthuma.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2017.
© für die Gesammelten Werke:
Suhrkamp Verlag Berlin 2017© Cees Nooteboom 2017
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
PROSA2008-2015
I.NACHTS KOMMEN DIE FÜCHSE
Erzählungen
»You might have got yourself a story«, I said. »Sure. But up here we're just people.«
Raymond Chandler, The Lady in the Lake
Gondeln
Gondeln sind atavistisch, er wußte nicht mehr, wo er das gelesen hatte, und wollte jetzt auch nicht darüber nachdenken, weil dann, so meinte er, etwas vom Pathos des Augenblicks verfliegen würde. Tiefstehende Sonne, die schwarze vogelartige Form einer Gondel im Nebel über der Lagune, die schweren Duckdalben wie eine vorrückende einsame Phalanx von Soldaten, die am unsichtbaren anderen Ufer verschwand zu einer Mission von Tod und Verderben, und er selbst hier an der Riva degli Schiavoni mit einem vergilbten, eingerissenen Foto in der Hand, wenn das kein Pathos war? Hier ungefähr hatte die Gondel angelegt, hier, an dieser Treppe oder der nächsten, noch dichter am halb im Wasser ruhenden Denkmal der standrechtlich erschossenen Partisanin, waren sie ausgestiegen. Es war ähnliches Wetter gewesen, das konnte man auf dem Foto noch erkennen. Sie hatten sich auf die Treppe gesetzt, und fast im gleichen Augenblick war ein junger Offizier gekommen, der ihnen sagte, diese Treppe habe frei zu bleiben für die Wasserschutzpolizei, und dabei auf ein Schild deutete. Dieses Schild mußte er jetzt also suchen, das konnte nicht schwer sein. Und wenn ich es finde, was dann? Dann stehe ich genau an derselben Stelle wie vor vierzig Jahren, und dann? Er zuckte mit den Achseln, als hätte jemand anders diese Frage gestellt. Dann also nichts, und genau darum, dachte er, ging es. Den Auftrag, etwas über die Ausstellung im Palazzo Grassi zu schreiben, hatte er angenommen, um diese eigenartige Pilgerfahrt anzutreten. Zu einem Schemen, nein, nicht einmal das, zu einer Abwesenheit. Die Treppe hatte er schnell gefunden, in ewigen Städten neigen die Dinge dazu, sich nicht zu verändern, nach wie vor legte die Wasserschutzpolizei hier an. Das Schild war noch da, an der Seitenmauer aus Backstein befestigt. Neu gepinselt, das denn doch. Er setzte sich auf die oberste Stufe. Der junge Offizier von damals mußte längst pensioniert sein, und auch wenn er in diesen vierzig Jahren nicht gealtert wäre, würde er den älteren Mann, der jetzt dort saß, nicht wiedererkennen. Das Foto war damals von einem Unbekannten gemacht worden, der sich ein Stück von ihnen entfernt, mit dem Rücken zur Lagune, an den Rand des Kais gestellt hatte. Ein Winkel von dreißig Grad, so daß der Dogenpalast in der Ferne noch drauf war. Er betrachtete das Foto und wunderte sich wie immer über das Trügerische daran. Nicht nur, daß ein Foto eine Tote abbilden konnte, es konnte einem auch eine ungültig gewordene Version der eigenen Person auftischen, einen nicht mehr erkennbaren Langhaarigen, der einst so perfekt ins damalige Bild gepaßt hatte, das diesem Foto das schal gewordene Aroma einer endgültig vergangenen Zeit gab. Daß man noch immer denselben Körper hatte, war das eigentliche Wunder. Aber natürlich war es nicht derselbe Körper. Sein Besitzer hatte noch immer denselben Namen, das war alles.
Was dieses Foto im Grunde sagen wollte, dachte er, mehr als Feststellung denn als Ausdruck von Tragik oder Selbstmitleid, war, daß auch für ihn allmählich die Zeit kam, daß auch er verschwinden mußte. Er hatte links von ihr gesessen, damals. Sie hatte den Kopf lachend zu dem unbekannten Fotografen erhoben, schnell noch das rote Haar etwas nach hinten geschoben und den Körper etwas zurückgebeugt, halb an die Seitenmauer der Treppe gelehnt, so daß das Schild nur zur Hälfte sichtbar war. Er blickte auf das sich leicht bewegende gräuliche Wasser am Fuße der Treppe. Wie erstaunlich, daß alles unverändert blieb! Das Wasser, die Form der Gondeln, die Marmorstufe, auf der er saß. Nur wir stehlen uns davon, dachte er, lassen die Kulisse unseres Lebens zurück. Er fuhr mit der Hand über die körnige steinerne Fläche neben sich, als wolle er ihre Abwesenheit fühlen. Daß alles, was man dabei denken konnte, ein Klischee war, wußte er selbst, nur hatte niemand diese Rätsel je gelöst. Unter Wirklichkeit und Vollkommenheit verstehe ich dasselbe, von wem dieser Satz stammte, wußte er ebenfalls. Ob Hegel die Situation, in der er sich befand, gemeint hatte, durfte bezweifelt werden, aber es schien doch zu stimmen. Er verspürte ein merkwürdiges Entzücken, weil die Dinge so waren, wie sie waren, weil man sie mit keinem einzigen Gedanken lösen konnte. Der Tod war etwas Natürliches, ging jedoch mit fast unzulässigen Formen von Kummer einher, die so groß waren, daß man am liebsten in ihnen verschwinden würde, um sich der vollkommenen Wirklichkeit des Rätsels hinzugeben.
Der Anfang war ganz einfach gewesen. Eine griechische Insel, das Haus von Freunden von Freunden, von ihnen arrangiert, weil es ihm nach seiner Scheidung schlechtging. Nicht gewöhnt, allein zu sein, ein Hunger nach allem, was weiblich war. Ein steinerner Spazierweg entlang dem Meer, auf dem all diese weiblichen Gestalten gingen oder schlenderten, die er gern angesprochen hätte, was er sich aber nicht traute, um nicht als Schwachkopf lachend abgewimmelt zu werden. Ankatzen nannte sein Freund Wintrop das. Das Wort war hübsch, aber er hatte es nie gekonnt. Wie lautete diese Gedichtzeile von Lucebert? Des Abends entlang weiblichen Schiffen ich schlendre. Das stimmte schon mal. Den Spazierweg hin und dann wieder zurück und dann noch einmal von vorn. Schlendern, bummeln, schauen. Hydra, Fischerboote, weiß in der sich verdunkelnden Nacht, sanft schaukelnd, beschienen vom Neonlicht der hohen Laternen am Kai. Schwalben, Zypressen, oder dachte er sich das jetzt aus? Gab es damals schon Neonlicht? Aber warum sollte seine Erinnerung stimmen müssen? Mach gelbes Lampenlicht daraus, hör eine Eule, sieh die dunklen Formen von Pinien. Das Meer bleibt das Meer und schwappt sanft an die Kaimauer. Alles andere ist austauschbar, das Arsenal, mit dem du die Erinnerung ausstaffierst.
Wie ein Schiff hatte sie nicht ausgesehen, als sie vorbeikam. Oder vielleicht doch, wie ein ganz leichtes mit nur einem kleinen Segel, das übers Wasser zu schweben scheint. Lächerlich mußte das gewesen sein, wie er plötzlich von der Kaimauer aufgestanden war und diese Handbewegung gemacht hatte wie ein Polizist, der den Verkehr stoppen will. Und genau das hatte er auch gesagt, STOP! Sogar jetzt empfand er noch Verlegenheit, obwohl sie später in Kalifornien, als alles lange vorbei gewesen war, oft darüber gelacht hatten. Sie war so erstaunt gewesen, daß sie sofort stehenblieb. Merkwürdigerweise wußte er nicht mehr, ob sie gleich an jenem ersten Abend mitgegangen war. Sie hatten lange in einer Kneipe im Hafen miteinander geredet. Amerikanerin, mit einem italienischen Namen. Sechzehn, achtzehn, er hatte es wissen wollen, aber nicht zu fragen gewagt. Schon da hatte er die Zeichen gesehen, mit denen sie Hände und Arme geschmückt hatte, Tierkreiszeichen, nicht tätowiert, wie man es heutzutage oft sah, sondern mit schwarzer Tinte auf diese braune Haut gemalt. Als er gefragt hatte, was das sei, hatte sie nur gesagt, oh, ich bin eine Hexe. Auch darüber hatten sie später gelacht, aber er besaß noch ihre Briefe aus jenen Tagen voller Geplapper über Zauberei und Verhexung, Schwärmerei, die, wie ihm schon bald klar wurde, nichts bedeutete, ihn aber doch erregt hatte. Es paßte zur Zeit, viel mehr aber noch zu diesem roten Haar, den schieferfarbenen Augen, der überraschend tiefen, ein wenig heiseren Stimme. In den Tagen danach hatte sie bei ihm in dem großen weißen Haus geschlafen. Bei ihm, aber nicht mit ihm. So lautete die Bedingung. Sie ließ sich mit abgewandtem Gesicht streicheln und sank dann auf beeindruckende Weise in Schlaf, mit der Abwesenheit eines Tiers, für das die Welt nicht mehr existiert. Er war sich ein wenig lächerlich und überflüssig vorgekommen, war aber gerührt gewesen über ihr Vertrauen. Lieber Gesellschaft als Liebe, etwas in der Art hatte er in sein Tagebuch geschrieben. Später hatte er dieses Tagebuch weggeworfen, was ihm jetzt leid tat – doch diesen Satz wußte er noch. Und ein paar Tage darauf war alles anders geworden. Vielleicht dachte er sich das jetzt aus, meinte sich jedoch zu erinnern, wie sie auf eines dieser merkwürdigen Zeichen deutete, die sie auch an anderen Stellen ihres Körpers trug, und etwas sagte wie: Der Augenblick ist jetzt gekommen. Etwas mit Planeten, alles, was er auch damals schon für Unsinn gehalten hatte. In der Liebe war sie gleichzeitig durchtrieben und kindlich gewesen, andere Wörter waren ihm dafür nicht eingefallen. Durchtrieben, das Wort hatte ihn nie befriedigt, es war das falsche, zielbewußt und berechnend vielleicht, aber auch das waren nicht die richtigen Wörter. Es hatte ihn erregt, weil sich durch das gewollt Kindliche etwas von einem verbotenen Spiel eingeschlichen hatte, als habe sie ihm im Grunde suggerieren wollen, er gehe mit einem Kind ins Bett, etwas, was er weder davor noch danach je so erlebt hatte.
Er ging zurück Richtung Stadt. Die Ausstellung von Piero della Francesca hatte ihn tief berührt. Weshalb er darin nun eine Parallele zu dieser Geschichte vor langer Zeit sehen mußte, wußte er auch nicht, vielleicht einfach, weil sowohl der Maler als auch die Erinnerung ihn jetzt beschäftigten, vielleicht auch, weil in diesen Gemälden etwas war, an das man nicht herankam, etwas, das mit diesen kurzen, gemeinsam verbrachten Wochen übereinstimmte. Man konnte nicht behaupten, daß sie geheimnisvoll war, diese Hexerei war purer Unsinn gewesen, doch die anwesende Abwesenheit von damals, neben ihm, ließ ihn jetzt an die hieratischen Gestalten in den Gemälden denken. Man stand davor, wollte mit aller Gewalt zu ihnen vordringen, aber es war eine Welt, zu der es keinen Zugang gab. Er hatte weder eine Ahnung, wie er seinen Essay schreiben, noch, wie er mit seiner Erinnerung umgehen sollte.
Sie hatten einen Zug genommen, damals, quer durch Griechenland nach Jugoslawien. Nichts wußte er mehr davon, abgesehen von ärmlichen Hotelzimmern und einem Kranz roter Haare auf einem Kissen. Eine Nacht in Belgrad, eine Art Biergarten, in dem erregte Männer ihnen Slibowitz spendiert und die Gläser über die Schulter auf den Kies geworfen hatten, wo sie zersplitterten. So waren sie nach Venedig gekommen. In welchem Hotel sie abgestiegen waren, wußte er auch nicht mehr, aber immerhin noch, an welcher Stelle dieses Foto entstanden war. Er drehte sich um und ging wieder zurück. Eigentlich war es undenkbar, daß Menschen einfach aus einem Leben verschwanden. Hundert parallele Leben müßte man haben. Abschied auf dem großen Bahnhof, danach verstört herumtaumeln auf der Fondamenta Santa Lucia, plötzlich wieder allein, ein Mann in einer flanierenden Menge, der erlebt hatte, wie sich jemand wieder in der Welt auflöste, ein schmaler, dünner Arm aus einem Zugfenster, dann der Zug selbst, der über den Ponte della Ferrovia entschwand, ein viereckiges Ding mit Lichtern, und dann nichts mehr. Im Jetzt vierzig Jahre später ging er in sein Hotelzimmer zurück und blätterte im Ausstellungskatalog. Unsinn natürlich, eine Verbindung mit Piero della Francesca zu sehen. Was war sie gewesen? Ein Kind der Flower-Power-Zeit, und er aus Einsamkeit nur allzu bereit, sich zu verlieben und dem Geplapper über Planeten und Sterne zu lauschen, die ihrer Meinung nach in ihrer aller Leben eingriffen. Als ob sie nichts anderes zu tun hätten! Doch wenn ihre Stimme, nachts am Wasser, vor sich hin mäanderte über Saturn und Pluto, als seien es Lebewesen, die vom All aus die Fäden spannen, an denen entlang das Leben einer Siebzehnjährigen aus Mills Valley und das eines freiberuflichen Kunstjournalisten aus Amsterdam verlaufen würden, hatte er eine schwer zu bestimmende Verzauberung gespürt, die nicht durch ihre Worte ausgelöst wurde, sondern durch das Schiefergrau dieser Augen, das im Dunkel aufzuleuchten schien. Liebe war das Bedürfnis nach Liebe, soviel hatte er verstanden. Die Absichten einer Reihe unbelebter Gas- und Eiskugeln irgendwo im Universum, das war eine Geschichte, die Menschen sich selbst erzählten, um jetzt, da die anderen Märchen ungültig geworden waren, in Gottesnamen irgendwo dazuzugehören, wenn man das nicht ertrug, mußte man nicht Stop! sagen zu einer beliebigen Passantin. In seinem leeren Haus in Amsterdam hatte er dann auf die Briefe in der unästhetischen amerikanischen Beinahe-Kinderschrift gewartet, mit wieder dem halben Tierkreis am Rand und sizilianischen Zeichen zur Abwehrung des bösen Blicks, jetzt fragte er sich, was um Himmels willen er darauf geantwortet hatte. Wer als erster das Schreiben eingestellt hatte, daran erinnerte er sich nicht mehr, wohl aber an die aufgeregte Überraschung, als gut zwanzig Jahre später plötzlich wieder ein Brief in dieser unbeholfenen Handschrift gekommen war. Sie hatte seinen Essay über Jacoba van Heemskerk in einem Katalog über spirituelle Kunst gelesen, der eine Ausstellung in San Francisco begleitete. Bei ihr sei sehr viel passiert, schrieb sie. Heirat, Scheidung, zwei Söhne, und sie male Bilder, die vielleicht Ähnlichkeit mit denen Jacoba van Heemskerks hätten. Zwei Fotos hatte sie mitgeschickt, nebulöse Flächen von der Farbe, die seiner Erinnerung nach ihre Augen hatten, grau mit leuchtenden, schwebenden Flecken, Kunst für die Wände eines Meditationszentrums. Es sei ihr nicht gut ergangen, aber der Buddhismus habe ihr sehr geholfen. Es gebe ein Kloster bei ihr in der Nähe, das ihr viel Kraft schenke, wenn sie ihre Söhne nicht hätte, wäre sie da eingetreten. Sie habe noch oft an ihn gedacht, und es müsse doch so etwas wie Seelenverwandtschaft geben, wenn er über die Gemälde von Jacoba schreibe, schließlich kenne die in Amerika so gut wie niemand, doch für sie sei sie eine große Inspirationsquelle gewesen und vor allem auch Trost, denn in ihrem Leben seien schlimme Dinge passiert, mit denen sie ihn nicht langweilen wolle. Sie hoffe, daß der Brief ihn erreiche, und meine, ihr Besuch in dieser Ausstellung sei ein Zeichen gewesen. Denn sei es nicht eigenartig, daß Menschen einander in der Welt einfach verlieren könnten? Daß man nicht mehr wisse, ob jemand noch lebe, obwohl es, wie auch immer, doch eine gemeinsame Reise gegeben habe, eine Erfahrung, die man geteilt habe? Eigentlich sei sie noch ein Kind gewesen, damals, in einer Art Traumschlaf habe sie gelebt, mit diesem alten Haus auf Hydra und dieser langen Bahnfahrt durch die ausgetrockneten Landschaften und schließlich Venedig, das sie irgendwann einmal wiederzusehen hoffe. Sie habe wahrscheinlich viel Unsinn geredet in jenen Tagen, liebe Güte, aber er habe sie so respektiert, wie sie damals gewesen sei, dafür sei sie ihm dankbar, es hätte auch anders laufen können. Sie wisse nicht, ob er verstehe, was sie meine, aber sie wolle damit sagen, daß er sie nicht mißbraucht habe. Sie hoffe, ihm sei klar, daß sie nichts von ihm wolle, daß es aber doch ein Wunder sei, wenn man sich unter Milliarden von Menschen wiederfinde. Er brauche natürlich nicht zu antworten, darum gehe es nicht, obgleich sie gern wüßte, ob es ihm gutgehe.
Nicht besonders, wäre die richtige Antwort gewesen. Das würde er also nicht schreiben und auch nicht, daß der Essay über Jacoba van Heemskerk eine Auftragsarbeit gewesen war, daß er zwar Respekt vor ihren Werken hatte, sie aber eigentlich auch ein wenig wesenlos fand und daß er das erneute Interesse an ihr als Teil der allgemeinen Vagheit sah, die in den letzten Jahren von den Seelen Besitz ergriffen hatte und deren Vorbotin sie, die Briefschreiberin, im Grunde gewesen war. Farbe genug, mit vielleicht der gleichen Spannung wie bei Kandinsky, aber nicht die Geschichte, die er suchte. Diese Kunst war pure Reaktion auf das neunzehnte Jahrhundert gewesen, das ihm selbst so zuwider war. Statt dessen schrieb er in seinem Brief, er arbeite an einer Dissertation über Piero della Francesca. Ob sie diesen Maler kenne? Und ja, er freue sich, daß sie geschrieben habe. Wie es wohl wäre, wenn sie sich wiedersähen? Er habe noch immer das kleine Foto von ihr auf dem Poller an der Riva degli Schiavoni, habe er ihr das seinerzeit geschickt? Er wisse es nicht mehr. Und das mit dem neunzehnten Jahrhundert stimmte eigentlich auch nicht. Flaubert, Stendhal, Balzac, die waren selbst bereits die Reaktion auf die antike Trägheit gewesen, in der so viel Erwartung erstickt war, er brauchte sich nur die ersten Fotos jener Zeit anzusehen, die Bewegungslosigkeit dieser langen Belichtungszeiten, um zu wissen, daß er nie in diesem Vorhof des Modernismus hätte wohnen wollen. Dieses Foto! Mädchen auf einem Poller, so groß, daß ein ganzes Seeschiff daran hätte festmachen können. Ein hauchdünnes Kleid mit etwas Violettem darin, und darüber das ephemere Gesicht eines menschlichen Wesens, durch und durch wegzupustende Vergänglichkeit. Eine Madonna von Bellini, das hatte er wohlweislich nicht gesagt. Wer Kunstgeschichte studiert hat, muß jedem Vergleich mißtrauen. Und dennoch, auch ohne Kind war sie eine Madonna gewesen. Auch bei ihr ein Schatten auf der linken Gesichtsseite, der nichts Gutes verhieß, fast nach innen gerichtete Augen, die die künftige Tragödie des abgewandten Kindes auf ihrem Schoß schon hundertmal gesehen hatten, und dann das Kind selbst, ein uralter Philosoph, der wußte, daß die schützende Hand seiner Mutter in der Stunde seines Todes nichts zu bedeuten haben würde.
Bevor er ihren Brief zu Ende gelesen hatte, stand sein Entschluß fest. Er würde sie aufsuchen, und das hatte er auch getan. Fällt in die Rubrik sinnlose Exerzitien, hatte einer seiner Freunde gesagt, aber daran glaubte er nicht. Dinge mußten zu Ende geführt werden. Dazu gehörte eine Reise nach Amerika, eine Frau, die einen auf dem Flughafen in San Francisco erwartete, jemand, an dem man erkannte, wie alt man selbst geworden war. Menschen waren phantastisch, eigentlich müßten sie immerzu Preise bekommen. Dieser rasend schnelle Blick, mit dem sie sich gegenseitig binnen einer Sekunde taxiert hatten, ein inneres Foto von bestechender Schärfe, über das vorläufig nicht gesprochen würde. Falten um die Augen, das Haar noch immer mit dieser roten Glut, nun aber von einem Schleier überzogen, die Schrift der Zeit, und dadurch eine plötzliche Kollegialität, vielleicht sogar Gerührtheit. Mehr Liebe als damals, das wußte er sofort, und zwar eine, mit der er nichts anfangen würde, das wußte er genauso schnell. Die Verletzbarkeit war größer geworden. Ein Holzhaus, Vorstadt einer Vorstadt, Aquarelle aus der Provinz Rudolf Steiners, Kunst, die er nie gemocht hatte, Dinge, die er früher gesagt hätte und bei denen er jetzt mit einer Leichtigkeit lügen konnte, die ihn selbst wunderte. Du lebst noch immer in einer Traumwelt, hatte er gesagt, und sie war sich treu geblieben und behauptete mehr oder weniger, Saturn habe diese nebulösen Kleckse gemacht, eine Woche höchster Ekstase, Nacht um Nacht habe sie diese Kraft gespürt, als es vorbei gewesen sei, habe sie sich so leer gefühlt wie noch nie, leer, aber glücklich. Kurz danach habe sie diese Ausstellung gesehen und verstanden, es sei ein Zeichen, daß sie ihm schreiben müsse. Aber sie hätte nie gedacht, daß er kommen würde.
Frauendienst war das Wort, das ihm einfiel. Er war gekommen, um etwas zu Ende zu führen. Das war nicht dasselbe wie einer Sache ein Ende zu machen. Etwas war offengeblieben. Meist änderte sich das nicht mehr – etwas war passiert, Distanz war dazwischengekommen und Zeit, Verschleiß, Vergessen. Ab und an ein Gedanke, eine vage Erinnerung, das war normal, so lief das, außer, man hatte keinen Frieden damit. Etwas stand noch aus, eine Verifikation, eine Form von Abschied. Dinge mußten zu Ende geführt werden, nicht nur für einen selbst, sondern auch für den anderen, es sei denn, der hätte kein Bedürfnis danach. Das hatte er also getan, in Mills Valley. Und das tat er jetzt, nach ihrem Tod, noch einmal, hier in Venedig. Schlimme Dinge? Das habe sie doch geschrieben? Ja, aber darüber wolle sie jetzt nicht sprechen. Könnten sie einen Spaziergang machen, am Meer? Das Wetter sei gut, etwas stürmisch, aber das passe ja. Oder sei er zu müde? Nein, das wolle er gern, daß der Wind durch ihn hindurchfege. Aber Schwimmen sei nicht möglich. Erstens der kalte Golfstrom, und dann auch noch die riptides, es sei phantastisch, aber gefährlich. Das stimmte. Marine County, McClure's Beach, ein langer Weg hinunter, links und rechts Felder mit riesigen Elchen, denen man nicht zu nahe kommen dürfe. Brunftzeit, manchmal höre man sie rufen. Dann gingen sie aufeinander los mit diesen gewaltigen Geweihen. Unten herrschte die Brandung, Wasserwände, die sich auf einen zubewegten, Strandläufer, die mit ihrem Getrippel vor den Wellen ein winziges Alphabet in den Sand schrieben. Lärm wie von einer wütenden Orgel, der Ort, um eine Geschichte zu Ende zu führen, die zwanzig Jahre zuvor angefangen hat. Dann schreit man gegen den Wind. Fluch, Schicksal, das nicht zu den Farben des Landes dort paßt, nicht zu den Kinderfarben der alten Menschen, nicht zu den hellen Holzhäusern, nicht zu den Imitationen einer niederländischen Malerin aus dem anthroposophischen Zeitalter. Darum muß man zur Gewalt des Ozeans, dann wirft man die Sätze dem Wind entgegen, eine Frauenstimme gegen die Brandung, die erzählt von einem weggelaufenen Dichter, einem drogensüchtigen Kind, einer Krankheit mit einer eingebauten Uhr, aber ich habe mich damit ausgesöhnt.
Ein bißchen viel, nicht, sagte sie später im Auto. Das war der Satz, der ihn nach Venedig begleitet hatte. Sie hatten noch ein paar Briefe gewechselt, doch seine Fragen nach ihrem Zustand hatte sie ignoriert. Planeten und Sterne seien jetzt mehr denn je ihre Begleiter, hatte sie geschrieben, sie habe das Gefühl, emporgehoben zu werden. Ein Bild habe sie für ihn bestimmt, das bekomme er, wenn es soweit sei. Und kein Mitleid, sie sei gerade vom Strand zurückgekehrt, ein unvorstellbarer Sonnenuntergang, eine lange rote Bahn direkt zu der Stelle, wo sie gestanden hätten, sie hätte ohne weiteres übers Wasser zur Sonne gehen können. Ungefähr eine Woche danach kam das Aquarell, das er bei ihr zu Hause gesehen hatte und bei sich nicht aufhängen würde. Und dazu seine Briefe der letzten Monate und die von vor zwanzig Jahren, die er jetzt ungelesen ins Wasser warf. Dafür gibt's Mülltonnen, sagte eine Stimme hinter ihm. Er antwortete nicht und schaute den schaukelnden weißen Papierschnipseln zu, die langsam im aschigen, abendfarbenen Wasser davontrieben, bis eine Gondel vorbeikam und er sie nicht mehr sah.
Gewitter
Ich bin selbst ein Barometer, hatte er zu ihr gesagt, als sie vor dem Barometer standen. Ich spüre es bis ins Skelett. Ein anderer hätte gesagt: bis in die Knochen, doch Rudolf sagte Skelett, weil er wußte, daß es Rosita ärgerte. Er wußte auch, warum es sie ärgerte, das machte es noch schlimmer. Sie hatte einen wortgetreuen Geist und sah daher ein Skelett, was ihr nicht angenehm war. Die Zeit der Vanitasbilder ist vorbei, erwiderte sie, du stellst dir doch auch keinen Totenkopf mehr auf den Arbeitstisch. Hättest du das vor einer Stunde gesagt, dann hätte ich nicht mit dir gebumst. Keine Lust, ein Skelett auf mir liegen zu haben. Sie sah es vor sich, klappernde Rippen, ineinanderbeißende Kiefer. Du bist manchmal ein richtiges Arschloch. Nur weil sich das Wetter ändert. Darauf entgegnete er nichts, denn es stimmte, sowohl das eine wie das andere. Plötzlich war der Sommer vorbei. Graue Wolkenschlösser, das Weiß der spanischen Häuser mit einemmal fahl und in Kürze der Garten unter Wasser, denn wenn es kam, dann richtig, wie aus Kübeln. Und die damit einhergehende Melancholie. Türen, die den ganzen Sommer offen gewesen waren, mußten geschlossen werden, die großen Spaziergänge entlang der Küste vorverlegt, zwischen der Zeit, da es dunkel wurde, und der Zeit, da man in Spanien essen gehen konnte, klaffte plötzlich ein finsteres Loch. Das bedeutete, früher zu trinken, in einer Bar, oder in dem auf einmal nicht mehr so angenehmen Haus neben einem elektrischen Heizöfchen leicht verfroren zu lesen. Unerträglich, daß sie nicht darunter litt. Sie litt, wenn er es sich recht überlegte, eigentlich nie unter irgend etwas. Nicht unter Schlaflosigkeit, nicht unter Langeweile. Sie verschwand einfach in ihr Arbeitszimmer und war dort offenbar glücklich. Wie jemand glücklich sein konnte, der sich schon seit Jahren mit der Geschichte der niederländischen Arbeiterbewegung befaßte, war ihm ein Rätsel. Alles, was sie darüber erzählte, von Ferdinand Domela Nieuwenhuis bis hin zu Henriëtte Roland Holst, erfüllte ihn mit tiefem Argwohn. Sämtlich Leute, die einen Doppelnamen trugen und es mit der ausgebeuteten Klasse gut gemeint hatten. Jetzt, ein Jahrhundert später, stand die zu erhebende Klasse von einst tätowiert wie ein Maori mit laut brüllendem Radio auf einer Leiter und strich das Nebenhaus. Gedudel und Gestampfe, fette Stimmen von populären DJs und im Fernsehen primitiv daherredende neue Berühmtheiten, die eine Saison lang die Helden in irgendeiner Soap waren. Die müßten mal wiederkommen, sagte er dann, die Gorters und die van Eedens.1 Das kalte Grausen würde sie packen. Endlich verwirklicht, die Diktatur des Proletariats, Kunst fürs Volk. Ich sehe die Arbeiter tanzen/silbrige Reigen am Rande des Ozeans. Gorter. Auch das ist verwirklicht, in der Disco in Torremolinos. Die Antwort darauf war meist ein leises Summen, von dem er nie so recht wußte, ob es nicht der Ausdruck von Verachtung oder tiefem Mitleid war. Ein leichtes, hohes Summen, eine Art Vogelgemurmel, als sei sie schon drauf und dran, von ihm wegzufliegen.
Doch das hatte sie nicht vor. Ich habe dich mitsamt deinem Genörgel gekauft, sagte sie bei einem seiner seltenen Anfälle von Reue. Sie hatte sich in einen Mann verliebt, der kleine Figuren aus Holz schnitzte, ein Barometer war und unter Sonnenfinsternis litt. Sobald die Sonne verschwand, mußten geheime Reservoire angezapft und Strategien ersonnen werden, um eine alles umfassende Düsterkeit abzuwehren. Nacht und Winter waren seine natürlichen Feinde. Dann lag das Holz unangerührt in seinem Studio, entstanden keine geschnitzten Traumwesen und erhielten Galerien keine Antwort. Er wurde dann zu einem Schiff, das ohne Kurs durch die Dunkelheit fuhr, sie spürte, daß ihr eigener Gleichmut ihn störte, wußte aber auch, daß ihre Unempfindlichkeit gegenüber dem, was er seine Schwarzgalligkeit nannte, ihn aufrecht hielt, bis er sich wieder an den Wechsel der Jahreszeit und die dazugehörige Dunkelheit gewöhnt hatte. Die beste Strategie war, ihn entschieden auf Kurs zu bringen.
Wollen wir nach San Hilario fahren?
Er zuckte mit den Achseln. San Hilario lag dreißig Kilometer entfernt. Man fuhr durch eine ziemlich wilde Landschaft. Es war eine kleine Bucht mit einem Strand, den sie noch in jungfräulichem Zustand gekannt hatten, wo aber ein Projektentwickler ein Hotel hingepflanzt hatte. Nicht weit davon, oberhalb des Strands, lag ein altes Lokal, in dem man etwas essen konnte, so eines, das die Spanier chiringuito nennen. Drinnen alles weiß getüncht, Plastiktische, eine große Steinterrasse, Aluminiumstühle, die ein hohes, scharrendes Geräusch von sich gaben, wenn man sie verrückte. Bei diesem dunklen Wetter würden die Neonlampen bereits brennen. Neon half, das hielt sie für experimentell bewiesen, ohne ihm das zu sagen. Eine lange weiße, kalte Sonnenattrappe als Placebo, das wirkte.
Es war das Ende der Saison, das heißt, wenige oder gar keine Touristen. Unterwegs brach das Gewitter los. Die Wolken waren bleigrau geworden, schwere Massen, die über dem Grün der Oleaster hingen, als wollten sie sie verschlingen. Plötzlich leuchtete die Landschaft eigenartig auf, der erste Blitz. Nach dem darauf folgenden scharfen, trockenen Donnerschlag nun auch Hagel in wüsten Schwallen gegen das Auto, Trommelwirbel auf dem Dach. Sie sah zur Seite, wußte sie doch, daß ihn das in eine aufgedrehte Stimmung versetzen würde. Es müßte eine Sprache geben, hatte er mal gesagt, um alle Wolkenarten zu beschreiben. Quader, Kalkstein, Schiefer, weiße Flusen, gefährlicher Grus. Am liebsten, das war ihr bewußt, würde er jetzt aussteigen und ins Gewitter laufen. Hauptsache, es war dramatisch. Was ich brauche, sind große Ereignisse natürlicher Art, hatte er dazu gesagt. Die bekam er nun, aufs Wort bedient wie immer. Sie hatte Mühe, den kleinen Seat auf der Straße zu halten. Ein einsamer Motorradfahrer war abgestiegen und wurde einen Moment lang vom Blitz als Standbild in die Landschaft geätzt. Der Parkplatz beim Lokal war fast leer, als sie ausstieg, stand sie bis zu den Knöcheln im Wasser. Während sie zur überdachten Terrasse rannten, hörten sie das Geräusch der Brandung, noch verschärft durch das Pfeifen des Sturms. Das Grau des Meeres ging über ins Grau des Himmels, die kleine Insel, die dort vor der Küste lag, war kaum zu erkennen.
Verstreut über die ganze Terrasse fünf Menschen. Zwei Frauen in Regenmänteln etwas weiter weg, ein einsamer schwarzer Mann in gelbem Hemd, der zu lesen versuchte, ein Ehepaar am Tisch neben ihnen. Genug für einen Film.
Sagte Rudolf. Sie kannte das an ihm, diese Neigung, in allem Filmszenen zu sehen. Meist war sie einer Meinung mit ihm. Und hier stimmte alles. Einheit von Zeit, Ort und Handlung. Drama genug, bei diesem Gewitter, und offenbar focht das Ehepaar neben ihnen einen grandiosen unterdrückten Streit aus. Das sah man, noch bevor ein Wort gefallen war. Die Frau war schön. Schuhe, Bluse, Regenmantel, alles, was sie trug, war weiß, und als sei das noch nicht genug, schminkte sie sich noch die Lippen mit einem Stift von fast phosphoreszierend heller Farbe, als wolle sie zum Gewitter passen. Ihr schien nicht kalt zu sein. Dem Mann schon, er hatte sich in seine rote Windjacke verkrochen und blickte mürrisch zu Boden, ein großes Kognakglas in der Hand. Rosita fand nicht, daß die Frau Ähnlichkeit mit ihr hatte, sah aber in dem Paar ein Spiegelbild ihrer eigenen Ehe, nicht ganz angenehm. Das sagte sie folglich nicht, allein schon deshalb, weil ihre Strategie funktioniert und Rudolf inmitten aller Düsterkeit des Gewitters seine eigene Trübsal abgelegt hatte. Es schien, als werde er von der Elektrizität draußen aufgeladen. Sie sah, wie er der Frau zuschaute, die jetzt versuchte, mit einer kleinen Digitalkamera den Blitz zu fotografieren. An seinem Blick erkannte sie, daß er an eine Figur dachte, irgend etwas würde eines Tages daraus hervorgehen. Sie wußte nicht, ob man einen Mund runzeln konnte, doch genau das tat er ihrer Meinung nach, eine merkwürdige, gierige, gespannte Art und Weise, die Lippen zusammenzupressen, während er jeder Bewegung der Kamera folgte, die die weiße Frau immer zu spät hochhielt und auf die Blitze richtete. Und was für Blitze. In diesen Breiten war Gewitter ein Phänomen anderer Ordnung. Lange Strahlen grellweißen Lichts, mitunter mehrere zugleich, und die immer lauter werdenden Schläge, die darauf folgten und stetig näher zu kommen schienen.
Laß doch den Blödsinn, sagte der Mann aus seiner Windjacke heraus. Auf deutsch, und so laut, daß klar war, er ging davon aus, daß niemand ihn verstand. Rosita hatte auf spanisch bestellt und konnte auch für eine Spanierin durchgehen.
Die Frau schoß ein weiteres Foto und machte ein Gesicht, als habe sie diesmal den Blitz eingefangen.
Arschloch. Du bist wirklich ein Arschloch. Sie sagte es in ruhigem, klarem Ton, fast wie eine Durchsage für Reisende.
Laß mich in Ruhe oder geh ins Hotel. Ich mache so lange weiter, bis ich einen … Der Rest des Satzes ging in einem Donnerschlag unter, so heftig, daß die Terrasse bebte.
Den bekommst du jedenfalls nicht drauf, sagte der Mann.
Beim nächsten Schlag fiel das Licht aus. Nur wenn es blitzte, sah man noch den Zaun aus dicken Ästen, der die Terrasse von dem zum Strand hinunterlaufenden Hang trennte. Den Zaun und die Schaumkronen, die am Strand zerbarsten. Offenbar versuchte die Frau erneut, ein Foto von der elektrischen Schrift zu machen, die wie ein zersplittertes Alphabet über den gesamten Horizont fuhr, denn sie hörten das schrille Geräusch ihrer Kamera und sahen für einen Moment ein zuckendes rotes Lämpchen. In den paar Sekunden, bis das Neonlicht auf der Terrasse wieder anging, mußte der Mann ihr die Kamera aus der Hand geschlagen haben. Das Ding lag in einer großen Wasserpfütze am Rand der Terrasse. Die Frau schlug ihm ins Gesicht und sagte das Wort noch mal, und diesmal wurde es vom Geräusch des Aluminiumstuhls unterstrichen, der umfiel, als der Mann abrupt aufstand. Das Kognakglas in der Hand, lief er wie ein programmierter Roboter auf die Treppe zu, die zum Strand führte. Der Ober, der, hinter den Fenstern geschützt, auf die Terrasse geschaut hatte, kam heraus, doch der schwarze Mann war schneller und rannte zur Treppe, die der andere langsam hinunterzusteigen begann. Was Rosita nie mehr vergessen sollte, war der schaurige Wechsel zwischen Hell und Dunkel, der den Mann mit dem Glas sichtbar machte und wieder verschwinden ließ, als habe die Dunkelheit ihn geschluckt. Jedesmal, wenn sie ihn sahen, war er, noch immer mit diesem roboterhaften Gang, dem Meer ein Stück näher gekommen.
Der ersäuft sich jetzt, sagte Rudolf, aber soweit kam es nicht.
Als der Blitz ihn traf, schien es für einen Augenblick, als ströme die Elektrizität über ihn hinweg. Flüssige Funken, eine rasend schnelle Linie aus weißem Licht entlang der düsteren Form seines Körpers. Sogar durch den Lärm der Brandung hindurch hörten sie seinen Schrei, ein Geräusch aus zerschmetterten Worten, das im hohen Kreischen der Frau und einem weiteren Donnerschlag unterging. Sie sahen, wie der Ober und der schwarze Mann sich über den verwundenen Körper beugten, ihn aber nicht anzufassen wagten. Das geschah erst viel später, als die Polizei und die Ambulanz mit lauten Sirenen vorfuhren. Während der Vernehmung, bei der die Frau in einem fort leise jammerte, erwähnte niemand den Streit, als hätten sie das so abgesprochen. Erst nachdem die Beamten ihre Adresse und weitere Angaben notiert hatten, durften sie gehen. Durch den Schlamm liefen sie zum Auto. Der Himmel wurde in der Ferne noch immer mit der elektrischen Schrift beschrieben, doch Donner hörten sie nicht mehr, und auch der Wind hatte sich gelegt. Nur der Regen war geblieben, sacht, aber eindringlich.
Aus der Straße war ein Bach geworden, hier und da mußten sie Ästen ausweichen. Rudolf hatte eine CD eingelegt, Chormusik von Kurtág, die er immer in seinem Atelier hörte. Nicht eben Musik, die Rosita liebte, dünne, hohe Stimmen, die in große Höhen zu steigen schienen, etwas Heiliges aus dem Raum hinter der geschlossenen Tür, Klänge, die sie ausgrenzten. Doch zugleich wußte sie, wenn diese Musik lief, arbeitete er, diese Stimmen begleiten mich, hatte er einmal gesagt. Sie hatte sich das vorzustellen versucht, wenn die Töne so merkwürdig ausfächerten, als sängen sie bis zum Ende ihres Atems, um dann in stets wiederholten Staccatobewegungen übereinander herzufallen. Manchmal glichen sie auch einer Menge, die irgendwo in der Ferne ein schreckliches Geheimnis besprach, dessen Kern ihr wegen der geschlossenen Tür entging. Jetzt, im Auto, gehörten die Stimmen plötzlich zu dem, was gerade geschehen war. Sie sah wieder, wie die weiße Frau, die auf einmal sehr still geworden war, von zwei Krankenpflegern gestützt zur Ambulanz gebracht wurde und sich dort auf einen kleinen Stuhl neben die menschliche Form unter dem Laken setzte. Erst vor wenigen Stunden hatte sie in diesem Ehepaar ein Spiegelbild gesehen. Sie fröstelte und blickte aus dem rechten Augenwinkel zu dem verschlossenen Gesicht neben ihr. Die Musik glich jetzt einem Kampf zwischen Männern und Frauen, die Frauenstimmen wie Peitschenschläge. Sie erschauerte und dachte daran, daß sie noch nie jemanden hatte sterben sehen. Mausetot, hatte Rudolfs Antwort gelautet, als sie gefragt hatte, ob der Mann tot sei. Das waren zehn elektrische Stühle, es roch ja richtig verbrannt. Man bekommt einen gewaltigen Schlag.
Niemand war auf der Straße. Morgen würde die Geschichte in der Inselzeitung stehen, und von überall her würden sie angefahren kommen, um zu schauen, wo es passiert war. Hier geschah nicht viel, sogar ein Zusammenstoß war schon eine große Nachricht. Plötzlich hob er die Hand und sagte, halt da rechts mal eben an. Er sah Dinge immer früher als sie, daran war sie gewöhnt. Jetzt würde er das Messer oder die kleine Säge holen, die immer im Kofferraum lag für den Fall, daß er ein besonderes Holzstück entdeckte, das er für irgend etwas verwenden konnte. Im Rückspiegel sah sie ihn ein kleines Stück zurückgehen und über den Straßengraben im Wald verschwinden. Er hatte die große Lampe mitgenommen, man konnte den sich bewegenden Lichtschein noch zwischen den Stämmen sehen. Sie stellte die Musik leiser und lauschte dem Geräusch des Regens, das von dem der Scheibenwischer in gleiche Teile geteilt wurde, ticktack, ticktack. Kurz darauf hörte sie ihn rufen. Sie schaltete das Warnblinklicht ein und stieg aus. Er stand vor den Wurzeln eines umgestürzten Baumes und bat sie, ihm kurz mit der Lampe zu leuchten. Im gelben Licht sah die Unterseite des Baums wie der Kopf einer gigantischen Medusa aus, die gewundenen Wurzeln wie riesenhaftes Rastahaar voller Erdklumpen und Steine. Sie hatte das Gefühl, alle diese Tentakel streckten sich nach ihr aus, und trat unwillkürlich einen Schritt zurück.
Nein, näher ran! Seine Stimme klang streng, wie immer, wenn er konzentriert war. Mit der Hand schlug er einen Teil der rotbraunen Erde ab und begann, an einer der Wurzeln zu sägen, einem bizarren, gewundenen Holzstück, das noch zu leben schien, was natürlich auch so war. Er hielt es hoch ins Licht. Ein merkwürdiger Knick war darin, wie bei jemandem, der auf dem Boden liegt und die Beine angezogen hat. Das sieht aus wie ein Fötus, sagte sie, aber er antwortete nicht. Nur dieser Blick, und sie wußte, sie hatte etwas Falsches gesagt. Schweigend gingen sie zum Auto zurück und legten das Holzstück in den Kofferraum. Er summte und hatte vergessen, die Musik wieder einzuschalten. Eine Zeitlang schaffte sie es, nichts zu sagen, dann aber fragte sie doch.
Was passiert eigentlich, wenn man vom Blitz getroffen wird? Ist man dann immer sofort tot?
Nein, nicht immer. Aber man bekommt einen gewaltigen Stromschlag. Der Mensch besteht zu 95 Prozent aus Wasser. Also verdampft man im Grunde. Der Widerstand kommt von den Knochen. Er dachte sich das spontan aus.
Du weißt es ja selber nicht.
Nein, stimmt, sagte er, aber er war tot. Verbrannt. Sein Gesicht war völlig verkohlt. Wasser leitet, und es hat geregnet.
Jetzt sagten sie beide nichts mehr. Zu Hause verschwand er in seinem Atelier. Sie hörte, wie er den Wurzelstrunk schrubbte. Am nächsten Morgen sah sie, daß er das Holzstück an den offenen Kamin gelegt hatte. Durch den Knick wirkte es, als hätte es Schmerzen, eine große Kraft hatte es in eine Form gezwängt, die nicht natürlich war. Und doch hatte die Natur das getan.
Nicht verbrennen, sagte er, trocknen lassen.
Im Morgenlicht konnte sie erkennen, was für eine Figur es werden würde. Einen Moment lang, als die Frau wieder fotografierte, hatte der Mann sie angesehen. Hellblaue Augen. Es hatte geschienen, als wolle er etwas sagen, aber er hatte es nicht getan. Sie selbst hatte kurz die Hand gehoben und dann zurückgelacht.
Die Zeitung kaufte sie nicht, um keinen Namen dazu zu haben.
1
Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) war eine der wichtigsten Figuren der frühen niederländischen Arbeiterbewegung. Herman Gorter, Henriëtte Roland Holst und Frederik van Eeden gehörten der literarischen Bewegung der »Tachtigers« (der »Achtziger«) an, die nach einer revolutionären Erneuerung der niederländischen Literatur strebte.
Heinz
»What an empty episode!« said Eliza. »It seems to have no meaning.« »It has none«, said Sir Robert. »So we will not give it one. We will not pretend that something has happened when nothing has.«
Ivy Compton-Burnett, The Last and the First
1
Erst eine glatte Täuschung. Ich sehe mir ein Foto mit mehreren Leuten an, zwischen denen ich selbst stehe. Jetzt muß ich so tun, als würde ich mich und die anderen nicht kennen. Was sehe ich dann? Nein, ich muß die Täuschung verstärken. Wenn ich nach draußen schaue, hier, wo ich dieses schreibe, sehe ich eine Wiese, eine schmale Landstraße, die nach links biegt. Der Asphalt ist naß. Es ist Winter, aber es liegt kein Schnee wie sonst in dieser Jahreszeit. Die Bäume vor mir sind kahl. Birken, eine abgestorbene Tanne, ein kleiner Teich. Daneben ist jemand ohne Grabstein begraben. Dahinter eine zweite Wiese und eine dritte. Der Boden sumpfig, matschig, das weiß ich von meinen Spaziergängen. In der Ferne Wälder wie eine schwarze Wehr.
Wehr ist vielleicht kein gebräuchliches Wort, aber es paßt zu Täuschung.
Sprache ist etwas, was man erbt, man ist nie ganz man selbst, wenn man spricht, auch das hilft beim Lügen. Wenn schönes Wetter wäre, könnte ich die Alpen sehen, dann wäre der Schein offensichtlicher, denn auf dem Foto hier auf meinem Tisch ist keine Rede von Bergen. Ich sehe die anderen auf dem Foto an. Sie – ich muß daran festhalten, die Zeit für wir kommt erst nachher – stehen in einer mediterranen Landschaft. Weit entfernt im Raum, weit entfernt in der Zeit. Eine zerzauste Gruppe, in Kleidern für draußen. Fünf Männer, zwei Frauen, ein halber Hund. Wäre das Foto auf der rechten Seite einen Zentimeter breiter, dann hätte man sehen können, ob das linke Ohr des weißen Hundes ebenfalls schwarz war. Im Hintergrund ein alter Bauernwagen. Was für ein Spiel ist das, so tun zu wollen, als würde ich diese Menschen nicht kennen? Denke ich, daß ich ihnen mit diesem Trick ihre Rätsel entlocken kann? Nur indem ich sie anschaue? Oder will ich Fremde aus ihnen machen, gerade weil ich ihre Rätsel kenne? Sie haben alle schon ungefähr fünfzig Jahre gelebt, soviel ist deutlich. Armut ist nicht ihr Problem, auch das ist zu erkennen. Bessere Kreise, rustikale Kleidung.
Vielleicht gehen sie gleich auf die Jagd oder versorgen ihre Pferde. Jemand, der dieses Foto findet, jetzt oder in fünfzig Jahren, was denkt der? Für den Fall, daß es jetzt ist, verspürt der- oder diejenige dann Neugier, würde sie diese Männer kennen wollen, findet er die Frauen attraktiv? In fünfzig Jahren lauten die Fragen anders. Dann sind diese Menschen ins Totenreich verwiesen oder in ein unwirkliches Alter, dann wird das Betrachten des Fotos eine flüchtige Sekunde lang zu einem melancholischen Exerzitium, allerdings ohne große Konsequenzen. Tote haben wenig Rechte. Ich lasse sie also lieber leben und behaupte, daß dieses Foto ein Jetzt darstellt, ein Jetzt, in dem die sieben Menschen einen unsichtbaren Fotografen (männl./weibl.) ansehen. Nur einer, der Mann mit der Mütze, lacht. Die anderen haben die Ahnung eines Lächelns auf den Lippen, mehr nicht. Ob sie den Fotografen (m/w) kennen, wissen wir nicht, wahrscheinlich schon, denn keiner wirft sich in Positur. Sie stehen einfach da, in einer mehr oder weniger zufälligen Reihe, die Gesichter der Kamera zugewandt. Zwei Sekunden später werden sie sich aus dieser Reihe lösen, wieder miteinander reden. Na schön, Schreiberling, was willst du damit bezwecken? Nur wenn du Alzheimer hättest, wüßtest du nicht mehr, wer diese Menschen sind. Ja, dich meine ich. Einer dieser sieben bist du selbst, zwei der Männer kennst du nicht, bleiben vier, und von einem der vier wolltest du etwas erzählen, weil er der einzige Tote ist. Warum diese ganze Geheimnistuerei? Wolltest du mehr daraus machen, als es ist? Dramen in Romanen oder Filmen sind nur deshalb Dramen, weil die Dauer beschränkt ist, weil man sie zu ein paar Abenden Lesen oder zwei Stunden Schauen zusammenpressen kann, aber sonst? In der Wirklichkeit darf man manche Dinge noch immer als Drama bezeichnen, und trotzdem, wenn man Kunst daraus machen will, muß man eindicken und zusammenpressen, das läßt sich nicht ändern. Dauer war im neunzehnten Jahrhundert eine Tugend, Stendhal, Trollope. Wir dagegen schaffen das nicht mehr, wir werden in einem fort abgelenkt. Unser Chaos macht Geschichten formlos, unübersichtlich. In einer guten Geschichte ist die Zeit sowohl aufgehoben als auch anwesend. Bei Fotos ist immer wichtig, wer nicht darauf ist, aber woher soll man das wissen? Ich meine, wenn man die Menschen auf dem Foto nicht kennt, kann man auch nicht wissen, wer fehlt. Das ist der Unterschied. Heinz steht neben seiner Frau, aber seine erste Frau ist nicht mit drauf. Heinz? Vierter von links und vierter von rechts. Zählt man den Hund nicht dazu, dann steht er genau in der Mitte. Deutscher Name, kein Deutscher. Mittelpunkt. Von dieser Gruppe, und von dieser Geschichte. Ich habe die Fiktion der Täuschung also nicht lange aufrechterhalten, aber sie ist mir bewußt. Warum habe ich es dann trotzdem versucht? Darf ich das nachher erzählen, am Ende?
2
Die ligurische Küste. Wer je Ossi di Seppia von Eugenio Montale gelesen hat, weiß, was das bedeutet. Tintenfischknochen. Hinter der verschandelten Küste noch immer eine klassische Landschaft, schließ die Augen, und ein römisches Heer marschiert vorbei, auf dem Weg nach Gallien. Tintenfische gehören zu den Schalentieren, doch was sie hinterlassen, wenn sie aus dem Leben verschwinden, ist kein Schneckenhaus und keine Muschelschale, sondern ihr Gebein, ein merkwürdiger, leicht kalkiger Gegenstand, weiß und oval, nicht hart, im Gegenteil zerbrechlich, früher sah man so etwas in Kanarienvogelkäfigen. Nicht zum Fressen, denke ich, sondern um den Schnabel der Sänger zu schärfen. Für Montale war es offenbar das Symbol seiner Heimat, und das hat etwas für sich. Ein kalkartiges Überbleibsel des Lebens, felsiger Boden, empfindlicher Sandstein, bewachsen mit Zypressen und Steineichen, Kakteen, Zitronenbäumen. Im Landesinneren hinter der Küste alte Bauernhöfe, solche wie der, vor dem wir an jenem Tag standen, weiß der Himmel in welchem Jahr, Zeit entgleitet mir immer als erstes. Der Mann mit der Mütze war der Verkäufer, er lachte am lautesten, aber es half nichts. Niemand kaufte. Er war der einzige Italiener in unserer Gesellschaft, der Rest Engländer, Heinz und ich die beiden Niederländer. Keiner von uns wohnte in der Stadt an der Küste, unsere Häuser lagen in den alten Dörfern und den umliegenden Hügeln. Jetzt muß ich natürlich das Foto beschreiben, aber zuvor eine Warnung. Wann ist etwas ein Drama? Vielleicht sollte ich doch wieder auf die alte Theaterdefinition zurückkommen: die Zwangsjacke der Einheit von Zeit, Ort und Handlung. Wer das erwartet, wird sich hier getäuscht sehen. Drama genug, aber keine Zwangsjacke, und folglich keine Kunst. Keine Kulmination, keine Auflösung. Die letzten drei Akteure waren Heinz, eine Taube und der Tod. Ich schaute nur zu, wie immer, und Molly hatte sich in die Kulissen geflüchtet. Aber sie ließen sich Zeit, das Buch war längst weggelegt, der Saal leer. Alles dauerte zu lang. Heinz war allein mit seinem Stück, wie Philip und Andrea, die, wenn man den Verkäufer nicht mitrechnet, an den beiden Enden der Reihe stehen. Nicht versehentlich, nicht durch Zufall. Von links nach rechts jetzt. Der Verkäufer, der mit der Mütze und dem Lachen. Er kann abtreten. Nach ihm kommen die echten Personen. Non dramatis. Die erste ist Andrea. Von unten: weiße Wanderschuhe, eine schmale schwarze Hose, ein langes weißes T-Shirt, eine kurze weiße Jacke aus gekräuselter Wolle, eine Art weißer Persianer, falls es so etwas gibt. Vielleicht ein Imitat, man weiß es nicht. Sie ist eine jener Frauen, bei denen auch Imitate echt wirken. Wie eine Reiterin steht sie da, aber vielleicht denke ich das nur, weil ich es weiß. Ich war mal verliebt in sie, wir haben es ausprobiert, nichts draus geworden. The Sun tägliche Nahrung, sonst nur Pferde. Daß ich gerade das anziehend fand, wollte sie nicht glauben. In your secret heart you are an arrogant intellectual, you laugh about me. Davon konnte keine Rede sein, aber beweisen ließ sich das nicht. Schon mal eine Frau im Abendlicht durch die Hügel reiten sehen? Ein Atavismus siegt immer über ein Skandalblatt. Slowenischer Adel, doch davon spricht man nicht, wenn man aus England kommt. Too ridiculous. Vater Antisemit und großer Pferdemensch, Tito entflohen, reich geheiratet. Neben ihr zwei Meter lang nichts, ein paar weiße Getreidesäcke an der Mauer, dann der unbekannte Segler, jemand, der an diesem Tag zufällig da war. Offenes, freundliches Gesicht. Keine Jacke, auf dem Meer ist es meist kälter. Dann Heinz, schwer. Er ist der Grund, warum ich so tun wollte, als würde ich sie nicht kennen. Ich wollte sehen, ob ich seinen Untergang hätte erraten können, aber egal, wie ich schaue, es ist nichts zu sehen, jetzt nicht und in fünfzig Jahren schon gar nicht. Nicht einmal das, was ich damals bereits wußte, zählt. Ein schwerer Mann in schwarzem Rollkragenpullover, offenem Jackett, schlampiger Hose, falschen Schuhen, das Gegenteil seiner Frau Molly neben ihm, damals noch. Sie spricht die gleiche Art von Englisch wie Philip und Andrea, nicht Oxford, eher etwas, was zu Jaguaren, Kricket und Pferden gehört, aber auch zu Zeitungen mit fettgedruckten Schlagzeilen und nacktem Fleisch auf Seite drei. Bessere Kreise, keine Bücher, damit ist wohl alles gesagt. Expatriates, aber Patria ist nur zwei Flugstunden entfernt, und die Sprache ist überall, im Gegensatz zum Finanzamt. Molly: ebenfalls eine Sonnenbrille, weißes Gestell. Bei manchen Engländerinnen weiß man genau, man wird nie ihr wahres Gesicht sehen. Tous les Anglais sont fous par nature ou par ton, sagte Chateaubriand aus dem Grab, und das gilt auch für die Frauen.
Weißen Schal locker umgebunden, hochblondes Haar, Dreivierteljacke aus Tweed. Eine gebeugte alte Frau mit kleinem Hund auf einem Feldweg, als ich sie das letztemal sah. Sie erkannte mich nicht. Hier stehe ich neben ihr, eine frühere Ausgabe meines chamäleonartigen Selbst. Wo jetzt mein Ellbogen auf dem deutschen Tisch liegt, muß meine Frau gestanden haben, um das Foto zu machen, m/w war also w. Wenn ich meiner damaligen Blickrichtung folge, nach den Gesetzen der Perspektive, sehe ich genau, wo ihre Füße sich auf den glatten sandfarbenen Felsen befunden haben müssen. Auch ich habe mir einen Schal locker umgebunden. Über die Zeit hinweg sehe ich noch, welchen, grün mit kleinen schottischen Karos. Auf unserem epischen Weg zwischen Nichts und Nichts lassen wir eine endlose Spur aus Kleidungsstücken zurück. Manchmal habe ich Heimweh nach ihnen, allein darum schon sollte man sich alte Fotos nicht zu oft anschauen. Neben mir Philip. Wildlederschuhe, wattierte Jacke, graues Haar, bereits damals, im Wind. Er hat die Kommandostimme seines Vaters, der mir einmal erzählt hat, welche Schlachten ihm im Krieg entgangen waren. Monte Cassino, zuviel Gin und über einen Zelthering gestolpert, El Alamein, zu spät von seinem orderly geweckt worden, Jerusalem, Befehl über ein Frauenregiment. Zusammen mit Heinz makelte Philip mit Land und Häusern. Jetzt von Andrea geschieden wegen der Pferde. Only time for those goddam horses. Out in the morning at six. Never at home. Aber die Geschichte handelt nicht von Philip und Andrea. Sie handelt von Heinz.
3
Von allen Rängen, die das Außenministerium zu vergeben hat, ist der des Vizehonorarkonsuls vermutlich der niedrigste. Honorar bedeutet unbesoldet und Vize, daß es auch noch jemanden geben könnte, der kein Vize vor seinem Namen stehen hat, doch in Heinz' Fall traf das nicht zu. Er hatte keinen über sich, und das war nur gut. Eine kleine Hafenstadt in einem Touristengebiet, das von vielen Niederländern besucht wird, muß ein Konsulat haben. Niederländer im Ausland sterben, werden verhaftet, haben einen Autounfall, verlieren ihr Geld oder ihren Paß oder beides, und dann muß der mächtige Arm des Heimatstaates bis über die Grenzen reichen können, um den Unglücklichen beizustehen. Als Gegenleistung darf sich der Honorarkonsul, meist ein ortsansässiger Geschäftsmann, der kaum Niederländisch spricht, das Schild mit dem Wappen des Königreichs an sein Haus hängen, was ihm vor Ort viel Prestige verleiht. Zwei goldene Löwen, die Pranken erhoben, heraldische Zungen in den aufgerissenen Mäulern, sind dem Geschäft dienlich, das meist im selben Gebäude angesiedelt ist. »Je maintiendrai« steht in ebenfalls goldenen Lettern auf diesem ovalen Schild, was von Heinz mit »Ich werde auch weiterhin maintenieren« übersetzt wurde, ein Satz, der zusammen mit der Kenntnis des Französischen aus der Sprache der jüngeren Generationen verschwunden ist. Maitresses, maintenées, alles ausgestorben, ausgetauscht gegen das abgewertete Wort Freundin, was nicht heißen soll, daß Heinz keine hatte. Dafür hatte er seine Sekretärin Sigismonda, die es ihm gelegentlich auch unter seinem Schreibtisch besorgte, eine fröhliche Achtundvierzigjährige, deren Pferdegesicht, wie er es nannte, er rührend fand. Heinz hatte ein aufgeräumtes Naturell, das weder zu seinem ersten noch seinem zweiten Vornamen paßte. Heinz Maximiliaan, das kommt davon, wenn man eine österreichische Mutter hat, sagte er regelmäßig, ich kann noch von Glück sagen, daß mir Adolf erspart blieb.
Ein weiteres Mal kehre ich zu dem Foto zurück. Aufgeräumtes Naturell, stimmt das wirklich? Und was ist mit dem Melancholiker, und dem Alkoholiker?
Aber das war es ja gerade, diese unwiderstehliche Kombination, die mich noch immer an ihn denken läßt. Das habe ich auch mit »keine Auflösung« gemeint. Die Auflösung ist schon von vornherein gewiß, denn es gibt keinen Knoten. Ein Alkoholiker trinkt sich zu Tode. Auf dem Grund seiner Seele hauste bei Heinz die mélaina cholē, die Spukgestalt der schwarzen Galle, die ihn unwiderruflich seinem Ende entgegentrieb, es war ein Wunder, daß er dabei so fröhlich blieb.
4
Alles fing vor ungefähr dreißig Jahren an. Ich saß mit meiner damaligen Liebsten in einem Straßencafé am Hafen. Beflaggte Segelboote, eine Prozession auf dem Wasser, der erste Fischer mit einer Figur der heiligen Jungfrau, die anderen Fischer um ihn herum, Singen und Tuten, ein goldgekleideter Pfaffe, der das Meer mit Weihrauch segnete, heidnische Rituale, die hier wahrscheinlich schon vor Christus stattfanden, denn das Meer flößt Angst ein, die beschworen werden muß, und das geht nun einmal nicht ohne Priester. Wir müssen ein paar Worte miteinander gewechselt haben, denn plötzlich tauchte ein dickes, rotes Gesicht zwischen uns auf und verkündete: »ich verstehe alles, was ihr sagt«, was dann sofort dazu führt, daß man sich fragt, was man gerade Schändliches von sich gegeben hat. Nein, bei dieser ersten Begegnung wirkte Heinz nicht einnehmend, und ich hatte keine Lust auf seine Bekanntschaft. Er roch nach Gin, war nicht rasiert, hatte aber bereits den Kellner gerufen und etwas im Namen des Vaterlands bestellt. Warum kam es nach dieser ersten Begegnung zu einer zweiten und danach zu einer endlosen Reihe von Begegnungen, die in jener letzten auf seiner Terrasse gipfeln sollte, an einem Tag mit bleigrauem Wasser und Sturm? Die Antwort, denke ich, ist wieder ein Foto. Nicht dieses, sondern eines, das Molly mir mal gezeigt hat, Heinz am Tag ihrer Hochzeit, sein Gesicht noch nicht gezeichnet vom Alkohol, ein Seeräuber, Bukanier, Clark Gable, ein Mann, von Abenteuer umgeben, ein Freibeuter, in den sie sich einst verliebt hatte, einer, der an jedem Finger zehn Frauen haben konnte, weil solche Männer eine Freiheit ausstrahlen, die selten ist. Ich weiß noch, daß ich mir dieses Foto lange ansah. Das Wort schelmisch ist ausgestorben, zumal im Zusammenhang mit erwachsenen Männern, doch der, der da stand, groß, gut gebaut, ein Mann auf einem Segelboot, ein Glas in der einen Hand und die andere am Ruder, das war der frühere Geist von Heinz Maximiliaan Schroeder, Vizekonsul Ihrer Majestät vor Ort, damals noch im Stand der Gnade, Libido und Humor intakt, vom Alkohol noch nicht eingeholt, schelmisch und, wieder so ein Wort, unschuldig, ein Hauch von Boshaftigkeit in diesen schrecklich blauen Augen, ein Mensch. Ich brauche anscheinend andere Sprachen, um mich ihm zu nähern. Und trotzdem, wenn ich sage ein Mensch, warum will ich dann verbergen, daß ich bei jenem ersten Mal, als sein rotes, betrunkenes Gesicht im Hafen neben mir auftauchte, sofort an einen Schweinekopf dachte? Die Welt des Bestiariums ist voll von hybriden Doppelformen, Pferde mit Menschenköpfen, Vögel mit Frauenbrüsten, ägyptische Götter mit Tiergesichtern, Adler mit Menschenkronen, der Minotaurus mit seinem bleischweren gehörnten Kopf auf diesem plötzlich so schmalen Männerkörper. Es ist die Zeit der Erbsünde, des mühsamen Abschieds von der Tierwelt, der Augenblick, da wir unsere Unschuld verloren. In unserem Heimweh nach dem zurückgelassenen Tierreich, dem wir entstammen, haben wir uns offenbar mit allen möglichen tierischen Wesen wenigstens teilweise identifizieren wollen, meines Wissens jedoch nie mit Schweinen, es sei denn in Karikaturen, um jemanden zu beleidigen.
5
Sein ältester Trick: eine Einladung in sein Sommerhaus am Meer, neben dem Pool. Und eine Fahrt mit seiner Motoryacht. Die Yacht war ein billiges Speedboot, das Sommerhaus eine weißverputzte, steinerne alte Fischerhütte, die Terrasse drei Meter lang, mit einem Schilfdach, der Pool ein in einer Terrassenecke eingemauertes Kinderplanschbecken mit einem Rand, der einem nicht einmal bis zum Knie ging, man konnte so eben darin sitzen, von Schwimmen keine Rede. Dort empfing er seine potentiellen Käufer, von denen nur wenige ihre Bestürzung verbergen konnten. Wenn sie dann doch noch etwas über den Pool sagten, wies er hinaus, aufs Meer. Die Hütte lag hoch über einer kleinen Bucht mit steilen Felsen, ein Teil des Spaßes bestand darin, von den Felsen ins Wasser zu springen, nicht ganz ungefährlich, weil vor allem im unteren Bereich scharfe Kanten vorstanden. Im Kopfsprung war er unübertroffen. Bei meinem ersten Besuch war das Wasser wild, sein Bügeleisen, wie er das kleine Speedboot nannte, zerrte im tosenden Wasser an den Leinen, mit denen Heinz es an zwei rostigen Haken im Fels festgemacht hatte. Zum Lunch waren wir eingeladen, meine Verflossene und ich. Philip hatte gesagt, eine Flasche Whisky wäre das willkommenste Geschenk, die hatte ich also dabei. Was Philip mir nicht erzählt hatte, war, daß die Flasche am Ende des Lunches leer sein würde. Ich selbst trinke mittags nichts Hochprozentiges, und auch die Frauen blieben beim Wein. Ein Film war es nicht, das ist das Alltagsleben nie, aber manchmal sollte man versuchen, Szenen aus dem Alltagsleben wie einen Film zu betrachten. Dann legt sich ein eigentümlicher Glanz darüber, einzelne Fragmente des Dialogs scheinen von einem zweitklassigen, aber nicht unwitzigen Drehbuchautor geschrieben zu sein, das Mikrophon pickt auch die Gespräche heraus, die nicht im Skript standen, und die Kamera hat hin und wieder einen weiten Schwenk gemacht, der bis zu der felsigen Insel in der Ferne reichte, hat den Kopf eines einsamen Schwimmers aufgezeichnet, der gegen die Wellen ankämpft, und hat dann Mollys sehr blasses Gesicht genau in dem Augenblick herangezoomt, als Heinz von ihr als »dieser Garnele« spricht, die noch immer kein Wort Niederländisch kann. Vielleicht war er bei dieser zweiten Begegnung noch mehr Schwein als bei der ersten, doch meine Transformation hatte bereits begonnen. Wenn es stimmt, daß es eine Liebe gibt, die nichts mit Eros zu tun hat, und wenn es auch stimmt, daß Platon gesagt hat, Liebe ist nicht in dem, der geliebt wird, sondern in dem, der liebt, dann hatte ich begonnen, schon damals, diesen Mann, der immer mehr Ähnlichkeit mit einem Bacchanten bekam, diesen verwilderten Trunkenbold, der nie volltrunken wurde, zuzulassen zu … ja, wozu? Ich habe außerordentlich wenig Lust, von mir selbst zu sprechen, aber etwas werde ich doch sagen müssen. Zu einer Gruppe intimer Freunde? Habe ich eigentlich nicht. Ich habe hier und da auf der Welt Menschen, Mann/Frau, die das Salz meines Daseins ausmachen, um es mal so zu nennen. Eine halb kulinarische Metapher, sie bringt einen nicht viel weiter, aber trotzdem. Menschen, um die man trauert, wenn sie sterben, aber auch, und darum geht es, schon vor diesem fatalen Abschied, Wesen, um die man bereits trauern kann, während man noch über sie lacht. Menschen, die verletzlich sind, verwundete Idioten, Frauen, die ihr Schicksal herausfordern, Ritter von der traurigen Gestalt, Männer, die von einem Nimbus des Unglücks umgeben sind. Ich will nicht wissen, was das über mich sagt, es soll mich nicht heilig machen, vielleicht ist es Mitgefühl, und vielleicht bin ich die Aasfliege, die vom Leichengeruch angelockt wird, womöglich fühle ich mich angesichts der angekündigten Tragödie eines anderen sicher, weil die dann jedenfalls nicht mehr mir zustößt, wer vermag das schon zu sagen.