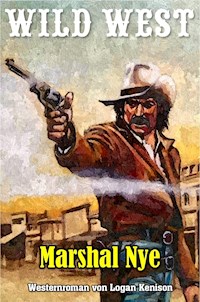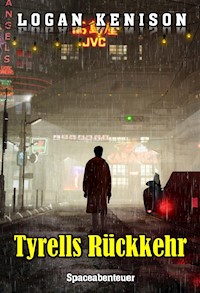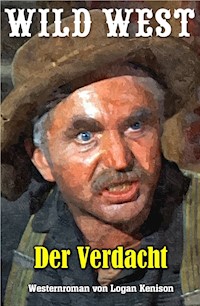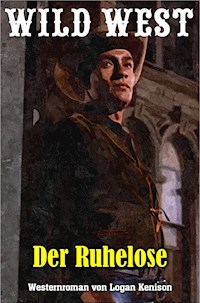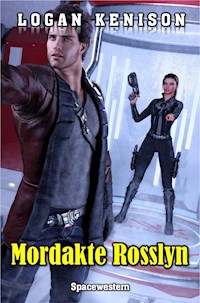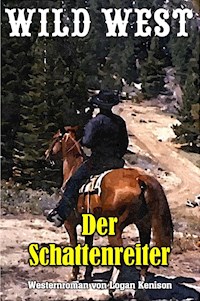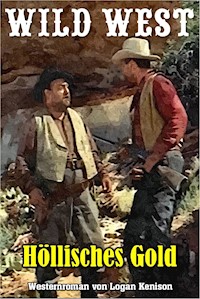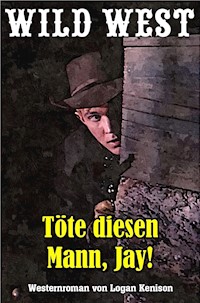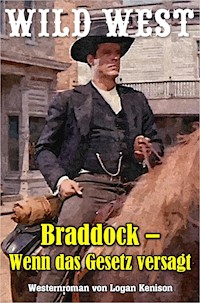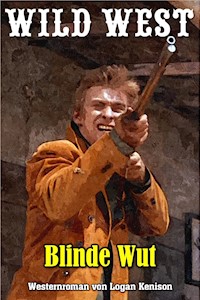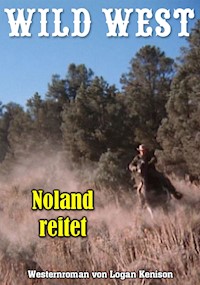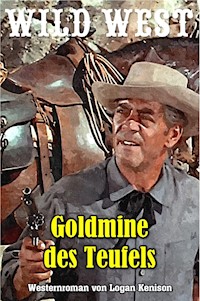
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über die verlorene Goldmine des Dutchman Jacob Waltz ranken sich viele Sagen und Gerüchte. Unzählige Männer sind aufgebrochen, um diese Goldmine in den Superstition Mountains zu suchen, denn es lockt unermesslicher Reichtum. Doch keiner war der Mine je näher als Daniel O'Hara... -- "Ein atmosphärisch dichter und spannend erzählter Western – wer wissen will, was es mit der ›Totengräberin‹ auf sich hat, sollte dieses Buch genießen. Es beruht übrigens auf wahren Begebenheiten." (Martin Barkawitz)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Goldmine des Teufels
Westernroman
von Logan Kenison
Das Buch
Über die verlorene Goldmine des Dutchman Jacob Waltz ranken sich viele Sagen und Gerüchte. Unzählige Männer sind aufgebrochen, um diese Goldmine in den Superstition Mountains zu suchen, denn es lockt unermesslicher Reichtum. Doch keiner war der Mine je näher als Daniel O’Hara...
»Ein atmosphärisch dichter und spannend erzählter Western – wer wissen will, was es mit der ›Totengräberin‹ auf sich hat, sollte dieses Buch genießen. Es beruht übrigens auf wahren Begebenheiten.« (Martin Barkawitz)
Lesermeinung
Ein Leser aus Arizona schreibt am 7. Oktober 2018 zu »Goldmine des Teufels«:
Eine gute Lese
Ich habe alle Bücher in der Logan Kenison Serie gelesen und diese ist mein Lieblings. Ich wohne in der Nähe der Superstition Mountains. Ich bin viele Male in der Superstition Wilderness gewandert. Die Legende des Lost Dutchman, Jacob Waltz, ist in Arizona gut bekannt. Diese Version der Geschichte ist sehr unterhaltsam und beschreibt richtig, wie verrückt mit Gier Menschen werden, wenn es die Aussicht schnell reich zu werden. Die Charaktere sind interessant, die Geschichte hält dein Interesse und das Ende ist zum Nachdenken anregend.
(5 Sterne)
Der Autor
Logan Kenison (vormals Joe Tyler) ist Autor von Western-, Abenteuer- und Spacegeschichten. Neben seinen Western, die er mit Leidenschaft verfasst, schreibt er seit 2018 die Reihe Spacewestern.
Inhalt
Impressum
Disclaimer
Goldmine des Teufels (Roman)
Weitere Titel von Logan Kenison
Erstausgabe 05/2015
Copyright © 2020 by Logan Kenison
Lektorat: Carola Lee-Altrichter
Abdruck auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Autors.
Das Cover wurde gestaltet nach Motiven der Episode »Hinrichtung im Morgengrauen« (Orig.: »Death at Dawn«, USA, 1960) der Bonanza-Komplettbox. Im Handel auf DVD erhältlich. Mit freundlicher Genehmigung von www.fernsehjuwelen.de
Disclaimer
Dieser Westernroman basiert auf wahren Begebenheiten. Die Namen einiger Personen und Orte wurden geändert.
Wer Gold liebt, wird mit Gold nicht gesättigt werden, noch jemand, der Reichtum liebt, mit Einkünften.
(nach Prediger 5:10)
Denn die Geldliebe ist eine Wurzel von schädlichen Dingen aller Arten, und indem einige dieser Liebe nachstrebten, sind sie vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst mit vielen Schmerzen überall durchbohrt.
(1. Timotheus 6:10)
Goldmine des Teufels
Logan Kenison
WIR ERWACHTEN am Morgen des 19. Februar 1891 nicht wie gewöhnlich. Nicht die frühen Vogelstimmen oder das Krähen unserer Hähne holten uns aus dem Schlaf, nicht das sanfte Murmeln des stets kraftlosen Salt Rivers oder die zärtliche Berührung eines liebenden Menschen.
Ein dröhnendes Getöse riss uns aus dem Schlaf!
Innerhalb eines Sekundenbruchteils wurde uns klar, dass etwas nicht stimmte. Das Haus wackelte, die Wände zitterten, Bilder fielen von den Wänden, Schränke wankten, Gläser klirrten. Für den Moment glaubten wir, das Ende der Welt wäre gekommen; ein Fauchen und Zischen, als fielen glühende Steine vom Himmel, doch als wir zu den Fenstern rannten, sahen wir ihn nur grau bedeckt, wie all die Tage zuvor.
Die Temperatur betrug 39° Fahrenheit (4° Celsius), und wir hatten unsere Kühe und Rinder draußen auf den Weiden. Die Farmer hatten Wintersaat im Boden, Kleingetier befand sich in den Gehegen oder lief, je nach Laune ihres Besitzers, frei umher.
Doch als wir nun aus den Fenstern blickten, erwartete uns nicht der gewohnte Anblick, sondern die völlige Zerstörung. Gewaltige Flutwellen waren ohne Vorwarnung durch das Flussbett herangewälzt und hatten alles niedergedrückt und mitgerissen.
Bäume – entwurzelt.
Hühnerställe, Scheunen, Häuser – zertrümmert.
Haustiere – trieben tot in den Fluten.
Jaulende Hunde wurden von den Wassermassen fortgerissen.
Flussbiegungen wurden einfach fortgewaschen, als wären sie Spielzeuge in der Hand eines Riesen.
Zur Haustür, die aufgesprungen war, weil sie dem Druck nicht mehr hatte standhalten können, spülten Wassermassen herein. Wohn- und Schlafräume füllten sich innerhalb zweier Sekunden. Haushaltsgegenstände schwammen bereits im schmutzig-braunen, schäumenden Wasser.
Die Kinder schrien in Todesangst. Wir Erwachsene brachten sie aufs Dach, und damit in Sicherheit. Von dort oben – noch in Schlafkleidung, denn zum Umziehen hatte uns die Zeit gefehlt – konnten wir beobachten, wie die Wassermassen unser Land und die Arbeit unserer Hände vernichteten.
Die Kinder schrien zunächst weiter, so laut und schrill, dass es uns in den Ohren klingelte. Doch dann klammerten sie sich aneinander, um sich zu wärmen und sich zumindest ein wenig vor dem eisigen Wind zu schützen, der unsere Nachtgewänder mühelos durchdrang.
Wir Erwachsenen standen da wie betäubt. Alles, was wir tun konnten, war zuzusehen. Hilflos zuzusehen, wie unsere Lebensgrundlage zerstört wurde. Es gab nichts, was wir tun konnten, nichts, gar nichts.
Wir sahen, wie in den Nachbarhäusern ums Überleben gekämpft wurde. Auch dort versuchte man, sich aufs Dach zu retten. Auch dort brachte man die Kinder in Sicherheit.
Was aus Fred Zimming wurde, weiß ich nicht. Er war fortgeschwemmt worden und tauchte nie wieder auf.
Bob Fabricant war ins Wasser gefallen. Er schaffte es mit Mühe zurück aufs Farmdach, und seine Söhne deckten ein paar Schindeln ab, durch die sie Decken heraufholten. Das rettete Bob das Leben, er wäre sonst an Unterkühlung gestorben.
Ada Summers und ihre Töchter hatten es geschafft, das nackte Leben zu retten. Ihr Kleinvieh hing in den Zäunen der Gehege – tot. Ihre Gemüsebeete waren verwüstet.
Oscar Simms und seine Frau steckten im Haus zwischen umgefallenen und festgekeilten Möbelstücken fest; wir fanden sie später und befreiten sie. An ihren Verletzungen wird sie noch wochenlang zu leiden haben.
Ed Poole hatte sich vors Haus gewagt und war gegen einen der Balken gestürzt, die sein Hausdach stützten. Er schlug so heftig mit Schulter und Schläfe gegen die spitzen Holzkanten, dass er bewusstlos wurde und ins Wasser glitt, das ihn gnadenlos überspülte. Wenige Schritte vor seiner Haustür ertrank er.
Von anderen hörten wir nur.
Sidney Heckler – tot.
Orel Cassell – tot.
Walton Youngs – vermisst.
Carey Selzak – verletzt.
Albion Polack – verletzt.
Und so ging es eine ganze Weile lang weiter.
Die Springflut war die schlimmste Naturkatastrophe, die uns im Salt River Valley getroffen hatte. Noch nie zuvor waren wir mit solchen Wassermassen konfrontiert gewesen, noch nie mit einem solchen Ausmaß von Zerstörung und Tod.
Das Wasser blieb nicht lange. Innerhalb weniger Tage lief es ab.
Zurück blieb ein Tal, in dem alle Bewohner ihre Existenzgrundlage verloren hatten. Alle Farmen, Ranches, Handwerksbetriebe waren zum Erliegen gekommen. Wohnhäuser, Scheunen und Ställe waren zerstört.
Doch dann setzte eine beispiellose Hilfsaktion ein. Die Jungen halfen den Alten, und die Alten halfen den Jungen. Alle Nachbarn halfen sich gegenseitig. Sogar die Einwohner von Phoenix kamen zu uns aufs Land heraus und halfen uns. Natürlich nicht beim Wiederaufbau – der wird erst in den kommenden Wochen und Monaten stattfinden können, wenn wir neues Bauholz und Werkzeuge erhalten haben. Doch sie halfen uns, indem sie uns von den Dächern holten oder aus den Trümmern unserer Häuser. Indem sie unsere Kranken verarzteten und uns in die Stadt schafften und uns dort Obdach anboten.
Auch wenn es zum Teil nur winzige Zimmer sind, in die sie ganze Familien stecken, sehen wir doch den Geist der Hilfsbereitschaft, den wir jetzt so verdammt nötig haben.
Gouverneur Irwin hat uns schnelle und unbürokratische Hilfe zugesichert. Wir hoffen auf Bauholz und Werkzeug. Wenn die Regierung uns hier etwas zur Verfügung stellt, wäre uns wirklich geholfen.
Ob es tatsächlich so kommt, werden wir abwarten müssen.
Doch wir hoffen es sehr.
Wir sind darauf angewiesen, dass man uns hilft. Denn sonst haben wir keine Lebensgrundlage mehr.
Gez. am 23. März 1891
William Frederick McNicholl
Phoenix, Arizona
*
WILLIAM McNICHOLL schrieb die letzten Zeilen seines Berichts in seinem Refugium, einem kleinen Zimmer über dem Al Kendrick’s Saloon in der Montezuma Street, in das gedämpft der Lärm der darunter liegenden Trinkstube drang. Es war beileibe keine große und komfortable Unterkunft, in der er und seine Familie sich hatten einquartieren können, doch sie hatten jetzt wenigstens ein Dach über dem Kopf und eine trockene und relativ saubere Schlafgelegenheit. Da er im Moment nichts für seine Farm tun konnte – dazu fehlten ihm schlichtweg die Mittel – hatte McNicholl den Job als Hausmeister für den Saloon und das dazugehörige Gebäude angenommen.
Nächste Woche würde er zu den Resten seiner Farm hinausmarschieren und sehen, welchen Aufwand der Wiederaufbau für ihn bedeutete, wie lange er dafür arbeiten müsste und was es ihn kostete. Danach wollte er das Büro der Stadtverwaltung aufsuchen und um Unterstützung ersuchen.
Den Bericht hatte er geschrieben, damit er später als Gedächtnisstütze dienen konnte – obwohl er nicht glaubte, dass er auch nur eines der grausigen Bilder jemals würde vergessen können.
Nun, nachdem er den letzten Federstrich gemacht, den Bericht nochmals gelesen und für gut befunden hatte, legte er den Federhalter beiseite und blickte zum Fenster hinaus. Draußen war gerade einer jener herrlichen Arizona-Frühlingstage zur Neige gegangen, die einem Beobachter pures Staunen abrangen, und hatte sich in einen wunderschönen Abend verwandelt. Die allgegenwärtige rötliche Farbe herrschte jetzt nicht nur im Sand und den Ziegeln der Adobegemäuer vor, sondern auch am Himmel. Die untergehende Sonne erstarb und tauchte alles in jenes blutrote Licht, welches für das Territorium Arizona so typisch war.
Von der Flutkatastrophe war hier nicht das Geringste zu erkennen. Das Leben ging weiter, als wäre sie nie vorgefallen: Männer drängten sich in die Saloons, während ein paar Frauen noch rasch letzte Einkäufe erledigten. Kinder spielten auf den Sidewalks und bei den Pferdetränken, und ein paar Hunde jagten sich gegenseitig die Straße hinab.
Von Süden kamen fünf Männer herangeritten – etwas abgerissen, verschwitzt und erschöpft, aber ziemlich unzufrieden und finster dreinblickend. Sie steuerten den Al Kendrick’s Saloon an. Keiner – nicht einmal William McNicholl, der sich die Zeit nahm, ihr Eintreffen vom Fenster aus zu beobachten und die Ankömmlinge genau zu studieren – wusste, was diese Männer dort draußen gemacht hatten.
Die Richtung, aus der sie kamen, mochte ein Indiz liefern, aber es war nicht mehr als ein äußerst schwacher Anhaltspunkt, und außer den verschmutzten Klamotten, den dreckstarrenden Stiefeln und den lehmverklebten Fellen ihrer Tiere deutete nichts auf die Art der Arbeit hin, der die Männer draußen nachgegangen waren.
Nun hielten sie vor dem Saloon und saßen ab, und als sie noch kurz im Kreis beisammenstanden und sich sehnsüchtig über die trockenen Lippen leckten, sagte ein Mann namens Ransom Biddle:
»Verdammte Scheiße, wir genehmigen uns jetzt einen! Aber du, O’Hara, du brauchst gar nicht erst mit reingehen! Deine Fresse kann ich nämlich nicht länger ertragen. Bleib also hier draußen und hüte die Pferde oder bohre in der Nase oder tu sonst was, nur belästige mich nicht mit deinem Anblick, wenn ich jetzt da reingehe.«
Der so derb angesprochene, auf den der Sprecher auch noch mit dem Zeigefinger deutete, war ein zwanzigjähriger blonder Bursche, der genauso verschmutzt war wie die anderen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil er sich aufopfernder durch Schlamm und Dreck gewühlt hatte.
»Lass’ den Kleinen in Ruhe, Ranse«, sagte Gunner Halverson, der Anführer des Trupps. Er war etwas über Vierzig, und sein Vollbart hatte bereits vor Jahren begonnen, eine graue Färbung anzunehmen. Da er sonst noch sehr agil und muskulös war, wirkte der graue Bart, der ein sonnengebräuntes Gesicht umrahmte, edel und ansehnlich. »Gewiss«, fuhr Halverson fort, »es war seine Idee. Aber sie hätte uns genauso gut ein paar Dollar einbringen können. Es ist ja nicht seine Schuld, dass die Bauerntölpel arme Schweine sind und wir in den Trümmern nicht das Geringste gefunden haben.«
Dass Halverson so unverhohlen für Daniel O’Hara Partei ergriff, missfiel Biddle, und er ballte die Fäuste. Es war klar, dass er nicht so rasch klein beigeben wollte. Andererseits suchte er nach einem Abgang, der seiner Person einigermaßen würdig war, ohne dass er einen Rückzieher machen musste, denn das war auch nicht gerade angenehm.
»Der mit seinen saudummen Ideen!«, stieß er daher noch einmal verächtlich hervor und spuckte zu Boden. Seine Ohren hatten zu glühen begonnen, ein Zeichen dafür, wie geladen er war. Ohne weiteres Wort wandte er sich ab und stapfte in den Saloon.
»Er hat sich an einem sägerauen Balken die Hand aufgerissen und ein paar Holzsplitter eingefangen«, versuchte Alfred Randall den Kameraden zu entschuldigen. Er klopfte Daniel auf die Schulter und sagte: »So schlecht war die Idee gar nicht. Konntest ja nicht wissen, dass wir rein gar nichts finden würden.« Er boxte eine spielerische Doublette gegen Daniels Oberarm, tänzelte ein paar Schritte von Daniel fort, tat dann, als stolpere er über den Absatz des Sidewalks und folgte Biddle lachend in den Saloon.
Halverson blickte Daniel kopfschüttelnd an. Daniel wusste die Geste nicht zu deuten: Galt sie Biddle und seinem Geschimpfe? Oder dem kindischen Getue, das Randall an den Tag legte? Beides war Daniel nicht ganz geheuer, denn er verabscheute das unablässige Genörgel Biddles so sehr, wie er Randalls Späße liebte.
Die »Idee«, die jetzt alle glaubten bewerten zu müssen, stammte tatsächlich von Daniel. Er hatte sich vorgestellt, dass in den Trümmern der Farmhäuser die Dollars nur noch eingesammelt werden müssten. Hatte gedacht, dass die Farmer und Handwerker im Salt River Valley jeder einen Sparstrumpf besaßen, den er irgendwo versteckt hielt. Und weil die Menschen das Gebiet verlassen hatten – die meisten waren in die Stadt gekommen, um ein Dach über dem Kopf oder ärztliche Hilfe zu bekommen – wäre es ein Leichtes gewesen, in den Trümmern nach den zurückgebliebenen Schätzen zu suchen und diese zu »heben«.
Doch das Ganze war ein einziger Fehlschlag gewesen. Nachdem sie stundenlang auf den Knien im Schlamm herumgerobbt waren, mit den Händen im Dreck gewühlt hatten, und sich schonungslos alle möglichen Häuser vorgenommen hatten, war ihnen klar geworden, dass die Bewohner gar keine Ersparnisse besaßen, die man ihnen hätte stehlen können.
Als diese neue Erkenntnis in ihren Gedanken Einzug hielt, waren sie schon durchnässt, durchfroren und ihre Kleidung stand vor Dreck. Sie hatten sich lächerlich gemacht, sich bis auf die Knochen blamiert, und zum Glück hatte kein Außenstehender etwas davon mitbekommen, denn mit dieser Pleite wollten sie nicht auch noch hausieren gehen; ihr Ruf wäre womöglich für alle Zeiten ruiniert gewesen. Auch dass es keine edle Sache war, die Notlage anderer auszunützen, um sich selbst zu bereichern, war Grund genug, mit keinem über den Schwachsinn zu reden, den sie heute dort draußen angestellt hatten.
Gunner Halverson wandte sich Daniel mit einem sparsamen Lächeln zu. Er sagte nur: »Ideen sind immer gut, Junge. Wenn du wieder eine hast, brauchst du dich nicht zu scheuen, sie mir zu erzählen.« Dann, ohne eine Erwiderung abzuwarten, wandte er sich ab und stieg die Stufe zur Saloontür hinauf.
Nun stand nur noch Alan Tamblin bei Daniel. Tamblin war Mitte Dreißig, ein meist schweigsamer Revolvermann, von dem man nie wusste, was er dachte. Wie alle anderen hatte auch er im Schlamm gewühlt und sah nun entsprechend verschmutzt aus. Er blickte nur stumm zu Daniel herüber – keine Geste, keine Freundlichkeit, keine Ablehnung –, bevor er sich in Bewegung setzte und im Saloon verschwand.
Daniel sah Tamblin nach, bis er außer Sichtweite war, dann seufzte er und lehnte mit dem Hintern gegen den Hitchrack, der bei seinem Gewicht bedrohlich nach hinten schwang.
Es war besser, wenn er jetzt nicht in den Saloon ging. Besser, er ließ Biddle in seinem schwelenden Zorn allein. Nachdem ein paar Biere und Whiskys geflossen waren, konnte sich die Stimmung bessern – oder aber sehr schnell in eine gewalttätige Atmosphäre umschlagen. Und Daniel wusste nur zu gut, dass er einem zornigen und alkoholgeschwängerten Biddle nichts entgegenzusetzen hatte.
Besser, er verbrachte den Abend irgendwo anders, nicht in Al Kendrick’s Saloon.
Er hatte schon einige Male mit dem Gedanken gespielt, die Mannschaft zu verlassen, doch wohin sollte er dann gehen? Diese Männer hatten ihn vor vier Jahren aufgenommen, als er, ein Vollwaise, niemanden auf der Erde mehr hatte. Diese Männer waren für ihn zu einer Art Familie geworden – wenngleich eine seltsame Familie –, mit Halverson als »Vater«, den Daniel ständig durch Ideen zu beeindrucken versuchte. Hatte er inzwischen Halversons Anerkennung errungen? Daniel wusste es nicht.
Sein Blick schweifte über die Häuserreihen. In vielen von ihnen waren die Opfer der Flut aufgenommen worden. Es hatte ein paar Tote gegeben, die man zum Boot Hill gebracht hatte. Andere waren einfach obdachlos geworden, und ihnen wurden Unterkünfte – zumeist einfache Kammern – zur Verfügung gestellt, bis sie wieder auf die Beine kamen.
Andere waren krank oder verletzt und siechten dahin – zu krank, um wieder auf die Beine zu kommen, oder zu alt, um nochmals von vorn anzufangen.
Drüben, bei Dessa Spellman, lag solch ein armer Teufel. Es hatte ihn bei der Flut schlimm erwischt, und er war mit einer schweren Lungenentzündung in die Stadt gebracht worden, wo Dessa sich bereiterklärt hatte, ihm zu helfen und ihn zu pflegen.
Daniel kannte Dessa Spellman; sie war Ende Dreißig und praktisch veranlagt. Ihr Mann hatte vor ein paar Jahren das Weite gesucht und sie mittellos zurückgelassen. Sie hoffte wohl auf ein paar Dollars, die ihr die Pflege des alten Mannes einbringen mochte. Aber vielleicht hoffte sie auch auf das große Geld.
Daniel kannte auch den alten Mann, der bei ihr untergebracht war. Sein Name war Jacob Waltz, und die Leute nannten ihn den »Dutchman« – eine Verballhornung und absichtlich falsche Verenglischung des Wortes »Deutschmann«. Über diesen Mann schwirrten eine Menge Gerüchte durchs Land. Angeblich sei er in Besitz einer gewaltigen Goldader, und Daniel würde sich nicht wundern, wenn Dessa es in Wirklichkeit auf diese Mine abgesehen hätte.
Nein, Daniel glaubte keine Sekunde, dass sie aus reiner Menschenfreundlichkeit und Nächstenliebe die Pflege des alten Mannes übernommen hatte. Und dass Waltz nicht mehr auf die Beine gekommen war, war kein Wunder, denn er war 81 und hatte stundenlang im eisigen Wasser ausharren müssen, bevor Helfer ihn hatten befreien können.
Daniel drehte sich eine dünne und wulstige Zigarette, die er selbst nur als völlig missraten bezeichnen konnte, und überlegte gerade, wie es Waltz wohl ergehen mochte. Da sah er Dessa aus dem Haus treten. Sie war eine kleine, mollige Person; keine besondere Schönheit, obwohl ihr rundliches Gesicht und die runden Formen auf manchen Mann durchaus attraktiv wirken mochten. Ihr Haar war nach hinten gekämmt und in einem Dutt zusammengeknotet. In der Armbeuge trug sie einen Einkaufskorb, eine Jacke hatte sie über die Schultern geworfen.
Daniel vermutete, dass sie noch Einkäufe erledigen wollte. Doch anstatt die Straße hinabzueilen und ein Ziel anzusteuern, blickte sie einen Moment zu Daniel herüber. Er nahm einen Zug von seiner kümmerlichen Zigarette, die mehr als alles andere nach verbranntem Papier schmeckte, weil er viel zu wenig Tabak in sie gepackt hatte, und erwiderte Dessas Blick gelassen. Noch war er zu keinem Entschluss gekommen, was er mit dem angebrochenen Abend anfangen sollte, als sie sich in Bewegung setzte und über die Straße zu ihm herüber kam.
»Gut, dass ich dich treffe, Danny«, begann sie ohne Gruß, »ich brauche deine Hilfe.«
Er blickte beinahe belustigt auf sie hinab. Dessa Spellman brauchte Hilfe? Von ihm? Sie war dafür bekannt, eine große Lippe zu führen, und ein paar Mal waren er und sie sich in ihrem Saloon, als sie ihn noch führte, wegen Kleinigkeiten in die Haare geraten. Doch das alles schien jetzt keine Rolle mehr zu spielen. Man kannte sich, und das war Grund genug, ihm einen Gefallen abzubitten.
»Na gut«, sagte Daniel, von oben in ihren Ausschnitt spähend, »was willst du?«
Dessa schob sich verschwörerisch nahe an ihn heran und raunte, als ob es niemand mitbekommen dürfe: »In meinem Haus liegt der alte Jacob Waltz. Ich glaube, er macht’s nicht mehr lange. Ich hatte noch keine Zeit, heute ein paar Dinge zu erledigen, und jetzt muss ich unbedingt noch Gemüse und Salat kaufen und zur Schneiderei und zur Post rüber. Kannst du eine Stunde auf den Alten Acht geben? Er hustet sich die Seele aus dem Leib, und ich möchte ihn ungern allein lassen.«