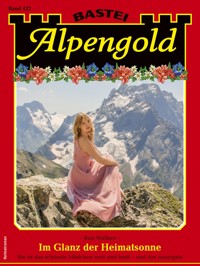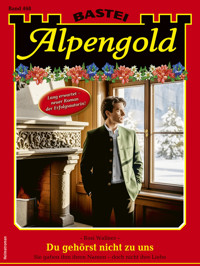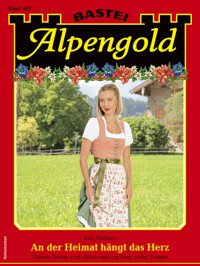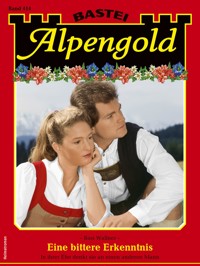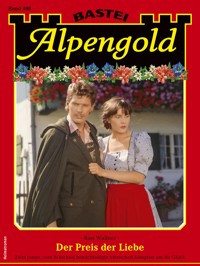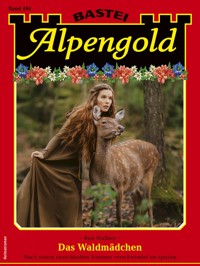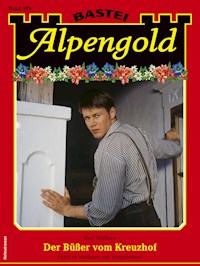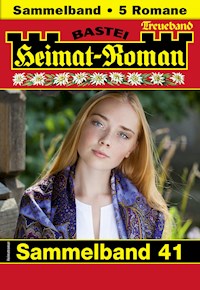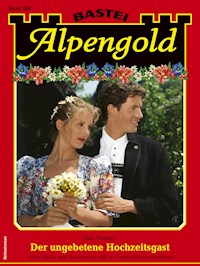5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Heimat-Roman Treueband
- Sprache: Deutsch
Lesen, was glücklich macht. Und das zum Sparpreis!
Seit Jahrzehnten erfreut sich das Genre des Heimat-Bergromans sehr großer Beliebtheit. Je hektischer unser Alltag ist, umso größer wird unsere Sehnsucht nach dem einfachen Leben, wo nur das Plätschern des Brunnens und der Gesang der Amsel die Feierabendstille unterbrechen.
Zwischenmenschliche Konflikte sind ebenso Thema wie Tradition, Bauernstolz und romantische heimliche Abenteuer. Ob es die schöne Magd ist oder der erfolgreiche Großbauer - die Liebe dieser Menschen wird von unseren beliebtesten und erfolgreichsten Autoren mit Gefühl und viel dramatischem Empfinden in Szene gesetzt.
Alle Geschichten werden mit solcher Intensität erzählt, dass sie niemanden unberührt lassen. Reisen Sie mit unseren Helden und Heldinnen in eine herrliche Bergwelt, die sich ihren Zauber bewahrt hat.
Dieser Sammelband enthält die folgenden Romane:
Alpengold 210: Das Häusl der Sünderin
Bergkristall 291: Die schöne Schwester des Wilderers
Der Bergdoktor 1777: Weint nicht um mich ...
Der Bergdoktor 1778: Dr. Burger und das Mauerblümchen
Das Berghotel 147: Vroni, die Quertreiberin
Der Inhalt dieses Sammelbands entspricht ca. 320 Taschenbuchseiten.
Jetzt herunterladen und sofort sparen und lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben
Für die Originalausgaben:
Copyright © 2015/2016/2017 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text und Data Mining bleiben vorbehalten.
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2023 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Covermotiv: © bedya / Shutterstock
ISBN: 978-3-7517-4695-3
https://www.bastei.de
https://www.sinclair.de
https://www.luebbe.de
https://www.lesejury.de
Heimat-Roman Treueband 52
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Alpengold 210
Das Häusl der Sünderin
Bergkristall - Folge 291
Die schöne Schwester des Wilderers
Der Bergdoktor 1777
Weint nicht um mich ...
Der Bergdoktor 1778
Dr. Burger und das Mauerblümchen
Das Berghotel 147
Vroni, die Quertreiberin
Guide
Start Reading
Contents
Das Häusl der Sünderin
Warum die Leut nicht an Luzias Unschuld glaubten
Von Rosi Wallner
Im Laden weiß man längst, was in der Nacht passiert ist, und als die Sarner-Bäuerin kommt, stürzen sich alle auf sie, um ihr das Furchtbare zu berichten.
»Alles verbrannt! Die ganze Hütte!« Die Augen der Bürgermeistersfrau glitzern. »Die Egnerin hat sich net retten können …!«
Elisabeth Sarner wird blass, bekreuzigt sich. »Und die Luzia?«, fragt sie atemlos. »Ist die am Leben?«
Die andere lacht böse. »Ich denk schon. Sie haben ja bloß die Alte gefunden. Die Luzia treibt sich wohl wieder im Wald herum. Die kommt schon wieder, die Hex! Wer weiß, was überhaupt passiert ist, da im Häusl der Egnerin!«
Elisabeth erschauert. Wie herzlos sie über das junge Mädchen reden! Wie grausam sie über Luzia richten, deren Leben nur aus Leid und Unglück bestanden hat!
»Ich muss nach ihr schauen«, murmelt Elisabeth, »muss ihr helfen …« Und entschlossen macht sie sich auf einen schicksalhaften Weg …
Als Elisabeth Sarner den kleinen Dorfladen betrat, verstummte für einen Augenblick die lebhafte Unterhaltung der Frauen, dann aber wandten sie sich ihr zu und sprachen auf sie ein.
»Hast du schon von dem Unglück gehört, Elisabeth? So was Furchtbares!«
»Und dass sie sich net hat retten können!«
»Ich bin eben erst ins Dorf gekommen und hab noch niemanden getroffen. Erzählt doch der Reih nach«, forderte Elisabeth die aufgeregten Frauen auf.
Lioba Lehnhofer, die Frau des Bürgermeisters, hielt es für ihr gutes Recht, das Wort zu ergreifen.
»Das Haus, oder besser gesagt, die Hütte von der alten Egnerin ist heut Nacht abgebrannt.«
»Jesses!« Elisabeth bekreuzigte sich unwillkürlich.
»Aber das ist noch net das Schlimmste. Die alte Egnerin ist net rechtzeitig …« Lioba verstummte, denn Elisabeth Sarner war erbleicht und schien zu schwanken.
»Und die Luzia? Ist die am Leben?«, fragte sie mit schwacher Stimme.
»Anscheinend! Man hat nur die Egnerin gefunden. Grauslich soll’s …«
»Man muss doch nach dem Madl schauen. Sie kann verletzt sein«, unterbrach Elisabeth Liobas Redeschwall.
»Die kommt schon wieder. Es ist ja net das erste Mal, dass sie sich tagelang in den Wäldern herumtreibt.«
Eine scharfe Antwort lag auf Elisabeths Zunge, doch sie unterdrückte sie, es war sinnlos, in Menschen wie Lioba Mitgefühl erwecken zu wollen. Wie viele der traditionsbewussten, bodenständigen Gebirgler grenzte sie alle aus, die sich nicht anpassten oder sich aus irgendwelchen Gründen nicht in die Dorfgemeinschaft einfügen ließen.
»Weiß man schon, wie der Brand entstanden ist?«, fragte sie nur.
»Angeblich konnte man nichts feststellen. Die Egnerin war schon was wunderlich, vielleicht hat sie net recht aufgepasst. Da hat sich das schnell!«
Niemand im Dorf hatte Marie Egner sonderlich gemocht. Manche nannten sie sogar eine bösartige alte Hexe, die ihre Enkelin so schlecht behandelte, dass sie immer wieder davonlief und sich so lange versteckte, bis der Hunger sie nach Hause trieb.
»Das erinnert mich irgendwie an den Brand beim Lehrer Hirrlinger. Da ist niemand zu Schaden gekommen, aber die Ursach hat man auch net herausgefunden«, bemerkte eine der Frauen, während sie ihre Einkäufe in einen geflochtenen Korb einräumte.
»Der Hirrlinger war damals fest davon überzeugt, dass da jemand gezündelt hat, um es ihm heimzuzahlen«, wusste Lioba zu berichten, die, was Dorfereignisse anbetraf, zuverlässiger als jede Chronik war.
»Wundern tät’s mich net! Dass der Hirrlinger Unterschiede macht, das weiß ein jeder. Wenn sich ein Bub von einem Kleinbauern was erlaubt hat, dann hat er gleich einen Rohrstock auf seinem Rücken zerdeppert. Aber die mit den reichen Eltern hat er net angerührt, das hat viel böses Blut gegeben! Auf die Luzia hat er es besonders abgesehen gehabt. Wie hat er sie immer genannt? Hexenbrut …«
Auf diese Worte folgte betroffenes Schweigen, keine der Frauen wagte auszusprechen, welcher Verdacht in ihnen aufkeimte. Schon gar nicht in Gegenwart von Elisabeth Sarner, deren Gerechtigkeitssinn geradezu sprichwörtlich war.
Zudem wollte es sich keine der Frauen, nicht einmal Lioba Lehndorfer, mit der Sarnerbäuerin verscherzen. Sie war nicht nur mit dem reichsten und mächtigsten Hofbauern in der Gegend verheiratet, sondern sie besaß auch eigenes Vermögen. Ihr Wort galt etwas in der Dorfgemeinschaft, und wenn jemand in Not geriet, war sie die Erste, die tatkräftigen Beistand leistete.
Da sich Elisabeths Gesicht verdüstert hatte, beeilte sich Lioba, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben.
»Ja, das sind traurige Sachen, aber zum Glück gibt es ja auch noch Erfreuliches wie der Verspruch von deinem Thomas mit der Ullmer-Brigitte. Ein schönes Paar. Und es passt auch alles zusammen, wie es sein soll für eine gute Ehe«, sagte Lioba schmeichlerisch.
Elisabeth unterdrückte ein Lächeln, sie wusste nur zu genau, worauf Lioba – nicht ohne Neid – anspielte. Thomas Sarner, Elisabeths einziger Sohn, hatte sich mit einer Nachbarstochter verlobt, die eine reiche Mitgift zu erwarten hatte.
In den Augen der Dörfler war das die beste Voraussetzung überhaupt für eine Eheschließung und machte sie noch unauflöslicher als jedes kirchliche Sakrament.
»Das wird sich erst zeigen, ob es eine gute Ehe wird«, meinte Elisabeth trocken, und eine steile Falte kerbte ihre Stirn.
»Wann soll denn die Hochzeit sein?«, fragte Lioba in unstillbarer Neugierde.
»Im Spätsommer, länger wollen sie net warten!«, gab Elisabeth bereitwillig Auskunft.
»Da haben’s auch recht, die beiden! Was zu lang reift, schmeckt am End gar nimmer«, meinte eine der jüngeren Frauen kichernd und erntete einige strafende Blicke.
Elisabeth wandte sich ihren Einkäufen zu und hörte nur noch mit halbem Ohr, was die Frauen zu schwatzen und zu tuscheln hatten, bis sich die Tür des Kramladens hinter ihr geschlossen hatte.
Freundlich, aber immer noch geistesabwesend erwiderte sie die Grüße der Dörfler, als sie mit eiligen Schritten die Straße entlangeilte.
Schlank und hochgewachsen bewegte sie sich immer noch mit der gleichen Anmut wie in ihrer Jugendzeit. Ihre ebenmäßigen Züge strahlten Freundlichkeit und Güte aus, aber auch innere Stärke. Obwohl sie fast siebenundvierzig war, zeigte sich keine graue Strähne in dem mattblonden Haar, das sie zu einem üppigen Knoten im Nacken zusammengefasst hatte.
Sie trug keinen Schmuck außer dem schmalen Ehering, und auch das dunkelblaue Leinendirndl ließ nicht vermuten, dass Elisabeth eine reiche Großbäuerin war. Doch gerade die Schlichtheit ihrer Kleidung hob Elisabeths Vorzüge noch mehr hervor.
Als Elisabeth die halbe Wegstrecke zum Sarnerhof zurückgelegt hatte, gönnte sie sich eine Ruhepause. Sie verweilte vor dem holzgeschnitzten Wegmarterl und sprach ein kurzes Gebet, ehe sie sich erneut bekreuzigte.
Dann ließ sie ihre Blicke über die Landschaft schweifen; zu den Häusern im Tal und über die sattgrünen Wiesen, die sich die Hänge emporzogen, bis sie vom Bergwald begrenzt wurden.
Sie nahm den Korb wieder auf, doch statt den Weg zum Sarnerhof einzuschlagen, stieg sie einen schmalen Pfad empor, der teilweise von Gestrüpp und überhängenden Ästen zugewuchert war.
Elisabeths Gedanken kreisten um das neue Unglück, das Luzia Egner getroffen hatte. Und sie machte sich die bittersten Vorwürfe.
»Kein Mensch hat sich um sie gekümmert, kein Mensch!«, murmelte sie vor sich hin.
Sie hatte das Mädchen seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen; sie wusste nur, dass Luzia immer noch mit der Großmutter zusammenlebte, obwohl diese sie schlechter behandelte als zuvor.
Elisabeth hatte Luzia als mageres, verschüchtertes Kind in Erinnerung, das zerlumpte Kleider trug und nicht einmal einen Schulranzen besaß.
Einmal hatte sie Luzia weinend an der Wegkreuzung vorgefunden, denn die rohen Dorfjungen – darunter auch ihr Sohn – hatten Luzia mit Lehmklumpen beworfen.
Ihre Kleidung war völlig verschmutzt, und sie traute sich offensichtlich nicht nach Hause.
Elisabeth nahm die Kleine mit zum Sarnerhof, badete sie und reinigte notdürftig ihre geflickten Kleider. Auch ein alter, aber gut erhaltener Schulranzen wurde gefunden, und dann packte Elisabeth selbst geräucherte Würste und Geselchtes zusammen.
Mit der schweigsamen Kleinen an der Hand war Elisabeth zu der Behausung der alten Egnerin aufgebrochen. Marie Egner hatte weder Überraschung noch Beunruhigung erkennen lassen, als Elisabeth die enge, stickige Stube betrat. Nachdem das Kind zum Spielen nach draußen geschickt worden war, legte die Bäuerin einen Umschlag mit Geld neben das umfangreiche Paket auf den Tisch.
»Das ist für dich und für das Kind. Kauf ihr ein paar anständige Sachen zum Anziehen! Es ist ja eine Schand, wie das Kind herumläuft!«
Marie Egner hatte ihr keine Antwort gegeben, sondern starrte sie nur aus trüben Augen an, sodass Elisabeth das Blut in die Wangen stieg.
»Egnerin, wenn man dir das Kind, wegnimmt, weil du es so verwahrlosen lässt, dann bist du hier im Dorf unten durch und kannst dir woanders eine Bleibe suchen! Dafür werd ich sorgen! Hast du verstanden?«
Dann hatte sich Elisabeth fluchtartig zum Gehen gewandt, um diesem leeren Blick zu entrinnen. Noch Stunden danach wütete der Zorn über die bösartige Halsstarrigkeit der Alten in Elisabeth.
Diese Szene trat wieder lebhaft vor Elisabeths Augen, als sie sich der abgelegenen Hütte näherte. Elisabeth glaubte inzwischen zu wissen, warum das Mädchen von seiner Großmutter so abgelehnt wurde.
Marie Egners Sohn hatte zu großen Hoffnungen Anlass gegeben; er war sehr begabt, und seine Mutter beeinflusste ihn darin, eine wohlhabende Frau zu heiraten. Doch als er Luzias Mutter, ein Mädchen aus bescheidenen Verhältnissen, kennenlernte, löste er sich von seiner ehrgeizigen Mutter und zog nach der Hochzeit mit seiner jungen Frau weg. Jahre später kam das Paar bei einem Unfall ums Leben, der von Luzias Mutter verursacht worden war.
Als Marie Egner die Umstände erfuhr, unter denen ihr Sohn zu Tode gekommen war, hätte sie, so erzählte man sich, die Schwiegertochter über das Grab hinaus verflucht. Und diesen Hass übertrug sie dann auf deren Tochter, die ihr schutzlos ausgeliefert war, obwohl Luzia doch auch ihr eigen Fleisch und Blut war.
Der Anblick der niedergebrannten Wohnstatt riss Elisabeth jäh aus ihren Gedanken; entsetzt blieb sie stehen. Von der Hütte war nichts mehr zu erkennen; nur rauchige Trümmer ragten empor, selbst der kleine Küchengarten war vollständig verwüstet.
Vorsichtig näherte sich Elisabeth der trostlosen Stätte in der Hoffnung, dass Luzia doch zurückgekehrt wäre. Sie umrundete mehrmals die brandgeschwärzten Überreste und wollte sich auf den Rückweg machen, als ein Wimmern an ihr Ohr drang.
»Luzia?« Sie folgte den Klagelauten, und schließlich fand sie das Mädchen hinter dichtem Gestrüpp verborgen, zusammengekauert auf einem umgestürzten Baumstamm; es wiegte sich hin und her, manchmal brach ein Stöhnen aus ihrem Mund.
»Luzia!«, rief Elisabeth sanft, doch das Mädchen nahm sie nicht wahr.
Elisabeth kniete sich nieder und nahm Luzia mütterlich in die Arme. Sie flüsterte ihr tröstliche Worte zu, die allmählich in ihr Bewusstsein drangen, denn sie kam langsam zur Ruhe und verstummte.
»Du kommst mit mir, Luzia! Hier kannst du net bleiben. Hab keine Angst.« Elisabeth erhob sich. »Komm, Luzia«, wiederholte sie, und das Mädchen ließ sich widerstandslos hochhelfen.
Es war ein mühsamer Weg zum Sarnerhof, denn Elisabeth musste das Mädchen stützen, und hin und wieder hielt sie sogar inne, wenn Luzia niederzusinken drohte.
Am Hoftor kam ihnen zu Elisabeths Erleichterung Thomas entgegen. Keinen Augenblick zu früh, denn Luzia verließen endgültig die Kräfte.
»Jesses! Was haben wir denn da?«, rief er erschrocken, nahm das Mädchen kurzerhand auf die Arme und trug es ins Haus.
»Trag sie nach oben in eine der leeren Kammern. Wir müssen gleich den Doktor holen«, wies seine Mutter ihn an.
Nachdem Thomas Luzia auf eine Bettstatt gelegt und die Tür hinter sich geschlossen hatte, wusch Elisabeth ihr behutsam das Gesicht und schälte sie aus der Kleidung.
»Was musst du durchgemacht haben, Madl«, entfuhr es Elisabeth, als sie dabei Spuren langjähriger Misshandlungen entdeckte. Lange, bläuliche Striemen zogen sich über den Rücken, die ihr von Marie Egner beigebracht worden waren.
Unwillkürlich ging es Elisabeth durch den Sinn, ob das Mädchen wohl nie den Versuch unternommen hatte, sich von der demütigenden Tyrannei ihrer Großmutter zu befreien, und sie erschauerte. Doch als sie Luzias Gesicht anblickte, zart und durchsichtig, da zerstob jeder Verdacht. Mit einem Instinkt der erfahrenen Frau erkannte sie die Unschuld und Arglosigkeit des Mädchens, das zu jenen Menschen gehörte, die es nie gelernt hatten, sich gegen die Bösartigkeit und Gemeinheit anderer zur Wehr zu setzen.
»Ich werd auf dich aufpassen«, murmelte Elisabeth und strich Luzia sacht die Haare aus der Stirn.
Es klang wie ein Schwur, und Elisabeth, der das Schicksal eine Tochter versagt hatte, war selbst überrascht über die Stärke der Zuneigung, die sie für Luzia Egner empfand.
***
»Na, was meint der Doktor? Was hat er wieder zu granteln gehabt?«, fragte Thomas, als seine Mutter die Stube betrat.
»Er ist gar net zufrieden. Das Madl hat einen schweren Zusammenbruch erlitten, aber das ist ja auch kein Wunder. Sie hat vorher schon genug aushalten müssen. Die Brandwunden sehen auch net gut aus«, erstattete seine Mutter Bericht.
Aufseufzend nahm sie am Mittagstisch Platz, der bereits für das Essen gedeckt war.
»Ist sie wieder zu sich gekommen?«, erkundigte sich Thomas voller Anteilnahme.
»Nur ganz kurz. Der Doktor hat ihr etwas gegeben, damit sie schlafen kann. Morgen schaut er wieder nach ihr.«
»Trinkst am besten einen Obstler auf den Schreck«, meinte Thomas.
»Hast recht, Bub, das könnt ich wahrlich brauchen«, sagte Elisabeth dankbar.
Voller Stolz umfasste ihr Blick den Sohn, der, schlank und hochgewachsen wie sie, an der Kredenz stand und zwei Obstler eingoss.
Thomas hatte auch ihr blondes Haar und die gleichmäßigen Züge geerbt, nur waren sie bei ihm schärfer geschnitten. Im Dorf spöttelte man, dass Linus Sarner bei der Entstehung seines Sohnes kaum mitgewirkt hätte, so sehr käme der auch im Wesen auf seine Mutter.
Sarner war jedes Mal sehr aufgebracht, wenn er derlei Anspielungen hörte, obgleich er allen Grund hatte, mit seinem Sohn zufrieden zu sein. Denn Thomas war nicht nur gut aussehend, sondern auch tüchtig und verlässlich; es stand außer Zweifel, dass er einmal ein guter Hofbauer werden würde.
Die Tür öffnete sich so heftig, dass Elisabeth zusammenzuckte, obwohl sie an die laute, polternde Art ihres Mannes gewohnt war.
»Weiß schon Bescheid! Was hast du denn da wieder ins Haus gebracht, Elisabeth?«, waren Sarners Begrüßungsworte.
Es klang, als spräche er von einer streunenden Katze, die seine Frau gesund pflegen wollte, und Elisabeth presste für einen Augenblick ärgerlich die Lippen aufeinander. In der Tat geschah es nicht selten, dass sich die Sarnerbäuerin ausgesetzter Tiere annahm, wobei sie bei ihrem Mann auf wenig Verständnis stieß.
»Das Madl hat kein Zuhaus mehr. Hätt man sie in dem Zustand sich selbst überlassen sollen?«, verteidigte Thomas sofort seine Mutter, was Sarner wie üblich noch mehr ergrimmte.
»Du bist genau wie deine Mutter! Weißt du net, was über das Madl geredet wird?«
»Nun lass gut sein, Linus!«, fiel ihm Elisabeth scharf ins Wort. »Geredet wird viel! Und jetzt essen wir erst mal, sonst werden die Krautknödel kalt.«
Dem hatte Linus nichts entgegenzusetzen, er knurrte nur etwas Unverständliches und ließ sich dann auf seinen Stuhl fallen. Seine Laune besserte sich allerdings, als die dampfenden Knödel vor ihm standen.
Die Sarners waren ein schönes Paar, das zwar äußerlich gut zusammenpasste, sich aber innerlich weit voneinander entfernt hatte.
Auch Linus Sarner hatten die Jahre nicht viel anhaben können; er war groß und breitschultrig, und das markante Gesicht mit den dunklen Augen beeindruckte noch immer. Nur um seinen volllippigen Mund, der einen Hang zur Sinnenfreude verriet, hatte sich mit der Zeit ein verkniffener Zug eingegraben.
Es war zudem ein offenes Geheimnis, dass Sarner es mit der ehelichen Treue nicht sehr genau nahm, wobei es ihm aber gelungen war, sich nie in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen.
Wie Elisabeth dazu stand, blieb allen verborgen, denn sie klagte nie und schien sich noch nicht einmal Hochwürden anzuvertrauen.
Man nahm jedoch an, dass sie sehr wohl über die Umtriebe ihres Mannes Bescheid wusste, aber aus Klugheit darüber hinwegsah, wie es nicht wenige Frauen tun. Die Dörfler respektierten diese Haltung – die Ehe war eine Sache, ein Seitensprung eine andere.
Nach dem Essen, als das Ehepaar allein war, kam es zur unvermeidlichen Auseinandersetzung, denn Elisabeth gehörte nicht zu den Frauen, die sich unterordnen und ducken.
»Schaff das verwahrloste Weibsbild aus dem Haus! Mit der haben wir nichts zu tun, mit dem Gesindel!«, forderte Sarner ungehalten.
Elisabeth, die gerade den Tisch abräumte, hielt inne und sah ihren Mann kühl an.
»Das hast net du allein zu bestimmen! Die Luzia muss erst wieder zu Kräften kommen, dann sehen wir weiter. Und red net so von ihr!«, erklärte sie bestimmt.
Es war diese Kühle, die ihn so an ihr reizte, diese Überlegenheit, gegen die er nicht ankam. Seiner Meinung nach trieb ihn Elisabeth dadurch in die Arme anderer Frauen, und er gab ihr die Schuld an dem Scheitern ihrer Ehe.
»Auf unseren guten Ruf nimmst wohl gar keine Rücksicht!«, gab er heftig zur Antwort. An seiner Schläfe pochte eine Zornesader, und am liebsten hätte er einen Teller ergriffen und ihn am Boden zerschmettert. Aber Elisabeths Reaktion auf Ausbrüche dieser Art hatte ihn gelehrt, gegen seinen Jähzorn anzukämpfen.
»Sprichst du von deinem guten Ruf? Meinst du net auch, dass …«
Linus wartete nicht ab, bis sie den Satz zu Ende gesprochen hatte, er stürmte wutentbrannt aus dem Raum und schlug krachend die Tür hinter sich zu.
Elisabeth seufzte auf und ließ sich auf einen der Stühle sinken. Sie stützte den Kopf in die Hand, und eine tiefe Traurigkeit ergriff Besitz von ihr. Es war einer jener Augenblicke, in denen sie bitter bereute, dass sie so blutjung und so überstürzt geheiratet hatte.
Elisabeth war gerade achtzehn gewesen, als Linus Sarner sie mit leidenschaftlicher Ausdauer umworben hatte. Unerfahren, wie sie war, konnte sie sich der starken Ausstrahlung des gut aussehenden jungen Hofbauern nicht entziehen. Ohne sich über Sarners Charakter ein Bild zu machen, willigte sie schon nach kurzer Zeit in die Heirat ein. Sie sah sich auch in ihrem Entschluss noch dadurch bestätigt, dass die Ehe von allen Seiten gutgeheißen wurde. Denn alles schien zu passen – beide hatten reiche Großbauern als Väter und befanden sich nach Ansicht der Eltern im richtigen Heiratsalter.
Die erste Zeit der Ehe war voller Glückseligkeit, besonders nachdem sie einem Sohn das Leben geschenkt hatte. Doch allmählich zeigte sich, dass Linus und Elisabeth sich im Grunde genommen völlig wesensfremd waren. Immer größer wurde die Kluft zwischen ihnen, bis sie selbst durch die Leidenschaft, die sie anfangs so verbunden hatte, nicht mehr zu überbrücken war.
Es kam immer häufiger zu erbitterten Auseinandersetzungen, da Linus erwartete, dass sich seine Frau widerspruchslos seinem Willen unterwarf.
Es dauerte nicht lange, bis Elisabeth herausfand, dass er angefangen hatte, sie zu betrügen. Und da es nicht bei einer einmaligen Verfehlung blieb – die hätte sie verzeihen können –, hatte Elisabeth bald jedes Vertrauen in ihren Mann verloren. So sehr sie sich auch für ihn schämte, niemals ließ sie sich etwas anmerken, niemals hätte sie zugelassen, dass man sie für ihr Unglück bemitleidete.
Der Hofhund, von irgendetwas in seinem Schlaf gestört, bellte plötzlich wütend, und Elisabeth schrak auf. Sie durfte sich nicht diesen düsteren Gedanken überlassen, die sie nur mutlos machten und ihr alle Tatkraft nahmen.
Entschlossen erhob sie sich; aus Erfahrung wusste sie, dass ihr lediglich die Arbeit über dunkle Stunden hinweghalf und sie ihr inneres Gleichgewicht wiederfinden ließ.
***
Elisabeth hatte die Vorhänge in Luzias Krankenzimmer zurückgeschoben, und helles Morgenlicht flutete in den Raum.
»Wie geht es dir heut, Luzia?«, fragte sie freundlich.
Das Mädchen hatte die Augen aufgeschlagen und blickte verwirrt um sich.
»Du bist auf dem Sarnerhof, Luzia. Ich hab dich gestern hierhergebracht.« Elisabeth betrachtete sie, betroffen von der eigenartigen Schönheit des Mädchens. Ihr Äußeres würde den Gerüchten, die über sie in Umlauf waren, nur noch neue Nahrung geben, davon war Elisabeth überzeugt.
Wie Flammen züngelten die üppigen rötlich braunen Locken um das ovale Gesicht, das von großen ernsten Augen unter fein gezeichneten Brauen beherrscht wurde. Ihre Haut zwar von einem matten milchigen Weiß, was den Reiz noch erhöhte.
Elisabeth beschlich ein banges Gefühl. Würde Luzia, wie vielen Frauen vor ihr, ihre Schönheit zum Verhängnis werden? Vor allen Dingen, wenn sie mit Unschuld und Wehrlosigkeit gepaart war?
Plötzlich verzerrte sich Luzias Gesicht, und sie stieß einen Wehlaut aus; offensichtlich kehrte die Erinnerung zurück.
»Die Großmutter!«, brachte sie mühsam hervor. »Sie ist …«
Sie wollte sich aufrichten, doch Elisabeth drückte sie sanft in die Kissen zurück.
»Du erinnerst dich an alles?«
Luzia nickte heftig. Ohne Aufforderung begann sie zu schildern, was sich zugetragen hatte.
»Der Großmutter ging es net gut. Dann schimpft sie immer über meine Mutter und schlägt mich. Ich lauf dann immer in den Wald.«
»Was hat deine Großmutter getan, als du aus dem Haus gegangen bist?«
»Sie hat vor dem Bild meines Vaters gesessen und eine Kerze angezündet. Es war sein Geburtstag, und sie hat den Rosenkranz für ihn gebetet.«
»Sie hat eine Kerze angezündet?«, wiederholte Elisabeth nachdenklich.
»Einmal ist ihr eine Kerze ganz heruntergebrannt, und sie hat es net gemerkt. Ich bin damals grad noch rechtzeitig dazugekommen«, fuhr das Mädchen fort.
»Könnt es net wieder so gewesen sein?«
»Sie hat sich sehr elend gefühlt, schon seit Tagen, auch wenn sie es nie zugegeben hätt!« Luzia fing an zu schluchzen, stoßweise und qualvoll, dass es Elisabeth ins Herz schnitt. »Warum bin ich net früher zurück? Ich konnt sie nimmer herausholen. Es ist meine Schuld!«
»Es ist net deine Schuld! Du hast alles versucht, schau dir nur deine Hände an!«, sprach Elisabeth auf das Mädchen ein.
»Und dann – ich kann mich nimmer entsinnen, was ich dann getan hab. Ich muss im Wald umhergelaufen sein …«
»Weißt du, was ich glaub, Luzia? Dass deine Großmutter einen Herzanfall gehabt hat und schon nimmer am Leben war, als der Brand ausgebrochen ist. Du hast ja gesagt, dass sie sich schlecht gefühlt hat, sie war wohl schon lang nimmer gesund. Niemand hätt sie retten können, Luzia. Du darfst dir keine Vorwürfe mehr machen, hast du gehört?«
Diese mit Entschiedenheit gesprochenen Wörter verfehlten nicht ihre Wirkung auf das Mädchen. Luzia entspannte sich und ließ sich etwas von der Brühe einflößen, die Elisabeth für sie zubereitet hatte. Dann aber sank ihr Kopf zur Seite, und sie fiel in den tiefen Schlaf der Erschöpfung.
Elisabeth verweilte noch einen Augenblick und zog die Bettdecke zurecht. Sie verspürte große Erleichterung, denn so, wie Luzia das Geschehen dargestellt hatte, gab es keinen Zweifel daran, dass es sich um einen tragischen Unglücksfall handelte.
***
Als Elisabeth später wieder nach Luzia sah, erschrak sie; die Wangen des Mädchens waren fieberheiß, es wälzte sich unruhig im Bett hin und her und stieß wirre Laute aus. Elisabeth rief sie an, doch Luzia erkannte sie nicht.
Der herbeigerufene Arzt stellte ein schweres Nervenfieber fest, schloss auch nicht aus, dass es sich um eine beginnende Lungenentzündung handelte.
»Das gefällt mir gar net«, murmelte er mehrmals. »Sie ist überhaupt in einer elenden Verfassung. Man könnt meinen, sie hätt net genug zu essen bekommen. So was hab ich noch nie gesehen.«
Als er die Spuren der Misshandlungen nochmals untersuchte, musste er gewaltsam an sich halten, um seiner Empörung nicht freien Lauf zu lassen. Unten in der Stube konnte er sich dann nicht länger beherrschen.
»Ich hab immer geahnt, dass da etwas net stimmt! Deshalb hat die Alte mich auch nie geholt, auch wenn die Luzia tagelang in der Schule gefehlt hat! Damit ich net dahinterkommen sollt, was sie mit ihr anstellt! Jetzt mach ich mir die größten Vorwürf. Man hätt der Egnerin das Kind nie überlassen dürfen!«
»Das Schicksal hat es wahrlich net gut gemeint mit der Luzia. Erst verliert sie die Eltern, und dann muss sie bei einer solchen Großmutter leben. Wenn sie sich nur jemandem anvertraut hätt«, sagte Thomas voller Mitgefühl.
Auch Linus Sarner, der bislang geschwiegen hatte, zeigte sich nicht gänzlich unberührt.
»Wird sie davonkommen? Sie ist doch noch blutjung«, fragte er den Arzt.
»Na ja, es geht ihr halt gar net gut«, antwortete dieser ausweichend.
Elisabeth sah nun den rechten Augenblick gekommen.
»Wenn die Luzia die Krankheit übersteht, würd ich sie gern auf dem Hof behalten. Die Leni will eh gehen, um im Geschäft ihrer zukünftigen Schwiegerleut mitzuhelfen. Dann hätt die Luzia ein Zuhause, und ich wär froh, wieder jemanden zu haben, der mir bei der Wirtschaft hilft. Und das Madl könnt dann auch allmählich auf eigenen Beinen stehen, denn was hat’s denn schon groß bei seiner Großmutter gelernt«, sagte Elisabeth, ohne in die Richtung ihres Mannes zu blicken.
»Das wär das Beste überhaupt für das Madl. Ein Glück, dass es noch solche wie dich gibt, Sarnerbäuerin!«, meinte der Arzt.
Elisabeth errötete; ein Lob aus dem Mund des bärbeißigen Doktors bedeutete viel.
Auch Thomas fand diesen Vorschlag gut, nur Linus Sarner, der sich übergangen fühlte, zog die Brauen zusammen und sagte kein Wort.
Erst als sich der Dorfarzt verabschiedet und mit seinem altersschwachen Gefährt geräuschvoll den Hof verlassen hatte, wandte er sich an seine Frau.
»Das hast du mal wieder schlau eingefädelt«, knurrte er.
Elisabeth zog es vor, nicht zu antworten. Sie stellte ihm stattdessen ein Glas mit Obstler hin, ein Friedensangebot, das er nach kurzem Widerstreben annahm.
***
»Grüß dich, Schatzerl. Wirst ja jedes Mal, wenn ich dich seh, noch hübscher!«
Thomas Sarner fasste Brigitte Ullmer um die Taille und schwenkte sie übermütig herum, bis sie lachend um Gnade bat. Er gab sie frei, und Arm in Arm gingen sie den verschwiegenen Waldweg entlang, wo sie sich ungestört küssen konnten.
Brigitte Ullmer, die zukünftige Sarner-Bäuerin, war in der Tat ein auffallend hübsches Mädchen. Mit den blonden Locken, die ein herzförmiges Gesicht mit großen hellblauen Augen und einem niedlichen Mündchen umgaben, entsprach sie dem Geschmack vieler Männer.
Sie liebte es, sich herauszuputzen, was Thomas gefiel, da er annahm, dass sie es um seinetwillen tat. Alles, was sie tat oder sagte, gefiel ihm, denn er war zum ersten Mal in seinem Leben heftig verliebt.
Brigitte plauderte unbefangen, und selbst dem lächerlichen Klatsch lauschte der verliebte junge Mann begierig, weil er aus ihrem Munde kam.
Plötzlich hielt sie inne.
»Sag mal, was hab ich da gehört? Die Luzia soll bei euch auf dem Hof bleiben?«
»Findest du das net gut, dass sich die Mutter so um sie kümmert?«, fragte Thomas. »Eine Zeit lang sah es so aus, als würd sie nimmer gesund. Jetzt meint der Doktor, dass sie sich bald wieder erholt. Sie ist aber noch so schwach, dass sie net aufstehen kann. So ein armes Hascherl!«
Brigitte hatte den Kopf gesenkt, sodass Thomas ihren Gesichtsausdruck nicht erkennen konnte.
»Deine Mutter ist viel zu gutmütig und lässt sich ausnützen. Das weiß ein jeder! Und jetzt muss sie sich auch noch so eine ins Haus holen.«
»Was heißt denn so eine?«, fuhr Thomas auf.
»Ach, die alte Egnerin war doch eine bösartige alte Hexe, und der Apfel fällt net weit vom Stamm. Eine richtige Schand waren sie fürs ganze Dorf, die Egnerin und die Luzia. Wie eine Lumpenliesel ist’s immer herumgelaufen, das verdruckste Ding!«
Auf Thomas’ Stirn erschien eine tiefe Kerbe.
»Dafür kann die Luzia doch nichts, dass ihre Großmutter sie so schlecht gehalten hat. Und verdruckst ist sie auch net; sie hat halt immer nur Angst gehabt, dass man sie wieder verspottet oder ihr sonst was antut! Zu meiner Schand muss ich sagen, dass ich da auch mitgemacht hab. Einmal haben wir sogar mit Lehmklumpen nach ihr geworfen. Das tut mir heut noch leid.«
Brigitte zuckte gleichmütig mit den Schultern und bog geringschätzig die Mundwinkel nach unten.
»So sind Kinder halt. Mich tät an deiner Stell’ viel mehr stören, dass die jetzt unter einem Dach mit euch lebt. Ich kann deine Mutter net verstehen. Jeder weiß doch, was man über die Luzia redet im Dorf. Wenn es brennt, dann ist die bestimmt net weit.«
»So ein Schmarrn!«, fiel ihr Thomas ungewohnt grob ins Wort. »Davon ist überhaupt nichts bewiesen!«
Brigitte, die es nicht gewöhnt war, dass jemand – und schon gar nicht der nachgiebige Thomas in diesem Ton mit ihr redete, bekam schmale Augen.
»Wo Rauch ist, da ist auch Feuer! Und wenn man sich mit solchen wie der Luzia abgibt, wird man nur in Sachen verwickelt, mit denen unsereins nichts zu schaffen hat!«
»Das musst du schon meiner Mutter überlassen, die hat sich noch nie in jemandem getäuscht«, erwiderte Thomas heftig.
»Ach ja – dein liebes Mutterl!«
Brigitte dehnte diese Worte so höhnisch, dass Thomas vor Verärgerung das Blut in die Wangen schoss. Er liebte seine Mutter sehr und reagierte arg empfindlich, wenn jemand ungerechtfertigt Kritik an ihr übte. Und mochte er noch so verliebt sein – auch Brigitte war es nicht gestattet, in diesem Ton über seine Mutter zu sprechen.
»Hast du was gegen meine Mutter? War sie net immer freundlich zu dir und hat dich mit offenen Armen aufgenommen?«, entgegnete Thomas also mit unerwarteter Angriffslust, die Brigitte, die nicht töricht war, sofort in ihre Schranken verwies.
»Natürlich nichts! Ich kann froh sein, solche Schwiegerleut wie deine Eltern zu bekommen. Ich mein halt nur, dass es mich auch etwas angeht, wenn die Egner-Luzia weiterhin auf dem Hof bleiben soll. Ich mag net mit ihr unter einem Dach leben, das steht fest.«
»Und wo soll sie deiner Meinung nach hin, die Luzia? Sie hat doch niemanden.«
»Das ist doch net meine Sach, oder?«, erwiderte Brigitte hart.
»Du denkst wohl nur an dich!«
Die beiden jungen Leute, die eben noch zärtliche Liebkosungen ausgetauscht hatten, standen sich unvermittelt wie erbitterte Feinde gegenüber.
Brigitte warf ihre Lockenpracht, die golden aufschimmerte, hochmütig in den Nacken und funkelte ihren Verlobten voller Zorn an.
»Wie redst du denn mit mir? Das lass ich mir net gefallen! Und wenn du’s genau wissen willst: Ich denk net an mich, ich denk an uns! Ich will die Egner-Luzia net in unserer Näh’ haben! Es gibt Menschen, die nur Unglück bringen, und so eine ist die Luzia. Hat sie net schon Unfrieden zwischen uns gestiftet? Wegen ihr haben wir doch angefangen zu streiten!«
Thomas starrte das Mädchen an und schüttelte nur verständnislos den Kopf.
»Brigitte, ich versteh dich net! Ich hätt net gedacht, dass du so abergläubisch bist! Die Luzia bringt net Unglück, sie hat großes Unglück gehabt – mehr als andere Leut in ihrem ganzen Leben.«
»Nenn es halt Aberglauben, Thomas, das ist mir gleich. Jedenfalls will ich, dass sie noch vor der Hochzeit verschwindet«, beharrte das Mädchen eigensinnig.
»Das musst du mit meiner Mutter ausmachen; noch ist sie die Sarner-Bäuerin«, erwiderte Thomas kühl.
»Dann pass nur auf, dass sie es net noch arg lang bleibt«, gab Brigitte heftig zurück.
Das Paar legte die letzte Wegstrecke zum Ullmerhof schweigend zurück; jeder war zu gekränkt und auch zu stolz, um ein versöhnliches Wort zu finden.
Thomas verspürte eine eigentümliche innere Kälte und Leere; es war, als ob ein Schleier vor seinen Augen zerrissen und er zu einer Erkenntnis gelangt war, die nur schmerzlich und quälend für ihn sein konnte.
Brigitte kam ihm mit einem Mal wie eine Fremde vor, das Band der Vertrautheit war plötzlich zerrissen, und Brigitte erschien ihm wie eines jener selbstsüchtigen und eitlen Mädchen, von denen er sich immer ferngehalten hatte.
Schließlich wandte sie ihm das Gesicht zu, doch ohne ihm in die Augen zu blicken.
»Also, pfüat dich! Denk noch mal über die ganze Sach nach, das tät nichts schaden!«, sagte sie schnippisch. Sie küsste ihn nicht und blickte auch nicht zurück, als sie den Hof überquerte und in dem stattlichen, breitgelagerten Wohnhaus des Ullmerschen Anwesens verschwand.
Sonst hatte sie ihn immer zum Vesper eingeladen, und er hatte danach noch mit ihren Eltern bei einem Glas Wein in der Stube zusammengesessen. Die Ullmers waren mit der Wahl ihrer Tochter hochzufrieden, und zwischen Thomas und ihnen herrschte ein gutes Einvernehmen.
Langsam machte Thomas kehrt und ging gedankenverloren zum Sarnerhof zurück. Schließlich versuchte er sich gut zuzureden, um seine Enttäuschung niederzukämpfen. Es war doch nichts Besonderes, wenn sich Verliebte auch einmal stritten. Sie mussten lernen, darauf einzugehen; ihr Zusammenleben würde auch nicht nur aus Küssen und leidenschaftlichen Umarmungen bestehen.
Doch er empfand dumpf, dass es um mehr ging, als um eine oberflächliche Auseinandersetzung, und er wagte es nicht, das, was noch verborgen war, auszuloten.
»Was machst denn du für ein Gesicht? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen?«
Thomas schrak zusammen, als er von der Stimme eines jungen Mannes, der nachlässig gegen einen Baumstamm lehnte, aus seinen Grübeleien gerissen wurde. Er war verärgert; auf sich selbst und auch auf den anderen, weil er zugelassen hatte, dass dieser ihn ungestört beobachten konnte.
»Na, auch wieder im Lande, Florian?«, fragte er sein Gegenüber mit erzwungener Freundlichkeit.
Florian Murner ließ eine frisch geschälte Gerte durch die Luft zischen und lächelte. Es war ein Lächeln, das seine Augen nicht erreichte.
Er wäre ein sehr gut aussehender Mann gewesen, wenn es nicht diese Linien, die ungewöhnlich für einen so jungen Menschen waren, gegeben hätte. Auch sein Lächeln, spöttisch und wissend, lag wie festgefroren auf seinen Zügen; es erhellte sein Gesicht nicht, verzerrte es vielmehr auf merkwürdige Weise.
»Schon länger«, gab er einsilbig zur Antwort.
Dann blickte er Thomas eindringlich, fast prüfend an, als wollte er sich jede Einzelheit dieses Gesichtes einprägen, und wieder befiel Thomas ein ungutes Gefühl.
Thomas wusste, dass Florians Mutter vor einiger Zeit gestorben war. Ihr Sohn war in seinen Geburtsort zurückgekommen, um sie zu beerdigen.
Zur nicht geringen Überraschung aller war er anschließend geblieben, und niemand konnte sich erklären, was ihn hier hielt. Er bewohnte das heruntergekommene kleine Haus seiner Mutter, und sein Verhalten gab den Dörflern Rätsel auf.
Resi Murner war zu ihrer Zeit eine Dorfschönheit gewesen, die vielen Burschen den Kopf verdreht hatte. Sie bediente im Dorfwirtshaus, und obwohl sie nichts mitbrachte, hatte sich ihr nicht nur einmal die Gelegenheit geboten, sich gut zu verheiraten. Doch sie schlug alle Angebote in den Wind.
Dann wurde der kleine Florian geboren, und niemand wusste, wer sein Vater war. Danach begann sie sich langsam zu verändern, bis es zum völligen Niedergang kam.
Zuerst vernachlässigte sie sich, dann fing sie an, immer mehr zu trinken, zunächst heimlich, dann in aller Öffentlichkeit. Aus dem blühenden jungen Mädchen wurde eine haltlose Frau, die überall auf Verachtung stieß.
So wuchs der kleine Florian halb verwahrlost und ungeliebt auf und lernte es früh, da er Hohn und Spott ausgesetzt war, sich zu wehren. Seine harten Fäuste und seine scharfe Zunge verschafften ihm Respekt. Freunde hatte er keine, was ihm nichts auszumachen schien, er war von Kind an undurchschaubar und einzelgängerisch.
So früh wie möglich verließ er das Gebirgsdorf, tauchte nur gelegentlich auf, und niemand wusste genau, was er trieb.
Umso verwunderlicher war es, dass er, der Ruhelose, nach dem Tod der Mutter dablieb, das Haus herrichtete und sich sogar um den verwilderten Garten kümmerte.
Er hatte sich nirgends nach Arbeit umgesehen, und wenn die Frage auftauchte, womit er seinen Lebensunterhalt bestritt, war man auf Vermutungen angewiesen.
Wohlmeinende waren der Auffassung, dass seine Mutter eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen hatte, von der er nun zehrte. Das wurde allgemein bezweifelt, denn woher hätte die Resi das Geld für die Beiträge nehmen sollen? Es war schon unklar, wovon sie sich ernährt hatte, denn in den letzten Jahren war sie nicht mehr imstande gewesen zu arbeiten.
Dies alles ging Thomas durch den Sinn, und er musterte Florian genauer. Der junge Murner war schlicht, aber ausnehmend gut und nicht ohne Geschmack gekleidet. Er strahlte eine gewisse Ungebundenheit und ein Selbstbewusstsein aus, das eher an einen wohlhabenden Städter denken ließ als an einen Dorfbewohner, der von seiner Hände Arbeit leben musste.
Eigentlich hätte sich Thomas jetzt mit ein paar nichtssagenden Worten verabschieden können, aber irgendetwas, das er sich nicht erklären konnte, hielt ihn fest.
»Es tut mir leid wegen deiner Mutter«, sagte er etwas unbeholfen.
Keine Regung zeigte sich auf Florians Gesicht, seine Fingerspitzen glitten prüfend über die Gerte, als wollte er gleich von ihr Gebrauch machen.
»Sie war eine verlorene Seele, meine Mutter. Das geborene Opfer!«, entgegnete er dann gleichmütig.
Thomas war über diese Antwort so verwundert, dass er nicht nachfragte, was genau Florian damit meinte, denn offensichtlich spielte der nicht allein auf die Trunksucht seiner Mutter an.
So nickte Thomas nur und verzichtete auf die üblichen leeren Phrasen.
»Es sind grad mal vier Männer und ein paar neugierige Klatschweiber zur Beerdigung gekommen, die falsch gesungen und noch viel falscher vor sich hingeflennt haben. Was für ein Ende!«
Die nüchterne Kälte, der spöttische Unterton in Murners Stimme berührten Thomas eigenartig. Doch gleich darauf fuhr Florian in veränderter Sprechweise fort.
»Aber etwas Sonderbares ist geschehen. Etwas ganz Sonderbares!« Florian widmete seine ganze Aufmerksamkeit der Gerte, liebkoste sie geradezu. »Als ich am nächsten Morgen zum Friedhof ging, um nach dem rechten zu schauen, lagen über dem ganzen Grab meiner Mutter Rosen verstreut, als wär’s ein Brautbett.«
Florian verstummte, und ein undeutbares Lächeln glitt über seine Züge.
»Hast du eine Ahnung, wer das gewesen sein kann?«, fragte Thomas verwirrt.
»Die Rosen stammen net von hier, das ist sicher. Derjenige muss nachts über die Friedhofsmauer geklettert sein, damit er sie in aller Heimlichkeit auf das Grab tun konnte.«
»Sonderbar, man hat gar nichts von der Sach gehört. So etwas spricht sich doch schnell herum«, wandte Thomas ein, der den Vorfall von der romantischen Seite sah.
»Dafür hab ich schon gesorgt, dass es net dazu kommen konnte. Vor mir war wohl noch keiner dort gewesen. Ich hab die Rosen eingesammelt und in eine Jauchegrube geworfen!«
»In eine Jauchegrube?«, wiederholte Thomas ungläubig. »Jemand hat deiner Mutter etwas Gutes …«
»Dazu war es zu spät!«, fiel ihm Thomas Murner hart ins Wort. »Viel zu spät!«
Dann jedoch klang seine Stimme wieder beherrscht; er warf die Gerte ins Gebüsch und löste sich aus seiner bequemen Haltung.
»Schön war’s oben! Hab einen langen Gang hinter mir. Das lernt man erst schätzen, wenn man eine Zeit lang weg war, als Kind nimmt man das alles gar net richtig wahr.«
Thomas konnte sich nicht enthalten zu fragen: »Was hast du eigentlich vor? Gehst du wieder zurück in die Stadt?«
Florians Miene war undurchdringlich.
»Ich werd ein paar Dinge in Ordnung bringen, dann seh ich weiter«, sagte er nur.
Er sah plötzlich Thomas mit einem Blick an, der ihn zu durchbohren schien, und obwohl er weder Hass noch Feindseligkeit widerspiegelte, sondern eher etwas unbarmherzig Forschendes, wich Thomas zurück.
Doch das dauerte nur Sekundenbruchteile, dann schienen sich Florians grüne Augen zu verschleiern. Er hob die Hand und wandte sich zum Gehen.
»Pfüat dich, Thomas. Wirklich schön heroben. Werd mich wohl öfters hier ein bisserl umschauen. Und grüß deine Eltern.«
»Pfüat dich«, murmelte Thomas und schaute ihm nach, bis er mit weit ausholenden Schritten um die Wegbiegung verschwunden war. Er beschloss, einen Umweg zu machen, um daheim unliebsamen Fragen über seine ungewöhnlich frühe Rückkehr auszuweichen. Er hatte nicht vor, etwas über die Auseinandersetzung mit Brigitte verlauten zu lassen, damit mussten sie beide allein fertig werden.
Eigenartigerweise beschäftigte ihn die Begegnung mit Florian Murner inzwischen weit mehr als der Streit mit Brigitte, den er im Nachhinein als kindisch abtat.
Florian Murner – als sie noch Kinder waren, hatte nichts Fremdes, keine Feindseligkeit zwischen ihnen bestanden. Thomas hatte den Jüngeren insgeheim für seinen Mut und seine Unverfrorenheit bewundert.
Als er sich einmal schützend vor Florian gestellt hatte, der von einer Überzahl raufwütiger Dorfjungen bedrängt wurde, belohnte ihn Murner dafür mit einem schmerzhaften Tritt vor das Schienbein. Denn Florian wollte keine Hilfe und keinen Schutz; er biss sich allein durch, wie es sich mehr als einmal gezeigt hatte.
Thomas hatte sich von da an nicht mehr um ihn gekümmert, und er war schon im Begriff gewesen, ihn zu vergessen, bis sein unerwartetes Auftauchen alte Erinnerungen wieder lebendig werden ließ.
Und plötzlich empfand Thomas die Gegenwart Florian Murners als etwas Bedrohliches.
Darüber sann er nach, als er quer über die Wiesen und Felder schritt; unklar fühlte er, dass etwas Fremdes, Unbestimmbares in seine vertraute, wohlgeordnete Welt eingedrungen war.
***
»Was hast du denn, Thomas? Schaust ja ganz blass aus«, sagte seine Mutter besorgt, als er in die Stube trat.
Seine Eltern, die sonst immer recht früh zu Bett gingen, waren noch auf. Elisabeth sah von einem schadhaften Leinentuch hoch, das sie mit sorgfältigen kleinen Stichen wieder herrichtete.
Linus saß über den Rechnungsbüchern und murmelte geistesabwesend vor sich hin, sodass er den Eintritt seines Sohnes kaum wahrnahm.
»Ich hab jemanden getroffen, und irgendwie war das ganz seltsam«, sagte Thomas mit belegter Stimme und nahm am Tisch Platz.
Elisabeth hielt inne und steckte die Nähnadel fest, um dem Sohn ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit schenken zu können.
»Wen hast du getroffen, und was meinst du mit seltsam?«, fragte sie, als er zögerte.
»Den Florian Murner; es war ganz in der Nähe«, gab Thomas Auskunft.
Bei der Nennung dieses Namens hob auch Linus Sarner den Kopf.
»Er soll im Haus seiner Mutter wohnen«, warf Elisabeth ein, sichtlich erleichtert, dass es sich um nichts Schlimmeres handelte.
»Er hat mir etwas erzählt, und wenn ich es mir recht überleg, dann hat er es mit voller Absicht getan. Ich weiß nur net warum, und das gefällt mir net an der Sach.«
»Spann uns net auf die Folter, sag schon!«, forderte ihn seine Mutter nachdrücklich auf.
»Es ging um seine Mutter, das heißt um ihre Beerdigung. Jemand hat in der Nacht Rosen auf ihr Grab gelegt. Lauter rote Rosen wären es gewesen.«
Elisabeth lächelte in wehmütiger Rückerinnerung.
»Die Resi war mal ein so schönes Madl und hatte viele Verehrer. Vielleicht war es einer, der net vergessen konnt, wie sie früher gewesen ist.«
»Das hab ich auch gedacht. Aber der Florian hat die Rosen alle weggeräumt und fortgeworfen.«
»Das ist net recht.« Linus Sarner war aufgefahren, und seine Stimme klang so eigenartig, dass Frau und Sohn ihn erstaunt anstarrten.
»Das ist wirklich net recht, dass er das einer Toten net gönnt!«, wiederholte er, und seinem Gesicht war keine Gefühlsregung abzulesen.
»Das find ich auch. Aber er hat gesagt, dass das jetzt zu spät wär«, meinte Thomas.
Linus Sarner murmelte etwas Unverständliches und versenkte sich wieder in seine Rechnungsbücher.
»Das kann man ihm eigentlich net verdenken, wenn er so etwas sagt«, überlegte Elisabeth und stand unvermittelt auf, ohne das Leinentuch ordentlich zusammenzulegen.
»Ich hab noch Schmalzgebackenes, wenn du davon was haben willst, Thomas«, lenkte sie das Gespräch auf Alltägliches zurück.
Nur zu gern folgte Thomas seiner Mutter in die warme Geborgenheit der Küche; er merkte jetzt erst, wie hungrig er war, weil er nichts zu Abend gegessen hatte. Er ließ es sich schmecken, und Elisabeth, die ihn, während sie geschäftig herumhantierte, heimlich beobachtete, atmete erleichtert auf.
»Wie geht es der Luzia?«, fragte er, als sein Hunger gestillt war.
»Sie macht große Fortschritte. Endlich kommt sie zur Ruhe; vorher kann sie auch net richtig gesund werden. Und wenn sie dann lernt, auf eigenen Füßen zu stehen, wird ein anderer Mensch aus ihr.«
Thomas schob nachdenklich den Teller von sich.
»Du magst sie wohl sehr gern, die Luzia, gell?«, fragte er leise.
»Ja, das stimmt. Trotz allem, was sie hinter sich hat, ist sie net falsch und verbogen. Und sie tät keinem Menschen etwas zuleid, obwohl sie so schlecht behandelt worden ist, das arme Hascherl.«
Thomas schwieg. Die Mutter würde sich niemals damit einverstanden erklären, Luzia wegzuschicken, so wie Brigitte es verlangte.
Es versetzte ihm auch einen Stich, dass seine Mutter sich überhaupt nicht nach Brigitte erkundigte; Luzia, dieses armselige kranke Wesen, schien ihr mehr zu bedeuten als die zukünftige Frau ihres Sohnes, auf die sie im Alter doch einmal angewiesen sein würde.
Er hütete sich wohl, diese Gedanken laut auszusprechen; er erhob sich, lobte das Schmalzgebackene und küsste seine Mutter liebevoll auf die Wange.
Bedrückt ging er zu Bett, und als er endlich eingeschlafen war, wurde er von wirren Träumen gequält.
Florian Murner ging auf ihn zu und warf ihm die Rosen vom Grab seiner Mutter vor die Füße, und sein Blick schien ihn zu versengen. Brigittes vor Zorn schrille Stimme gellte dazwischen, doch er konnte die Worte nicht verstehen, die sie ihm entgegenschrie.
Schweißgebadet wachte Thomas vor der Zeit auf und lag benommen da, während das erste Grau der Morgendämmerung durch die Spalten der Fensterläden sickerte.
***
Auf dem Ullmerhof hing der Haussegen schief. Es hatte damit begonnen, dass Ambros Ullmer sich darüber wunderte, dass Thomas nicht wie üblich am Abendessen teilgenommen hatte, wenn er sich mit Brigitte traf.
Brigitte druckste mit einer Erklärung herum, bis ihre Mutter besorgt nachfragte.
»Sag mal, habt ihr euch am End gestritten? Das ist doch sonst net seine Art. Und wenn er keine Zeit gehabt hätte, dann hätt er wenigstens hereingeschaut, der Thomas.«
Brigitte presste die Lippen zusammen und stocherte mürrisch in ihrem Essen herum.
»Soll’s geben bei den jungen Leuten. Die müssen sich eben zusammenraufen«, meinte Ambros.
Ihre Eltern hätten es dabei belassen, wenn Brigittes ganzer aufgestauter Groll nicht plötzlich hervorgebrochen wäre.
»Die Egner-Luzia soll auf dem Hof bleiben! Weil die Sarnerin mal wieder die heilige Elisabeth spielen will, darum dreht sich’s!«, stieß sie giftig hervor.
»Na, mir tät das auch net gefallen. Aber so ist die Sarnerin halt«, meinte Lena Ullmer, die grobschlächtige Frau mit derben Gesichtszügen, gleichmütig.
Niemand konnte sich erklären, wie die Ullmers zu so einer hübschen Tochter gekommen waren, und darin war wohl auch der Grund zu sehen, warum Brigitte als Kind so verwöhnt und zum Leidwesen ihres älteren Bruders immer bevorzugt worden war.
»Sie muss sie wegschicken, sonst …«
»Was sonst, Brigitte? Willst du sonst net den Thomas heiraten?«, fragte der Vater eher scherzhaft.
Als Brigitte aber verstockt schwieg, wurde er unvermittelt ernst und sah sie forschend an.
»Was geht da in deinem Kopf vor, Brigitte? Du wirst dich doch wegen so einer Sach net mit dem Thomas zerstreiten! Einen besseren Mann findest du nimmer, und damit mein ich net nur, dass er mal den größten Hof in der Gegend erbt. Also nimm deinen Verstand zusammen und verrenn dich net in was, das dir später leidtut!«
Es war ungewöhnlich, dass sich Ambros Ullmer, ein eher wortkarger Mann, zu einem solchen Redeschwall hinreißen ließ, doch er kannte den Eigensinn seiner Tochter zur Genüge. So fielen seine Ermahnungen auch jetzt nicht auf fruchtbaren Boden.
»Da geb ich net nach! Als seine zukünftige Frau kann ich verlangen, dass der Thomas …«
»Gar nichts kannst du verlangen! Du heiratest auf den Sarnerhof ein, und da kannst du von Glück sagen! Die Sarners haben immer noch das Heft in der Hand, denn mit gerade mal zweiundfünfzig geht der Linus bestimmt net aufs Altenteil! Du tätest besser daran, dich mit deinen zukünftigen Schwiegerleuten gutzustellen, als den Thomas gegen seine Eltern aufzuhetzen!«, herrschte ihr Vater sie an.
»Und ich brauch dir ja net zu sagen, wie sehr der Thomas an seiner Mutter hängt«, fügte Lena hinzu, die sich ausnahmsweise nicht schützend vor ihre Tochter stellte.
Brigitte bedachte sie mit einem bösen Blick.
»Als ob ich das net gemerkt hätt! Ein richtiges Muttersöhnchen ist er!«
»So schlimm ist’s nun auch wieder net! Der Thomas ist tüchtig und fleißig, und treu ist er auch. Aber das scheint bei dir ja net zu zählen!«
Ambros’ Stimme hatte sich erhoben, und seine Frau, die die bedrohlichen Vorzeichen zu deuten wusste, forderte die Tochter schnell auf, ihr beim Abräumen behilflich zu sein. In der Küche ließ sie dann ihrem Unmut freien Lauf und hielt die Tochter, die schnell aus der Tür schlüpfen wollte, mit harter Stimme zurück.
»Du bleibst da! Was fällt dir eigentlich ein? Dein Vater hat ganz recht! Als ich hier eingeheiratet hab, war das auch net der Himmel auf Erden. Obwohl ich eine ordentliche Mitgift mitgebracht hab. Meine Schwiegermutter«, Lena Ullmer bekreuzigte sich, »führte ein strenges Regiment. Sie war seit Langem Witwe und ließ sich von keinem dreinreden, auch net von ihrem eigenen Sohn. Ich konnt ihr nichts recht machen, auch wenn ich mich abgerackert hab den ganzen Tag und der Hoferbe auch net lang auf sich warten ließ. Das war eine harte Zeit, denn ans Überschreiben hat sie net im Traum gedacht.
Das wär noch lang so weitergegangen, wenn sie net von heut auf morgen plötzlich an einem Schlaganfall gestorben wär.«
»Das sind doch alte Geschichten«, sagte Brigitte gelangweilt.
»Ich weiß schon, warum ich dir das erzähl. Die Sarnerin mag sein, wie sie will, aber schikanieren wird sie dich net. Und dafür kannst du dankbar sein. An deiner Stelle würd ich den Mund halten und net versuchen, einen Keil zwischen den Thomas und seine Mutter zu treiben!«
Als Brigitte keine Antwort gab, fuhr die Ullmer-Bäuerin begütigend fort: »Und am End wirst du sehen, dass sich alles findet. So eine wie die Luzia, die nichts mitbringt und nichts gelernt hat, bildet sich bestimmt bald ein, dass sie in der Stadt besser dran ist. Die bleibt net lang auf dem Hof, die ist doch das Arbeiten gar net gewöhnt.«
»Meinst du?« Brigittes Gesicht hatte sich aufgehellt, und ein boshaftes Lächeln umspielte ihre Lippen. »Und wenn net, dann kann ich ja nachhelfen. Schöne Tag mach ich der ganz bestimmt net.«
»Aber bis zur Hochzeit musst du klug sein und dich zurückhalten. Die Sarners sind eben …« Die Ullmerin suchte nach einem passenden Ausdruck, aber Brigitte verstand sie auch so.
»Wenn’s halt sein muss«, meinte sie unlustig. »Ich geh jetzt hoch.«
Dieses Mal hinderte Lena ihre Tochter nicht daran, den Raum zu verlassen, denn Brigitte war ihr sowieso keine große Hilfe; sie stellte sich, ob mit Absicht oder nicht, denkbar ungeschickt an.
»Ich schlag drei Kreuze, wann das Madl unter der Haube ist«, murmelte sie vor sich hin.
Sie musste sich allerdings eingestehen, dass sie nicht unschuldig daran war, dass sich ihre Tochter auf diese Weise entwickelt hatte. Lena war so vernarrt in das niedliche Kind gewesen, dass sie Brigitte ständig herausputzte und sie nie zu etwas anhielt.
Brigitte hatte kein Interesse daran gehabt, einen Beruf zu erlernen, aber auch gegen Hausarbeit hatte sie eine große Abneigung. Sie legte ihre Trägheit nur ab, wenn es um Kleider oder Vergnügungen ging.
Lena konnte sich kaum vorstellen, wie ihre Tochter einmal den vielfältigen Aufgaben einer Hofbäuerin gewachsen sein sollte. Schon jetzt schämte sie sich insgeheim für Brigitte, und sie nahm sich vor, ihre Tochter in der kurzen Zeit, die noch bis zur Hochzeit verblieb, energisch auf ihre Pflichten vorzubereiten.
Brigitte indessen machte sich darüber überhaupt keine Sorgen; sie war davon überzeugt, dass sie ihr bisheriges bequemes Leben fortsetzen könnte.
Allerdings hatte ihr der heutige Tag vor Augen geführt, dass nicht alles so einfach gehen würde, wie sie es sich ausgemalt hatte.
Brigitte schob diese unerfreulichen Gedanken beiseite und widmete sich wieder den Plänen für das Fest. Eine große Bauernhochzeit im traditionellen Stil sollte es werden. Schon ihr Brautkleid sollte alles bisher da gewesene in den Schatten stellen, und sie sah schon die missgünstigen Mienen der Dorfmädchen vor sich, wenn sie am Arm ihres Bräutigams zum Altar schritt.
Voller Eifer verglich sie die Abbildungen von Brautkleidern, die sie in der letzten Zeit gesammelt hatte. Sobald sie sich für eines entschieden hatte, verwarf sie es bald darauf wieder, weil es ihr doch nicht prächtig genug erschien. Vielleicht sollte sie doch noch einmal die umfangreichen Alben bei der Schneiderin durchblättern.
Mit diesem Entschluss ging sie zu Bett, und bevor sie einschlief, dachte sie noch flüchtig daran, dass sie sich wieder mit Thomas versöhnen musste. Leicht würde sie es ihm aber nicht machen …
***
Thomas war sehr unglücklich über das Zerwürfnis, und in seiner blinden Verliebtheit gab er sich zuletzt selbst die Schuld daran. Bei dem Ruf, den die alte Egnerin im Dorf hatte, konnte man es Brigitte nicht verdenken, wenn sie in deren verwahrloster Enkelin eine Gefahr erblickte.
Und war es nicht natürlich, dass Brigitte auf seine Mutter eifersüchtig war? Als seine zukünftige Frau durfte Brigitte den ersten Platz in seinem Herzen beanspruchen, er aber hatte sofort Partei für seine Mutter ergriffen.
Wie viele junge Leute, die vor der Hochzeit mit Eigenschaften des geliebten Menschen konfrontiert werden, die sie nicht wahrhaben wollen, hoffte auch Thomas, dass sich mit der Eheschließung alles zum Besseren wenden würde.
Aufgezogen von einer liebevollen Mutter, die allgemein als vorbildlich galt, hatte er die Vorstellung, dass alle Frauen so wie sie sein müssten. Niemals hätte er eine Frau mit Arglist oder Täuschung in Verbindung gebracht, selbst in Resi Murner sah er nur ein bedauernswertes, irregeleitetes Geschöpf.
So verbrachte er die nächsten Tage in größter Unruhe; Brigitte ließ nichts von sich hören, was er nicht als Taktik, sondern als tiefe Gekränktheit auslegte.
Plötzlich befiel ihn die Furcht, sie könnte sich trotz aller Hochzeitspläne doch noch von ihm trennen, eine Vorstellung, die er als unerträglich empfand. Er sehnte sich nach ihren Küssen, nach dem rauschhaften Glücksgefühl, das ihn immer überkam, wenn sie sich in seine Arme schmiegte.
Schließlich überwand er seinen Stolz und ging eines Abends nach Einbruch der Dämmerung zum Ullmerhof. Er schalt sich einen Feigling, weil er verstohlen um das Anwesen herumschlich, statt wie sonst durch die Vordertür einzutreten. Doch er hätte es nicht ertragen können, wenn Brigitte ihn vor den Hofleuten mit Vorwürfen überhäufen würde, eine Zurückweisung hätte er nicht hinnehmen können.
Schließlich blieb er unterhalb ihres Kammerfensters stehen. Er hob ein paar kleine Kieselsteine und warf sie gegen die Scheibe, es prasselte so laut, dass er sich unwillkürlich erschrocken umsah.
Zunächst – es kam ihm wie eine Ewigkeit vor – tat sich nichts, dann aber öffnete sich das Fenster, und Brigitte schaute heraus.
»Was willst du?«, fragte sie kurz angebunden und alles andere als freundlich.
»Dass wir uns wieder vertragen. Ich wollt dich net kränken. Wir müssen halt noch mal über alles reden«, beschwor Thomas sie.
Brigitte gab zunächst keine Antwort. Offensichtlich war sie gerade im Begriff gewesen, zu Bett zu gehen, denn sie trug ein leichtes Nachtgewand, das im Dämmerlicht hell schimmerte. Sicherlich unabsichtlich hatte sie die obersten Knöpfe nicht geschlossen, und als sie sich weiter vorbeugte, wurde der Ansatz ihrer vollen weißen Brüste sichtbar.
Eine heiße Lohe flammte in Thomas empor, und er konnte die Augen nicht von ihr wenden. Ein kleines Lächeln, das aber sofort wieder verschwand, spielte um Brigittes Mund. Doch Thomas hatte es trotzdem wahrgenommen, und wenn auch seine Leidenschaft nicht erlosch, so löste es dennoch sehr widersprüchliche Empfindungen in ihm aus.
»Treffen wir uns wieder wie sonst?«, fragte er mit heiserer Stimme.
»Vielleicht«, gab Brigitte zurück und schloss hart das Fenster.
Thomas blieb lange stehen, dann trat er schließlich den Heimweg an. Er hatte immer noch das verführerische Bild vor Augen, das Brigitte in dem leichten Hemd geboten hatte, und heißes Verlangen erfüllte ihn. Bald würde sie seine Frau sein, und er dürfte sich ungehindert ihrer Schönheit erfreuen.
Doch dazwischen schlichen sich andere Gedanken ein, Gedanken, die seine romantischen Träume zunichtezumachen drohten.
Hatte Brigitte mit Absicht seine Leidenschaft entfacht, indem sie sich ihm so darbot? Spielte sie mit ihm und ließ ihn ihre Macht spüren, damit er ihr in allem nachgab?
Thomas blieb stehen und strich sich verwirrt über die erhitzte Stirn. Wie konnte er so hässlich über die Frau denken, die er liebte und mit der er sein Leben verbringen wollte?
Niedergeschlagen beschleunigte er seine Schritte und atmete auf, als er den Sarnerhof vor sich sah. Es war ihm, als könnten ihm sein Zuhause und die vertraute Umgebung die innere Sicherheit, die ins Wanken geraten war, wiedergeben.
Als er sich am nächsten Tag mit klopfendem Herzen ihrem üblichen Treffpunkt näherte, wartete Brigitte schon auf ihn. Ungestüm riss er sie in die Arme und küsste sie leidenschaftlich. Als sie wieder zu Atem kamen, flüsterte er ihr Liebesbeteuerungen ins Ohr, die ihr zu Herzen gingen und ihren Trotz dahinschwinden ließen.
Sie schworen sich, es nie wieder so weit kommen zu lassen, dass sie im Streit auseinandergingen. Brigittes Einsicht und Nachgiebigkeit zerstreuten Thomas die Bedenken, die ihn jetzt mit Scham erfüllten.
Der Frieden war wiederhergestellt zwischen ihnen, und falls doch ein Stachel in Thomas’ Herzen zurückgeblieben war, so spürte er ihn jetzt in der Freude über die Versöhnung nicht.
***
»Das kann ich net annehmen, Bäuerin. So schöne Sachen!«, sagte Luzia fast flüsternd.
Bewundernd strich sie über die weichen Stoffe der Kleidungsstücke, die Elisabeth Sarner vor ihr auf dem Bett ausgebreitet hatte, nachdem sie einer sorgfältigen Musterung unterzogen worden waren.
»Aber Kind. Das sind Kleider, die ich längst beiseitegelegt hab, weil ich halt nimmer so rank und schlank wie früher bin! Dir müssten sie passen, mit ein paar Veränderungen natürlich. Schließlich brauchst du was zum Anziehen!«
Luzia nickte zögernd; der Brand hatte ihr nichts von ihrem ohnehin geringen und armseligen Kleiderbestand gelassen. Selbst das, was sie am Leib getragen hatte, war stark in Mitleidenschaft gezogen worden.
»Zieh mal diesen Rock an, Luzia. Die beiden Blusen passen dazu.«
Gehorsam schlüpfte sie in einen weit schwingenden dunkelblauen Leinenrock, der mit Zierlitzen geschmückt war, und in eine weiße Bluse mit angebauschten Ärmeln.
»Nur den Saum musst du kürzen, und am Bund könnt er ein bisserl enger sein, du mageres Spatzerl, dann schaut er tadellos aus. Die Sachen sind ja net aus der Mode.«
Elisabeth steckte mit flinken Händen den Saum höher und betrachtete dann zufrieden ihr Werk.
»Das ist schon besser.«
Auch zwei Dirndl und ein Trägerrock ließen sich verwenden, sodass Luzia vorläufig ganz ordentlich ausstaffiert war, vielleicht würden sich sogar noch passende Sandalen finden.
»Der Rock gefällt mir«, sagte Luzia schüchtern.
»Er steht dir auch gut. Bist ein sauberes Madl, Luzia«, meinte Elisabeth neidlos.
Sie wusste, dass sie damit untertrieb, denn das Mädchen war eine Schönheit, die alle anderen im Tal in den Schatten stellen würde. Die Blässe, die noch von ihrer Krankheit herrührte, unterstrich Luzias Reiz nur noch, ließ ihre ebenmäßigen Züge wie gemeißelt erscheinen. Obwohl sie die üppigen Haare geflochten und im Nacken züchtig zusammengesteckt hatte, wirkte sie auffallender als jede aufwendig herausgeputzte Großbauerntochter.
Und plötzlich befiel Elisabeth eine große Beklemmung, eine Vorahnung, dass es zu Verwicklungen führen könnte, wenn dieses schöne Mädchen mit ihnen unter einem Dach lebte.
Elisabeth kannte genau die Schwächen ihres Mannes, wusste, wie leicht entflammbar er war, auch wenn noch nie ein Wort darüber über ihre Lippen gekommen war. Nun fürchtete sie, dass er nicht davor zurückschrecken würde, Luzia, deren Jugend und Unschuld sie noch unwiderstehlicher machten, zu verführen.
Doch gleichzeitig empfand Elisabeth, dass dieses gedemütigte, vom Schicksal geschlagene Mädchen trotz allem eine Festigkeit des Wesens, eine innere Stärke besaß, die sie dazu befähigten, sich auch gegen die Versuche eines skrupellosen Mannes zur Wehr zu setzen.
»Kommst du mit runter? Es ist Zeit für das Essen«, forderte Elisabeth das Mädchen auf, denn es war inzwischen kräftig genug, um an den gemeinsamen Mahlzeiten teilzunehmen.
Luzia errötete, und ihre Hände, die eben noch umsichtig ein Kleidungsstück zusammengelegt hatten, begannen zu zittern.
»Ich weiß net. Ich möcht erst noch den Rock säumen. Aber wenn du es willst, Bäuerin …«
»Lass nur. Du willst sicher erst etwas zum Anziehen fertighaben, das kann ich verstehen. Ich schau auch noch nach Schuhen, nachher bring ich dir was hoch.«
Luzia nickte dankbar, ohne aufzublicken; es war spürbar, wie sich ihre innere Anspannung wieder löste. Elisabeth erkannte mit Besorgnis, wie menschenscheu Luzia inzwischen geworden war, auch mochte sie ahnen, dass sie nicht bei allen auf dem Sarnerhof willkommen war.
»Wir sind froh, dass du wieder gesund bist, Luzia«, sagte Elisabeth spontan und betonte das wir besonders, um dem Mädchen etwas von seiner Angst zu nehmen.
»Morgen werd ich …« Luzia verstummte.
»Ich nehm dich beim Wort. Jetzt muss ich aber nach unten. Die Mannsleut sind sicher schon hungrig wie die Wölfe«, sagte Elisabeth gewollt heiter.
Als sich die Tür hinter Elisabeth geschlossen hatte, blieb das Mädchen eine Weile reglos sitzen. Dieser bescheidene Raum war ihr wie ein Zufluchtsort erschienen, doch die Zeit der Schonung war nun vorüber.
Schließlich griff Luzia nach Nadel und Faden und begann mit sorgfältigen kleinen Stichen den bereits abgesteckten Rock zu säumen, als könnte sie sich damit von ihren quälenden Ängsten ablenken.
***
Als Luzia am nächsten Tag mittags in die Stube trat, den Kopf scheu gesenkt und an der Schürze nestelnd, war es, als ob sich der Raum erhellte.
Linus Sarner, der gerade zu Messer und Gabel greifen wollte, hielt in der Bewegung inne und sah das Mädchen aus prüfend zusammengekniffenen Augen an.
»So, du bist also wieder gesund«, sagte er lediglich.