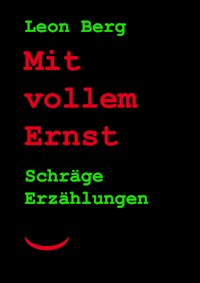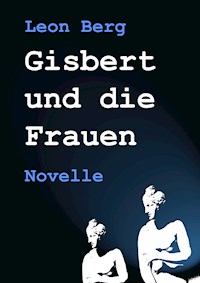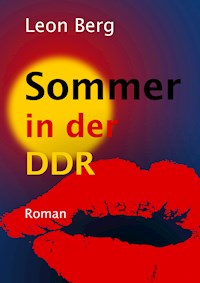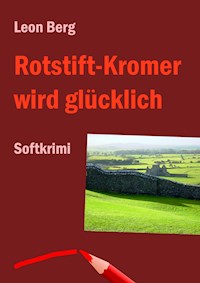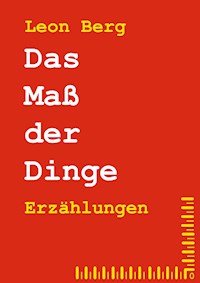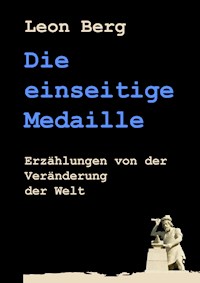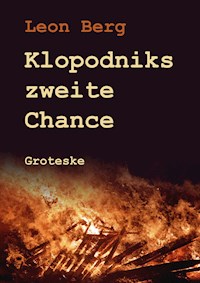Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Henri DePalma, von Beruf Automechaniker, träumt davon, von der Kunst zu leben. Durch eines Glücksfall gelingt es ihm, seinen Traum zu verwirklichen. Doch nun prallen unterschiedliche soziale Codes aufeinander. Die Welt scheint sich gegen ihn zu verschwören. In tiefgründiger und heiterer Weise gelingt es dem Roman, von den Konflikten zu erzählen, die entstehen, wenn "ein Schuster nicht bei seinen Leisten" bleibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leon Berg
Herr Mallorca fliegt
Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Herr Mallorca fliegt
Impressum neobooks
Herr Mallorca fliegt
Roman
Die Rothaarige
Die Steigleitung, die den Spülkasten der Toilette speiste, war eingefroren, und die Geizhälse von der Hausverwaltung hielten es für unnötig, Abhilfe zu schaffen. Henri DePalma musste beim Discounter Wasser kaufen, in den vierten Stock schleppen und hoffen, dass die Flaschen nicht genauso einfrören wie die Steigleitung. Der Frost klirrte schon seit Wochen, er erinnerte an die gute, alte Zeit vor der angeblichen Klimakatastrophe, als es noch heiße Sommer und eisige Winter gegeben hatte.
Natürlich hätte Henri DePalma umziehen können – das heißt, genau das hätte er nicht können. Ihm fehlte die nötige Verdienstbescheinigung.
Zum Glück lebte Henri DePalma in einer Millionenstadt, einer mit öffentlich zugänglichen Toiletten reich gesegneten Metropole. Vor den meisten wachten allerdings übel gelaunte Männer oder matronenhafte Frauen, die einen Euro kassieren wollten, obwohl es drinnen genauso stank wie in einer kostenlosen Bahnhofsunterführung. Es gab viele Möglichkeiten, außer Haus aufs Klo zu gehen und das französische Gletscherwasser vom Discounter für die Nacht aufzusparen.
Eine schöne Toilette hatte zum Beispiel sein Hausarzt. Dort bollerte eine richtige Dampfheizung aus der Zeit, als noch niemand ans Energiesparen dachte. Das Eisen des Radiators strahlte wie eine elektrische Herdplatte und brachte die Wangen zum Glühen. Zwei Stunden Wartezimmer, und der Körper war wieder fit, um die Eiseskälte zu ertragen. Sich dort aufzuwärmen, war fast wie ein Kurzurlaub in der Karibik, olé.
„Herr DePalma, waren Sie schon einmal bei uns?“, fragte die junge Arzthelferin, die er noch nie hier gesehen hatte.
„Klar, erst vor ein paar Tagen…“
Das blasse Mädchen mit den schwarzen Augenhöhlen und dem silbernen Ring, der den Wulst ihrer Unterlippe durchbohrte, schaute in den Computer.
„Sie können gleich durchgehen. Zimmer zwei, den Flur lang, dann rechts.“
„Ich weiß, wo Zimmer zwei ist.“
Schon zum zweiten Mal passierte es ihm, dass er wie ein Privatpatient sofort drankam. Seit sein Hausarzt Termine vergab und die Patienten zur Pünktlichkeit erzog, war es aus mit dem Aufwärmen in überheizten Räumen.
Der Doktor drückte ihm mit einem Mundspatel auf die Zunge und leuchtete ihm in den Rachen, bis in die Tiefen des Schlunds hinunter. Es würgte ihn, pfui Teufel.
„Das war's.“
„Schon?“
Henri DePalma stand wieder auf der winterlichen Straße, das Rezept in der Hand, das er nicht einlösen würde. Durch die Schuhsohlen zog die Kälte in die Füße. Die Zehen schmerzten, seine Blase meldete sich zurück. Die wohlige Wärme in der Praxis hatte ihm nur einen kurzen Aufschub verschafft.
Auf den vereisten Gehwegen musste er langsam tun, um nicht auszurutschen und sich den Fuß zu verstauchen oder gar zu brechen. Früher hatte die Stadt genug Salz gestreut, und gut war’s. Jetzt war der Umweltschutz ein willkommenes Argument, um Geld und Arbeit zu sparen und den Menschen die Kosten wintergeeigneter Schuhe aufzuhalsen.
Die neue staatliche Gemäldesammlung ragte vor ihm auf, eine glatte, hellgraue Betonfassade mit schießschartenartigen, eckigen Thermofenstern. Henri DePalma liebte moderne Architektur. Im neunzehnten Jahrhundert hatten die Bauherren geglaubt, dass nur Gebäude, die der Akropolis ähnelten, genug hermachten, um Postämtern, Bahnhöfen, Regierungspräsidien und Museen eine Heimat zu geben. Diese Zeiten waren zum Glück vorbei. Henri DePalma schritt die flachen Stufen hinauf, trat durch eine Glasdrehtür wie bei Ikea und stand an der Kasse.
„Ich müsste mal für kleine Mädchen.“
Die Aushilfe hinter der perforierten Glasklappe drehte sich nach ihrer erfahrenen Kollegin um.
„Da ist einer, der sagt, er müsse mal aufs Klo.“
„Ist er ein Penner?“ Die Stimme kam aus Off, aus dem angrenzenden Büro. „Der Chef hat gesagt, dass sich Penner bei uns aufwärmen dürfen, solange es draußen so kalt ist.“
Die Kassenfrau schaute Henri DePalma an.
„Sind Sie ein Penner?“
„Ganz gewiss“, sagte er geistesgegenwärtig.
Sie betrachtete seine kurz geschnittenen Haare, das glattrasierte Kinn, sah das Logo auf dem Parka, der gewiss nicht aus einem Ein-Euro-Shop stammte. Sie erhob sich, taxierte die Hose, schaute an den Beinen hinab. Henri DePalma hoffte, dass die Sohlen keine Embleme der trendigen Schuhmarke auf den Marmorboden gestempelt hatten.
„Meinetwegen.“
Henri DePalma betrat den beheizten Toilettenraum. Es roch nach frischen WC-Steinen, Glasreiniger, Handseife und beißendem Salmiak. Henri DePalma zielte auf die rosafarbene Hygienekugel im Pissbecken. Trotz der rund zweiminütigen körperwarmen Dauerdusche schmolz ihr Volumen kaum ab. Er zog den Reißverschluss am Hosenlatz hoch, wandte sich ab. Automatisch rauschte die Spülung. Im Vorraum wusch er sich mit heißem Wasser die Hände und das Gesicht. Er öffnete einen Spalt breit die Tür und spähte in die Eingangshalle hinaus. Die Aufseherin, die an den Museums-Tickets die Ecken abriss, war nirgends zu sehen. Eilig schlüpfte er durch den Einlass und stand nach wenigen schnellen Schritten im ersten gut beheizten Ausstellungssaal.
Er folgte den Schildern, die zur Sonderausstellung wiesen, und gelangte in einen Raum, wo eine rothaarige Mittvierzigerin, ganz in schwarz, von Pipilotti Rist erzählte. Eine Gruppe älterer Herrschaften scharte sich um sie. Henri DePalma tat so, als gehöre er dazu. Es spielte ja keine Rolle, ob jemand zusätzlich zuhörte, Informationen waren keine Bouletten, von denen die anderen weniger bekamen, wenn einer mehr mitaß.
Die Rothaarige sprach davon, dass die Videokünstlerin hundert Stunden Arbeit in eine Minute Film stecke, um die Menschen in einer Minute mit hundert Stunden zu beschenken. In rauschhaften, farbintensiven Bilderfluten erforsche sie das Verhältnis von Vernunft und Animalität.
So einen Job wie die Rothaarige hätte Henri DePalma auch gerne gehabt, am liebsten mit stimmungsvollen Landschaften und Sonnenuntergängen, keine Kirchenbilder mit Heiligen und biblischen Szenen, auch wenn die gemalten Menschen irdisch nackt und erotisch daherkamen wie Michelangelo Buonarrotis Fresken in der Sixtinischen Kapelle. Ja, er kannte sich aus mit der Kunst. Er hatte sich immer dafür interessiert, auch wenn er als Beruf den Automechaniker hatte wählen müssen. Sein Papa war Automechaniker gewesen, sein Opa auch. Kein Fabrikant, Arzt oder Anwalt hatte es unter seinen Vorfahren gegeben, nur Automechaniker. Mit den Segnungen der deutschen Sozialdemokratie hätte er es vielleicht zum Auto-Ingenieur bringen können, aber Kolben, Blech und Ritzel hatten ihn nie interessiert.
Er kannte sich in der Bildenden Kunst nicht nur aus, er liebte sie, hatte zu ihr kein instrumentell-professionelles sondern ein persönliches Verhältnis. In den Werken entdeckte er jedes Mal Neues. Nie wurden sie langweilig. Sie erzählten unendliche Geschichten von den ewigen Dingen, von Werten und Tugenden, von Unsitten, Verrat, von Tod, Liebe und Geburt. Sie stellten Fragen nach dem Woher und dem Wohin. Wie klares Wasser befreiten sie den Geist vom Unrat des Vergänglichen.
Rückblickend erschien es ihm unbegreiflich, dass er seinen Genius an obenliegende Nockenwellen verschwendet hatte. Nichts täte er lieber, als die Tage zwischen den Werken berühmter Maler zu verbringen. Zwar gehörte das Öl auch zum Metier eines Automechanikers, aber leider nicht das Öl der Farben, sondern der schwarze Schmierstoff der Zylinder.
Bei Pipilotti Rist ging es um Videokunst. An drei Wände des Raums wurde drei Mal der gleiche Film projiziert. Die Videos zeigten subjektive Kamerafahrten durch Tulpenfelder, sie nahmen die Perspektive krabbelnder Insekten ein. Riesige, bunte Blumenstängel wiegten im Wind. Groß und gefährlich wie Python-Schlangen krochen Regenwürmer durch das Dickicht. „Lungenflügel“, hieß die Audio-Videoinstallation, sie dauerte eine Viertelstunde und ging dann wieder von vorne los.
Henri DePalma drängte es weiter zu den anderen Exponaten. Als er sich von seinem Sitzkissen erhob, stand plötzlich die Frau von der Kasse neben ihn. Ein Mann begleitete sie.
„Sehen Sie, Herr Direktor, das ist der Herr, der sich als Penner ausgegeben hat, nur um sich kostenlos in unsere Ausstellung einzuschmuggeln.“
Diese verdammte Petze, dachte Henri DePalma.
Doch der Direktor war voller Wohlwollen, als er hörte, dass Henri DePalma kein Intellektueller war und sich trotzdem für Bildende Kunst interessierte.
„Jemanden wie Sie brauchen wir für die nächste Ausstellung. Wir sind in unseren Elfenbeintürmen elitären Kunstverständnisses gefangen. So erreichen wir immer nur dieselben Leute, aber Kunst ist für alle da. Kunst bereichert das Leben, sie bildet den wohltuenden Kontrast zur käuflichen Ware.“
So redete der Direktor auf ihn ein. Er warf mit Namen und Fachbegriffen um sich, von denen Henri DePalma viele schon gehört hatte. Aber auch bei den Wörtern, die er nicht sofort verstand, nickte er verstehend. Seine Unkenntnis durfte ihm diese einmalige Chance nicht verbauen.
„Können wir mit Ihnen rechnen?“, fragte der Direktor.
Dummerweise fiepte genau in diesem Moment der Wecker, unerbittlich. Die Sonne strahlte in grellem Licht durch die Fensterläden, warme Luft wehte herein. Henri DePalma öffnete die Augen und versetzte dem Wecker einen heftigen Schlag. Das Aufstehen war ihm zuwider. Lieber hätte er noch eine Weile die Süße des Traums ausgekostet, als sich in den Niederungen seines gewöhnlichen Daseins mit Alltäglichem herumzuschlagen, zum Beispiel mit einer gewissen Frau Moltke.
Aber die Wirklichkeit kannte kein Pardon. Henri DePalma hatte den Wecker stellen müssen, weil ein Behördentermin auf ihn wartete. Die Vorderseite des Schreibens, das er bekommen hatte, klang nach freundlicher Einladung, die Rückseite nach feindlicher Vorladung. Hinten, im Kleingedruckten, stand alles über die drastischen Sanktionen, die ihm drohten, falls er auch heute, zum wiederholten Mal, nicht auftauchen sollte.
Henri DePalma spielte mit dem Gedanken, seinen Hausarzt aufzusuchen und sich krankschreiben zu lassen wie letztes Mal. Damals hatte es geschneit, heute schien die Sonne. Es war ein wunderschöner Tag, der ihn nicht im Bett hielt.
Das einzige, was in seinem Traum der Realität entsprochen hatte, war das französische Gletscherwasser, das er in die Toilette schütten musste, weil die Wasserspülung schon seit Tagen nicht mehr funktionierte. Die Geizhälse von der Hausverwaltung scherten sich einen Dreck darum.
Frau Moltke
„Nehmen Sie bitte Platz, Herr DePalma.“
Die Frau, die Gabi Moltke hieß – so stand es auf dem Türschild und auf den maschinell erstellten Einladungsschreiben –, nickte ihm aufmunternd zu. Sie deutete auf den Besucherstuhl vor ihrem Schreibtisch.
„Wie geht es Ihnen?“, erkundigte sie sich. „Nehmen Sie bitte Platz, und fühlen Sie sich wie zuhause.“
Er merkte sogleich, dass Frau Moltke zu einer neuen Generation von Werktätigen im Öffentlichen Dienst gehörte. Sie schnauzte ihre Klientel nicht an. Sie zeigte ihre blendend weißen Zähne und lächelte, als wollte sie ihn zu einem Date herumkriegen. Na ja, das hatte sie auch tatsächlich vor, aber natürlich sollte er sich nicht mit ihr im Mondschein treffen, sondern mit einem potenziellen Arbeitgeber in dessen Personalbüro, vermutlich einer dubiosen Autowerkstatt in der Peripherie der Stadt.
Obwohl er im Moment keinen Hintergedanken in der Frage nach seinem Wohlbefinden erkennen konnte, entschied er sich für eine möglichst kurze Antwort in neutralem Tonfall.
„Gut.“
So hielt er sich alle Optionen offen.
Falsch wäre es gewesen zu jammern „mir ist schlecht, ich habe dauernd Kopfschmerzen, weil mir ein Job fehlt“. Garantiert hätte sie ihn als arbeitsunfähig nach Hause geschickt und ihm zur Strafe das Einkommen gekürzt. Ein hochmotiviertes Siegerlächeln, „super, absolut blendend“, hätte sie dagegen misstrauisch gemacht und zu zeitraubenden Nachforschungen angespornt. Unbedachter Small-Talk mit amtlichem Personal konnte verheerende Folgen haben, egal wie nett und höflich es sich benahm.
Frau Moltke trug ihre blonden Haare strubbelig kurzgeschnitten, sie hatte gerötete Augen mit viel dunkelblauem Lidschatten drum herum, als wolle sie mehrere durchzechte Nächte vertuschen. Ihre Haut war sonnenstudiogegerbt. Nur das dunkelblaue Sommerkleid mit den weißen Punkten verlieh ihrer Erscheinung eine halbwegs adrette Frische.
„Und Ihnen? Wie geht es Ihnen?“
Frau Moltke überging seine Frage. Das hätte er sich eigentlich denken können.
Sie sah ihn freundlich an und lächelte.
„Haben Sie schon einmal in einem Kunstmuseum als Aufsicht gearbeitet?“
Er ließ sich Zeit mit der Antwort, um auch diesmal keinen strategischen Fehler zu begehen.
In einem Museum gearbeitet, dachte er. Eine Fangfrage? Um herauszubekommen, ob er ein bequemer Typ war, der am liebsten den ganzen Tag auf einem Stühlchen hockte und teilnahmslos vor sich hinstarrte? Vielleicht gab es eine neue gesetzliche Regelung, die besagte, dass den Leuten, die Erfahrung im ausgiebigen Herumsitzen hatten, ein gewisser Prozentsatz vom monatlichen Unterhalt abgezogen werden durfte?
Man konnte nie wissen, wie die Politik und ihre ausführenden Behörden tickten, gerade dann, wenn sie eine so freundliche Person wie Frau Moltke vorschoben. Sie lächelte ihn an wie die Verkäuferin bei einem Herrenausstatter, die ihre Kunden als todschick bejubelte, obwohl sie bei der Anprobe die unpassendsten Klamotten ausgewählt hatten.
Oder prüfte Frau Moltke tatsächlich seine Affinität zur Kunst? Hei, das wäre ein Treffer ins Schwarze!
Immer wunderte er sich über das Aufsichtspersonal in Museen, das gelangweilt und müde herumsaß und heimlich auf die Armbanduhr schielte. Wenn er so einen Job bekäme, machte er alles anders. Die meisten Besucher lechzten nach Information. Sie gaben sich nicht mit den unleserlich klein getippten Schildchen zufrieden, die neben den Bildern klebten. Er würde sich zu ihnen gesellen und sein gesamtes Wissen über die Gemälde ausbreiten, er würde sachkundige Vorträge halten, so wie die Rothaarige über Pipilotti Rist, von der er in der Nacht geträumt hatte.
„Nein“, sagte er wahrheitsgemäß.
Frau Moltke protokollierte seine Antwort im Computer. Sie tippte, ohne auf den Monitor zu schauen. Ihr Blick galt allein ihm, ihrem Kunden.
„Noch nie als Aufsichtsperson gearbeitet? Hm.“
Henri DePalma wollte genau diesen Job unbedingt haben, falls es nicht nur heiße Luft war, was Frau Moltke aus sich herausgeblasen hatte. Er wusste aber auch, dass er nicht mit offenen Karten spielen durfte. Keinesfalls zu viel Interesse zeigen, Reserviertheit war wichtig. Freude und Glücksgefühle hätten Frau Moltke nur stutzig gemacht. Sie war es nicht gewohnt, dass ihre Klientel Begeisterung empfand. Möglicherweise zöge sie ihr Angebot zurück, um in Ruhe nach dem Haken zu suchen.
Henri DePalma verhielt sich also lieber wie ein gewiefter Börsianer, der scharf auf die Aktienmehrheit einer geilen Firma war. Der Börsenprofi hing sein Vorhaben nicht an die große Glocke, sondern spielte mit verdeckten Karten.
„Würden Sie denn gerne in einem Kunstmuseum arbeiten, Herr DePalma?“
Frau Moltke klapperte wieder mit der Tastatur ihres Computers und schaute ihn erwartungsvoll an. Wenn er jetzt ablehnte, drohten Sanktionen. Sie wusste, dass er es wusste. Er schlug die Augen nieder und ließ sie in dem Glauben, dass es ihr persönlicher Erfolg wäre, wenn er jetzt ein zähneknirschendes „ja“ über die Lippen brachte. Persönliche Erfolge machten nie misstrauisch, immer nur die Erfolge der anderen.
„Ja.“
„Ja?“
Sie druckte einen Bogen Papier aus, auf dem die Adresse des Museums geschrieben stand.
„Bitte melden Sie sich dort bei einem gewissen Doktor Gramnitz, am besten sofort. Doktor Gramnitz ist der Direktor. In dieser Woche wird in der Kunsthalle eine international bedeutende Ausstellung englischer Malerei eröffnet. Man erwartet einen riesigen Besucheransturm.“
„Ah, Van Dyck, Hogarth, Reynolds, Gainsborough…”
„Wie bitte?”
„Ach nichts“, sagte er.
„Geben Sie mir umgehend Bescheid, was bei dem Gespräch herausgekommen ist.“
Das klang nicht mehr geflötet, sondern nachdrücklich, eindringlich. Alternativlos. Zwischen den Worten schwangen all die Strafen und Zwangsmaßnahmen mit, die zur Anwendung kämen, wenn er sich dumm anstellte und es versäumte, sich bei Doktor Gramnitz zu melden. Kiloschwere Paragrafen und Ausführungsbestimmungen sausten auf ihn herab und brächen das Rückgrat seiner materiellen Existenz. Das Gesetz funktionierte auch ohne das Zauberwort „bitte“.
„Auf Wiedersehen Frau Moltke.“
Er brummte die Verabschiedung mit frostiger Stimme und drehte sich beim Hinausgehen auch nicht um. Dass er sich unbändig darauf freute, in einem Museum zu arbeiten, dazu in der berühmten Kunsthalle, bedeutete noch lange nicht, die Freude auch zu zeigen. Sein Glücksgefühl ging niemand etwas an, schon gar nicht diese übernächtigte Frau Moltke.
Mit gewollt ausdrucksloser Miene schritt er durch die düsteren Gänge des Klinkersteingebäudes. Ohne Hast Abstand gewinnen, sich außer Reichweite begeben. Sich nicht umschauen wie Lots Frau. Vielleicht war alles ein Irrtum. Vielleicht schösse sogleich Frau Moltke aus ihrem Büro, um ihm die Adresse der Kunsthalle wieder zu entreißen. Das aufgeregte Pochen seines Herzens drohte ihm die Brust zu sprengen.
Was für ein Glück, dass er sich heute kein ärztliches Attest besorgt hatte. Ein Traum ging in Erfüllung. Er würde etwas dazulernen dürfen, nicht den Gebrauch eines neuen Abgasmessgeräts sondern kunsthistorische Fakten. Damit hatte er wahrhaftig nicht gerechnet, zumal es in Frau Moltkes Formularen keine Kästchen gab, um Träume anzukreuzen.
Er verließ das Gebäude, bog um die nächste Ecke, und jetzt endlich warf er die Arme in die Luft.
Ein Jauchzer stieg aus seiner Brust empor. Er sprang und hüpfte vor Freude, wie er es schon lange nicht mehr getan hatte, lachte. Er war ein Siegertyp, er ballte die Fäuste wie ein Torwart, der in letzter Sekunde einen unhaltbaren Ball über die Latte gelenkt und das Spiel entschieden hatte. „So sehen Sieger aus“, grölte er innerlich. Passanten drehten sich nach ihm um. Sie runzelten zuerst die Stirn, ließen sich dann aber von seiner beschwingten Stimmung anstecken. Schön, einen Menschen zu sehen, der glücklich war und seine Gefühle zeigte.
Henri DePalma kniff sich fest in den Oberschenkel, bis es richtig wehtat. Nein, er schlief nicht, diesmal war es kein Traum, der mit dem Erwachen drohte. Einmal im Leben hatte die Wirklichkeit Erbarmen gezeigt. Jetzt kam es darauf an, den Museumsdirektor davon zu überzeugen, dass sein Haus von diesem unbekannten Henri DePalma profitierte wie von sechs Richtigen im Lotto mit Zusatzzahl. Ob man ihm glaubte?
An ihm sollte es nicht liegen. Die zweite Chance hatte ihm den kleinen Finger entgegengestreckt, und er würde mit Macht nach der ganzen Hand greifen.
Else Tinkeltod
Das Ausstellungsplakat, das viele Litfaßsäulen zierte, zeigte einen englischen Landedelmann und seine Gattin. Sie posierten unter einem knorrigen Baum. Die Frau saß aufrecht auf einer schmiedeeisernen Bank. Sie trug ein hellblaues Kleid, das die Farbe des Himmels auf die Erde zu holen schien. Ein Reifrock im Stil des Rokokos spreizte ihre Hüften und – so sah es aus – hielt ihren Ehemann auf Distanz, der mit leidenschaftsloser Miene neben ihr stand. Unter dem Saum des Kleides schauten zwei Füßchen hervor, sittsam übereinandergeschlagen. Der Mann hatte die Beine gekreuzt, er hielt lässig die Flinte unterm Arm. Ein Jagdhund schnupperte an dem Lauf, der zu Boden zeigte und zufällig auf eine Wurzel zielte. Die Szene war aus dem Zentrum des Gemäldes gerückt, sie füllte die linke Bildhälfte. Dadurch war rechts genug Raum, um den Blick auf die Ländereien zu öffnen, einer Landschaft aus sanft geschwungenen Hügeln und abgeernteten Feldern.
Henri DePalma empfand es als unglaubliches Glück, dass er sich in der Kunsthalle vorstellen durfte. Er würde alles tun, um den Job zu bekommen.
Den Job? Die Aufgabe! Nie mehr verschmierte Overalls, dafür Nahrung für den Kopf.