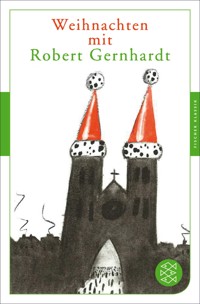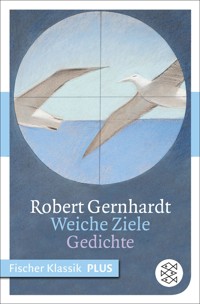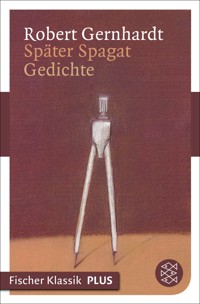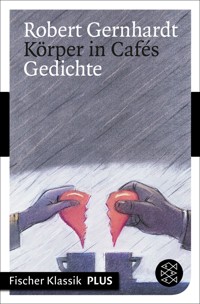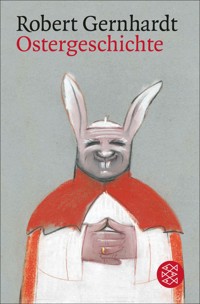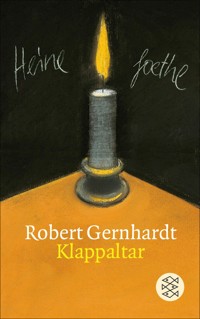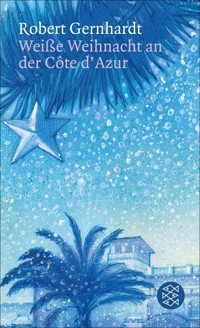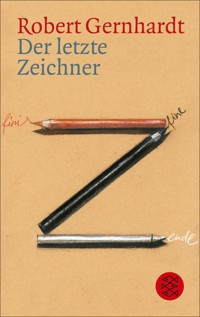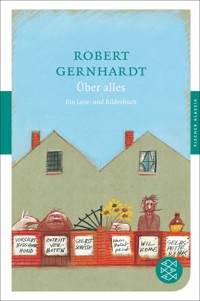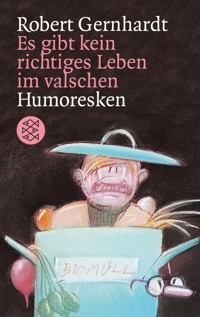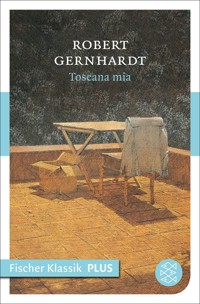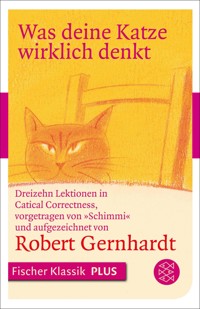9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Reisen Sie mit Robert Gernhardt um die Welt! Dass der Dichter, Maler und Satiriker Robert Gernhardt zeitlebens ein großer Reisender war, bezeugen viele seiner Texte und Zeichnungen. Darüber hinaus hat er seine Erlebnisse und Beobachtungen in diversen Ländern Europas und der Welt in seinen legendären ›Brunnenheften‹ dokumentiert. Eine Auswahl dieser Notate wurde nun erstmals zusammengestellt und ergibt einen Reiseführer der besonderen Art: Quer zum kosmopolitischen Mainstream rückt Gernhardts scharfer, kluger, teils ironischer, teils melancholischer Blick auf Land und Leute, Architektur und Kunst, Natur und Tourismus beliebte Reiseziele in ein ungewohntes Licht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Robert Gernhardt
Hinter der Kurve
Reisen 1978-2005
Über dieses Buch
Reisen Sie mit Robert Gernhardt um die Welt!
Dass der Dichter, Maler und Satiriker Robert Gernhardt zeitlebens ein großer Reisender war, bezeugen viele seiner Texte und Zeichnungen. Darüber hinaus hat er seine Erlebnisse und Beobachtungen in diversen Ländern Europas und der Welt in seinen legendären ›Brunnenheften‹ dokumentiert. Eine Auswahl dieser Notate wurde nun erstmals zusammengestellt und ergibt einen Reiseführer der besonderen Art: Quer zum kosmopolitischen Mainstream rückt Gernhardts scharfer, kluger, teils ironischer, teils melancholischer Blick auf Land und Leute, Architektur und Kunst, Natur und Tourismus beliebte Reiseziele in ein ungewohntes Licht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Robert Gernhardt (1937-2006) lebte als Dichter und Schriftsteller, Maler und Zeichner in Frankfurt/ Main und in der Toskana. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Heinrich-Heine-Preis und den Wilhelm-Busch-Preis. Sein umfangreiches Werk erscheint bei S. Fischer, zuletzt ›Was das Gedicht alles kann: Alles. Texte zur Poetik‹ (2010) und ›Toscana mia‹ (2011).
Kristina Maidt-Zinke, Journalistin und Literaturkritikerin, hat Robert Gernhardts ›Brunnenhefte‹ für das Deutsche Literaturarchiv Marbach gesichtet und dokumentiert.
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Robert Gernhardt
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012
ISBN 978-3-10-402117-1
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen
des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402117-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
Wenn einer keine Reise tut
»Ein unschuldiger Sport, dieses Erinnern«
Wo ist das alte, würdige Reval geblieben?
Die ziemlich unwahrscheinliche Geschichte vom Stuhl des Konsul Ströhm
Keine Obstbäume mehr in Kambja
Auf Reisen – oder nie – lernt man es, Ansprüche zu stellen
»Die alten Kinderfragen«
Innsbruck: Mindermaler und Chinesen
Wien: Kaiserschützen und Wunderwerke
Linz: Reisen bildet
Obergurgl, geschenkt
Sölden, ein Alpen-Alptraum
»Plastikkegel vor dem Gotthard«
»Ausschweifende Zuckerdosen«
Die beharrenden Kräfte in Turin
Am Marmorstrand
Der neapolitanische Taxifahrer erzählt
Lügen in Pompeji
Sardinien I: Keine Ruhe bei den Reichen
Sardinien II: Das Weiße in den Augen der Russen
Welt im Wandel
Das Wunder von Mantua
Kalterer See
Petrarcas Katze
Venedig: O Sohle mio
»Frühgotisch ist besser als spät«
Betrugsformen im Burgund
Reise durch Burgunds Lücken
Cluny-Gespräch zwischen einem atheistischen Ästheten (A) und einem gläubigen Katholiken (K)
Gastsein
»Myriaden von Gaffern, mittenmang ich«
Was mir in Teneriffa auffiel
Topfblumen für Franco
Gabi, die Hispanophile
Was ich von Barcelona behalten werde
»Von Entdeckern und Absahnern«
Porto enttäuscht
Lissabon: Was läuft da falsch?
Jenseits des Goldenen Zeitalters
Januarsfluss
Die Maler-Maler
»Gelassen im Bronzestatuenwald«
Lauschiges London
Erinnerung und Gedächtnis
Fackel und Kienspan
»Hirsch an der Tankstelle«
Das Wohnmobil als Schauplatz
Wildlife Abounds
Die Tiere (1)
Die Tiere (2)
Die Tiere (3)
Die drei Anstrengungen des Reisens zu einem Ziel
Die Tiere (4)
Die Tiere (5)
Die Tiere (6)
Tourist in der Wilderness
Die Tiere (7)
Die Tiere (8)
Lake Louise
Die Tiere (9)
Naturmuseum
Bärenfang
Paarsituationen
Seelöwenfelsen
Zwei, drei Worte zum Kanadier/West
Kunst und Umweltschutz
Zivilisation
Gute Szene
Wo laufen sie denn?
»Wo die Kunst endet«
New York: Nirgends ein Korkenzieher
Florida: Dreams that money can buy
Chicago: Mord, Kunst und Fett
»Vollkommenheit«
Paradies
Insekten
Wächter
Nacht
»Frösteln am Amazonas«
Anflug
Er findet etwas, was ihm selber gehört
Verwüstungen
Umlernen
Haustiere
Amazonasfahrt
Frauen
Menetekel Manaus
Der Brasilianer und der Deutsche
Schlangen und Vögel
Vom Zuspätkommen
Gnadenlose Tropennächte
Salvaterra
Die deutsche Reiseagentin
Irrtümer und Fragen
»Das Paradiesische ist feststellbar«
Indonesisch für Anfänger
Rache der Malaien I
Rache der Malaien II
Die Einsamkeit des Weißen unter den Braunen
Eine dieser Klasseunterhaltungen
Ort der Orte
Im Tropenhaus
Borobudur.
Nicht Bali, sondern Lombok
Hängengeblieben in Bima
Warane, Warane, Warane
Herr und Diener
Der Weg ist das Ziel
Die Gaukler in Taman Runi
Ohne Kunst, aber trotzdem
»Kaffeefahrt zum Floating Market«
Der Tourist als Held
Gedanken eines Touristen, der anderen Touristen beim Fotografieren zusieht
Der Tourist als Gefangener
Buddha: Reinfälle und Tricks
Der Tourist als Verkehrsteilnehmer
Der sensible Tourist
Folklore: Das europäische Konzept
Schönheit, Hässlichkeit
Tiere, Bäume
Kulturnotizen
Laute Tropen
Letzte Kämpfe
Das war’s
»Unheimlich aufgeräumt«
»Den Tieren Noten geben«
Was beim Reisen schön ist
Chasing the Cheetah
Gametracker-Geschichten
Wild Dogs
Rettet den Somali-Nacktmull
Anmerkungen
Botswana
Brasilien
Indonesien
Kanada
Jamaika
USA
Vorwort
Der Weg ist das Ziel,
und wenn sich keiner mehr bewegt,
ist das Ziel auch weg.
Robert Gernhardt
Als Robert Gernhardt 1988 aus fast zehnjähriger »Notiererei« das Resümee zog, seine Brunnen-Hefte seien ihrem Wesen nach »reine Bewegung … und kein Ankommen«, hatte er erst ein gutes Drittel der Wegstrecke zurückgelegt, auf der die Hefte ihn begleiten sollten. Die achtzehn Jahrgänge, die noch folgten, bestätigen jenes frühe Fazit. Und die »Bewegung« ist dabei nicht nur eine Metapher: Müsste unter den vielfältigen Funktionen, die das unliniierte Schreibheft der Marke »Brunnen« für Gernhardt als Dichter, Zeichner, Essayisten, Publizisten, Ideensammler und Tagebuchschreiber in Personalunion erfüllte, eine einzige benannt werden, die den Charakter des 675 Hefte umfassenden Notat-Œuvres am besten wiedergibt, dann wäre es die des Reisejournals.
Ortswechsel prägten die Biographie des Autors von Anfang an. In Reval geboren, auf Umwegen in Göttingen gelandet und dort aufgewachsen, nach Stuttgarter und Berliner Studienjahren (mit ersten »Bildungsreisen« nach Italien und Griechenland) in Frankfurt am Main und in der Toskana heimisch geworden, war Robert Gernhardt während seines gesamten Künstlerlebens vorwiegend unterwegs – als Pendler zwischen dem deutschen und dem italienischen Wohnsitz, auf Lesetourneen und anderen berufsbedingten Reisen, aus privaten Anlässen und zwecks Erkundung der Welt, die ihn, den hellwachen Sinnen- und Geistesmenschen, in all ihren Erscheinungsformen und Merkwürdigkeiten interessierte, oftmals irritierte und zum ironischen Widerspruch reizte, vor allem jedoch zu unentwegter Text- und Bildproduktion inspirierte. Hatte er ein Reiseziel erreicht, blieb er auch dort meist in Bewegung, beobachtend, Stoff sammelnd, Eindrücke sortierend, registrierend und zugleich reflektierend, was ihm auffiel.
Seit 1978 war ihm das Notatheft samt Kugelschreiber, ein aus heutiger Sicht schon antikes Instrumentarium, auf Reisen wie im Frankfurter Alltag zum unentbehrlichen Utensil geworden. Das heißt freilich nicht, dass er Reiseberichte nach konventionellem Verständnis hinterlassen hätte. Seine »Buchführung«, daheim wie in der Fremde, bleibt trotz ihres staunenswerten Detailreichtums stets unsystematisch, spielerisch und mit dem Zufall im Bunde, also beweglich im weitesten Sinne: Sie springt hin und her zwischen Wahrnehmung und Assoziation, Analyse und künstlerischer Verarbeitung, verweigert sich dem chronistischen Prinzip ebenso wie dem der Vollständigkeit. Allein nach subjektiven und situativen Kriterien erhält das Erlebte sein Gewicht, wird mit früheren Erfahrungen verknüpft, poetisch oder satirisch umgestaltet oder einfach im Arbeitsspeicher abgelegt.
Das hat zur Folge, dass in den Reisenotizen, die im vorliegenden Band versammelt wurden, die bereisten Länder sehr unterschiedlich zur Geltung kommen, sowohl vom Umfang des Materials als auch von den Textarten und der thematischen Perspektive her. Streiflichtartige Impressionen wechseln ab mit langen Essays, minimalistische Aperçus mit Szenen, Gedichten und Erlebnisprotokollen. Manchmal blieb unterwegs reichlich Muße zum Notieren und Zeichnen, manchmal war die Zeit knapp. Zuweilen ist es der Anlass der Reise, der die Blickrichtung bestimmt und die Aufzeichnungen filtert, häufig sind es ausgeprägte Interessen des Autors (insbesondere Architektur, Kunstmuseen und wild lebende Tiere); dann wieder wird seine Aufmerksamkeit spontan von Gegenständen oder Zuständen angezogen, die der Reise nachträglich ein Thema geben, sie in einen Kontext stellen.
Auf diese Weise entstand zwischen 1978 und 2005 in den Brunnen-Heften ein Gernhardt’sches Weltpanorama, von dem ein Teil in das publizierte Werk eingeflossen ist, der größere jedoch hiermit erstmals an die Öffentlichkeit gelangt. Der Band stellt die Texte der – zum Teil mehrfach – bereisten Länder nicht in chronologischer Abfolge vor, sondern in einer gedachten geographischen Linie, die von Estland, dem Ort der familiären Wurzeln des Künstlers, ausgeht und zunächst in ostwestlicher Richtung durch Europa, dann nach Amerika, Asien und Afrika führt, so dass sich eine virtuelle Route um die Welt ergibt. Die Notate von einem mehrmonatigen Rom-Aufenthalt und von den Reisen – vornehmlich Lesereisen – innerhalb Deutschlands sind aufgrund ihres speziellen Charakters und der Menge des Materials in dieser Zusammenstellung nicht enthalten.
Die Zeitspanne, in der Robert Gernhardt seine Auslandsreisen unternahm, war diejenige, in der Dörfer, Städte, Landschaften in aller Welt ihr Gesicht nachhaltiger veränderten als in Jahrhunderten zuvor, was nicht zuletzt den Auswirkungen einer demokratischen Errungenschaft namens Massentourismus geschuldet war. Als der Autor begann, seine Brunnen-Hefte zu füllen, hatte die zweite große Reisewelle nach dem Krieg längst Orte und Territorien erfasst, von denen die Wirtschaftswunder-Generation noch nicht einmal geträumt hatte. Von dieser Welle war eine neue Publikumsschicht erfasst worden, jene neoromantisch gestimmten Individualreisenden, die den Neckermann-Urlaub verachteten und das dezidiert Untouristische, Authentische und Ursprüngliche suchten, das unkorrumpierte Idyll mit Meerblick, gern auch mit funktionsfähiger Dusche und kulinarisch ergiebiger Fischerkneipe, kurzum: mit all den Attributen, die Gernhardt unter dem Begriff »Ort der Orte« subsumiert (siehe Seite 200ff.). Es war die Ära, in der Deutsche ausschwärmten, um gefährdete Kulturräume zu »retten«, indem sie toskanische oder provençalische Bauernhäuser zu Spottpreisen aufkauften und mit Naturmaterialien renovierten, während dort, wo sie herkamen, aber auch dort, wo ihre weniger anspruchsvollen Landsleute hinreisten, profitsüchtige Bauwut unbehelligt ihr Unwesen trieb.
In den Aufzeichnungen aus seiner toskanischen Zweitheimat (Toscana mia, Frankfurt 2011) befasst sich Robert Gernhardt wiederholt mit dieser Konstellation und dem darin verborgenen Dilemma, in das er selber verstrickt ist. Und so begegnen wir ihm auch in seinen Reisenotizen immer wieder als Kulturkritiker, der auf den Ausverkauf der Welt und auf die Begleitsymptome der touristischen Globalisierung mit dem scharfen Blick des Satirikers, zugleich aber mit der Wehmut des empfindsamen Reisenden reagiert – und der sich selbst, mit seinen Sehnsüchten und Verblendungen, seinen Bedürfnissen und Gewohnheiten, als Teil des Problems begreift. Daraus ergeben sich hochkomische Situationen, glasklare Erkenntnisse und melancholische Einsichten. Nebenpfade, zumal die Museumsrundgänge des Malers Gernhardt als komprimierte Lehrstunden einer etwas anderen Kunstbetrachtung, führen in traditionelle Reservate der Kulturreise und leuchten sie neu aus.
Wer mit Robert Gernhardt reist, dem werden die Augen geöffnet für vieles, was ihm bei der eigenen Welterkundung bisher entgangen sein könnte. Ganz im Sinne des 1985 entstandenen Gedichts »Hinter der Kurve«, das dem vorliegenden Band den Titel gab und dessen erste Strophe lautet:
Was hinter jener Kurve ist –
Ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht.
Es rauszufinden ist die Pflicht,
Die uns das Schicksal zugemißt.
München, im Mai 2012
Kristina Maidt-Zinke
Wenn einer keine Reise tut,
dann kann er nichts erzählen.
Wenn einer keine Liebste hat,
dann kann er niemand quälen.
Wenn einer keinen Hammer hat,
dann hat er nichts zu klopfen.
Wenn einer keine Mäuler hat,
dann hat er nichts zu stopfen.
Wenn einer keine Brüder hat,
dann hat er nichts zu schwestern.
Wenn einer keine Ostern hat,
dann hat er nichts zu western.
Wenn einer keine Götter hat,
dann hat er nichts zu lästern.
(1989)
»Ein unschuldiger Sport, dieses Erinnern«
Estland 1993
Wo ist das alte, würdige Reval geblieben?
Reise nach Reval – wieder mit Frau und Mutter. Es ist die zweite Frau, und die Mutter kommt zum zweiten Mal nach der Umsiedlung wieder in die Heimatstadt, und wieder sind plusminus 27 Jahre vergangen: 1939–1966, 1966–1993.
Muttchen hat bestimmte Vorstellungen von dem, was sie diesmal sehen will; heute sollte es Lodensee sein, eine – die letzte – Sommerfrische der Familie. Nicht einfach zu finden: Die Ortsbezeichnungen sind natürlich alle estnisch – welcher volltönende Orts- bzw. Arealname könnte Lodensee gewesen sein? Tante Ebba hatte dort einmal gezeichnet, jetzt lieferte die stark idealisierte Zeichnung das Material zur Rekonstruktion. Das könnte das alte Fischerhaus auf ihrer Zeichnung gewesen sein, das der tote Bau, das dort das Meer und die Steine – und so weiter, bis zu einem Schuppen voller Fischernetze: Die hingen bei Tante Ebba noch draußen.
Ein unschuldiger Sport, dieses Erinnern und Wiedererkennen bzw. Wiedererkennenwollen, der geradezu heitere Züge annehmen kann, wenn eine junge, des Deutschen sehr mächtige estnische Reiseführerin eine Stadtführung für alte baltische Damen macht und manches nicht so recht weiß: Da zur Linken soll früher ein Lokal gewesen sein, ein etwas berüchtigtes Lokal, und die alten Damen rufen unisono, das sei die »Schwarze Katz« gewesen.
Aber nicht nur die alten Damen erinnern sich ihrer Jugend, auch ich erinnere mich, meiner ersten Reise und all dessen, was ich seither über Reval erzählt habe. Eine Hansestadt wie Lübeck, nur noch nicht vom Kommunismus zerstört, urdeutsch, sehr nordisch – und dann gehe ich mit L., die das alles von mir gehört hat und nun ein Kleinod der Backsteingotik erwartet, in die Altstadt und begreife mich und die Welt nicht mehr. Wo ist das alte, würdige Reval geblieben? Hat es das vor 27 Jahren überhaupt gegeben?
Diesmal jedenfalls springt nicht die Hansestadt ins Auge, sondern vor allem die Stadt des ehemaligen Ostblocks und, dahinter aufscheinend, die Stadt, die etwas undefinierbar Östliches hat, wobei dieser Osten durchaus europäisch ist, nur eben nicht Lübeck, sondern eher Laibach, Witebsk, St. Petersburg. So ist auch Halva, der türkische Honig, gereist, in einem Bogen von der Türkei über den Balkan, Rußland in die ehemals russischen Kolonien Estland/Finnland.
Hatte mich beim ersten Besuch (Juni, sonnige Tage) das Leere, Entrückte, Stille an deutsches Mittelalter denken lassen, so sehe ich nun – unter ähnlichen Umständen – vor allem das Gewagte dieser Stadtmelange, das Unseriöse einzelner Bauten, das Undefinierbare der gesamten Bau- und Lebensgesinnung.
Dauernd muß ich mich bei L. entschuldigen; zu meiner Entschuldigung sage ich nur, dieser erste Abendspaziergang habe uns lediglich einen kleinen Blick in die Stadt werfen lassen – vielleicht finde sich das Reval meiner Erinnerung in Bezirken, die wir noch nicht betreten haben.
Die estnische Reiseführerin: »Rechts der Schornstein des Kraftwerks, nicht gerade eine Verschönerung.« Die alten baltischen Damen im Bus: »Von dem hat man uns schon 1930 versprochen, daß der wegkommen soll.«
Geht oder fährt man durch Reval, sieht man häufig halbierte oder demolierte Monumente. Im Vorbeifahren weist die Reiseführerin auf eine durchbrochene Zementkrone hin und sagt, darin hätten sich ca. 15 Bronzefiguren befunden, um an den Volksaufstand von 1924 zu erinnern: Der Volksmund habe gesagt, das sei das einzige Denkmal eines Volksaufstandes, auf welchem auch alle Teilnehmer verewigt worden seien.
Gegenüber der Stadtbibliothek steht ein Monument mit sehr verblaßten Lettern, schaut man näher hin, wird deutlich, daß die Bronze-Buchstaben entfernt worden sind und nur noch als Rost- bzw. Schmutzabdruck weiterexistieren, vermutlich nicht mehr allzu lange.
Andere Monumente, z.B. eines auf dem Domberg, das das Vollrelief eines Herrn mit Brille zeigt, sind teilweise entfernt worden – d.h., die Tafel, welche an die Verdienste dieses Herrn erinnerte, wurde entfernt, so daß dessen intensives Dräuen etwas sehr Rätselhaftes, ja Unsinniges bekommt. Wieder anderswo, an der Fassade einer Wohnanlage aus der Stalinzeit, fehlt eine Figur, die einst die zentrale Nische geschmückt hat – den Sowjetstern, der das Ganze und eine herzlich sinnlose Laterne krönt, hat man gelassen.
Auch in Dorpat läßt man sich Zeit: Dem Reliefschmuck eines klassizistischen Hauses am Rathausplatz sind Hammer und Sichel hinzugefügt und bisher nicht wieder entfernt worden.
Das alles hat natürlich mit den Russen zu tun und mit deren Version der estnischen Geschichte nicht nur dieses Jahrhunderts.
Unbegreiflich bleibt dem leidlich informierten Flaneur, wie wenig die Russen nach ca. 260 Jahren fast ununterbrochener Herrschaft hinterlassen: Einige Gerichte auf der Speisekarte, französischen Kognak und andere Alkoholika – aber sonst? Keine Produkte, keine Lieder, keine Bilder, gar Inbilder; es ist, als hätte es sie hier nie gegeben. Sieht man mal ab von stalinistischer Architektur, die langsam bröckelt, Olympia-Architektur (Segel-Olympiade), die rasch zerfällt, und von zwei Abscheulichkeiten: der Alexander-Newski-Kathedrale auf dem Domberg, in den 90ern des 19. Jahrhunderts als Beweis russischer Ansprüche mitten ins deutschbaltische Adelsviertel gepflanzt – und dann gibt es noch das Befreiungsdenkmal auf dem Wege nach Brigitten, eine Zementschlacht und die abstruseste Lösung des Problems: Wie mache ich mich als Besatzungsmacht so unbeliebt wie möglich.
L., aus dem Fenster des Hotels Viru in Reval hinausschauend: »Ein größerer Rassismus ist hier wohl nicht zu verzeichnen.«
Ich: »Mangels Rasse.«
Die ziemlich unwahrscheinliche Geschichte vom Stuhl des Konsul Ströhm
Wir besuchen das Revaler Stadtarchiv, die estnische Reiseführerin hat uns diesen Besuch ermöglicht, nimmt jedoch nicht teil.
Wir – L., meine Mutter und ich – haben uns einer Reisegruppe angeschlossen, der Besuch hat sich also so ergeben. Die Mutter ist eine geborene Ströhm, der Vater hieß Arthur. Ich bin im dritten meiner drei Namen nach ihm benannt: Robert Johann Arthur. Sein Foto hat mein Leben begleitet; er war ein, so scheint es, strenger, wacher Mann, erfolgreich als Verlagsbuchhändler, mehrfacher Hausbesitzer, Jahrgang ca. 1860, in seiner Jugend Mitglied der Schwarzhäuptergilde, einer Vereinigung von unverheirateten Kaufleuten, die tief ins Mittelalter zurückreicht und sogar heute noch in Westdeutschland weitergeführt wird. Wer heiratete, verließ die Schwarzhäupter und ihr Gildehaus und wurde – automatisch! – Mitglied der Großen Gilde, auch mein Großvater ging diesen vorgeschriebenen Weg – wenn er zwischen 20 und 30 geheiratet hat, muß er etwa 1890 der Großen Gilde beigetreten sein. Meine Mutter, dies als Eckdatum, wurde mit ihrer Zwillingsschwester 1904 geboren, sie waren die Jüngsten, die sogenannten Strömlinge (ein kleiner Fisch, angeblich der Wappenfisch der Ströhms, die in der Tat drei solcher Fische im – wie alten? – Wappen führten).
Der Archivar führt die Gruppe durchs Archiv, neben L., Muttchen und mir auch D. (Enkelin von Arthur Ströhm), H., ihre Schwester (dito), und deren Ehemänner. Im Vortragssaal setzen sich einige auf die stoffbezogenen Allerweltsstühle, D., F. und ich wählen je einen der Stühle, die längs der Wand stehen, drei davon mit, zwei ohne Lehne.
Der Archivar, ein jüngerer Este, der ein hervorragendes Deutsch spricht, erklärt die Baugeschichte der Archivgebäude und zeigt dann auf die Stühle: »Keine gewöhnlichen Stühle, das sehen Sie am Emblem, das sind Stühle aus dem Schwarzhäupterhaus« – alle tragen in der Tat den Schwarzhäupterkopf. »Und«, fährt der Archivar mit einer gewissen Vorfreude fort, »die Stühle gehörten nicht irgendwem, die Namen sind auf ihnen vermerkt« – er dreht einen der drei Lehnstühle um, hinten ist der Name Reinhard Witte eingeschnitzt. »Die Wittes waren ein wichtiges Revaler Geschlecht«, sagt der Archivar, und Muttchen sagt: »Natürlich, die Wittes.«
Neugierig dreht darauf H. den zweiten Lehnstuhl um, und da passiert das Unglaubwürdige: Auf der Rücklehne des Stuhls ist der Name Arthur Ströhm eingeschnitzt. Einige Aufregung, einiges Hin und Her an Fotos und Ausrufen, dann stellen sich neue Fragen:
Die Stühle sind aus dem ersten Viertel dieses Jahrhunderts, jedenfalls legt ihr Stil dies nahe – da aber war Arthur Ströhm nicht mehr Junggeselle, ergo auch nicht mehr Mitglied der Schwarzhäupter. Hatten sich die Sitten seither derart gelockert, daß auch verheiratete Mitglieder noch im Haus verkehren durften? Oder waren die Namen Hinweise auf Stuhl-Stiftungen?
Doch schließlich bringt das Staunen solche Fragen zum Verstummen: Der Archivar berichtet, Inventar dieser Art, ob aus dem Schwarzhäupterhaus oder – er zeigt auf zwei Hocker – aus dem ersten estnischen Parlament, seien irgendwann nicht mehr modern, also auch nicht mehr gewünscht gewesen, man habe solche Möbel weggeworfen. 1939, spätestens 1944 gab es keine Deutschen mehr in Reval, also auch keine Schwarzhäupter. Von wie vielen Stühlen der Schwarzhäupter überlebten wie viele? Jedenfalls fanden besagte fünf ihren Weg in die Sicherheit, das Stadtarchiv, vier von ihnen benamst. Und ausgerechnet einer der drei Lehnstühle trägt den Namen meines Großvaters! Was sagen wir denn dazu?
So wenig wie möglich. Wir teilen unsere Erregung dem Archivar mit, der erlebt Minuten intensiver Geschichtlichkeit, als die 89jährige Tochter des Konsuls auf dem ca. 70jährigen Stuhl ihres Vaters Platz nimmt und sich da ablichten läßt, wo früher nach menschlichem Ermessen keine Frau sitzen durfte.
Denkspiel: Alles könnte natürlich auch Teil eines raffinierten Ränkespiels sein. Dem Archivar werden rechtzeitig die Familiennamen der zu erwartenden Gäste mitgeteilt, und er gibt der Werkstätte den Auftrag, Erinnerungsstücke nach Informationen des Archivs herzustellen – vom Ehrenstuhl bis zum Schulzeugnis. Die läßt er die Töchter/Söhne/Enkelinnen/Enkel »zufällig« finden, um sodann, nachdem die Freude und das Erstaunen sich gelegt haben, mit einer Klage zu beginnen, die knappe Lage des Archivs betreffend. Fazit: Man könne sich unter Umständen von solchen Erinnerungsstücken trennen, gegen eine Spende natürlich.
Was wäre natürlicher als die freudige Zustimmung der Gäste: Großvaters Schwarzhäupterstuhl in den eigenen vier Wänden zu haben samt der unbezahlbaren Fund- und Erwerbsgeschichte – wäre das nicht lumpige drei- bis fünftausend Mark wert?
Keine Obstbäume mehr in Kambja
Mit Fahrer machen wir uns auf die Suche nach Kambja, dem Kamby der Erzählungen, dem Gutshaus der väterlichen Linie, ca. 200 Kilometer von Reval und 15 von Dorpat entfernt. Da der Fahrer sich verfährt, wird es etwas aufregender – eigentlich ist der Ort leicht zu finden, man fährt von Dorpat einfach Richtung Vöru. Muttchen: »Es ist zwar peinlich, in Vöru geboren zu sein, aber nicht zu ändern.«
Wir dagegen waren eine Straße zu früh abgebogen, nach etwa 10 Kilometern umgekehrt, bogen wir wieder in die verlassene Straße ein, sahen kurz darauf das Schild Kambja. Muttchen, auf einen Laden deutend: »Das ist der Körz, da durften wir nicht hin, hier muß es gleich sein«, und da war’s auch schon, nahe der Straße gelegen, ein renoviertes Gutshaus, gelb-weiß, davor ein Rondell mit Rosen, alles umstanden von alten Bäumen, alles in allem ein rechtes Inbild von Ländlichkeit, Behäbigkeit, Herrschaftlichkeit.
Drumherum zerfallene Stallungen, jedenfalls vom Zerfall bedrohte, aus den Bäumen einer Anhöhe ragt ein Kirchturm, der renoviert wird. Ein See, der früher zum Gut gehört hat, ältere und moderne, kastenförmige Häuser – das alles liegt sehr locker zerstreut in einer anmutigen Gegend, gehügelt und grün, Laubbäume und Kiefern.
Im Gutshaus ist heute das Rathaus, 1989 hat man das alles renoviert und mit schmiedeeisernen Überdachungen versehen, auf einer steht: Kambja 1989.
»Die alte Eingangstür«, sagt Muttchen, »links war der Saal.« Der ist da immer noch, aber abgeschlossen. Hinterm Haus: keine Obstbäume mehr, viel Wiese, bis zum See – da sei die Terrasse gewesen.
Sehr feudal, sagt L., doch Muttchen rückt zurecht: Sehr kalt im Winter, Mamma Minna habe immer nach Dorpat umziehen müssen. Die schweren Zeiten im Krieg: Die Jungs hätten sich mit Grütze über Wasser halten müssen. Nach der Enteignung sei ohnehin kein Auskommen mehr gewesen, wie denn auch, mit so wenig Land.
Ich denke an das alte Foto, das die Familie vor dem Rondell postiert zeigt, der Vater trägt eine Art Reformkleidung, im Hintergrund das Haus. Nun, in einer Art Überblendung, nehmen Muttchen und ich an etwa gleicher Stelle Haltung ein und lassen uns von L. ablichten. Ein weiteres Foto dieser Art wird es nicht geben können, mangels Nachwuchs, und ob der, hätte es ihn gegeben, noch mal den weiten Weg gemacht hätte, ist doch mehr als fraglich.
Auf Reisen – oder nie – lernt man es, Ansprüche zu stellen
»Nein, ich hätte gern ein Zimmer mit Meeresblick.«
»Haben wir leider im Moment nicht.«
»Wann wird eins frei?«
»Vielleicht Sonntag.«
»Kann ich damit rechnen?«
»Fragen Sie Sonntag vormittag an der Rezeption. Nein, besser nachmittag.«
Dann heißt es sich einen Ruck geben und fragen. Der Umzug klappt, doch nun stören Straßenbahnen. Wird man sich an die gewöhnen? Oder abermals um ein neues Zimmer bitten, diesmal ohne Meeresblick, aber ruhiger?
Jede Frage kann schließlich abschlägig beschieden werden, und jede Verweigerung ist eine Kränkung. Wer will die schon riskieren? Also gar nicht erst fordern, sondern die ganze Woche nicht auf Meer und Altstadt blicken?
Weitere Aufgaben:
Die Musik im Frühstücksraum ist zu laut. Darum bitten, sie leiser zu stellen, oder einfach schneller frühstücken?
Der Taxifahrer fordert einen unverständlich hohen Preis für die gewünschte, kurze Strecke. Weitersuchen, oder die Summe von 40 Eestikronen zahlen, obwohl dieselbe Fahrt am Vortage 6 Kronen gekostet hatte? (Wir bestellten ein Taxi zum Hotel, das dann 18 Kronen kostete, wegen Telefonzusatzgebühr und weil der Fahrer einen – wie wir meinten – unsinnigen Bogen gefahren war. Erst später stellte sich bei genauer Betrachtung der Verkehrslage vor dem Hotel heraus, daß der Fahrer sich korrekt, der billige Fahrer vom Vortage jedoch verkehrswidrig verhalten hatte.)
Im Panoramascheibenseeblick-Lokal ist abgedunkelt worden, da die tiefstehende Sonne blendet. Allerdings sind die Ziehharmonika-Jalousien auch da geschlossen, wo die Sonne nicht scheint. Auf der Aussicht bestehen? Die Ober verstehen die Bitten nicht. Selber tätig werden?
Die Steigerung solcher Fragen ergibt sich durch den einfachen Umstand, daß ein Paar (oder eine Dreiergruppe) sich ihnen stellt – oder auch nicht.
A: Die Musik ist ziemlich laut.
B: Findest du?
A: Du nicht?
Beide frühstücken.
A: Na ja, morgen sind wir ja weg.
B: Aber laut ist sie heute, die Musik.
A: Findest du?
B: Hast du gefunden, grad eben.
A: Dir ist sie nicht zu laut?
Beide frühstücken.
B: Wenn dir die Musik zu laut ist, sag es bitte. Aber sag es nicht mir, sondern dem Typen, der die Zimmernummern am Eingang kontrolliert.
A: Ich bin ja gleich fertig.
B: Aber ich nicht. Ich möchte in aller Ruhe frühstücken!
A: Das nennst du ruhig?
B: Deine Hetze?
A: Nein. Die Musik.
Beide frühstücken.
B: Du meinst also, ich soll darum bitten, daß die Musik leiser gestellt wird.
A: Wie kommst du denn jetzt darauf?
B: Warum sagst du mir sonst, daß die Musik zu laut ist?
A: Vielleicht wollte ich nur etwas Solidarität. Oder etwas Bestätigung. Wenn man etwas feststellt, dann heißt das doch nicht gleich, daß man etwas ändern will.
B: Man nicht. Man hält sich raus. Man sagt das nämlich nur, damit der andere das Gefühl bekommt, er müßte jetzt was tun.
A: Aber jetzt mach mal einen Punkt! Wenn ich sage: Die Serben verhalten sich vor Sarajewo verbrecherisch – dann heißt das doch nicht, daß du etwas dagegen tun solltest!
B frühstückt.
A: Oder wenn ich sage: Schrecklich, diese Tornados in Florida.
B frühstückt.
A: Oder wenn ich sage: Die Musik ist ziemlich laut.
B: Findest du wirklich, daß das drei vergleichbare Aussagesätze sind?
A: Du nicht?
Beide frühstücken. A verdreht leidend die Augen, als die Musik, die für einen Moment ausgesetzt hat, wieder beginnt.
B wirft wütend die Serviette hin und geht zum Mann hinter dem Schalter. Der sagt ihm, er werde veranlassen, daß die Musik leiser gestellt werde. B kehrt zum Tisch zurück.
A trinkt die Kaffeetasse leer und steht auf.
B: Was soll das? Wo ich gerade darum gebeten habe, die Musik leiser zu stellen.
A: Ich habe dich nicht darum gebeten, das zu tun, also auch keine Lust, dir in fortwährender Dankbarkeit gegenübersitzen zu müssen. Außerdem bin ich nicht nach X gekommen, um endlos zu frühstücken. Ich will schließlich auch was von der Stadt sehen.
Was tut B? Ist die gemeinsame Reise noch zu retten?
Die beiden wollen einchecken, etwas zu langsam, denn bevor sie den Schalter der Economy Class erreichen, stellt sich da bereits eine Gruppe lärmender Amerikaner an. Daneben, bei der Business Class, dagegen: kein Klient.
Wer der beiden kommt auf die Idee, es dort zu versuchen? Wer führt die Idee aus?
»Die alten Kinderfragen«
Österreich 1989, 1992, 1996, 2000, 2001
Innsbruck: Mindermaler und Chinesen
Im Tiroler Landesmuseum mal wieder die ziemlich unwiderlegbare Gewißheit, daß die Jahre zwischen 1830 und 1890 zu den erfreulicheren der Malerei gehört haben, und das weltweit.
Durchschreitet man nämlich die Säle, die vom Mittelalter bis heute ausschließlich Mindermaler versammeln, so werden die Nachteile der jeweiligen Zeitstile grausam deutlich: Das Hölzerne der gotischen Malerei, das formelhaft Dumme der Barockmalerei, die sagenhafte Uninspiriertheit und Unsinnlichkeit des Klassizismus, doch dann, zumal in minderen Sujets, vor allem aber in Landschaften leuchten noch einmal die Suggestionsmöglichkeiten der Malerei auf; all die Techniken und Tricks, die seit den pompejanischen Wandmalereien entwickelt worden sind, um Illusionen herzustellen, zu inszenieren und zu überwältigen, werden noch einmal in den Dienst meist unerheblicher Inhalte gestellt. Wie da ein Herr Unterberger einen Blick auf Amalfi zaubert, das hat schon etwas leicht Wahnsinniges, wie da Vordergrund und Verdämmern mit stets kontrollierbaren, im Detail jedoch unfassbar körperlosen Mitteln hergestellt werden – all das ist ein malerischer Schwanengesang, dem die Nachfolgezeiten nichts an die Seite zu stellen haben: Da nun jeder ein Originalgenie sein muß, ist fortan der Mindermaler zur absoluten Unerheblichkeit verdammt.
(1989)
Lokal in Innsbruck: »China Restaurant Peking, Internationale Küche, Tiroler Bauernkeller«.
Der Taxifahrer, besinnlich: »Da hat man mal gut essa kenna – aber die Tiroler Küch ist zu teuer, der Kines macht’s Renna.«
(1992)
Wien: Kaiserschützen und Wunderwerke
Im Café Griensteidl hängt eine große Kopie des Klimtschen »Kusses« – »Gustav Klimt« hieß bereits die Lauda-Air-Maschine, die mich nach Wien brachte –, und je länger ich das Paar betrachtete, desto unabweisbarer die Einsicht, daß sich da ein sehr ungleiches Paar karessiert: Wenn sie aufsteht, überragt sie ihn derart, daß ein Gegenkuß auf ein fast kindlich bemessenes Gegenüber stieße. Wenn sie nicht mehr kniete, müßte er aufschauen.
»Die letzten Kaiserschützen aus dem Völkerringen 1914–1918 ihren toten Kameraden RGT Nr 1 Trient Nr 2 Bozen Nr 3 Innichen. Getreu ihrem Wahlspruch ›Sieg oder Tod im Alpenrot‹ starben 502 Offiziere und über 15500 Mann für das Vaterland.«
(Es liegt in der Natur der Sache, daß die letzten Kaiserschützen diejenigen sind, die die Hunde nicht gebissen haben: Wären sie ihrem Wahlspruch nicht untreu geworden, hätten sie den toten, wahlspruchgetreuen Kameraden keine Gedenktafel in der Votivkirche setzen können.)
Allein mit sieben Bildern von Velázquez. Auf mich blicken von vorn 1 Infantin (Maria Teresa), von hinten der König und die Königin, von der Seite 1 König, dreimal Margarita Teresa und ein Infant. Wenig Besucher, daher diese Momente des Alleinseins mit dem Dargestellten, wobei besonders die sprunghaft heranwachsende Margarita Teresa einen sehr lebendigen, etwas unheimlichen Effekt macht: In immergleicher Haltung wird sie von Bild zu Bild älter – das hat etwas von jenen Foto-Sequenzen, in denen jemand den gleichen Gegenstand konstant ablichtet.
Tritt man näher, stellt sich immer wieder das Gefühl ein, daß es besser nicht geht: Besser kann man Stoff nicht malen, die Hand nicht aufliegen lassen, die Informationen nicht reduzieren und zugleich verdichten. Die Folge: Ein gesteigertes Lebensgefühl, eine Kräftigung des Gemüts und des Verstandes, des ersten, weil ihm die Farben und deren Zusammenspiel guttun, des zweiten, weil der die Eleganz der Lösungen als hochbefriedigend empfindet: Da soll ein König gemalt werden, mit allen Insignien der Macht und vor repräsentativem Hintergrund? Der Maler kommt auf die denkbar einfachste, zeitsparendste und bildhafteste Lösung: Roter Vorhang als Fond, winziger Ausblick auf eine Balustrade, Schwert, Handschuh und Zettel als Insignien. Eine Kunst, die Maßstäbe setzt, aus sich selber. Der Infant ist ein schwaches Bild (ein sehr schwacher Velázquez nota bene): Da hat er den Kampf gegen Quasten und Kleidungsdekor lustlos gekämpft und nach Punkten verloren. Sein Pinsel addiert und führt alle Schlaufen und Schmuckborten mit der gleichen mäßigen Genauigkeit aus. Um so größer das Fest, das er auf dem Bild der jüngsten Margarita bereitet: Ein Wunderwerk an höchstintelligenten Tupfern und Verschleifungen, die evozieren, was er braucht, Haut und Haar, Blume und Seide, Fläche, Rundung und Raum.
Joseph Heintz, Bartholomeus Spranger, Jodocus van Winghe, Hans von Aachen – alles Hofmaler von Rudolf II