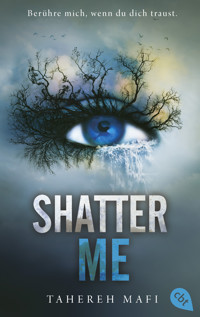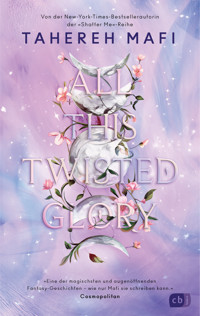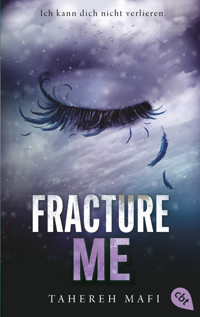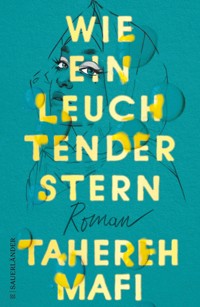8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Shatter me
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Die BookTok-Sensation SHATTER ME in deutscher Übersetzung
Die Schlacht gegen das Reestablishment ist verloren, der Zufluchtsort der Rebellen zerstört, Juliettes Freunde sind in alle Winde zerstreut. Über das Schicksal ihrer großen Liebe Adam ist Juliette im Ungewissen – ebenso wie über ihre Gefühle für ihn. Die einzige Gewissheit, die sie noch hat, ist, dass sie das grausame Regime unbedingt besiegen muss. Doch dazu bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich Warner anzuvertrauen, dem einen Menschen, den sie auf ewig zu hassen schwor. Und der ihr das Leben rettete. Jetzt verspricht er, an ihrer Seite zu kämpfen. Doch kann Juliette ihm vertrauen? Und was will er wirklich von ihr? Der dritte Band der mitreißenden Romantasy-Saga. Auch lieferbar unter dem Titel »Ignite me«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Ähnliche
Buch
Die entscheidende Schlacht gegen das Reestablishment ist verloren. Omega Point, der geheime Zufluchtsort der Rebellen, ist zerstört. Und Juliettes Kampfgefährten, ihre Freunde, sind in alle Winde zerstreut – oder tot. Selbst über das Schicksal ihrer ersten großen Liebe Adam ist Juliette im Ungewissen, ebenso wie über ihre Gefühle für ihn. Geblieben ist ihr nur noch eine einzige Gewissheit: Sie muss das grausame Regime des Reestablishment unbedingt besiegen, koste es, was es wolle, selbst wenn sie sich dazu tatsächlich in die Hände von Warner begeben muss, Kommandeur von Sektor 45, Sohn des feindlichen Oberbefehlshabers – und durch eine seltsame Fügung des Schicksals nunmehr Juliettes einziger Verbündeter. Der eine Mensch, den sie auf ewig zu hassen schwor. Und der ihr Leben rettete, als sein Vater ihr eine Kugel in die Brust jagte. Jetzt verspricht er, an ihrer Seite gegen eben diesen Vater zu kämpfen. Doch kann sie ihm wirklich vertrauen? Wird er für sie auf Macht und Privilegien verzichten? Und was will er wirklich von ihr?
Tahereh Mafi
Ich brenne für dich
ROMAN
Deutsch von Mara Henke
Für meine Leserinnen und Leser.Habt Dank für eure Liebe und Unterstützung.Dieses Buch ist euch gewidmet.
1
Ich bin ein Stundenglas.
Meine siebzehn Lebensjahre sind in sich zusammengebrochen und haben mich von innen heraus begraben. Meine Beine sind mit Sand gefüllt und verschweißt, und Sandkörner rieseln auch durch meinen Kopf, unentschlossen, ungeduldig, während die Zeit aus meinem Körper rinnt. Der kleine Zeiger einer Uhr tippt mich an, um eins und zwei, um drei und vier, flüstert, hallo, aufwachen, aufstehen, es ist Zeit zum
Aufwachen
Aufwachen
»Aufwachen«, flüstert er.
Ein scharfes Einatmen, und ich bin wach, aber nicht aufrecht, verblüfft, aber nicht verstört, und blicke in abgrundtief grüne Augen, die viel zu viel zu wissen scheinen. Aaron Warner Anderson beugt sich über mich, seine Augen betrachten mich besorgt, seine Hand verharrt in der Luft, als habe er mich berühren wollen.
Er zuckt zurück.
Starrt mich weiter an. Seine Brust hebt und senkt sich.
»Guten Morgen«, krächze ich. Auf meine Stimme ist ebenso wenig Verlass wie auf Datum und Uhrzeit, wie auf die Worte, die mir über die Lippen kommen, wie auf diesen Körper, der meine Hülle ist.
Warner trägt ein weißes Button-Down-Hemd, das halb aus seiner erstaunlich faltenlosen schwarzen Hose hängt. Die Ärmel sind aufgerollt, hinter die Ellbogen geschoben.
Sein Lächeln sieht aus, als bereite es ihm Schmerzen.
Es gelingt mir, mich aufzusetzen, und Warner rückt beiseite, um mir Platz zu machen. Schwindel erfasst mich. Ich schließe die Augen und rühre mich nicht, bis das Gefühl verfliegt.
Ich bin geschwächt, erschöpft und hungrig, aber von ein paar Schmerzen hie und da abgesehen scheine ich unversehrt zu sein. Ich lebe. Ich atme und blinzle und fühle mich menschlich, und ich weiß genau, warum.
Ich sehe Warner an. »Du hast mir das Leben gerettet.«
Man hat mir in die Brust geschossen.
Warners Vater hat mir eine Kugel in die Brust gejagt, und ich spüre noch immer den Widerhall. Wenn ich mich konzentriere, erlebe ich den Moment aufs Neue; den Schmerz: so mörderisch, so unerträglich; nie werde ich ihn vergessen können.
Zittrig atme ich ein.
Ich nehme plötzlich den Raum wahr, der mir fremd und vertraut zugleich ist, und etwas in mir schreit panisch, dass ich doch ganz woanders eingeschlafen bin. Mein Herz rast, und ich rutsche nach hinten, stoße mir den Rücken am Kopfbrett des Bettes, meine Hände krallen sich in die Laken, und ich versuche nicht auf den Kronleuchter zu starren, an den ich mich nur allzu gut erinnere –
»Alles ist in Ordnung«, sagt Warner. »Keine Sorge –«
»Wieso bin ich hier?« Panik, Panik; Grauen vernebelt meine Gedanken. »Wieso hast du mich hierhergebracht –?«
»Juliette, bitte, ich werde dir nichts antun –«
»Warum hast du mich dann wieder hierhergebracht?« Meine Stimme bricht, ich ringe um Beherrschung. »Wieso hast du mich an diesen grauenhaften Ort –«
»Ich musste dich verstecken.« Er seufzt und starrt an die Wand.
»Was? Warum?«
»Weil niemand weiß, dass du am Leben bist.« Er sieht mich an. »Ich musste zurück zum Hauptquartier. Ich musste so tun, als sei alles in Ordnung und als hätte ich es furchtbar eilig.«
Ich zwinge mich, die Angst wegzuschließen.
Ich betrachte Warners Gesicht und versuche seinen ruhigen, ernsthaften Tonfall einzuschätzen. Die Erinnerung an letzte Nacht kehrt zurück – es muss Nacht gewesen sein –, an sein Gesicht, als er im Dunkeln neben mir lag. Er war behutsam und sanft und fürsorglich, und er hat mich gerettet, hat mir das Leben gerettet. Hat mich wahrscheinlich ins Bett getragen, mich zugedeckt. Nur er kann das getan haben.
Doch als ich an mir herunterblicke, sehe ich, dass ich saubere Kleidung trage, ohne Blut oder Löcher oder andere Spuren, und ich frage mich, wer mich gewaschen und umgekleidet hat, und überlege beunruhigt, ob das wohl auch Warner getan hat. »Hast du …« Ich zögere, berühre das T-Shirt, das ich anhabe. »Hast du – ich meine – die Sachen hier –«
Er lächelt. Starrt mich an, bis ich rot anlaufe und zu dem Schluss komme, dass ich ihn gerade ein bisschen hasse. Dann schüttelt er den Kopf. Blickt auf seine Handflächen. »Nein. Das haben die Zwillinge gemacht. Ich habe dich nur ins Bett getragen.«
»Die Zwillinge«, flüstere ich benommen.
Die Zwillinge.
Tana und Randa. Die beiden Heilerinnen waren auch da, und sie haben Warner geholfen. Haben ihm geholfen, mich zu retten, weil er nun der Einzige ist, der mich berühren kann, der einzige Mensch auf der Welt, der die Heilenergie der Zwillinge in meinen Körper leiten konnte.
Meine Gedanken lodern.
Wo sind die Zwillinge, was ist mit ihnen passiert, und wo ist Anderson, und der Krieg, und o Gott, was ist mit Adam und Kenji und Castle, und ich muss aufstehen, ich muss aufstehen, ich muss aufstehen und etwas tun
aber
als ich mich bewegen will, muss Warner mich auffangen. Ich bin zu kraftlos und zittrig, fühle mich immer noch, als seien meine Beine im Bett verankert, und plötzlich kann ich nicht mehr richtig atmen, sehe Flecken vor den Augen, bin zu schwach. Muss aufstehen. Muss raus.
Kann nicht.
»Warner.« Meine Augen suchen sein Gesicht. »Was ist passiert? Was ist mit dem Kampf –?«
»Bitte.« Er hält mich an den Schultern fest. »Du musst es langsam angehen. Du solltest was essen –«
»Sag es mir –«
»Willst du nicht zuerst etwas essen? Oder duschen?«
»Nein«, höre ich mich sagen. »Ich muss es jetzt sofort wissen.«
Ein Moment. Zwei, drei.
Warner holt tief Luft. Eine Million weitere Momente. Seine rechte Hand legt sich auf die linke, dreht den Jadering am kleinen Finger, wieder und immer wieder. »Es ist vorbei«, sagt er.
»Was?«
Ich sage das Wort, aber meine Lippen geben keinen Laut von sich. Ich bin wie betäubt. Blinzle und sehe nichts.
»Es ist vorbei«, wiederholt Warner.
»Nein.«
Ich stoße das Wort mit dem Atem aus, stoße seine Unfassbarkeit aus.
Er nickt. Um mir zu widersprechen.
»Nein.«
»Juliette –«
»Nein«, sage ich. »Nein. Nein. Sag nicht so etwas Dummes. Sei nicht albern. Und lüg mich nicht an, verflucht«, meine Stimme ist jetzt brüchig und schrill und unstet und »Nein«, keuche ich, »nein, nein, nein –«
Diesmal gelingt es mir aufzustehen. Tränen schießen mir in die Augen, und ich blinzle und blinzle, aber die Welt ist Chaos, und ich will lachen, weil ich denke, wie grausam und wunderbar sie ist und dass unsere Augen die Wahrheit verschleiern, wenn wir es nicht ertragen können, sie zu sehen.
Der Boden ist hart.
Daran gibt es keinen Zweifel, denn er drückt plötzlich gegen mein Gesicht, und Warner versucht mich anzufassen, aber ich schreie wohl und schlage nach ihm, weil ich die Antwort schon kenne. Ich weiß die Antwort, weil das Grauen in mir aufsteigt und meine Eingeweide durchwühlt, aber ich frage dennoch. Ich liege quer, doch ich stürze noch immer, und die Löcher in meinem Kopf reißen auf, und ich starre auf den Teppich und weiß nicht, ob ich überhaupt noch lebe, aber ich muss es hören.
»Warum?«, frage ich.
Nur ein Wort, schlicht und dumm.
»Warum ist es vorbei, warum ist der Kampf vorbei?«, frage ich. Ich atme nicht mehr und spreche nicht richtig, spucke nur Buchstaben aus.
Warner wendet den Blick ab.
Er starrt an die Wand und auf den Boden und zum Bett und auf seine Knöchel, als er die Hände zur Faust ballt, aber er sieht mich nicht an, nein, mich schaut er nicht an, und seine nächsten Worte sind so leise, so leise.
»Weil sie tot sind, Süße. Weil sie alle tot sind.«
2
Mein Körper blockiert.
Meine Knochen, mein Blut, mein Hirn erstarren, sind schlagartig wie gelähmt, und ich kann kaum noch atmen. Mühsam ringe ich um Luft, und die Wände vor meinen Augen schwanken unerbittlich.
Warner nimmt mich in die Arme.
»Lass mich los!«, schreie ich, aber nur in meiner Fantasie, denn meine Lippen können sich nicht mehr bewegen, und mein Herz ist stehen geblieben, und mein Geist ist Schrott, und meine Augen meine Augen scheinen zu bluten. Warner flüstert Trostworte, die ich kaum höre, und seine Arme umklammern mich, versuchen mich durch körperliche Kraft zusammenzuhalten, aber das ist sinnlos.
Ich fühle rein gar nichts.
Warner wiegt mich, murmelt beruhigend, und erst jetzt merke ich, dass ich einen entsetzlichen, markerschütternden Laut von mir gebe, weil der Schmerz mich zerfetzt. Ich will sprechen, widersprechen, Warner beschuldigen, ihn einen Lügner schimpfen, aber ich kann nichts sagen, keine Laute formen, nur diese Töne, die so jämmerlich sind, dass ich mich meiner selbst schäme. Ich reiße mich los, krümme mich keuchend zusammen, umklammere meinen Bauch.
»Adam«, würge ich.
»Juliette, bitte –«
»Kenji.« Ich atme hastig und stoßweise, vornübergebeugt.
»Bitte, Süße, ich möchte dir helfen –«
»Was ist mit James?«, höre ich mich fragen. »Er war in Omega Point – er durfte n-nicht – m-mitkommen –«
»Es ist alles zerstört worden«, sagt Warner langsam und tonlos. »Alles. Sie haben einige von euren Leuten so schlimm gefoltert, dass sie die Lage von Omega Point verraten haben. Dann hat das Reestablishment alles in die Luft gejagt.«
»O Gott.« Ich schlage die Hand vor den Mund und starre zur Decke.
»Es tut mir so leid«, sagt Warner. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr.«
»Lügner«, flüstere ich, mit Hass in der Stimme. Ich bin jetzt zornig und gemein und will nicht gerecht sein. »Es tut dir überhaupt nicht leid.«
Ich werfe ihm einen raschen Blick zu und sehe, wie der Schmerz in seinen Augen aufblitzt und wieder erlischt. Warner räuspert sich.
»Es tut mir leid«, wiederholt er, leise, aber entschieden. Nimmt seine Jacke vom Kleiderständer, schlüpft hinein.
»Wo gehst du hin?« Ich fühle mich sofort schuldig.
»Du brauchst Zeit, um das zu verarbeiten, und legst offenbar keinen Wert auf meine Gesellschaft. Ich werde ein paar Sachen erledigen, bis du bereit bist zu reden.«
»Bitte sag mir, dass du dich irrst.« Meine Stimme bricht, und mir stockt der Atem. »Sag mir, es gibt noch eine Chance, dass du dich irrst –«
Warner blickt mich lange eindringlich an. »Wenn ich auch nur die geringste Möglichkeit hätte, dir diesen Schmerz zu ersparen«, sagt er schließlich, »würde ich sie nutzen. Du musst doch wissen, dass ich es dir nicht gesagt hätte, wenn es noch Zweifel gäbe.«
Und das – seine Aufrichtigkeit – reißt mich endgültig entzwei.
Denn die Wahrheit ist so unerträglich, dass ich wünschte, er würde mich belügen.
Ich weiß nicht mehr, wann Warner hinausging.
Ich weiß nicht mehr, was er vorher sagte. Ich weiß nur, dass ich eine Ewigkeit zusammengekrümmt auf dem Boden liege. So lange, dass von meinen Tränen nur noch Salz bleibt, dass mein Hals austrocknet, dass meine Lippen rissig werden, dass mein Kopf so dröhnend hämmert wie mein Herz.
Langsam richte ich mich auf, spüre, wie sich mein Gehirn verzerrt. Es gelingt mir, mich zum Bett zu hangeln und mich daraufzusetzen, immer noch benommen, aber ein klein wenig klarer im Kopf. Ich ziehe die Knie an die Brust.
Ein Leben ohne Adam.
Ein Leben ohne Kenji, ohne James und Castle und Tana und Randa und Brendan und Winston und alle anderen von Omega Point. Meine Freunde, alle zerstört durch einen einzigen Knopfdruck.
Ein Leben ohne Adam.
Ich umschlinge meine Knie, bete, dass der Schmerz nachlässt.
Er tut es nicht.
Adam ist nicht mehr da.
Meine erste Liebe. Mein erster Freund. Mein einziger Freund, als ich niemand anderen hatte, und nun ist er nicht mehr da, und ich weiß nicht, wie mir zumute ist. Merkwürdig vor allem. Wie im Wahn. Leer und gebrochen und betrogen und schuldig und zornig und hoffnungslos, hoffnungslos traurig.
Wir hatten uns entfremdet, seit wir in Omega Point Zuflucht gesucht hatten, aber das war hauptsächlich meine Schuld gewesen. Er wollte mehr von mir, aber ich wünschte ihm ein langes Leben. Wollte ihn schützen vor den Schmerzen, die ich ihm zugefügt hätte. Ich hatte versucht ihn zu vergessen, ohne ihn weiterzumachen, mich auf eine Zukunft ohne ihn vorzubereiten.
Ich hatte geglaubt, sein Leben retten zu können, indem ich ihm fernblieb.
Dumm.
Die Tränen sind frisch und fallen schnell, rinnen lautlos über meine Wangen und in meinen keuchenden Mund. Meine Schultern zucken, meine Hände ballen sich zu Fäusten, mein Körper verkrampft sich, meine Knie schlagen aneinander, und alte Gewohnheiten kriechen aus meinem Inneren, und ich zähle Risse und Farben und Laute und mein eigenes Schaudern und wiege mich vor und zurück vor und zurück vor und zurück, und ich muss ihn loslassen loslassen loslassen loslassen loslassen
Ich schließe die Augen
und atme.
Raue, harte, rasselnde Atemstöße.
Ein.
Aus.
Zählen.
Ich kenne das, sage ich mir. Ich war schon viel einsamer, hoffnungsloser, verzweifelter. Ich kenne das und habe es überlebt. Ich kann das durchstehen.
Doch nie zuvor bin ich so brutal beraubt worden – Liebe und Chancen, Freundschaften und Zukunft: weg. Ich muss ganz von vorne anfangen, der Welt wieder alleine gegenübertreten. Eine finale Entscheidung treffen: aufgeben oder weitermachen.
Ich stehe auf.
Mein Kopf dreht sich, meine Gedanken kollidieren, aber ich schlucke die Tränen hinunter. Ich balle die Fäuste und unterdrücke die Schreie und verwahre meine Freunde in meinem Herzen und
Rache
erschien mir noch nie
süßer.
3
Festhalten
Durchhalten
Kopf hoch
Stark sein
Durchhalten
Festhalten
Stark wirken
Aufrecht halten
Irgendwann
Irgendwann werde ich
zer-brechen
Irgendwann werde ich
aus-brechen
Irgendwann werde ich
frei
sein
Warner kann sein Erstaunen nicht verbergen, als er wieder hereinkommt.
Ich schaue auf, klappe mein Notizheft zu. »Ich nehme das wieder an mich«, sage ich.
Er blinzelt. »Es geht dir besser.«
Ich nicke. »Mein Notizheft lag da auf dem Nachttisch.«
»Ja«, sagt er langsam. Zögernd.
»Ich nehme es wieder an mich.«
»Ja.« Er steht immer noch an der Tür, reglos, starrt mich an. »Willst du«, er schüttelt den Kopf, »tut mir leid, ich meine, willst du irgendwohin gehen?«
Erst jetzt merke ich, dass ich schon auf halbem Wege zur Tür bin. »Ich muss raus hier.«
Warner bleibt stumm. Er macht ein paar Schritte, hängt seine Jacke über einen Stuhl. Zieht drei Pistolen aus seinen Holstern und legt sie bedächtig auf den Nachttisch, auf dem zuvor mein Notizheft lag. Als er aufschaut, spielt ein leichtes Lächeln um seine Lippen.
Er steckt die Hände in die Taschen. Das Lächeln wird breiter. »Wo willst du denn hin, Süße?«
»Ich muss einiges erledigen.«
»Ach ja?« Er lehnt sich an die Wand, verschränkt die Arme vor der Brust. Lächelt noch immer.
»Ja.« Ich werde wütend.
Warner wartet. Starrt mich an. Nickt, als wolle er sagen: weiter.
»Dein Vater –«
»Ist nicht hier.«
»Oh.«
Ich versuche meine Bestürzung zu verbergen, weiß aber plötzlich nicht mehr, weshalb ich sicher war, Anderson würde noch hier sein. Das erschwert die Lage.
»Du hast echt geglaubt, du könntest hier einfach so rausspazieren«, sagt Warner, »bei meinem Vater an die Tür klopfen und ihn erledigen?«
Ja. »Nein.«
»Lügen haben kurze Beine«, sagt Warner leise.
Ich funkle ihn wütend an.
»Mein Vater ist im Kapitol«, sagt Warner, »und hat Tana und Randa mitgenommen.«
Ich keuche entsetzt. »Nein.«
Jetzt lächelt Warner nicht mehr.
»Sind sie … noch am Leben?«
»Ich weiß es nicht.« Er zuckt die Achseln. »Ich denke schon, denn in anderem Zustand würden sie meinem Vater ja nichts nützen.«
»Sie leben?« Mein Herz rast jetzt so, als würde ich gleich einen Infarkt bekommen. »Ich muss sie zurückholen – ich muss sie finden, ich –«
»Was?« Warner betrachtet mich forschend. »Wie willst du denn an meinen Vater rankommen? Wie willst du gegen ihn kämpfen?«
»Weiß ich noch nicht!« Ich wandere im Zimmer auf und ab. »Aber ich muss die Zwillinge finden. Sie sind vielleicht die einzigen Freunde, die ich noch habe auf der Welt und –«
Ich verstumme.
Fahre herum. Das Herz schlägt mir bis zum Hals.
»Vielleicht haben auch noch andere überlebt?«, flüstere ich, obwohl ich es kaum zu hoffen wage.
Ich trete zu Warner.
»Vielleicht gibt es noch weitere Überlebende?«, sage ich, jetzt lauter. »Vielleicht verstecken sie sich irgendwo?«
»Unwahrscheinlich.«
»Aber es könnte doch sein, oder?«, frage ich drängend. »Wenn auch nur die geringste Chance besteht –«
Warner seufzt. Reibt sich den Hinterkopf. »Wenn du die Verwüstung gesehen hättest, würdest du so was nicht sagen. Hoffnung wird dir das Herz nur aufs Neue brechen.«
Meine Knie geben nach.
Ich atme zu schnell, und mit zitternden Händen halte ich mich am Bettgestell fest. Nichts weiß ich mehr. Ich weiß nicht genau, was mit Omega Point geschehen ist. Ich weiß nicht, wo das Kapitol ist und wie ich dorthin kommen könnte. Ich weiß nicht einmal, ob ich noch beizeiten zu Tana und Randa gelangen würde. Doch die plötzliche, vielleicht sinnlose Hoffnung, dass weitere Freunde überlebt haben, kann ich nicht aufgeben.
Weil meine Freunde stärker sind als diese Katastrophe – und klüger.
»Sie waren schon seit so langer Zeit auf Krieg vorbereitet«, höre ich mich sagen. »Sie müssen irgendeinen Notplan gehabt haben. Ein Versteck –«
»Juliette –«
»Ach, verflucht, Warner! Ich muss es versuchen. Du musst mir erlauben, nach ihnen zu suchen.«
»Das ist nicht gut.« Warner sieht mich nicht an. »Es ist gefährlich für dich zu glauben, dass jemand von ihnen überlebt haben könnte.«
Ich starre auf sein klares, markantes Profil.
Er betrachtet seine Hände.
»Bitte«, flüstere ich.
Er seufzt. »Ich muss in den nächsten Tagen die Siedlungen aufsuchen, um mir einen Eindruck von den Wiederaufbauprozessen zu verschaffen.« Seine Stimme klingt angespannt. »Wir haben viele Zivilisten verloren. Zu viele. Die Überlebenden sind natürlich traumatisiert und entmutigt, genau wie es mein Vater bezweckt hat. Sie haben jegliche Hoffnung auf Rebellion aufgegeben.«
Er holt tief Luft.
»Und jetzt muss die Ordnung so schnell wie möglich wiederhergestellt werden«, fährt er fort. »Die Leichen werden eingesammelt und verbrannt. Die zerstörten Siedlungsbauten werden ersetzt. Die Bürger werden gezwungen, wieder zur Arbeit zu gehen, Waisen werden anderswo untergebracht und die restlichen Kinder angehalten, wieder ihre Schulen zu besuchen. Das Reestablishment«, endet er, »gewährt den Menschen keine Zeit für Trauer.«
Ein schweres Schweigen lastet im Raum.
»Während ich die Siedlungen inspiziere«, sagt Warner, »kann ich es einrichten, dich nach Omega Point zu bringen. Ich kann dir zeigen, was geschehen ist. Und dann, wenn du es mit eigenen Augen gesehen hast, musst du dich entscheiden.«
»Was soll ich entscheiden?«
»Was du als Nächstes tun willst. Du kannst bei mir bleiben«, er zögert, »oder, falls dir das lieber ist, könnte ich dafür sorgen, dass du irgendwo unbemerkt in einer Sperrzone leben kannst. Doch das wird ein einsames Dasein werden«, fügt er hinzu. »Man darf dich ja niemals entdecken.«
»Oh.«
Wir bleiben beide stumm.
»Ja«, sagt er.
Wieder Schweigen.
»Oder«, sage ich, »ich verschwinde von hier, suche deinen Vater auf, bringe ihn um und muss dann eben im Alleingang mit den Folgen zurechtkommen.«
Warner versucht ein Lächeln zu unterdrücken, scheitert jedoch.
Er blickt zu Boden und lacht ein wenig in sich hinein, bevor er aufschaut und mich kopfschüttelnd ansieht.
»Was ist so witzig?«
»Mein liebes Mädchen.«
»Was?«
»Auf diesen Moment warte ich schon so lange.«
»Was meinst du damit?«
»Endlich bist du bereit«, antwortet er. »Endlich bist du bereit zu kämpfen.«
Die Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag. »Natürlich bin ich bereit.«
Im selben Moment werde ich von Erinnerungen an den Kampf durchflutet, an die Angst, erschossen zu werden. Ich habe meine Freunde, meine Überzeugung, meine Entschiedenheit, etwas zu verändern, nicht vergessen. Meinen Willen, wirklich etwas zu bewegen. Zu kämpfen, ohne das geringste Zögern. Was auch geschieht – und was ich auch entdecken werde –, es gibt kein Zurück mehr für mich. Ich habe keine Alternativen.
Das habe ich nicht vergessen. »Ich schlage mich durch oder sterbe.«
Warner lacht laut, sieht aber aus, als sei er den Tränen nahe.
»Ich werde deinen Vater töten«, bekräftige ich, »und ich werde das Reestablishment zerstören.«
Warner lächelt immer noch.
»Ich werde es tun.«
»Ich weiß«, sagt er.
»Wieso lachst du mich dann aus?«
»Das tue ich nicht«, sagt er leise. »Ich frage mich nur, ob du mich dabei an deiner Seite haben möchtest.«
4
»Was?« Ich blinzle ungläubig.
»Ich habe dir immer schon gesagt, dass wir ein exzellentes Team abgeben würden. Ich habe immer schon gesagt, dass ich warte, bis du bereit bist – bis du deine Wut, deine Kraft erkennst. Darauf warte ich seit dem Tag, als ich dich kennenlernte.«
»Aber du wolltest mich für das Reestablishment benutzen – du wolltest, dass ich unschuldige Menschen foltere –«
»Das stimmt nicht.«
»Was? Wovon redest du? Du hast mir doch selbst gesagt –«
»Ich habe gelogen.« Er zuckt die Achseln.
Mir bleibt der Mund offen stehen.
»Es gibt drei Dinge, die du über mich wissen musst, Süße.« Warner macht einen Schritt auf mich zu. »Erstens: Ich hasse meinen Vater mehr, als du jemals auch nur annähernd verstehen könntest.« Er räuspert sich. »Zweitens: Ich bin ein sträflich selbstsüchtiger Mensch, der in fast jeder Situation nur nach seinen eigenen Interessen handelt. Und drittens:« Er blickt zu Boden. Lacht leise. »Hatte ich niemals die Absicht, dich als Waffe zu benutzen.«
Es hat mir die Sprache verschlagen.
Ich taumle rücklings zum Bett, sacke darauf.
Wie betäubt.
»Das war ein ausgeklügelter Plan, den ich nur meines Vaters wegen ersonnen habe«, erklärt Warner. »Ich musste ihn davon überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, in jemanden wie dich zu investieren. Dass wir dich zu militärischen Zwecken einsetzen könnten. Und offen gestanden habe ich immer noch keine Ahnung, wie es mir gelungen ist, ihn davon zu überzeugen. Es ist eine vollkommen absurde Idee, so viel Zeit, Geld und Energie aufzuwenden, um ein mutmaßlich psychotisches Mädchen zum Folterwerkzeug zu machen.« Er schüttelt den Kopf. »Ich wusste von Anfang an, dass es ein aussichtsloses Unterfangen sein würde, totale Zeitvergeudung. Es gibt weitaus effektivere Methoden, widerspenstigen Menschen Informationen zu entlocken.«
»Aber – aber was wolltest du dann von mir?«
Sein Blick ist erschütternd aufrichtig. »Ich wollte dich studieren.«
»Was?«, keuche ich.
Er wendet sich ab. »Wusstest du«, sagt er so leise, dass ich ihn kaum verstehen kann, »dass meine Mutter in diesem Haus lebt?« Er schaut zur Tür. »In dem Haus, in das mein Vater dich gebracht hat. In dem er auf dich geschossen hat. Sie war dort in ihrem Zimmer. Auf demselben Flur, auf dem auch du untergebracht wurdest.«
Als ich stumm bleibe, wendet sich Warner mir wieder zu.
»Ja«, flüstere ich. »Dein Vater hat sie erwähnt.«
»Wirklich?« Entsetzen flackert kurz in seinen Augen auf, aber er hat sich schnell wieder im Griff. »Und was?«, fragt er, bemüht ruhig, »hat er über sie gesagt?«
»Dass sie krank ist«, sage ich und hasse mich selbst, als ich sehe, wie Warner zusammenzuckt. »Dass er sie dort untergebracht hat, weil sie in den Siedlungen nicht leben kann.«
Warner lehnt sich an die Wand, als bräuchte er sie als Stütze, und holt tief Luft. »Ja«, sagt er schließlich. »Das stimmt. Sie ist krank. Es begann ganz plötzlich.« Er blickt auf einen Punkt in weiter Ferne. »Als ich klein war«, spricht er weiter und dreht unentwegt den Jadering an seinem Finger, »schien sie mir ganz normal. Doch dann, eines Tages … brach sie plötzlich zusammen. Jahrelang habe ich versucht bei meinem Vater durchzusetzen, dass sie Hilfe bekommt, aber er wollte sich nie darum kümmern. Schließlich habe ich mich im Alleingang um eine Behandlung für sie bemüht, aber wen ich auch aufsuchte – kein Arzt konnte ihr helfen. Keiner«, er atmet mühsam ein, »konnte herausfinden, was ihr fehlt. Sie lebt in einem Zustand ständiger Qual. Und ich war immer zu selbstsüchtig, sie sterben zu lassen.«
Er schaut auf.
»Dann hörte ich von dir. Gerüchte über dich. Und schöpfte zum ersten Mal Hoffnung. Ich wollte dich kennenlernen, wollte dich erforschen. Dich verstehen. Denn du schienst der einzige Mensch zu sein, der mir Aufschluss geben konnte über den Zustand meiner Mutter. Ich war vollkommen verzweifelt«, fügt er hinzu. »Ich war bereit, mich auf alles einzulassen.«
»Wie meinst du das?«, frage ich. »Wie sollte jemand wie ich deiner Mutter helfen können?«
Seine Augen, fahl vor Schmerz, suchen meine. »Weil du, Süße, niemanden berühren kannst. Und sie«, sagt er, »kann nicht berührt werden.«
5
Das Sprechen habe ich verlernt.
»Endlich verstehe ich ihr Leid«, sagt Warner. »Endlich begreife ich, wie sie sich wohl fühlt. Durch dich ist das möglich geworden. Weil ich sehen konnte, was es dir angetan hat – was es dir noch antut –, mit einer solchen Bürde zu existieren, über solche Kräfte zu verfügen und zwischen anderen leben zu müssen, die dich nicht verstehen.«
Er lehnt den Kopf an die Wand, presst die Handflächen auf die Augen.
»Ähnlich wie du«, fährt er fort, »hat sie wahrscheinlich das Gefühl, dass ein Ungeheuer in ihr lebt. Doch im Gegensatz zu dir ist sie selbst ihr einziges Opfer. Sie kann nicht in ihrer Haut leben. Sie kann nicht nur von anderen nicht berührt werden, sondern auch nicht von sich selbst. Kann sich nicht die Haare aus der Stirn streichen, die Hände nicht zu Fäusten ballen. Fürchtet sich zu sprechen, die Beine zu bewegen, die Arme auszustrecken, sich bequemer hinzulegen, weil die Berührung ihrer eigenen Haut ihr grauenhafte Schmerzen bereitet.«
Er lässt die Hände sinken.
»Es hat den Anschein«, sagt er, um Fassung bemüht, »dass etwas in der Wärme der menschlichen Nähe, des menschlichen Hautkontakts, diese grauenvolle zerstörerische Kraft in meiner Mutter freisetzt. Und weil sie sowohl der Erzeuger als auch das Opfer dieser Schmerzen ist, ist sie außerstande, sich selbst das Leben zu nehmen. Stattdessen vegetiert sie als Gefangene in ihrem eigenen Körper dahin und kann dieser selbstgeschaffenen Folter nicht entkommen.«
Meine Augen brennen furchtbar, und ich blinzle heftig.
So viele Jahre lang hatte ich mein eigenes Leben für schwierig gehalten; hatte geglaubt zu wissen, was Leiden bedeutet. Aber das. Das ist etwas, das ich nicht einmal annähernd begreifen kann. Niemals hatte ich in Erwägung gezogen, dass andere Menschen in einer schlimmeren Lage sein könnten als ich.
Ich schäme mich dafür, dass ich mich jemals selbst bemitleidet habe.
»Lange habe ich geglaubt, sie sei einfach … krank«, fährt Warner fort. »Ich dachte, sie hätte eine Krankheit, die ihr Immunsystem angreift, und hoffte, dass sie mit der richtigen Behandlung wieder gesund werden könnte. Doch Jahre vergingen, ohne dass sich ihr Zustand besserte. Schließlich zerstörten die chronischen Schmerzen ihr seelisches Gleichgewicht, und sie verlor den Lebenswillen, ergab sich ihrem Schicksal. Sie stand nicht mehr auf, aß nicht mehr regelmäßig, vernachlässigte ihre Körperhygiene. Und meinem Vater fiel nichts anderes ein, als sie unter Drogen zu setzen.
Er hält sie in diesem Haus unter Verschluss; nur eine Krankenschwester ist bei ihr. Inzwischen ist meine Mutter morphiumabhängig und auch psychisch krank. Sie erkennt mich nicht mehr. Als ich die Drogen wiederholt abgesetzt habe, hat sie versucht mich zu töten.« Er verstummt, scheint fast vergessen zu haben, dass ich noch im Raum bin. »Meine Kindheit war manchmal sogar beinahe erträglich«, fügt er dann hinzu, »aber nur wegen meiner Mutter. Und nun hat mein Vater sie endgültig zerstört, anstatt sich um sie zu kümmern, für sie zu sorgen.«
Er blickt auf und lacht bitter.
»Ich habe immer noch daran geglaubt, sie heilen zu können«, sagt er. »Ich dachte, wenn es mir gelänge, die Ursache zu finden – dann könnte ich etwas dagegen tun – etwas –« Er bricht ab, streicht sich übers Gesicht. »Ich weiß nicht«, flüstert er. Wendet den Blick ab. »Aber ich wollte dich niemals gegen deinen Willen benutzen. Das hatte ich niemals vor. Ich musste nur den Schein aufrechterhalten. Weil mein Vater nicht möchte, dass ich mich um meine Mutter kümmere.«
Sein Lächeln wirkt gequält und verzerrt, und er starrt auf die Tür.
»Er wollte ihr niemals helfen. Sie ist für ihn eine Last, die ihn anwidert. Und er bildet sich auch noch ein, ich sollte dankbar dafür sein, dass er so gütig ist, sie am Leben zu erhalten. Er findet, ich sollte mich damit zufriedengeben, dass er meine Mutter in eine degenerierte Kreatur verwandelt hat, so gequält von Schmerzen, dass sie dem Wahnsinn anheimgefallen ist.« Er streicht sich zittrig durch die Haare, greift sich in den Nacken.
»Aber ich konnte mich damit nicht zufriedengeben. Ihr zu helfen wurde mir zur Obsession. Ich wollte sie ins Leben zurückholen. Und ich wollte es spüren«, sagt er und sieht mich an. »Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, solche Schmerzen zu erleiden, Tag für Tag. Deshalb habe ich mich nie vor deiner Berührung gefürchtet«, fährt er fort. »Ich wartete sogar darauf. War mir sicher, dass du dich irgendwann verteidigen und mich schlagen würdest, und ich freute mich darauf. Aber dann kam es nicht dazu.« Er schüttelt den Kopf. »Durch die Berichte in deinen Akten hatte ich den Eindruck gewonnen, dass du eine gefährliche, bösartige Kreatur seist. Ich hatte damit gerechnet, dass man dich sorgfältig bewachen müsste, weil du jede Gelegenheit nutzen würdest, um mich und meine Männer anzugreifen. Aber du hast mich enttäuscht, indem du dich als zu menschlich und zu liebenswert erwiesen hast. Und als so naiv. Du wolltest dich nicht wehren.«
Er blickt sinnend ins Leere.
»Du hast nicht auf meine Drohungen reagiert und auf nichts, was wichtig war. Hast dich benommen wie ein verzogenes Kind. Mochtest deine Kleider nicht, hast die guten Speisen verschmäht.« Er lacht und verdreht die Augen, und mein Mitgefühl löst sich in Luft auf.
Jetzt würde ich ihn gerne mit etwas bewerfen.
»Du warst so beleidigt«, spricht er weiter, »weil ich dich gebeten habe, ein Kleid anzuziehen.« Er schaut mich an, und seine Augen funkeln belustigt. »Ich war darauf vorbereitet, mich gegen ein todbringendes Monster zu verteidigen, das einen Menschen mit bloßen Händen umbringen kann.« Er verkneift sich den nächsten Lachanfall. »Und du bekamst Wutausbrüche wegen sauberer Kleidung und warmer Mahlzeiten. Ach, was warst du albern«, sagt er und blickt kopfschüttelnd zur Decke auf. »So lächerlich. Und ich hatte noch nie zuvor in meinem Leben so viel Spaß. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich das alles genossen habe. Ich hatte so viel Freude daran, dich wütend zu machen«, fügt er mit durchtriebenem Grinsen hinzu. »Habe ich übrigens immer noch.«
Ich kralle mich so erbittert in einem der Kissen fest, dass es vermutlich gleich zerreißen wird, und starre ihn aufgebracht an.
Er lacht amüsiert.
»Ich war so wahnsinnig abgelenkt«, fährt er fort. »Habe nur so getan, als müsste ich Pläne für deine Zukunft im Reestablishment besprechen, weil ich dauernd mit dir zusammen sein wollte. Du warst so harmlos und wunderschön und hast mich ständig angeschrien.« Er grinst vergnügt. »Wegen der läppischsten Bagatellen hast du mich angebrüllt. Aber niemals die Hand gegen mich erhoben. Nicht ein einziges Mal – nicht einmal, um dein eigenes Leben zu retten.«
Das Lächeln verblasst.
»Das hat mich beunruhigt. Es machte mir Sorgen, dass du offenbar eher bereit warst, dich selbst zu opfern, als dich zu verteidigen.« Er holt tief Luft. »Deshalb habe ich die Taktik geändert und versucht, dich so massiv zu provozieren, dass du mich anfassen musstest.«
Ich zucke innerlich zusammen, als ich mich an den Tag in dem blauen Zimmer erinnere. Als er mich gereizt und manipuliert hat und ich kurz davor war, ihn anzugreifen. Er verletzte mich so schwer mit Worten, dass ich ihn körperlich verletzen wollte. Was ich dann auch beinahe getan hätte.
Er legt den Kopf schief. Seufzt. »Aber selbst das hat nicht funktioniert. Und dann verlor ich mein ursprüngliches Ziel aus den Augen. Ich war so vernarrt in dich, dass ich vergaß, weshalb ich dich überhaupt hatte herbringen lassen. War völlig entnervt, weil du dich nicht zur Gewalt gegen mich hinreißen lassen wolltest. Doch jedes Mal, wenn ich kurz davor war aufzugeben, passierte irgendetwas, etwas ganz Besonderes«, sagt er und schüttelt den Kopf. »Einer dieser unglaublichen Momente, in denen die ungebändigte Kraft endlich zutage trat. Es war grandios.« Er wendet den Blick ab, verliert sich in Erinnerungen. »Aber dann hast du dich immer wieder in dich selbst verkrochen. Als würdest du dich schämen. Als wolltest du diese Gefühle in dir nicht wahrhaben. Deshalb habe ich die Taktik ein weiteres Mal geändert. Etwas anderes ausprobiert. Etwas, wovon ich glaubte, dass es dich endgültig über die Grenze locken würde. Und das, muss ich sagen, hat dann wirklich funktioniert.« Er lächelt. »Du hast zum ersten Mal richtig lebendig ausgesehen.«
Meine Hände sind plötzlich eiskalt.
»Die Folterkammer«, keuche ich.
6
»Könnte man vielleicht so bezeichnen.« Warner zuckt die Achseln. »Wir nennen es Simulationsraum.«
»Du hast mich gezwungen, dieses Kind zu foltern«, sage ich, und die Wut und Angst dieses Tages brechen wieder über mich herein. Wie sollte ich das je vergessen können? Die entsetzlichen Erinnerungen aus meiner Vergangenheit, die ich erneut durchleben musste, weil Warner seinen Spaß haben wollte. »Das werde ich dir niemals verzeihen«, sage ich, und meine Stimme klingt schneidend. »Ich werde dir niemals verzeihen, was du diesem kleinen Jungen angetan hast. Was ich ihm deinetwegen antun musste!«
Warner runzelt die Stirn. »Entschuldige – was?«
»Du warst bereit, ein Kind zu opfern!« Jetzt zittert meine Stimme. »Wegen deiner idiotischen Spiele! Wie konntest du nur etwas so Abscheuliches tun!« Ich feuere das Kissen auf ihn. »Du krankes, herzloses Monster!«
Warner fängt das Kissen auf und starrt mich an, als sähe er mich zum ersten Mal. Dann weiten sich seine Augen, und das Kissen gleitet ihm aus der Hand, fällt zu Boden. »Ach so«, sagt er langsam. Kneift die Augen zu, um sich zu beherrschen. »O Gott, du wirst mich umbringen«, sagt er, kann sein Lachen jetzt nicht mehr unterdrücken. »Damit komme ich bestimmt nicht mehr klar –«
»Wovon redest du? Was ist los?«, frage ich.
Er grinst immer noch breit, als er sagt: »Erzähl es mir, Süße. Erzähl mir einmal ganz genau, was an dem Tag passiert ist.«
Ich balle die Fäuste vor Wut über seine Flapsigkeit. »Du hast mir irgendwelche winzigen Stofffetzen zum Anziehen gegeben! Und mich in die Kellerräume vom Hauptquartier gebracht und in einen dreckigen alten Raum eingeschlossen. Ich seh das alles noch vor mir«, sage ich, um Beherrschung bemüht. »Widerliche gelbe Wände. Abgetretener brauner Teppich. Riesiger Spionspiegel.«
Warner zieht die Augenbrauen hoch. Nickt, damit ich weiterspreche.
»Dann … hast du irgendeinen Schalter umgelegt.« Ich muss mich zwingen weiterzureden. Habe keine Ahnung, weshalb ich an mir selbst zu zweifeln beginne. »Und diese riesigen Metallstacheln schossen aus dem Boden. Und dann –«, ich zögere, muss mich wappnen, »kam ein Kleinkind reingelaufen. Mit verbundenen Augen. Und du hast gesagt, er sei dein Stellvertreter. Wenn ich ihn nicht retten würde, dann würdest du es auch nicht tun.«
Warner betrachtet mich forschend. »Bist du sicher, dass ich das gesagt habe?«
»Ja.«
»Ach ja?« Er legt den Kopf schief. »Du hast mit eigenen Augen gesehen, wie ich das gesagt habe?«
»N-nein«, sage ich rasch, »aber da waren Lautsprecher – ich habe deine Stimme gehört –«
Er holt tief Luft. »Ja, sicher. Natürlich.«
»Ich habe dich aber sprechen hören«, beharre ich.
»Und was ist danach passiert?«
Ich schlucke. »Ich musste den Jungen retten. Er wäre sonst gestorben. Er sah nicht, wo er hinlief, und wäre sonst von diesen Stacheln aufgespießt worden. Ich musste ihn hochnehmen und so halten, dass ich ihn dabei nicht töten würde.«
Ein kurzes Schweigen.
»Und ist dir das gelungen?«, fragt Warner dann.
»Ja«, flüstere ich. Ich kann nicht begreifen, weshalb er mir diese Fragen stellt, obwohl er doch alles selbst miterlebt hat. »Und dann wirkte der Junge leblos«, rede ich weiter. »War einen Moment lang gelähmt in meinen Armen. Aber dann hast du einen anderen Schalter umgelegt, und die Stacheln sind verschwunden, und ich habe den Jungen abgesetzt, und er – er fing wieder an zu weinen und stolperte gegen meine nackten Beine. Und fing an zu schreien. Und ich … ich wurde so rasend wütend auf dich …«
»Dass du eine Betonwand durchbrochen hast«, sagt Warner, und ein kleines Lächeln spielt um seine Lippen. »Du hast Beton durchbrochen, weil du mich erwürgen wolltest.«
»Du hattest es verdient«, höre ich mich sagen. »Das und Schlimmeres.«
»Tja«, seufzt er. »Wenn ich tatsächlich getan hätte, was du behauptest, hätte ich das wohl wahrhaftig verdient.«
»Was meinst du damit? Ich weiß doch, dass du es getan hast –«
»Ach wirklich?«
»Ja, sicher!«
»Dann sag mir doch, Süße, was aus dem Jungen geworden ist.«
»Was?« Ich erstarre, und Eiszapfen schürfen mir über die Arme.
»Was ist aus dem kleinen Jungen geworden? Du sagst, du hast ihn abgesetzt. Aber dann hast du eine Betonwand durchbrochen, in die ein drei Meter breiter Spiegel eingelassen war, und hast dich nicht mehr um das Kind gekümmert, das deiner Aussage nach in dem Raum umherirrte. Meinst du nicht, das Kind wäre bei so einer Aktion verletzt worden? Meine Soldaten haben jedenfalls Verletzungen davongetragen. Du bist durch Beton gebrochen, Süße. Du hast eine riesige Glasfläche zerstört. Und du hast nicht innegehalten, um dir zu überlegen, wen die ganzen Splitter und Trümmer vielleicht getroffen haben.« Er hält inne. Starrt mich an. »Oder?«
»Nein«, keuche ich. Das Blut scheint mir aus dem Leib zu rinnen.
»Was ist also passiert, nachdem du weggegangen bist?«, fragt er. »Oder erinnerst du dich nicht daran? Du hast dich umgedreht und bist rausmarschiert, nachdem du meinen Raum zertrümmert, meine Männer verletzt und mich an die Wand geknallt hattest. Du bist einfach rausgegangen.«
Ich bin wie benommen, als die Erinnerung zurückkehrt. Das stimmt. Er hat recht. Ich musste einfach so schnell wie möglich raus da. Weg, um wieder klarzusehen.
»Was ist also mit dem Jungen geschehen?«, fragt Warner hartnäckig weiter. »Wo war er, als du rausgegangen bist? Hast du ihn gesehen?« Warner zieht die Augenbrauen hoch. »Und was ist mit den Stacheln? Hast du mal hingeschaut, um festzustellen, woher sie gekommen waren? Weshalb sie einen Teppichboden durchbohrt haben, ohne Löcher zu hinterlassen? Fühlte sich der Boden unter deinen Füßen irgendwie beschädigt oder uneben an?«
Ich versuche regelmäßig zu atmen und ruhig zu bleiben. Fühle mich wie gebannt von seinem Blick.
»Juliette, Süße«, sagt Warner leise. »Es gab keine Lautsprecher in diesem Raum. Er ist absolut schalldicht und nur mit Sensoren und Kameras ausgestattet. Es ist eine Simulationskammer.«
»Nein«, hauche ich fassungslos. Ich will nicht akzeptieren, dass ich mich geirrt habe, dass Warner nicht das Monster ist, für das ich ihn gehalten habe. Er darf jetzt nicht alles ändern. Darf mich nicht so verwirren. So soll das nicht ablaufen. »Das ist nicht möglich –«
»Ich habe insofern Schuld auf mich geladen«, sagt er, »als ich dich gezwungen habe, diese grausame Simulation zu durchlaufen. Dafür übernehme ich die Verantwortung, ich habe mich auch schon dafür entschuldigt. Aber ich wollte dich damit nur zu einer Reaktion treiben, und ich wusste, dass diese Situation etwas in dir auslösen würde. Aber, großer Gott, Süße –«, er schüttelt den Kopf, »du musst eine entsetzlich schlechte Meinung von mir haben, wenn du glaubst, ich würde jemandem ein Kind stehlen und dann zusehen, wie du es folterst.«
»Das war nicht echt?« Ich erkenne die raue, krächzende Stimme nicht wieder, die einmal meine war. »Das war alles nicht echt?«
Er lächelt mich mitfühlend an. »Ich habe die Basiselemente dieses Programms entworfen. Das Tollste daran ist, dass es sich direkt den emotionalen Reaktionen des jeweiligen Soldaten, der es durchläuft, anpassen kann. Wir benutzen es, um Soldaten zu schulen, die bestimmte Ängste überwinden müssen oder eine besonders heikle Mission vor sich haben. Man kann so gut wie jede Umgebung damit simulieren«, erklärt er. »Sogar Soldaten, die genau wissen, was auf sie zukommt, vergessen, dass sie sich in einer Simulation befinden.« Er wendet den Blick ab. »Ich wusste, dass es schlimm für dich wird, und habe dich dem trotzdem ausgesetzt. Und ich bedauere es aufrichtig, dass ich dich damit gequält habe. Doch ja«, sagt er leise und sieht mich wieder an, »es war alles nicht echt. Meine Stimme hast du dir eingebildet. Ebenso wie den Schmerz, die Geräusche, die Gerüche. Das war alles nur in deinem Kopf.«
»Ich will das nicht glauben«, flüstere ich.
Er versucht zu lächeln. »Was meinst du, warum ich dir diese Kleider gegeben habe?«, fragt er. »Der Stoff war mit einer Chemikalie präpariert, die auf die Sensoren im Raum anspricht. Und je weniger man anhat, desto leichter können die Kameras deine Körperwärme, deine Bewegungen registrieren.« Er schüttelt den Kopf. »Ich hatte nie die Chance, dir zu erklären, was du da erlebt hast. Zuerst wollte ich dir sofort folgen, aber dann dachte ich mir, dass ich dir vielleicht erst Zeit lassen sollte, dich zu sammeln. Was ein dummer Fehler meinerseits war. Als ich dich dann wiedersah, war es nämlich schon zu spät. Da warst du schon bereit, aus einem Fenster zu springen, nur um von mir wegzukommen.«
»Aus gutem Grund«, fauche ich.
Er hält abwehrend die Hände hoch.
»Du bist ein furchtbarer Mensch!«, schreie ich und bewerfe ihn mit den restlichen Kissen, wütend und verstört und gedemütigt. »Warum hast du mich dieser Situation ausgesetzt, wo du doch wusstest, was ich durchgemacht hatte, du blöder, überheblicher –«
»Bitte, Juliette«, sagt er, tritt auf mich zu und weicht einem Kissen aus, um mich an den Armen zu fassen. »Es tut mir ehrlich leid, dass ich dich gequält habe, aber ich glaube wirklich, es hat sich gelohnt –«
»Fass mich nicht an!« Ich reiße mich los, umklammere einen Bettpfosten, als sei er eine Waffe. »Ich sollte gleich noch mal auf dich schießen, weil du mir das angetan hast! Ich sollte – ich sollte –«
»Was denn?« Er lacht. »Noch ein Kissen auf mich feuern?«
Ich schubse ihn heftig, und als er sich nicht rührt, fange ich an, auf ihn einzuschlagen. Ich boxe auf seine Brust, seine Arme, seinen Bauch, seine Beine, auf alles, was ich erreichen kann, und wünsche mir mehr denn je, er hätte nicht die Fähigkeit, meine Kraft zu absorbieren. Damit ich ihm sämtliche Knochen zertrümmern und ihm fürchterliche Schmerzen zufügen könnte. »Du … selbstsüchtiges … Ungeheuer!« Ich fuchtle herum und merke dabei nicht, wie sehr mich diese Anstrengung erschöpft, wie schnell sich die Wut in Schmerz verwandelt. Plötzlich will ich nur noch weinen. Ich zittere von Kopf bis Fuß, vor Erleichterung und vor Grauen zugleich – weil ich von der Angst befreit wurde, einem weiteren unschuldigen Kind etwas angetan zu haben, und weil ich entsetzt bin, dass Warner mir so etwas Schlimmes angetan hat. Um mir zu helfen.
»Es tut mir so leid«, sagt er. »Aufrichtig. Ich kannte dich damals noch nicht. Nicht so wie jetzt. Jetzt würde ich das niemals mehr tun.«
»Du kennst mich nicht«, murmle ich und wische meine Tränen weg. »Du bildest dir nur ein, mich zu kennen, weil du mein Notizheft gelesen hast, du dummes, impertinentes, unsensibles Arschloch –«
»Ach ja, genau – da du es grade erwähnst –« Er grinst, zieht mir mit einer raschen Bewegung das Notizheft aus der Tasche und geht zur Tür. »Ich fürchte, die Lektüre war noch nicht beendet.«
»Hey!« Mein Schlag streift ihn nur noch. »Du hast gesagt, du gibst es mir wieder!«
»Ich habe nichts dergleichen gesagt«, erwidert er ungerührt und steckt das Heft in seine Hosentasche. »Und nun warte bitte hier. Ich hole dir etwas zu essen.«
Ich beschimpfe ihn immer noch lauthals, als er die Tür hinter sich schließt.
7
Ich lasse mich aufs Bett fallen.
Knurre wütend. Feuere ein Kissen an die Wand.
Ich muss etwas tun. Muss in Bewegung kommen.
Einen Plan entwickeln.
In all der Zeit in Gefangenschaft und Flucht habe ich mich ständig Tagträumen hingegeben, in denen ich das Reestablishment besiege. Einen Großteil der 264 Tage in der Zelle habe ich mir den letztlich undenkbaren Augenblick ausgemalt, in dem ich meinen Unterdrückern und all ihren Schergen ins Gesicht spucken kann. Und obwohl ich mir Millionen Szenarios vorgestellt hatte, in denen ich kämpfen würde, hätte ich doch niemals geglaubt, dass es jemals dazu kommen könnte. Ich hätte niemals geglaubt, dass ich die Kraft und den Mut dazu hätte oder überhaupt jemals die Gelegenheit dazu bekommen würde.
Doch nun?
Alle anderen aus dem Widerstand gibt es nicht mehr.
Ich bin offenbar die Einzige, die noch übrig ist.
In Omega Point war ich froh darüber, dass Castle das Kommando hatte. Ich kannte mich mit vielem nicht aus und hatte ohnehin zu viel Angst, um selbstständig zu handeln. Castle war der Anführer, und er hatte bereits einen Plan; deshalb vertraute ich darauf, dass er alles richtig machen würde.
Was ein Fehler war.
In meinem tiefsten Inneren hatte ich immer geahnt, wer den Widerstand anführen müsste. Insgeheim wusste ich es schon seit geraumer Zeit, doch ich fürchtete mich zu sehr vor diesem Wissen, um es in Worte zu fassen. Es musste jemand sein, der nichts zu verlieren hatte. Jemand, der niemanden mehr fürchtete.
Nicht Castle. Nicht Kenji. Nicht Adam. Nicht einmal Warner.
Sondern ich.
Ich betrachte zum ersten Mal genauer meine Kleidung und merke, dass ich offenbar alte Sachen von Warner anhabe: ein verwaschenes orangenes T-Shirt, in dem ich beinahe verschwinde, und eine graue Sweathose, die mir von den Hüften rutscht, wenn ich aufrecht stehe. Ich teste mein Gleichgewicht auf dem dicken weichen Teppich unter meinen bloßen Füßen. Rolle den Bund der Hose so oft auf, bis sie an meiner Taille festsitzt, und knote das riesige T-Shirt im Rücken zusammen. Was vermutlich albern aussieht, aber die Konturen der Kleider am Körper geben mir Sicherheit und das Gefühl, die Lage und mich selbst wenigstens ein bisschen besser im Griff zu haben. Jetzt fehlt mir nur noch ein Gummiband; meine Haare fühlen sich im Nacken so schwer an, als wollten sie mich erdrücken. Und ich sehne mich nach einer Dusche.
Ich höre die Tür hinter mir und fahre herum.
Meine Haare halte ich immer noch hoch, zum Pferdeschwanz zusammengefasst, und mir wird plötzlich bewusst, dass ich keine Unterwäsche trage.
Warner hat ein Tablett in Händen.
Er starrt mich an. Sein Blick gleitet über mein Gesicht, meinen Hals, meine Arme. Verharrt auf meinem Bauch. Ich blicke an mir herunter und merke, dass das Shirt hochgerutscht ist und man nackte Haut sehen kann. Und dann weiß ich auch, warum Warner den Blick nicht von mir lösen kann.
Die Erinnerung an seine Küsse auf meiner Haut; seine Hände, die meine nackten Beine erkunden, meine Oberschenkel, seine Finger, die über das Gummiband meines Höschens streichen und es nach unten ziehen –
Oh.
Ich lasse meine Haare abrupt los, und die braunen Wellen branden auf meine Schultern, meinen Rücken. Mein Gesicht steht in Flammen.
Warner fixiert jetzt irgendeinen Punkt über meinem Kopf.
»Ich sollte mir wahrscheinlich die Haare kürzer schneiden«, sage ich in den Raum hinein, ohne zu begreifen, weshalb. Ich will gar keine kürzeren Haare haben. Sondern mich im Bad einschließen.
Warner antwortet nicht. Er trägt das Tablett zum Bett, und erst als mein Blick auf Wasser und Essen fällt, merke ich, wie hungrig ich bin. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt etwas gegessen habe; mein Körper hat von der Energie gezehrt, die mir für den Wundheilungsprozess eingeflößt wurde.
»Setz dich«, sagt Warner, ohne mich anzusehen. Er weist mit dem Kopf auf den Boden und lässt sich dann selbst auf dem Teppich nieder. Ich tue es ihm gleich, und er schiebt das Tablett zu mir.
»Danke«, sage ich, den Blick auf das Essen gerichtet. »Das sieht köstlich aus.«
Die Mahlzeit besteht aus gemischtem Salat und buntem Duftreis, Würfelkartoffeln mit Kräutern und einer Portion gedämpftem Gemüse. Einer kleinen Schüssel Schokoladenpudding und einer Schale mit frischen Obststücken. Zwei Gläsern Wasser.
Als ich zum ersten Mal hier landete, hätte ich diese Mahlzeit verschmäht.
Hätte ich damals gewusst, was ich jetzt weiß, dann hätte ich jede Chance genutzt, die ich durch Warner bekam. Ich hätte das Essen freiwillig verspeist und die Kleider angenommen. Ich hätte darauf geachtet, mich zu stärken, und mich aufmerksam umgesehen, wenn ich mit Warner im Hauptquartier unterwegs war. Hätte nach Fluchtwegen Ausschau gehalten und Gründe ersonnen, um die Gebäude zu erkunden. Und dann wäre ich abgehauen. Hätte Möglichkeiten gefunden, alle zu überleben. Ich hätte Adam nicht mit ins Verderben gerissen und mich selbst und so viele andere nicht ins Chaos gestürzt.