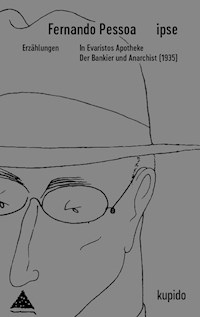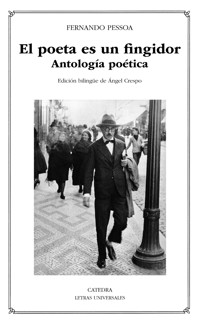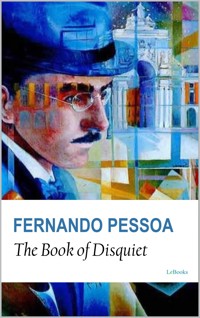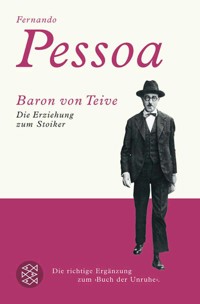22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Fernando Pessoa, Werkausgabe
- Sprache: Deutsch
Der große portugiesische Dichter und Denker Fernando Pessoa gibt Einblick in seine schwer zu fassende komplexe Persönlichkeit. Der Autor des Jahrhundertwerks »Das Buch der Unruhe« hat tausend Gesichter: Er ist Dichter und Theosoph, Pazifist und Monarchist, Klassiker und Futurist, der an sich selbst Zweifelnde und der sich selbst Überhöhende, der Misanthrop und der Menschenfreund. Eine Vielheit, die offenbart, was den Portugiesen umtrieb: sein Suchen, Zweifeln und Werden, seine inneren Kämpfe, seine Widersprüche, seine Sehnsucht nach Selbstvergewisserung und Identität. In einer Auswahl von Selbstanalysen, Tagebucheinträgen, Briefen, ergänzt durch Aussagen von Zeitgenossen, lädt die bekannte Pessoa-Kennerin und -Übersetzerin Inés Koebel dazu ein, sich auf die Spur dieses geheimnisvollen Verwandlungskünstlers zu begeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Fernando Pessoa
Ich Ich Ich
Selbstzeugnisse und Erinnerungen von Zeitgenossen
Biografie
Fernando Pessoa (1888-1935), der bedeutendste moderne Dichter Portugals, ist auch bei uns mit dem »Buch der Unruhe« bekannt geworden. Einen Großteil seiner Jugend vebrachte er in Durban, Südafrika, bevor er 1905 nach Lissabon zurückkehrte, wo er als Handelskorrespondent arbeitete und sich nebenher dem Schreiben widmete. 1912 begann seine Tätigkeit als Literaturkritiker und Essayist. Er schuf nicht nur Gedichte und poetische Prosatexte verschiedenster, ja widersprüchlichster Art, sondern Verkörperungen der Gegenstände seines Denkens und Dichtens: seine Heteronyme, darunter Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos – und er schrieb eben auch als Pessoa, das im Portugiesischen so viel wie »Person, jemand« bedeutet.
Inés Koebel, geboren in Bamberg, arbeitete als Buchhändlerin und freie Feature Autorin. Sie übersetzt aus dem Französischen und Portugiesischen, hat den Band ›Brasilien erzählt‹ (S.Fischer 1994) ediert und ist Mitherausgeberin der neuen Pessoa Werkausgabe. Neben dem ›Buch der Unruhe‹ hat sie die Gedichte von Álvaro de Campos, Alberto Caeiro und Ricardo Reis übertragen sowie Baron von Teive und Pessoas statisches Drama ›Der Seemann‹.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Dieser Band erscheint in Fortführung der Pessoa-Werkausgabe, die im Ammann Verlag begonnen wurde. Herausgegeben von Egon Ammann.
Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds e.V. für die Förderung ihrer Übersetzung durch ein Arbeitsstipendium.
Dieses Werk wurde mit der Unterstützung des portugiesischen Kultur- und Sprachinstituts Camões herausgegeben.
Obra publicada com o apoio do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua I.P.
Erschienen bei FISCHER E-Books
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Die enthaltenen Fotografien und Faksimiles entstammen dem Nachlass der Familie Fernando Pessoas.
Covergestaltung: Gundula Hißmann und Andreas Heilmann, Hamburg. Nach einem Entwurf von Beate Becker
Coverabbildung: Amman Verlag, Zürich
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403381-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Ich fühle mich vielfältig.
Vorwort Fernando Pessoa – Zuschneider von Paradoxien
13 Jahre (1901)
Aufzeichnungen und Briefe 1905–1935 Ich sollte jetzt unbedingt sagen, was für eine Art Mensch ich bin
[1905?]
[Drei Fragmente von C. R. Anon]
Exkommunikation
[Entwurf eines Briefes an den Pfarrer seiner Kirchengemeinde]
[Fragment von C.R. Anon]
[Entwurf eines Briefes an die Mutter]
Briefe, die Aufschluß über meinen Charakter geben
[Brief von »Faustino Antunes«]
[Brief von Ernest A. Belcher an »Faustino Antunes«]
[Brief von Clifford E. Geerdts an »Faustino Antunes«]
Alexander Searchs Pakt mit dem Leben
[Bruder Maurice zugeschriebener Text]
[Alexander Search zugeschriebener Text]
[Frederick Wyatt zugeschriebener Text]
[Brief an Armando Teixeira Rebelo]
[Pantaleão zugeschriebener Text]
[Pantaleão zugeschriebenes Textfragment]
Persönliche Aufzeichnungen
[Pantaleão zugeschriebener Text]
[Brief an Mário Beirão]
Einflüsse
[Brief an einen Dichter]
[Fragment eines Briefes an die Mutter]
[Brief an Armando Côrtes-Rodrigues]
[Brief an Armando Côrtes-Rodrigues]
[Brief an Mário De Sá-Carneiro]
[Entwurf eines Briefes von Marcos Alves]
[Fragment eines Briefes an einen nicht identifizierten Adressaten]
[Unbeendeter Brief an Hector und Henri Durville]
Tramway
[Brief an Francisco Manuel Cabral Metello]
Lebensplan
[Entwurf eines Briefes an den Herausgeber der englischen Wochenzeitung Answers]
Vorwort
Notiz
Bibliographische Tafel
[Aus einem Brief an Luís Miguel Nogueira Rosa]
[Aus einem nicht abgesandten Brief an João Gaspar Simões]
[Zwei Briefe an Ofélia Queirós]
[Aus einem Brief an Joâo Gaspar Simões vom 11.12.1931]
[Brief an José Osório de Oliveira aus dem Jahr 1932]
[Aus dem Entwurf eines Briefes an Adolfo Casais Monteiro 1935]
[Aus einem Brief an Adolfo Casais Monteiro vom 13. Januar 1935]
Erklärung eines Buches
[Aus einem Brieffragment an Adolfo Casais Monteiro vom 30. Oktober 1935]
Biographische Notiz
Mediumistische Intermezzi
[Aus einem Brief an Ana Luisa Pinheiro Nogueira de Freitas (Tante Anica) vom 24. Juni 1916]
Texte Automatischen Schreibens
Ein Fall von Mediumismus
1. Wie auf Mediumismus zu schließen ist
2. Fortschreiten des Mediumismus
3. Psychische Begleiterscheinungen des Mediumismus
4. Analyse der sogenannten medialen »Mitteilungen«
5. Konklusionen
Reflexionen Ich komme als ein Bote des Bewußtseins
Persönliche Aufzeichnung (BNP/E3, 138–74)
Ich habe mir immer [...]
Lebensregeln
Willenskraft
Anmerkung
Lebensregel
[Nachwort – Portias Kästchen]
Lebensregel
Lebensregel
Anmerkungen zu einer Lebensregel
Was uns umbringt
[Das Beispiel von Noronha]
Erinnerungen von Zeitgenossen Konnte Fernando Pessoa Auto fahren?Fernando nicht, aber Álvaro de Campos
Zehn Minuten mit Fernando Pessoa
Dona Henriqueta Madalena Rosa Dias, Stiefschwester Pessoas
Eduardo Freitas da Costa, Vetter und Herausgeber verschiedener Werke Pessoas
Ofélia Queirós, einzig bekannte Liebesbeziehung Pessoas
Pedro Moitinho de Almeida, Dichter und Freund Pessoas
Joâo Gaspar Simões, Schriftsteller, Kritiker und erster Biograph Pessoas
Augusto Ferreira Gomes, Dichter und langjähriger Freund Pessoas
Jorge de Sena, Dichter, Romancier und Verfasser zweier Essaybände über Pessoa und dessen Werk
Daten zu Leben und Werk
Editorische Notiz
Erläuterung der Zeichen
Danksagung der Übersetzerin und Herausgeberin
Ich fühle mich vielfältig.
Ich bin wie ein Zimmer mit unzähligen, wundersamen Spiegeln, die eine einzige zentrale Wirklichkeit falsch und verzerrt reflektieren, eine Wirklichkeit, die sich in allen und in keinem dieser Spiegel findet.
Fernando Pessoa
VorwortFernando Pessoa – Zuschneider von Paradoxien
»Hier bin ich, ich bin Pessoa«, ruft es aus dem Bühnenraum, und weiter: »Ich bin Pessoa, der vorgibt, ein Schauspieler zu sein, der heute Abend Fernando Pessoa spielt.«
So beginnt das Bühnenstück, das Antonio Tabucchi über den von ihm verehrten Dichter Fernando Pessoa geschrieben hat, den er für Italien entdeckte und der in seinem Werk vielfach Eingang fand. Obgleich der Titel des Stückes »Herr Pirandello wird am Telefon verlangt« lautet, tritt Pirandello darin nicht auf, wohl aber Pessoa, der mit ihm telefonieren möchte. Pessoa sieht sich hier auf der Bühne selbst als eine Figur in einem Theaterstück, er schlüpft in eine Rolle, um sich eine Identität zu entwerfen, und es wird dem Zuschauer nicht leichtgemacht, zwischen dem Schauspieler und der von ihm verkörperten Rolle als Dichter zu unterscheiden.
Und so mag diese kleine Szene als Auftakt dazu gelesen werden, sich auf die Spur dieses großen portugiesischen Dichters und Denkers zu begeben.
Bereits eine frühe Notiz Pessoas weist auf den weiten Horizont hin, der in seinen Selbstaussagen abgeschritten wird. »Ich möchte alles verstehen, alles wissen, alles verwirklichen, alles sagen, alles genießen, alles erleiden, ja, alles erleiden. Aber ich tue nichts dergleichen, nichts, nichts. Ich bin wie vernichtet bei der Vorstellung von dem, was ich gerne hätte, könnte, fühlte. Mein Leben ist ein nicht enden wollender Traum.«
Er, der, wie er sagt, »von Natur aus das Geheimnisvolle liebte, die Mystifikation, das Obskure« und zugleich ein »aufrichtiger Liebhaber der Wahrheit« war, gibt in den vorliegenden Textfragmenten und Briefen Einblick in seine schwer zu fassende komplexe Persönlichkeit, jenseits seiner literarischen Identitäten, seiner Heteronyme. Sie offenbaren, was den Verfasser dieser »Autobiographie ohne Ereignisse« umtrieb, sein Suchen, Zweifeln und Werden als junger Mensch, seine inneren Kämpfe, seine Sehnsucht nach Selbstvergewisserung, seine Widersprüche, in einer zuweilen geradezu gnadenlosen Selbstanalyse. Die Aussagen von Zeitzeugen erweitern den Blick auf ihn zudem in eindrücklicher Weise.
Seine Selbstanalysen, tagebuchähnlichen Aufzeichnungen, Reflexionen und Texte Automatischen Schreibens fanden sich in der legendären Truhe, deren immensen Schatz man 1942, sieben Jahre nach seinem frühen Tod, zu sichten begann. Denn obwohl Pessoa zu Lebzeiten in allen wichtigen Zeitschriften seines Landes vertreten war, zwei selbst gegründet, verschiedene europäische Literaturströmungen in Portugal eingeführt und drei selbst erfunden hatte, war er, wie Antonio Tabucchi schreibt, eher als ein Intellektueller und heftiger Polemiker mit wechselhaften Ansichten denn als Dichter bekannt und anerkannt. Als solcher hatte er unter eigenem Namen und den Namen Alberto Caeiro, Ricardo Reis und Álvaro de Campos lediglich in Zeitschriften mit geringer Auflage publiziert – sowie vier schmale, kaum wahrgenommene Gedichtbände auf englisch – und mit Mensagem (Botschaft), einem ebenfalls schmalen Gedichtband, den zweiten Preis bei einem Literaturwettbewerb gewonnen. Jetzt aber fand sich die Bestätigung für die Existenz seiner drei großen Dichter-Heteronyme sowie seines Halbheteronyms Bernardo Soares und ihrer eigenständigen komplexen Werke. Zudem entdeckte man nach und nach auch eine vielstimmige, auf englisch, französisch und portugiesisch schreibende Autorschaft und darüber hinaus einen bis dahin weitgehend ungekannten Pessoa in Person.
Die hier versammelten Selbstzeugnisse und Reflexionen – fragmentarisch wie Pessoas gesamtes Werk mit Ausnahme der Lyrik – sind gleichsam als eine Vorstufe zu den Gedanken und Reflexionen in seinem orthonymen und heteronymen Werk zu verstehen. Sie zeigen, da zumeist undatiert, keine Chronologie im eigentlichen Sinne auf. Ihre Zu- und Anordnung ist zum einen durch den Textzusammenhang gegeben und zum anderen durch die Abfolge der englischen Originale. Diese stammen mehrheitlich aus der Zeit um und nach Pessoas definitiver Rückkehr nach Lissabon, als er in Ermangelung von Freunden, mit denen er sich austauschen konnte, seine Gedanken zunächst in der in Südafrika erworbenen Zweitsprache Englisch und gelegentlich auch in Französisch, das er bereits als Kind mit seiner Mutter erlernt hatte, niederschrieb.
Der erste Teil dieses Bandes umfaßt Aufzeichnungen und Briefe aus den Jahren 1905 bis 1935, der zweite Teil aus den Jahren 1916/1917 und 1929/1930, als Pessoa als Medium agierte und Erfahrungen mit dem Automatischen Schreiben machte. Der dritte Teil beinhaltet eine Sammlung undatierter Reflexionen. Der vierte Aussagen und Erinnerungen von Angehörigen, Freunden und Zeitgenossen Pessoas. Der fünfte Daten zu Leben und Werk.
In Pessoas Selbstzeugnissen ist die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit bisweilen fließend. Einige seiner Aussagen deuten bereits auf eine mögliche spätere Fiktionalisierung hin, sie erwecken zuweilen den Eindruck, als seien sie im Rückblick aus der Perspektive eines fortgeschrittenen Alters geschrieben. Bereits in jungen Jahren hat Pessoa eine Reihe literarischer und später wieder aufgegebener Doubles, Alter egos oder Präheteronyme erschaffen, die hier zum Teil mit aufgenommen wurden, da sie keine Masken des Dichters verkörpern, sondern im Gegenteil geistige Zwillingsbrüder des jungen Pessoa sind und die dramatischen Konflikte offenbaren, die sich in ihm abspielten.
Bemerkenswert die »Briefe, die Aufschluß über meinen Charakter geben«. In ihnen bittet Pessoa, der sich unter dem Namen »Faustino Antunes« als Psychiater ausgibt, seinen ehemaligen Schulkameraden Geerdts und zwei frühere Lehrer um deren Einschätzung von Charakter und Verhalten des ehemaligen Schülers Fernando Pessoa, der seinem Leben ein Ende gesetzt habe. Handelt es sich hier um eine Maskerade, ein Spiel des passionierten Scharadenspielers, oder ist der Verfasser dieser Briefe ernsthaft an der Fremd- und Außenperspektive auf seine Persönlichkeit interessiert? Aber warum lenkt er die erwartete Einschätzung seiner Person durch die Vorgabe einer fiktiven und detaillierten neurasthenischen Krankengeschichte?
Wir müssen uns zunächst einen jungen Mann vorstellen, der 1905 im Alter von 17 Jahren nach langer Abwesenheit nach Lissabon zurückkehrt und versucht, sich wieder in seine Stadt, in sein Land hineinzufinden. Er, der sich selbst eine »irrende Seele« nannte und zwischen zwei Ländern, zwei Kulturen und zwei Sprachen aufwuchs, fühlt sich aufgrund seiner Überzeugungen als Fremder im eigenen Land. Er schreibt: »Wenn ich spreche, wie ich bin, versteht man mich nicht, weil ich keine Portugiesen habe, die mir zuhören. Wir, meine Landsleute und ich, sprechen nicht dieselbe Sprache. Ich schweige.« Wir wissen aber, daß Pessoa keineswegs geschwiegen, sondern seine Stimme in Zeitungen und Zeitschriften erhoben und sich lautstark Gedanken um sein Land gemacht hat. Er wundert sich, daß die bei seiner Rückkehr nach Portugal durchweg republikanisch gesinnte Jugend Jahre später durchweg monarchistisch eingestellt ist. Dabei ist er selbst politisch gesehen eher wankelmütig. Zu Zeiten der korrupten, dekadenten Monarchie ist er Republikaner, als ihm die Republik zu mittelmäßig erscheint, ist er gegen die Republik. Die Militärdiktatur wird von ihm verteidigt, und gegen die herrschende Ungleichheit hat er keine Einwände. Zu Zeiten des Faschismus ist er zunächst für und schließlich vehement gegen Salazar. Doch dieses kontroverse politische Hin und Her geschieht immer zugunsten seiner ideellen oder aber der mystischen Rettung Portugals. Er wolle, sagt er, Portugal nicht als Nationalist, sondern mit seiner Seele retten. Pessoa leidet nicht nur an sich selbst, sondern auch »bis zum Wahnsinn« an Portugal.
Die Widersprüchlichkeit in Pessoas Fühlen und Denken zeigen auch Texte, in denen er einen bewußt elitären Standpunkt in seinen gesellschaftlichen Analysen einnimmt, und wiederum auch solche, in denen er von seiner umfassenden Liebe zur gesamten Menschheit spricht.
Sein Lebensgefühl ist geprägt von Einsamkeit und Fremdheit und dem Wunsch nach einem wahren Freund. »Ein enger Freund ist ein Ideal von mir.« Doch »lieben, ohne dazuzugehören« sind seine idealen Paradoxien von Nähe und Distanz.
Trost findet er in der Philosophie, die sein Denken nachhaltig prägt. »Ich bin ein von der Philosophie inspirierter Dichter.« Wie zutreffend diese Selbstcharakterisierung ist, wird deutlich in seiner beharrlichen Suche nach Wahrheit hinter den Phänomenen und insbesondere in der oft verzweifelten Suche nach Selbstvergewisserung und Identität: »Ich bin der Schatten meiner selbst auf der Suche nach dem, dessen Schatten er ist.«
Die Welt empfindet er als Mysterium, das in sein Leben eingedrungen ist und sein Denken und Fühlen bestimmt. Zwischen sich und der Welt spürt er einen »Nebel, der verhindert, daß ich die Dinge sehe, wie sie wirklich sind – wie sie für die anderen sind«. In einem vom Mysterium geprägten Weltverständnis ist auch die eigene Daseins-Verortung mysteriös und uneindeutig. »Ich fühle mich vielfältig (…) als mehrere Wesen. Ich fühle mich fremde Leben leben, in mir, unvollständig, als habe mein Sein an allen Menschen teil, an jedem unvollständig, und als füge sich aus einer Summe von Nicht-Ichs ein künstliches Ich zu einem Einzelwesen zusammen.« Aber dieses Einzelwesen ist kein faßbares Ganzes, in seiner Selbstanalyse verfällt es in Extreme: »Eine Hälfte von mir ist edel und erhaben, die andere klein und nichtswürdig. Beide sind ich.« Es ist das vielfältige Ich beziehungsweise das »weite Ich«, das den Wunsch hegt, alle und alles zu sein. Auch die Angst, lächerlich zu sein, weckt in Pessoa den Wunsch nach Überlegenheit – ein für ihn erstrebenswertes Ziel, mit dem er sich wiederholt auseinandersetzt – und nach Unverletzlichkeit durch ein vielfältiges Ich.
Wer sich einerseits solch gegensätzliche Charaktereigenschaften zuschreibt und sich andererseits so extremen Forderungen an sich selbst unterwirft, wie einer »tiefe[n], unverbrüchliche[n] Liebe zur Menschheit (…), die Schwachen zu verteidigen, Wunder zu vollbringen (…)«, bringt sich ums seelische Gleichgewicht, das Pessoa nie hatte. »Ich sehnte mich nach einem starken Selbstwertgefühl, dank dessen ich mich selbst hätte vergessen können.« Ein Beispiel für die von Pessoa angestrebte »Überlegenheit« findet sich in dem Fragment über den »überlegenen Menschen«, den »olympischen Whitman«, den »Proteus des Verständnisses«. »Er kann, wenn die Schiffe in See stechen, je nach Belieben, an Bord gehen oder an Land bleiben – und kann zugleich an Bord gehen und an Land bleiben, da er weder an Bord geht noch an Land bleibt.« Und ganz konkret auf den Punkt gebracht: »Alle Arbeit des überlegenen Menschen muß darin bestehen, vergessen zu wollen, daß die äußere Welt existiert.«
Philosophisch geprägt sind auch seine Reflexionen über den Willen in seiner grundlegenden Bedeutung für das menschliche Handeln und Sein. Auch das Auseinanderfallen zwischen Denken und Handeln bestimmt sein Daseinsgefühl: »Ich wollte immer Zuschauer des Lebens sein, ohne mich einzumischen.« Das Unvermögen, sich einer Sache ganz zu widmen oder sich für etwas zu entscheiden, belastet ihn: »Könnte ich mich doch nur irgend etwas widmen – einem Ideal, einem Kanarienvogel, einem Hund, einer Frau, einer historischen Untersuchung, der unmöglichen Lösung eines unnützen grammatikalischen Problems … Dann, ja, dann wäre ich vielleicht glücklich.«
Von welch großer Bedeutung gerade die Fähigkeit ist, eine Entscheidung zu treffen und sie in Handlung umzusetzen, zeigt sich anschaulich in »Noronha war hier«, einer Parabel darüber, wie einer einen Weg geht, den noch nie einer gegangen ist. So nimmt Pessoa die von einem Fremden in einem Fels hinterlassene Nachricht wie die in Schrift sichtbar gewordene Entschlußkraft wahr.
Ihm fehlt immer wieder der Wille zur Entscheidung und zum Handeln. In einem Nachwort, das er für den Band Entrevistas von M. C. Metello verfaßte, bezeichnet er in einer Anspielung auf das Wahlverfahren in Shakespeares Kaufmann von Venedig die Nichtentscheidung sogar als Quelle des Glücks. Auch für die Liebe in Gestalt Ofélias, der wohl einzigen in seinem Leben, vermag er sich, wie er am 29.9.1929 an die junge Frau schreibt, nicht zu entscheiden. Sie muß hinter seinem Werk zurückstehen. Während die beiden hier mit aufgenommenen Briefe (einer davon mit Álvaro de Campos gezeichnet) an sie in einer spielerisch, zärtlichen Sprache verfaßt sind, zeichnen die Briefe an seine Familie, an Freunde und Kollegen in Gedankenführung und Stil ein äußerst differenziertes Bild des Dichters und seiner Befindlichkeiten, die er in hochsensiblen poetischen Bildern beschreibt. Sie umkreisen zum Großteil das eigene Ich und das eigene Schaffen und sind so vielfältig wie seine Schriften und sein Denken. Er spricht von dem schmerzlichen Verlangen, sich mitzuteilen; in herzlicher, brüderlicher Verbundenheit und auf die Zuversicht bauend, verstanden zu werden, teilt er sich, seine seelische Verfassung, seine Reflexionen über sein Werk, die »Mission«, zu der er sich »berufen« fühlt, mit. Und so erlauben diese, in einer ganz bestimmten Intention an ausgewählte Freunde und Kollegen gerichteten Briefe, einen weiteren Einblick in die Person Pessoa. In zweien dieser Briefe tritt Pessoa als Kritiker auf – an einen jungen brasilianischen Dichter und an seinen mondänen Schriftstellerkollegen M. C. Metello. Er kritisiert unter Berufung auf seine Auffassung von Kunst und Literatur und macht so seine Kritik einsichtig, er begegnet den Kritisierten ernst, schreibt dezidiert, jedoch höflich und zugewandt und lobt im Detail.
Daß Pessoa seine Willensschwäche als Mangel empfindet, zeigt der Brief an die Pariser Magnetiseure Hector und Henry Durville, in dem er um Material für einen Fernkurs in »persönlichem Magnetismus« bittet. Er begründet diese Bitte mit dem Wunsch, seinen Willen zum Handeln zu entwickeln und dem Leben »eine äußere Richtungskoordination« zu geben. Die einzige Methode hierfür sei die magnetische Kultur.
In Pessoas Aufzeichnungen finden sich häufig Überlegungen zur Organisation des Lebensdienlichen und konkrete Lebensregeln. Numeriert und nüchtern als Aufforderung formuliert, muten sie an, als versuche er damit die praktischen Voraussetzungen für ein Leben in seiner geistigen Welt zu schaffen.
Pessoa, der sich zeitlebens eingehend mit Astrologie, Okkultismus, europäischen Geheimorden und der Kabbala beschäftigte, brachte mittels des Automatischen Schreibens (Écriture automatique) eine Reihe medialer Mitteilungen zu Papier. Bei den hier vorliegenden, ausschließlich auf englisch verfaßten Texten handelt es sich um keine ausgearbeiteten oder literarischen, sondern nahezu ausnahmslos um unzensierte, aus dem Unbewußten entstandene Texte von psychologischem Interesse. Sie geben Aufschluß über Pessoas Psyche, seine (sexuellen) Obsessionen, seine Ängste und Phantasien. Die zentrale Thematik in seinen Automatischen Schriften (er ist zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt) ist seine »Jungfräulichkeit«, sein Wunsch, diese zu verlieren, und zugleich seine Angst vor der Einlösung dieses Wunsches und sein Ringen um eine »normale« Sexualität. Doch selbst in der Sexualität ist Pessoa sowenig festzulegen wie in seinem Schreiben und Denken. Und so ist es auch nicht verwunderlich, daß er, der nicht nur Beobachter und Zuschauer des Lebens, sondern auch immer seiner selbst war, sich in einer theoretischen Abhandlung zum Mediumismus von diesem indirekt distanziert, indem er ihn als Ergebnis einer Angststörung abtut.
Die Aussagen von Zeitgenossen erlauben einen weiteren, teils widersprüchlichen Blick auf den Dichter. Facettenreich ist auch sein Bild als Alltagsmensch, wie es in den Erinnerungen seiner Schwester und Ofélias in deutlicher Zugewandtheit gezeichnet wird. Familie, Freunden und Kollegen zufolge war er ein überaus umgänglicher, heiterer und humorvoller Mensch. Was den Romancier Jorge de Sena nicht hinderte, in dieser Haltung ein quasi weiteres Heteronym zu sehen, das ihn vor allzu großer Nähe schützte. Pessoas Büroalltag, kaum vorstellbar angesichts seines ungeheueren dichterischen Werkes, und sein Auftreten am Arbeitsplatz werden anschaulich vermittelt.
Den Leser seiner Schriften hat Pessoa zuweilen durchaus vor Augen, jedoch als Autor, der vollends hinter seinem Werk zurücktritt und die Anonymität der Berühmtheit vorzieht: »Berühmtheit ist ein Plebejismus (…). Ein unbekannter genialer Mensch kann die süße Wonne des Kontrastes zwischen seiner Anonymität und seinem Genie genießen und kann im Wissen, berühmt zu sein, wenn er nur wollte, seinen Wert mit dem besten Maß messen, nämlich sich selbst.«
Die Verwandlungen Pessoas, seine tausend Gesichter – in seinen Selbstzeugnissen, Fragmenten und Aussagen von Zeitgenossen werden sie bereits vielstimmig einsichtig: Er ist der religiöse Dichter, der Antikatholik, der Theosoph, der sich für den Templerorden erwärmt und der Freimaurerei anhängt (ohne je Freimaurer zu werden); der Imperialist, der Pazifist, der Monarchist, der Republikaner; der Klassiker und Futurist, der Nonkonformist und Angepaßte, der an sich selbst Zweifelnde und der sich selbst Überhöhende, der Misanthrop und der Menschenfreund. Eine Vielheit, auf die er stolz ist – oder ist sie seine Zuflucht? –, findet ihren Niederschlag in den »Betrachtungen, die ich hier in allen Einzelheiten zu Papier bringe, damit die Nachwelt über sie nachdenkt«.
Dazu mag der vorliegende Band eine Einladung sein.
Inés Koebel
Berlin, Juni 2017
13 Jahre (1901)
20 Jahre (1908)
26 Jahre (1914)
40 Jahre (1928)
47 Jahre (1935)
Aufzeichnungen und Briefe 1905–1935Ich sollte jetzt unbedingt sagen, was für eine Art Mensch ich bin
[1905?]
Ja, was ist der Mensch anderes als ein geistloses, blindes Insekt, das gegen ein geschlossenes Fenster anschwirrt? Instinktiv fühlt er jenseits der Glasscheibe helles Licht und Wärme. Er ist jedoch blind und kann das Licht nicht sehen; wie er auch nicht sehen kann, daß sich zwischen ihm und dem Licht etwas befindet. Daher versucht er beharrlich, sich ihm zu nähern. Er kann sich zwar vom Licht entfernen, ihm aber nicht näher kommen, als die Scheibe erlaubt. Wie kann ihm Wissen helfen? Er mag die Unebenheit des Glases erkennen, seine rauhe Beschaffenheit, mag feststellen, daß es hier dicker und dort dünner ist: Mit alledem aber, werter Philosoph, wieviel näher kommt er da dem Licht? Wieviel näher kommt er da dem Sehen? Und dennoch glaube ich, daß der geniale Mensch, der Dichter, in gewisser Weise vermag, die Glasscheibe zu durchdringen und ans äußere Licht zu gelangen; er empfindet Wärme und Freude, um so vieles weitergegangen zu sein als alle anderen, aber ist nicht selbst er noch immer blind; ist er der Erkenntnis der ewigen Wahrheit tatsächlich näher gekommen? Lassen Sie mich meine Metapher noch ein wenig weiter fassen. Manche entfernen sich von der Glasscheibe zur falschen Seite hin, rückwärts; und kaum finden sie keine Glasscheibe[1] mehr vor, verkünden sie auch schon lauthals: »Wir haben es geschafft!«
(Orig. engl.)
Ich war ein von der Philosophie inspirierter Dichter, kein Philosoph mit dichterischen Fähigkeiten. Ich fand großen Gefallen daran, die Schönheit der Dinge zu bewundern und die poetische Seele des Universums im kaum Wahrnehmbaren und durch das verschwindend Kleine hindurch aufzuspüren.
Die Poesie der Erde ist niemals tot. Wir können vielleicht sagen, die vergangenen Zeiten waren poetischer, können aber auch sagen □
In allem ist Poesie – an Land und im Meer, in den Seen und an den Ufern der Flüsse. Auch in der Stadt – leugnet es nicht; sie ist deutlich sichtbar für mich, hier, wo ich sitze: In diesem Tisch ist Poesie, in diesem Blatt Papier, in diesem Tintenfaß; im Rattern der Fuhrwerke auf den Straßen ist Poesie, in jeder noch so geringen, gewöhnlichen, lächerlichen Geste eines Arbeiters, der auf der anderen Straßenseite das Ladenschild einer Metzgerei malt. Mein innerer Sinn beherrscht meine fünf Sinne dergestalt, daß ich die Dinge in diesem Leben – ich bin davon überzeugt – anders sehe als die anderen. Für mich sind – und waren – ein so lächerliches Ding wie ein Türschlüssel, ein Nagel in der Wand, die Schnurrhaare einer Katze reich an Bedeutung. Für mich hat ein Huhn, das mit seinen Küken quer über die Straße stolziert, etwas überaus Spirituelles. Der Duft von Sandelholz, eine alte Konservenbüchse auf einem Müllhaufen, eine im Rinnstein liegende Streichholzschachtel oder zwei schmutzige Papierfetzen, die an einem windigen Tag einander jagend die Straße hinabwirbeln, sind für mich von tieferer Bedeutung als menschliche Ängste.
Denn Poesie ist Erstaunen, Bewunderung, wie die eines vom Himmel gefallenen Wesens, das im vollen Bewußtsein seines Falls die Dinge erstaunt wahrnimmt. Wie die eines Wesens, das die Dinge in ihrer Seele kannte und versucht, sich dieses Wissen zu vergegenwärtigen, sich erinnernd, sie nicht so gekannt zu haben, nicht in dieser Form und unter diesen Gegebenheiten, sich aber an nichts anderes mehr erinnert.
(Orig. engl.)
Ein Künstler ist es sich schuldig, von Geburt an schön und elegant zu sein; denn wer die Schönheit verehrt, dem darf es nicht an ihr fehlen. Und es ist gewiß überaus schmerzlich für einen Künstler, nichts von dem in sich zu finden, wonach er strebt. Wen kann es beim Betrachten der Porträts von Shelley, Keats, Byron, Milton und Poe verwundern, daß sie Dichter waren? Alle waren sie schön, alle wurden sie geliebt und bewundert, alle haben sie in der Liebe die Wärme des Lebens und die himmlische Wonne erfahren, soweit dies einem Dichter oder überhaupt einem Menschen zuteil werden kann.
(Orig. engl.)
[Drei Fragmente von C. R. Anon[2]]
Zehntausend Mal ist mir das Herz in der Brust gebrochen. Ich vermag die Schluchzer, die mich schüttelten, die Schmerzen, die in meinem Herzen wüteten, nicht zu zählen.
Und doch habe ich auch andere Dinge gesehen, die mir Tränen in die Augen trieben und mich so heftig bewegt haben wie ein Blatt im Wind. Ich habe Männer und Frauen gesehen, die ihr Leben, ihre Hoffnungen, die alles für andere hingaben. Ich habe Akte von so großer Hingabe gesehen, daß ich Tränen der Freude weinte. Diese Dinge, dachte ich, sind schön, auch wenn sie nichts ungeschehen machen können. Sie sind reine Sonnenstrahlen auf dem großen Misthaufen[3] der Welt.
(Orig. engl.)
Ich habe die kleinen Kinder gesehen …
Ein Haß auf Institutionen, auf Konventionen hat meine Seele mit seinem Feuer entflammt. Ein Haß auf Priester und Könige hat mich erfaßt wie ein reißender Strom. Einst war ich ein frommer, leidenschaftlicher, aufrichtiger Christ; meine leicht erregbare, empfindsame Natur verlangte nach Nahrung für ihren Hunger, nach Brennstoff für ihr Feuer. Als ich aber diese Männer und Frauen betrachtete, leidend und böse, sah ich, wie wenig sie die Verdammnis einer weiteren Hölle verdienten. Welche Hölle ist schlimmer als das Leben? »Dieser freie Wille«, schrie ich innerlich, »auch er eine Konvention, eine Lüge, von den Menschen erfunden, um im Namen der ›Gerechtigkeit‹, diesem Beinamen für ›Verbrechen‹, strafen, foltern und töten zu können. ›Richtet nicht‹, steht in der Bibel – ja, in der Bibel: ›richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet‹!«
Als ich Christ war, dachte ich, die Menschen seien verantwortlich für ihr schlechtes Tun – ich haßte die Tyrannen, verdammte Könige und Priester. Als ich den irreführenden Einfluß der Philosophie Christi von mir abgeschüttelt hatte, haßte ich die Tyrannei, das Königtum und das Priestertum – das Übel schlechthin. Mit Königen und Priestern hatte ich Mitleid, denn sie waren Menschen.
(Orig. engl.)
Exkommunikation
Ich, Charles Robert Anon, Wesen, Tier, Säugetier, Vierfüßler, Primat, plazentar, Affe, Altweltaffe, □, Mensch; achtzehn Jahre alt, unbeweibt (mit gelegentlichen Ausnahmen), megaloman, mit Anzeichen periodisch auftretender Trinksucht, dégénéré supérieur, Dichter, mit humoristischen Ambitionen, Weltbürger, idealistischer Philosoph etc. etc. (um dem Leser weitere Unbill zu ersparen),
Verhänge im Namen der WAHRHEIT, der WISSENSCHAFT und der PHILOSOPHIE, nicht mit Glocke, Buch und Kerze, sondern mit Feder, Tinte und Papier,
Das Urteil der Exkommunikation gegen alle Priester und alle Sektierer aller Religionen der Welt.
Excommunicabo vos.
Seid alle verdammt.
Ainsi soit-il.
Vernunft, Wahrheit, Tugend durch C.R. A.
(Orig. engl.)
[Entwurf eines Briefes an den Pfarrer seiner Kirchengemeinde]
[1907]
Werter Herr,
ich wende mich mit einer Frage an Sie, die vielleicht nicht sonderlich angenehm ist, um die ich dennoch nicht umhinkomme, da sie mir mein Gewissen gebietet.
Am (…) Juli 1888 wurde ich in dieser Gemeinde – in dieser Kirche[4] – getauft, geboren wurde ich am 13. Juni desselben Jahres.
Nun aber bedingt die Taufe, wie mir scheint, die Eingliederung des Opfers in die Katholische Kirche, nötigt das Individuum, während es noch ein irrationales Wesen ist, einer allzu menschlichen Gemeinschaft beizutreten, mit deren Theorien es im Juli 1888 getauft, im späteren Mannesalter gedanklich vielleicht nicht einverstanden sein möchte.
Mir ist folgendes widerfahren: Die Katholische Kirche, so mächtig wie dumm, so irrational wie hinfällig, erhält die alte Hypothese eines Schöpfergottes aufrecht, die überaus dumm und vollkommen falsch ist, wenn man bedenkt (…)
[Fragment von C.R. Anon]
Ich stellte in mir eine allmähliche und schreckliche Aufspaltung zwischen der Welt und mir fest; der Unterschied zwischen den Menschen und mir war größer denn je. Familiäre Zuneigung – die meiner Familie zu mir – erschien mir angesichts meiner innigen Liebe zur gesamten Menschheit auf schmerzliche Weise kalt. Lebensüberdruß ergriff von meiner Seele Besitz; ich reagierte zusehends feindselig auf die Meinungen der Menschen, obgleich ich sie weiter aus tiefstem Herzen liebte. Jeder Tag, der mich älter werden sah, sah die furchtbare Kluft größer und größer werden. Ich war ein Genie, ich war mir dieser Wahrheit bewußt, sah aber auch diese andere: Ich war als Genie ein Wahnsinniger.
Zum Erfolg, sagt Dr. Reich,[5] benötigt ein junger Mann drei Dinge: Geographie, Geschichte und Religion. Die »Religion« sollte ich durch »Glaube« ersetzen, womit ich »Aufrichtigkeit« meine.
Um aber in der Welt Erfolg zu haben, wenn es denn das ist, was Dr. Reich meint, möchte ich noch hinzufügen, daß für den Erfolg in der Welt drei Dinge unentbehrlich sind: Gewissens- bzw. Skrupellosigkeit; Brutalität; Ehrgeiz. Sie folgen so problemlos aufeinander, sind so logisch miteinander verbunden, daß wir sie alle in einem einzigen Wort zusammenfassen können: Kriminalität, oder der Hang zur ihr.
(Orig. engl.)
[Entwurf eines Briefes an die Mutter]
[1907]
Papa[6] ist ein ehrenhafter Mann, dem ich sehr dankbar bin und den ich überaus schätze und respektiere, in dieser Angelegenheit aber hat er weder etwas zu sagen, noch kommt er in den Tempel. Ich sehe ihm nach, daß er mich nicht versteht; doch fällt es mir schwer, ihm zu verzeihen, daß er nicht versteht, daß er mich nicht versteht und sich in Dinge einmischt, in denen sein guter Wille kein guter Lotse und seine Redlichkeit kein guter Wegweiser ist.
Es gibt ein Gebiet, auf dem wir uns verstehen können: das unserer gegenseitigen Wertschätzung. Darüber hinaus ist, sobald er in das vordringt, was mein ist, und meine Seele mit Nadelstichen zu traktieren beginnt, kein gegenseitiges Verstehen und auch kein Wohlbefinden mehr möglich.
Sie, Mama, lieben mich, denken aber anders als ich.
Wir werden einander nicht erzürnen. So intolerant Sie auch sein mögen, ich bin es nicht. Ich verstehe, daß Sie, Mama, nicht verstehen, und auch wenn mich dieses Unverständnis irritiert und verletzt und Ihr empörender Mangel an Taktgefühl mich noch mehr verletzt und irritiert, so leide ich dennoch darunter, daß mich dies nahezu mit Haß erfüllt, und schreibe ungeachtet dieses Umstandes [?], nüchtern, bei klarem Verstand.
Ich verlange nicht von den anderen als gleich angesehen zu werden. Ich möchte einzig, daß sie mein Anderssein nicht herabwürdigen, indem sie sich als mir gleich ausgeben. Im Gegenzug werde ich alle Vorurteile zu respektieren wissen […] und das ehrliche Unverständnis Ihrer Seele.
Ich weiß wohl, Sie werden alldem mit einem leicht ironischen Ton begegnen □. Doch das verletzt mich nicht. Übelkeit hingegen verursachen mir diese entnervenden Ratschläge und dieses tatsächliche Unverständnis. Das Unverständnis, mit dem Sie mich so lächelnd bedenken wie mit den ironischen Spitzen, die ich erwarte, stört mich nicht. Aber auch das andere [Unverständnis] würde mich jetzt nicht mehr stören. Seit heute bin ich allein, menschlich verlassen und allein, aber gewappnet gegen die Pfeile Ihrer Unbewußtheit und die Lanzen Ihrer unbegreiflichen Zuneigung.
Nach dem nächsten Vorkommnis werden Sie, Mama, vielleicht verstehen, warum Sie nicht verstehen. Aber diese Tatsache, die Ihre Seele der meinen näher bringen kann, wird Sie mich nicht besser verstehen lassen, und ich werde auf ewig allein bleiben.
Erste Seite des Briefentwurfes an die Mutter (BNP/E3, 138a–46)
Briefe, die Aufschluß über meinen Charakter geben
[Schreiben an:]
Archivar der High School (Essays); mich als geisteskrank ausgeben.
Geerdts[7]
, Oxford (Lincoln College); mich als verstorben ausgeben.
Belcher; mich als geisteskrank ausgeben.
Dr. Haggar; mich als geisteskrank ausgeben.
Jeweils mit Faustino Antunes unterzeichnen.
[Ich schreibe Ihnen bezüglich des] verstorbenen Fernando António Nogueira Pessoa, der vermutlich Selbstmord beging; zumindest sprengte er das Landhaus, in dem er sich befand, in die Luft, wobei er selbst und weitere Personen zu Tode kamen. Ein Verbrechen (?), das in Portugal, als es (vor mehreren Monaten) geschah, großes Aufsehen erregte. Man hat mich beauftragt, soweit dies heute noch möglich ist, Nachforschungen hinsichtlich seines Geisteszustandes anzustellen, und da ich erfahren habe, daß der Verstorbene gemeinsam mit Ihnen die High School besuchte, möchte ich Sie bitten, mir in aller Offenheit mitzuteilen, wie ihn die anderen jungen Leute besagter Institution einschätzten. Lassen Sie mir diesbezüglich einen möglichst detaillierten Bericht zukommen. Was für eine Meinung hatte man von ihm? In intellektueller, in sozialer Hinsicht? etc. Hielt man ihn einer Tat, wie ich sie beschrieben habe, für fähig oder nicht?
Ich muß Sie bitten, in dieser, wie Sie sicherlich verstehen, überaus heiklen und überaus traurigen Angelegenheit größtmögliches Stillschweigen zu wahren. Im übrigen könnte es (wie sehr ich doch wünsche, daß dem so wäre) durchaus ein Unfall gewesen sein, und in diesem Falle wäre wiederum eine vorschnelle Verurteilung unsererseits ein Verbrechen für sich. Meine Aufgabe besteht lediglich darin, Nachforschungen über Pessoas Geistesverfassung einzuholen, herauszufinden, ob es sich bei dieser Katastrophe um ein Verbrechen oder schlicht um einen Unfall handelte.
Für eine rasche Antwort wäre ich Ihnen sehr verbunden.
(Orig. engl.)
[Brief von »Faustino Antunes«]
Er ist (zweifellos) ein vesanischer Neurastheniker. Die gewöhnliche Neurasthenie oder ihre auf einen Boden der Degeneration fallenden Auswirkungen haben gewissermaßen eine typisch hysteriforme, um nicht zu sagen, hysterische Geistesverfassung erschüttert. Hinsichtlich dieser Diagnose hege ich keinerlei Zweifel. Ich würde gerne die Krankheitsgeschichte von P. aufzeigen oder, besser gesagt, die Geschichte □, ich möchte deren Psychologie verstehen, in Erfahrung bringen, auf welche Weise oder mittels welcher Kanäle [?] die gegenwärtige Neurasthenie sich in diesem armen, von Natur aus hyposthenischen Temperament festgesetzt hat.
Nun aber fehlen mir zu dieser »Geschichte eines Lebens« oder »Geschichte einer Seele« die Daten. Innerhalb der begrenzten Möglichkeiten kenne ich das mentale Leben von P. bis 1895 (Dezember), bis zu dem Zeitpunkt, als er (im Alter von knapp sieben Jahren) nach Durban zog. Es ist alles andere als normal. In diesem Alter weist der Beobachtete bereits so etwas wie eine ausgeprägte Neigung zur Neurasthenie auf: Mit sieben Jahren ist er bereits, wenngleich nicht manifest, ein Peridyspeptiker, ein □. Desgleichen legt P. ebenfalls bereits als Siebenjähriger ein zurückhaltendes, wenig kindliches Wesen an den Tag – eine Besonnenheit (nicht die Besonnenheit des gesunden ganz und gar bürgerlichen Menschenverstandes, sondern eine melancholische und geistige Besonnenheit), eine Ernsthaftigkeit, die erstaunlich sind. Er sondert sich bereits ab; spielt, liest, schreibt (hat es sich selbst beigebracht) gern für sich allein. Unübersehbar ein Einzelgänger. Alldem sind noch zahlreiche impulsive, nahezu haßerfüllte Zornesausbrüche (oftmals ohne die entsprechende Veranlassung) hinzuzurechnen, und große Angst. Man kann ihn als intellektuell frühreif bezeichnen, versehen mit einer früh ausgeprägten lebhaften Phantasie, boshaft, ängstlich und mit einem Hang zur Absonderung. Ein Neuropath en miniature.
Wahrscheinlich wird er noch einige Zeit so weitergemacht haben. 1901 (August) kehrt er aus Durban zurück. Im Wesen unverändert, aber weniger impulsiv; das Klima und die schulische Disziplin werden ihm (vermutlich) einen Riegel vorgeschoben haben. Zu diesem Zeitpunkt gibt er sich nicht sonderlich kompliziert: eine wache Intelligenz, eine große, aber nicht zwangsläufig lebhafte Phantasie, etwas kindlich […], keine auffälligen Ängste – mit anderen Worten, er zeigt sie nicht ohne eindeutige äußere Veranlassung. Physiologisch ist er also noch normal. Darüber hinaus ist er schüchtern, einfältig und unverkennbar egoistisch – doch alles innerhalb des Normalen. Er ist noch nicht in der Pubertät. Da er in einem Land (dem südafrikanischen Natal) fern des verderblichen Einflusses der Zivilisation lebte, ist er mental noch nicht entjungfert; zu dieser Zeit verfügt er (wie ich glaube) nach wie vor über eine gänzlich jungfräuliche Phantasie. Im übrigen läßt sich dies nicht mit Sicherheit ermitteln.
Von August 1901 bis September 1902 hielt er sich in Lissabon auf; somit muß er also in gewisser Weise von der urbanen und […] verderblichen Sinnlichkeit beeinflußt gewesen sein. Es war mir jedoch gänzlich unmöglich, auf welche Art auch immer, herauszufinden, ob □
(Orig. franz.)
[Brief von Ernest A. Belcher an »Faustino Antunes«]
Durban High School, 14. Juli 1907
Sehr geehrter Herr Antunes,
zutiefst betrübt habe ich Kenntnis vom Inhalt Ihres Briefes genommen, den ich mit der heutigen Post erhielt, und hoffe nur, daß dieser, einem anerkannten Berater Ihres Ranges anvertraute Fall sich nicht als ganz hoffnungslos erweist. Pessoa war für einige Jahre an unserer Schule, und als er die Oberstufe besuchte, standen wir in täglichem Kontakt, da er aber kein Interner war, wußte ich über seine Arbeit hinaus nicht viel von ihm. Als Siebzehnjähriger schrieb er einen Artikel über Macaulay, den ich Ihnen beilege und den ich stets als eine außerordentliche Leistung angesehen habe. Seine englischen Aufsätze waren im allgemeinen ausgezeichnet und bisweilen nahezu genial. Er war ein großer Bewunderer Carlyles, und es kostete mich einiges, ihn davon abzubringen, dessen Stil allzusehr nachzuahmen.
Ich entnehme Ihrem Brief, daß Sie mit der englischen Literatur vertraut sind, und so werden Sie auch verstehen, daß Carlyle der letzte Autor ist, den ein junger Mann mit einem noch nicht ganz ausgereiften Stil nachahmen sollte. Ich war immer gut Freund mit diesem Jungen und empfand ihn als loyal und umgänglich. Er tat sich in den üblichen englischen Sportarten nicht sonderlich hervor, aber einige seiner Mitschüler haben mir erzählt, daß er bei einem Fußballspiel als Zuschauer leicht zu begeistern war. Da er Katholik war, versuchte ich nie, ihm meine religiösen Ansichten nahezubringen, ich konnte aber feststellen, daß er tolerant und liberal war, was sich mit meinen eigenen religiösen Prinzipien bestens vertrug. Ich hoffte einmal sehr, er würde, ehe er sich an der Universität Lissabon einschrieb, nach Oxford[8] gehen, ich hielt diesen jungen Mann immer für einen außergewöhnlichen klugen Kopf, für jemanden, der unter umsichtiger Führung eine vielversprechende, wenn nicht glänzende Zukunft vor sich hatte. Herr C. E. Geerdts, jetzt am Lincoln College, Oxford, und in der Oberstufe sein Klassenkamerad, könnte Ihnen wahrscheinlich einige aus Schülersicht wichtige Informationen geben. Ich bin sicher, er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um Ihnen weiterzuhelfen. Wenn Sie ihm schreiben, beziehen Sie sich bitte auf mich.
An Faustino Antunes adressierter Briefumschlag (BNP/E3, 75a–31v)
Ich habe Dr. Edwards, der Pessoa hier in Durban mehrmals behandelte, gebeten, seinen vertraulichen Krankenbericht an Sie zu schicken, und falls ich sonst noch etwas für Sie tun kann, lassen Sie es mich bitte wissen. Sobald das neue Schuljahr an der High School beginnt, werde ich versuchen, Weiteres in Erfahrung zu bringen, und sollte darunter etwas Nennenswertes sein, werden Sie nochmals von mir hören.
Möglicherweise bin ich nächstes Jahr in Europa, in diesem Fall werde ich mein Möglichstes tun, um Sie in Lissabon aufzusuchen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr getreuer und gehorsamer Diener
Ernest A. Belcher
(Orig. engl.)
[Brief von Clifford E. Geerdts an »Faustino Antunes«]
Elbing
W. Prussia
4. Oktober 1907
Sehr geehrter Herr Antunes,
soeben habe ich Ihren Brief vom 21. September erhalten, und teile Ihnen in der Hoffnung, Ihnen mit meinem Schreiben bei der Behandlung Ihres Patienten, Herrn Fernando Pessoa, dienlich sein zu können, und auf Ihr Versprechen vertrauend, den Inhalt meines Briefes streng vertraulich zu behandeln, unverzüglich alles mit, was mir über das schulische Leben von Pessoa bekannt ist.
1. Um Ihre erste Frage zu beantworten, so vermag ich nicht genau zu sagen, wie lange ich Umgang mit Pessoa hatte, aber die intensivsten Erinnerungen an ihn gehen auf das Jahr 1904 zurück, als wir zusammen dieselbe Schule besuchten. Wie alt er damals war, weiß ich nicht, ich nehme jedoch an, um die fünfzehn oder sechzehn Jahre. Da er Ihr Patient ist, werden Sie sein damaliges Alter natürlich selbst wissen.
2. Er war ein blasser, schmächtiger Junge und machte einen körperlich recht unterentwickelten Eindruck. Er hatte einen schmalen, eingefallenen Brustkorb und neigte zum Buckel. Sein Gang war eigentümlich und ein Sehfehler verlieh auch seinen Augen einen eigentümlichen Ausdruck, es war, als hätten seine Lider keinen Halt.
3. Hinsichtlich seiner Moralität ist mir nicht bekannt, daß er jemals unmoralisch gehandelt hätte, mehr kann ich dazu nicht sagen. Er wirkte auf mich, als hätte er einen Hang zur Morbidität. Er galt als außergewöhnlich intelligent, denn obgleich er als Kind kein Englisch sprach, lernte er es so schnell und gut, daß er in dieser Sprache über einen ausgezeichneten Stil verfügte. Obgleich jünger als seine Mitschüler, schien er nicht nur problemlos mitzuhalten, sondern sie auch noch zu übertreffen. Für jemanden seines Alters dachte er viel und ernsthaft nach, und in einem Brief an mich klagte er einmal über »geistige und materielle Bürden widrigster Art«. Unsere gemeinsame Schulzeit verlief ohne besondere Vorkommnisse, und mir bot sich nicht die geringste Möglichkeit, seine Willenskraft auf die Probe zu stellen. Seine Arbeit schien ihm Freude zu bereiten, daher bedurfte es keiner besonderen Willensanstrengung seinerseits, um beharrlich zu arbeiten. Ich erinnere mich nicht, ihn jemals in einer Situation erlebt zu haben, die ihm diesbezüglich eine große Willenskraft abgefordert hätte. Soweit ich mich erinnere, war es ein Leichtes, ihn zu überzeugen, dies oder jenes zu tun. Er war sanftmütig und friedlich und neigte eher zum Außenseitertum.
4. Ich kann mich an keine Eigenheit erinnern, die auch nur im geringsten auf eine seelische Störung bei ihm hingewiesen hätte.
5. Im allgemeinen war er bei dem einen oder anderen seiner Klassenkameraden beliebt, aber die restlichen Schüler hatten so gut wie keine Meinung zu ihm, zumal er weder mit ihnen Sport trieb noch an anderen schulischen Aktivitäten außerhalb des Klassenzimmers teilnahm und sie ihn daher nur selten zu Gesicht bekamen.
6. Soviel ich weiß, hatte er weder Liebesabenteuer, noch gab er sich irgendwelchen sexuellen Exzessen hin. Ich weiß nicht, mit wem er außerhalb der Schule Umgang pflegte und ob es überhaupt jemanden gab, was ich eher bezweifle. Seine Schulkameraden waren, meines Erachtens, gar nicht in der Lage, ihn sexueller Exzesse zu verdächtigen. Diesbezüglich ließe sich dennoch sagen, daß Pessoa einige anstößige französische und portugiesische illustrierte Hefte besaß. Ich erzähle Ihnen dies, wozu auch immer es gut sein mag, vielleicht hilft es Ihnen herauszufinden, ob er sich unsittlichen Handlungen dieser Art hingab oder nicht.
7. Bezüglich Pessoas »toleranter und liberaler Einstellung« und seines »loyalen und umgänglichen Wesens« teile ich Mr. Belchers Meinung voll und ganz.
8. Pessoa nahm an keinerlei sportlichen Aktivitäten teil, ich nehme an, er verbrachte seine Freizeit mit Lesen. Wir waren allgemein der Auffassung, daß er entschieden zu viel arbeitete, und wenn er so fortführe, seiner Gesundheit schadete.
Alles, was ich hier gesagt habe, ist unter Vorbehalt zu lesen, da es sich lediglich um meine allgemeinen Eindrücke von Pessoa handelt. Mit anderen Worten, für einige meiner hier gemachten Äußerungen kann ich keine konkreten Beweise erbringen. Es ist also durchaus möglich, daß ich hier und da völlig falsche Vorstellungen von ihm habe.
Abschließend möchte ich Sie um einen Gefallen bitten, wenngleich widerstrebend, zumal ich von Ihnen weiß, daß Sie sehr beschäftigt sind. Ich bitte Sie, mich ein wenig über Pessoas Krankheit zu informieren und mir mitzuteilen, ob er seinen Verstand völlig verloren hat oder ob es eine Aussicht auf Genesung gibt. Ich verspüre ein natürliches Interesse an einem alten Schulkamerad und kenne niemanden sonst, der mir etwas über ihn erzählen könnte. In der Hoffnung, daß Ihre beruflichen Verpflichtungen Ihnen erlauben, die Zeit zu finden, mich etwas über Pessoa wissen zu lassen, und Ihnen meine Informationen auf die eine oder andere Art von Nutzen sein mögen, verbleibe ich mit den besten Grüßen
Ihr
C. E. Geerdts
(Orig. engl.)
25. Juli 1907
Ich bin es müde, mich mir selbst anzuvertrauen, mich über mich zu beklagen, Tränen des Mitleids über mich zu vergießen.
Zwischen mir und Tante Rita[9] ist es soeben zu einer Art Szene gekommen, es ging um F. Coelho[10]