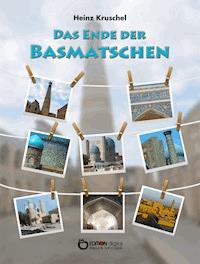7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es sind Entdeckungsreisen in menschliche Leben. Vielleicht lässt sich so am besten das Gemeinsame im Unterschiedlichen dieser 18 Erzählungen beschreiben, die 2001 veröffentlicht wurden. Da ist die Titelgeschichte „Ihr wilder Mut“, die am letzten Novembertag des Jahres 2000 spielt, als die Temperaturen in Mitteleuropa auf 18 Grad anstiegen, und in welcher der Autor über den Zusammenhang zwischen Liebe, Glück und einem Staatsakt nachdenkt. Und diesen Zusammenhang gibt es vielleicht gar nicht, jedenfalls nicht für das Mädchen Hannah, das seinen Freund liebt, ihm noch eine Flaschenpost in seine Abwesenheit schicken will und nicht im Geringsten ahnt, welche Gefahr für einige Leute von ihr auszugehen droht. Da sieht einer nach fünfzig Jahren seine alte Schulstraße wieder, erzählt seinem Enkel von früher und wofür er sich noch heute schämt. Es geht um die scheiternde Liebe einer 13-jährigen Schülerin und ihres weit älteren Lieblingslehrers, um die letzten Gedanken eines langsam Sterbenden und die harten und herzlosen Zeiten der beiden Eheleute davor, es geht um einen Jungen, der sehr allein ist, um einen etwas anderen Heiligen Abend, an dem die christliche Barmherzigkeit auf die Probe gestellt wird, es geht um eine Kuhherde, die die Straße nur mit Hilfe eines blonden Engels namens Julia unbeschadet überqueren kann, um den kleinen siebenjährigen Hermann, der kein Gehör bei den Erwachsenen findet und am liebsten zu den Sternen fliegen würde. Es geht um gefährliche Mutproben. Airbaging: eine Crashfahrt im gestohlenen Auto, sich nur voll auf einen funktionierenden Airbag verlassen, nach dem Aufprall rauspringen und davonlaufen – wenn es denn noch geht. Es geht um das Leben und Sterben einer alten Medizin-Professorin, die Schmerzen in der Brust und in der Seele hat, einen Doktor in den besten Jahren liebt und ihr Erdendasein mit Champagner in der Krankenhaus-Schnabeltasse beendet. Anhand eines Schachkampfes im Jahre 1957, als ein Schüler einem Internationalen Großmeister ein Remis abtrotzt, spürt Kruschel in „Satchmos Punkt“, den Nach-Wende-Veränderungen nach. Eine alte Frau rettet sieben Entenküken das Leben und verliert ihr eigenes, eine gibt per Todesanzeige bekannt, dass sie verstorben ist - ein Doppelporträt in Fragen und Antworten - , Pauline empfindet ihr Leben als einen Irrgarten ohne Ausweg, und der Autor erzählt von einem Vater, der zwei Söhne hat, von denen der eine 1934 den anderen erschießt, und von Bruno Beye, einem Zeitzeugen des vorigen Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Heinz Kruschel
Ihr wilder Mut
Erzählungen
ISBN 978-3-95655-100-0 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 2001 im Geest-Verlag, Ahlhorn.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Julitag in der Schulstraße
Nach fünfzig Jahren sehe ich die Stadt wieder und wundere mich, wie klein manches ist, das ich viel größer in Erinnerung hatte. Ich gehe in die Schulstraße und zeige dem Enkel mein Geburtshaus: schmal steht es zwischen sieben Reihenhäusern, die der Schacht erbaut hatte.
Die Zeit hat viele gelebte Jahre blass werden lassen, aber Bilder tauchen auf, die man vergessen hatte. Jede Straße hat eine Geschichte. Ich zeige dem Enkel die Ecke, wo der Kaufmann sein Geschäft hatte, in dem ich für einen Groschen bunten Puffreis kaufen konnte, und ich zeige ihm auch das Haus, wo der Jude Arend wohnte, der als Diener das Auto des Generaldirektors fuhr, und auch das Haus des Glasermeisters steht noch, der einen steifen Arm hatte und dessen Töchterchen vor der geöffneten Ofenklappe erstickt war.
Jedes Haus hat auch eine Geschichte.
Ich gehe durch die Straße, als erwartete ich, erkannt zu werden, und ich versuche, in alten Gesichtern die Freunde der Schulzeit zu erkennen, und ich erinnere mich, weiß aber nicht genau, ob das, woran ich mich zu erinnern glaube, mir nicht von anderen erzählt worden ist. Ich denke in dieser Straße an einen bestimmten Tag, und nichts von diesem Tag hat sich abgeschwächt, und ich sage laut zu meinem Enkel: „Ich schäme mich heute noch, wenn ich an einen bestimmten Tag in dieser Straße denke.“
Der Enkel sieht mich erstaunt an.
Damals trugen wir die Ärmel hochgekrempelt, sodass man die festen Muskeln sah, und die Strümpfe runtergekrempelt, das war Mode in den vierziger Jahren. „Warum schämst du dich?“
„Das kannst du nicht verstehen.“
„Weil du es selber nicht verstehst, was? Erzähl einfach.“ Ich finde, dass die erzählte Erinnerung mich schwächen wird, und weiß nicht, ob sie für ihn wichtig ist.
„Es war Krieg und ich war dreizehn Jahre alt.“
„So alt wie ich.“
„So alt wie du heute, ich war nur viel dümmer.“
„Stimmt das? Das sagst du bloß so.“
Ich hole ein vergilbtes Foto aus der Brusttasche und zeige es dem Enkel. Es zeigt das einstöckige Schachterhaus, vor dem wir stehen. Aus den Fenstern im ersten Stock sehen Menschen herab. Eine Frau hält ein weißes Bündel im Arm. Die Frau ist meine Großmutter. Das Bündel soll ich sein.
In der Schulstraße war nur morgens Betrieb, wenn die Kinder zur Schule gingen. Hier spielten wir nicht, man konnte sich in der Straße nicht verstecken. Zum Spielen gingen wir auf dem nahen Feuerwehrplatz an der Salzrinne, wo schmutzig gelbes Wasser aus der Fabrik abfloss.
„Du wirst schon noch alles erzählen. Wer wohnte in dem Haus nebenan?“
„Die Hermanns. Er war Kommunist und sie eine ganz Strenge. Meine Großeltern trafen sich mit ihnen zum Skat. Die Hermanns wollten nicht, dass ihr Sohn die schwarze Kumalke heiratete.“
„Und warum nicht?“
„Die Kumalke verkaufte vom Karren herab grüne Heringe.“
„Na und, was ist schon dabei?“
Ich weiß nicht, warum das ihnen nicht passte, der alte Hermann hatte wohl einen Posten unter Tage, er vertrat den Steiger, wie soll man das alles heute einem Jungen erklären. Kommunisten hatten ihren eigenen Stolz. Hätte ich nur nicht gesagt, dass ich mich immer noch für einen ganz bestimmten Tag schäme, den ich vergessen hatte.
„Es war sehr heiß an diesem Tage.“
„Und warum seid ihr dann nicht schwimmen gegangen? Bis zum Strandbad ist es doch nicht weit.“
„Wir hatten Dienst.“
„Was ist das, Dienst haben?“
„Wir mussten marschieren üben, wie man sich dreht und die Beine wirft.“
„Marschieren? Drehen? Beine werfen? Das haut mich um.“
Ich lache, aber mein Lachen klingt verlegen und etwas gequält. Ich finde mein Lachen sogar dumm. Wie erkläre ich denn, was „Linksum“ bedeutete oder was ein Fähnleinführer war, wie erklärt man das einem Dreizehnjährigen heute, und muss man das überhaupt erklären?
„Es war ein Tag im Juli 1943.“
„Es war Krieg, stimmt’s?“
Der Enkel geht in die achte Klasse und weiß, von wann bis wann der Krieg gedauert hat, also muss mich die Feststellung nicht überraschen. Anderes müsste ich erklären: An die tausend Kilometer von der Schulstraße entfernt, nämlich in Italien, beschloss in eben diesem Sommer 43 ein Verwandter des italienischen Königs, vor den Engländern und Amerikanern die Waffen niederzulegen. Er sagte: Sollen doch die Deutschen allein weiterkämpfen, die gewinnen den Krieg sowieso so nicht mehr, das ist unser Krieg nicht länger. Das erzähle ich dem Enkel.
„Wie hieß dieser Verwandte?“
Es war ein Marschall, und er hieß Badoglio.“
„Und was hat er mit der Schulstraße zu tun?“
„Gar nichts, oder doch? Wenigstens in meiner Fantasie.“
„Die Uroma, was deine Mutter ist, die sagt, dass du schon immer viel geträumt hast, Großvater. Du sollst sogar aus dem Bett gefallen sein.“
„Wenn sie das sagt, wird es vielleicht stimmen.“
„Wer vergisst, was schlimm war, der wird dumm, sagt Töffel.“
„Wer ist denn Töffel?“
„Na, Herr Krüger, den kennst du doch, der hat bei dir das Abi gebaut.“ Der Krüger also, denke ich, eine Leuchte war das nicht, aber mit dieser Bemerkung hat er was Kluges gesagt.
Ich hole ein weiteres Foto aus der Tasche. Es zeigt eine kleine festliche Gesellschaft auf dem engen, ummauerten Hof des Schachterhauses, die Hochzeit meiner Eltern. „Der kleine Dicke da, das ist Arend, ein Jude, der fuhr rasant Auto und aß gern Buttercremetorte.“
„Und wo bist du?“
„Aber Junge, zur Hochzeit meiner Eltern war ich noch nicht auf der Welt.“ Der Enkel besieht sich interessiert das Bild, aber er fragt nicht nach den eisernen Kreuzen, die Vater und Großvater auf den Anzügen tragen. Wir laufen ein paar Schritte, und die Erinnerung läuft neben mir her und wird mächtiger. Ich könnte die Augen zumachen, deswegen würde sie doch bleiben. Wir gehen bis zu dem Platz, auf dem die Kirche steht, eine Kirche, wie man sie in den Gründerjahren an vielen Orten hochgezogen hatte, schmucklos grau, und genau so an dem gleichen Platz das ehemalige Rathaus, das ein Heim geworden war, in dem sich Jungen und Mädchen zweimal oder dreimal die Woche trafen, um nach den Befehlen und Trillerpfeifen von Jugendlichen, die bunte Schnüre als Zeichen ihrer Macht trugen, das Stillgestanden, das Kehrt-um, Links-um und Im-Gleichschritt-marsch auf dem Hof zu üben, Schlachtrufe zu brüllen, Landknechtslieder zu singen, in vier Zügen anzutreten, einhundertzwanzig Jungen, die das sogenannte Fähnlein bildeten, sich auf Kommando hinzuwerfen oder das richtige Grüßen der Fahne zu üben.
„Das war ja ‘ne komische Partystimmung bei euch, seid ihr denn solche Weicheier gewesen?“
Ich sage: „Ja, so waren wir.“
„Finde ich ödig. Und was passierte nun in der Schulstraße?“ Meinen Freund müsste ich neben mir haben, gemeinsam erzählt sich manches Schwere leichter, denn was der eine vergisst, fällt dem anderen ein, aber vielleicht hat mein Enkel auch die Bemerkung von der Scham vergessen. Wer bin ich denn, ein alter Mann, fast siebzig Jahre alt, der sich schämt für einen Tag, der vor einer Ewigkeit gewesen ist. Ich weiß, das ist für den Enkel ein Trip zu den Skelettis, so drücken sie sich heute aus. Ich bin aber in einem Alter, in dem man sich gern an Trauriges erinnert.
„Kennst du das, wie es ist, wenn du dich total geirrt hast? Ich hatte eigentlich an einen Jux geglaubt, und dabei war es bitterer Ernst.“
„Ich stehe schrill daneben, Großvater, das kriege ich überhaupt nicht in meinen Kanal.“
„Wir nannten uns Jungvolk, weißt du?“
„Nee, finde ich auch voll bedröhnt, klingt so nach Hühnervolk.“
Also erkläre ich: „Ich war zu diesem Dienst auf diesem Hof des Heims und hörte von draußen Musik, die näherkam, Geschrei und Musik.“
„Was für Musik?“
„Von Trommeln und Hörnern, von schweren Landknechtstrommeln, die ganz dumpf und tief klangen. An diese vielen Trommeln erinnere ich mich.“
„Und warum kamen die?“
Erinnerung kann in bestimmten Augenblicken zur Gegenwart werden, sie kann ins Leben, in die Gegenwart zurückkehren.
„Ich wusste nicht, warum die Trommeln näherkamen“, sage ich, „ich dachte wegen Badoglio.“
„Wieso? Der war doch in Italien.“
Seinerzeit gossen die Zeitungen ihren Spott über den italienischen Marschall aus, der wohl feige war und nicht den Widerstand gegen die Deutschen organisierte, sondern der sich mit seinem König in die Büsche schlug und floh und die erst von ihm selber gebildete Regierung im Stich ließ.
„Ich sah, wie hinter den Trommeln schwere Pferde auftauchten. Sie zogen einen Plattenwagen. Auf dem Wagen stand ein Käfig. Ein Käfig aus Maschendraht.“
„Waren da Menschen auf der Straße?“
„Ja, ich sah die Hermanns am Straßenrand. Ihre Gesichter waren wie aus Stein. Um den Wagen herum tobten Menschen, viele Kinder auch, sie johlten und pfiffen. Vielleicht warfen auch einige mit Kieselsteinen.“
„Und Arend, der Jude? Guckte der auch zu?“
„Arends wohnten schon nicht mehr da. Sie waren auf ein Dorf verzogen.“
„Und wer war nun in dem Käfig? Dieser Dingsbums da, dieser Badoglio?“
So dachte ich damals wirklich, und dass ich so dachte, das weiß ich noch wie heute, ich dachte also: da haben sie doch eine Puppe als Badoglio zurechtgemacht und auf den Wagen in den Käfig gestellt und veralbern ihn. Denn für uns war er damals ein Verräter, zwar ein Faschist, aber auch ein Verräter.
Das ist schon wieder schwer zu erklären.
„Stand dieser Marschall nun als Puppe auf dem Wagen?“
„Nein.“
„Aber da stand doch was auf dem Wagen.“
Ja.“
„Ein Mensch?“
„Ja, ein Mensch.“
„Und deswegen schämst du dich?“
„Deswegen schäme ich mich.“
„Wer war der Mensch in dem Käfig?“
„Eine Frau.“
„Eine Frau in einem Käfig? War sie nackt?“
„Nein, das hätten sie vielleicht doch nicht gewagt. Sie trug ein graues, beflecktes Kleid, und man hatte ihr die Haare abgeschnitten.“
„Stimmt das?“, fragt mich mein Enkel, als traue er seinen Ohren nicht, „wenn man einer Frau die Haare abschneidet, dann nimmt man ihr auch die Ehre, das habe ich gelesen, Tatsache.“
Er sagt den Satz mit so großem Ernst, dass ich nicht widerspreche.
„Weinte sie, lag sie am Boden?“
Jetzt merke ich, wie tief sich die Erinnerung an diesen konkreten Tag eingeätzt hatte, und ich sehe das Bild vor mir: „Nein, sie stand sehr gerade. Sie hatte die Augen weit geöffnet. Es war, als wollte sie alles und alle sehen. Ich dachte ja auch, sie sieht mich an, und deswegen habe ich sie nur einmal angesehen und nicht gelesen, was auf dem Schild stand, das sie um den Hals trug, ich konnte nicht hinsehen, und dazu immer das Dröhnen der Trommeln und das Kreischen.“
Der Junge sieht mich lange und ernst an und fragt dann: „Und warum hat man sie in den Käfig gestellt?“
„Sie hatte einen Freund, einen Ausländer.“
„Na und?“
„Der Freund war ein Pole. Sie waren ein Paar. Der Pole war ein Zwangsarbeiter, der in der Chemiebude wohnen und arbeiten musste.“
„Das regt dich alles auf, nicht wahr, Großvater?“
„Ja, mein Junge. Ich wollte, ich hätte das alles vergessen.“
„Wirklich? Das wäre vielleicht nicht gut. Hatten die beiden geklaut?“
„Nein.“
„Was dann?“
„Sie hatten sich geliebt.“
„Sie hatten also miteinander gepennt, na und?“
„Das war verboten nach damaligen Gesetzen. Eine deutsche Frau durfte nur mit einem Deutschem zusammen sein.“
„Ach so, Deutschland über alles, Mann, so rasanto kriege ich das nicht auf die Rolle. Und deswegen war die Frau in dem Käfig? Über alles in der Welt. Und deswegen hat man ihr die Haare abrasiert? Scheiße.“
„Ja, deswegen.“
„Aber das ist doch so bescheuert!“
Ich war dreizehn Jahre alt, als das geschah. Nun bin ich bald siebzig und schäme mich dieses Tages, obwohl ich an seiner Abfolge nichts hätte ändern können. Aber ich bin in diese Stadt und in diese Straße zurückgekommen, die ich vor fünfzig Jahren verlassen hatte. Ich weiß nicht, wie die Frau hieß. Ich weiß nicht, wo sie gewohnt hat. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Aber ich weiß, dass an dem Tage im Kino der Film ‘... reitet für Deutschland‘ gespielt wurde, und ich kenne sogar noch den Namen des Schauspielers, der die Hauptrolle spielte, er hieß Willi Birgel und war der Schwarm meiner Mutter, und ich weiß sogar noch, dass es zum Abendessen Griesbrei gab und dass ich meinen Teller nicht abessen konnte. Von Zehntausenden von Tagen, die seither vergangen sind, weiß ich nichts mehr, aber von diesem Julitag, der vor Jahrzehnten war, da weiß ich alles wieder.
Vielleicht klebt der längst vergessene Tag an mir oder aber ich an ihm.
„Gehen wir noch schwimmen?“, fragt mein Enkel. „Ich habe einen Bock auf eine richtige Ladung Allotri im Wasser, wir schwimmen über den See um die Wette.“
Auch das noch, denke ich.
Kopflos
Damals wussten wir alle in der Klasse, dass die Ehe unseres Klassenlehrers nur auf dem Papier bestand. Wir alle liebten ihn und nannten ihn Chaos, weil sich manchmal seine Ideen und Einfälle überstürzten. Er zog einen spannenden Unterricht ab. Bei keinem anderen Lehrer war es so aufregend wie bei ihm. Andere waren auch nicht schlecht, aber an ihn kam keiner ran. Wir passten auf, weil wir während der Stunde nichts versäumen wollten. Und wenn die Stunde vorüber war, sagte keiner „endlich vergessen“. Ich hatte oft das Gefühl, als wartete die ganze Welt draußen nur auf mich. Chaos setzte sich immer für uns ein, auch der Schulleitung und seinen Kollegen gegenüber. Ich denke, er liebte uns, er liebte seine ganze Klasse. Aber mich, mich mochte er am meisten, echt, und jeder akzeptierte das. Er wusste, dass er sich immer auf mich verlassen konnte. Wenn ich im Unterricht den Kopf schüttelte, dann war das für ihn ein Signal und hieß, dass es keiner von uns kapiert hatte. Ich sorgte dafür, dass unser Klassenbuch stets in Ordnung war, ich sammelte irgendwelche Gelder ein, ich erinnerte ihn an fällige Termine und mahnte ihn, wenn er Gefahr lief, ungerecht zu werden. Aber das kam selten vor. Nach seinen Stunden war ich steinstark.
Schon als Dreizehnjährige sah ich aus wie ein sechzehnjähriger Zierfisch, und ich hörte, dass man mir auf der Straße nachpfiff, ich war als Freundin begehrt bei Mädchen und bei Jungen. Aber die Jungen waren mir zu albern. Und die eine Freundin in der Klasse reichte mir.
Alle haben für ihn geschwärmt, alle, ich aber, ich träumte von ihm. Ich liebte sein Haar, seinen Siebentagebart, sogar seine Ohren, die kleine Rubbelränder hatten, seine Sprache und seine Bewegungen, wie er lachte oder die Stirn runzelte. Ich mochte sogar den Duft seines Rasierwassers. Aber wir wussten damals auch alle, dass er eine Lady hatte, eine Referendarin.
Keiner klagte ihn deswegen an, wir kannten ja seine Frau und konnten ihn deshalb schon verstehen. Trotzdem, irgendwie waren wir eifersüchtig. Diese junge Lehrerin gönnte ihm keine von uns Mädchen.
Es begann mit einem Brief. Und es sollte eine Erpressung werden, eine ungewollte Erpressung mit schlimmen Folgen.
Versetzen Sie sich bitte in meine Lage. Das ist sechs Jahre her. Wir waren in der siebten Klasse, in einem heißen Sommer, und wir saßen mit Chaos in einem Café, weil er für alle eine Runde Eis spendierte. Auf dem Tisch lag sein Cheftimer. Er schrieb einige Geburtstage und Termine ein. In dem Buch lagen einzelne beschriebene Blätter. Ein Blatt fiel herunter, und ich hob es auf und steckte es ein. Ich weiß nicht, warum ich das tat. Vielleicht wollte ich von ihm was ganz Privates haben, was kein anderer besaß. Das Blatt war sehr privat, es war ein echter Liebesbrief. Wahrscheinlich an jene junge Lehrerin, mit der er zusammen war. Der Brief war ohne Anrede, ohne Überschrift. Komisch, eine Marotte, die ich mir aber erklären konnte. Er hatte in der Klasse einmal erzählt, dass er immer erst später die Anrede über seine Briefe setzte, bis zum Schluss würden seine Briefe immer kopflos bleiben. Wirklich komisch.
Ich war dreizehn, wie gesagt, und ich sah aus wie sechzehn, wie gesagt, und dieser Brief törnte mich an. Chaos beschrieb seine junge Lady, den Schwung ihrer Hüften, ihre festen Brüste, die Linie des Halses und den feinen Mund, und er hoffte auf einen bestimmten Tag, an dem er ihrem Herzen zuhören würde.
Die Lady muss echt hipp gewesen sein. Also, ich las den Brief einige Male. Er gefiel mir, weil er zu mir passte, und da passierte etwas Merkwürdiges, denn ich machte den Brief sogleich zu meinem Brief. So einen hätte ich gern von ihm bekommen. Und hätte er nicht für mich sein können? Vielleicht wollte er auf diese Weise seinen Anker werfen? Die Maße meiner Hüften und meiner Brust stimmten. Aber am nächsten Tage fragte er mich unter vier Augen, ob ich einen Notizzettel oder einen Brief aufgehoben und eingesteckt hätte, aus Versehen natürlich. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte und ob mich jemand am Tisch beobachtet hatte.
Darum dürfte ich ganz schön rumgestottert haben, aber dann nahm ich alle Kraft zusammen, atmete tief durch, wie vor dem Tauchen im Schwimmbecken, und sagte: „Ich gebe Ihnen den Brief nicht zurück. Sie sollten keine Freundin haben, eine fremde Frau, immerhin sind Sie verheiratet, und wenn Sie schon eine haben wollen, dann will, dann will, dann will ich das sein!“
Es war heraus. Ich hatte es ihm gesagt. Das hatte ich ihm wirklich gesagt. Echt. Die Wörter konnte ich nicht zurückholen. Er sprach mit mir auf dem Flur der Schule, also ganz leise, und zischte mich an, ob ich denn verrückt sei oder ob er mir für meine Frechheit eine kleben sollte, er könne sich doch nicht in mir so getäuscht haben. Ich schwieg, ich weinte, ich war selber sprachlos und erschrocken über mich.
Nach Schulschluss erwartete er mich auf dem Hof und drohte, mit meinen Eltern zu sprechen.
Ich sagte: „Dann schicke ich den Brief an Ihre Frau.“ Nun bemerkte ich, wie sehr er erschrak. Ich solle bitte vernünftig sein, er habe sich doch immer auf mich verlassen können.
Er kam natürlich nicht zu meinen Eltern. Warum eigentlich nicht? Das war vielleicht sein entscheidender Fehler. Er wollte mit dieser Angelegenheit wahrscheinlich selber fertig werden: eine Schülerin, die würde er doch überzeugen können, zumal eine, die ihn so sehr mochte, seine Beste, das wäre doch gelacht.
In der Klasse erzählte ich keinem von dem Liebesbrief. Erst nach einer vollen Woche kam es wieder zu einem Gespräch zwischen uns. „Schwamm drüber“, sagte er, „wenn du den Brief zurückgibst. Es tut mir leid für dich, vergessen wir es, ja?“
Ich lehnte wieder ab.
Viel später erfuhr ich, dass er in dieser Zeit seine Freundin informiert hatte, diese Label-Lady, die junge hübsche Referendarin. Ich weiß nicht, was sie ihm geraten hatte. Wahrscheinlich nicht, die Eltern oder die Schule zu informieren, denn er ging fortan zu meiner Überraschung auf meine Wünsche ein, auf Forderungen, die ich mir ausgedacht hatte: sich mit mir zu treffen. Wir spazierten an der Elbe entlang und schwatzten über Bücher, die ich gelesen hatte, wir fuhren zusammen in ein Waldbad, lagen nebeneinander nah auf der Decke unter der Sonne, und wenn er im Wasser unter mir wegtauchte und zufällig meine Brüste berührte, dann hielt ich das für Absicht. Ich war stolz auf meine Brüste. Man nannte mich deshalb Bardot, nach einer französischen Schauspielerin mit schöner Oberweite. Ich war selig. Ich konnte ihn anfassen und genoss die Berührung. Aber das war alles harmlos, wirklich. Er gab mir nicht mal einen kurzen Kuss auf die Backe. Ihm zuliebe zog ich ganz helle Klamotten an, ich wusste, dass er die mochte. Wir sprachen auch über die Zukunft.
Wer bestimmt denn, dass eine Dreizehnjährige einen vierzigjährigen Mann nicht lieben dürfe. Dass sie es könne, würde ich allen schon beweisen. Denn ein Mann liebe ja nicht die Jahre des Mädchens, sondern das Mädchen. In diesem Fall liebte nicht irgendeine Unke einen vollen Nullchecker, nein, nein. In unserer Kraft könne eine solche Liebe einmalig sein. Solche Gespräche provozierte ich. Er war ganz still und legte seinen Arm um mich. Ach, Bardot, so solltest du nicht spinnen, kleine Fantastin, das Leben ist ganz anders. Ich meinte, meine Forderungen steigern zu können. Er solle auf mich die fünf Jahre warten, ja, dann wäre ich achtzehn, und wir könnten vor den Leuten ein Paar sein.
Das war ihm zu viel, und ich merkte rasch, dass er bisher auf seine Weise bloß mitgespielt hatte, einfach gespielt. Er reagierte sehr bestimmt und forderte endgültig den Brief zurück.
Ich weinte und dachte an das Ende, an ein endgültiges Ende, und wollte am liebsten meinen Föhn in die Badewanne fallen lassen. Wie verklapst, so kam ich mir vor. Aber von einem bestimmten Tage an war ich keine Konfusi mehr, ich konnte wieder handeln, und zwar ganz kalt, und erzählte meinen Eltern, dass mich mein Lehrer belästigte, dass er mir einen Liebesbrief geschrieben und sich mit mir getroffen hätte.
Der Brief lag auf dem Tisch, er war der Beweis. Sogar die Eintrittskarten der Badeanstalt tat ich dazu. Was liegt, das pickt, sagt man beim Kartenspiel.
Nun erst wollte Chaos mit den Eltern sprechen, aber mein Vater lehnte ab, er würde das nur im Beisein einer vorgesetzten Behörde tun. Die Würfel waren gefallen. Ich konnte nicht mehr zurück.
In der Klasse erzählte ich nur meiner Freundin davon, und die schwieg, wie ich auch schwieg. Ich arbeitete im Unterricht mit, wie immer, und hielt die Einskommavier in seinen Fächern und blieb auch zuverlässig. Meine Signale veränderten sich nicht, ich hing an seinen Lippen.
Eines Tages bat er mich noch einmal, doch endlich zu erzählen, wie es wirklich gewesen wäre. Dahinter steckte natürlich seine Label-Lady. Die hatte sich nämlich inzwischen von ihm getrennt und wollte auf gar keinen Fall, dass ihr Name genannt wurde. Sie wollte aus allem herausgehalten werden. Das hatte er ihr auch versprochen. Und Chaos hielt immer seine Versprechungen. Feige war diese Referendarin, sie hatte eigentlich die Lösung in ihrer Hand.
Nach einigen Wochen erzählten meine Eltern von einer Sitzung bei der Schulbehörde, das heißt, mein Vater erzählte laut, und meine Mutter kommentierte, wie das immer in unserer Familie war. Sie sagten, dass Chaos bestritten hätte, von mir eine künftige Heirat gefordert zu haben. Er hätte mich zwar nicht angerührt, wohl aber berührt. Eltern und Behörde waren sich einig: Schlimmeres musste verhütet werden.
Ich schämte mich. Da wurde der Mann, den ich liebte, als verabscheuungswürdig und abscheulich hingestellt. Ihm waren nur ein paar hilflose Beteuerungen geblieben, der Brief lag ja vor. Den Namen der jungen Referendarin würde er nicht nennen.
Nach den Ferien wurde ich krank, lag mit Fieber im Bett und bekam Besuche von Klassenkameradinnen, die von mir wissen wollten, was eigentlich los sei. Da hatte zum Beispiel der Englischlehrer bei der Behandlung des Possessivpronomens den Satz übersetzen lassen: „Chaos ist euer Klassenlehrer“, und darauf hatte ein Junge geantwortet: „Aber nicht mehr lange.“
Er wusste schon alles.
Nun schwieg ich nicht länger. Ich erzählte die Story, aber natürlich meine Fassung. Sie gafften und sie starrten. Sie nannten mich Spinnerin, Angeberin, eingebildete Ziege, ich war in ihren Augen metamies. Blödsinn, wer sollte das von Chaos glauben.
Ich lächelte. Das Lächeln kostete mir viel Kraft. Nun folgte der Anfang vom Ende. In seinem Unterricht wurde es immer ruhiger, aber es war keine gute Ruhe mehr, alle warteten gespannt und wurden enttäuscht. Viele glaubten es nicht. Wenn er in dieser Situation der unheimlichen Ruhe und Anspannung die Wahrheit gesagt und alles erklärt hätte, dann wäre es zu einer Prügelei gekommen, sie hätten mich grün und blau geschlagen, obwohl in unserer Klasse selten geprügelt wurde. Aber er sagte nichts, Chaos stellte mich nicht bloß. Die Klasse erwartete von ihm ein offenes Wort, und ich wurde kaum noch beachtet.
Nur meine engste Freundin hielt zu mir.
Er tat mir sehr leid. Ich wäre zu ihm hingegangen, wenn das hätte helfen können. Ich hätte mich vor ihm ausgezogen, und es wäre schön gewesen, mit ihm unter der Dusche zu stehen und gestreichelt zu werden und diese ganze blöde Welt zu vergessen.
Aber dazu fehlte mir der Mut. Er würde mich doch wegschicken. Kurz und gut, nein, nicht gut, denn er erkrankte und wurde in eine Klinik eingewiesen. Ich weiß nicht, was sich alles auf diesen Ämtern abspielte und wie ihn die Bürokratie fertigmachte. Unsere Klasse wurde von einem anderen Lehrer übernommen. Allmählich kamen viele Mitschüler und fragten mich aus, das war doch eine Sensation. Wie ist er denn so gewesen? Ein toller Mann, was? Ein richtiger Yiffie? Erzähle mal. Aber ist er nicht eigentlich schon ein Fossil?
Nicht alle fragten, nein. Einige verachteten mich. Aber ich glaube, gar nicht des Briefes wegen, den verzieh man ihm, den verstand man, nein, man verachtete mich, weil ich, wie sie denken mussten, meine und seine Liebe verraten hatte. Sie glaubten ja alle auch, dass der kopflose Brief an mich gerichtet war.
Und sie glauben es heute noch. In der achten Klasse erfuhren wir, dass Chaos aus dem Dienst entlassen worden war.
Ich habe ihn geliebt, und ich glaube, dass er mich auch geliebt hat, aber eine Schülerin darf ja einen Lehrer nicht lieben. Und ein Lehrer erst recht keine Schülerin. Einmal traf ich ihn auf der Straße und wollte auf die andere Seite, dann gingen wir einander vorbei und grüßten uns ernst.
Ich wusste, dass ihn immer noch einige besuchten und beneidete sie darum. Ich habe mich schuldig gemacht.
Aber war er denn ganz ohne Schuld? Hat er nicht manchmal auf einem Ausflug meinen Oberarm umfasst, mich umarmt, herzlicher als andere, hat er mir nicht manchmal einen Klaps auf den Po gegeben und mit mir auf dem Rasen gerangelt? Das soll nur so aus Jux gewesen sein? Hatte denn nur ich einen Tango im System, und er gar keinen?
Als ich auf dem Gymnasium war, verblasste die Erinnerung an Chaos etwas, aber jetzt bricht alles wieder auf. Meinen Eltern habe ich übrigens nie die Wahrheit gesagt, keinem Menschen habe ich je erzählt, wie es wirklich gewesen ist.
In den sechs Jahren habe ich viele Freunde gehabt. Aber keiner hatte das Format meines Lehrers. Ich habe es bei keinem länger als zwei Monate ausgehalten. Wenn da mehr als Petting verlangt wurde, ging ich auf Nullstellung, dann war sofort Schluss.
Es wäre besser gewesen, wenn ich Chaos nicht wiedergesehen hätte. Aber ich habe ihn nun wiedergesehen, und das kam so: