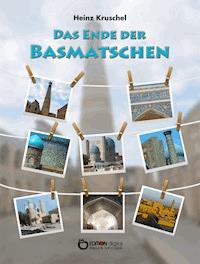7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor Heinz Kruschel, bekanntgeworden durch Romane und Erzählungen, erzählt in diesem Roman die Geschichte des Biologen Robert Karnel, der seine eigene Dissertation verwirft, weil er einem außerordentlich interessanten und volkswirtschaftlich wichtigen mikrobiologischen Problem auf die Spur gekommen ist und es lösen helfen möchte. Gleichzeitig hat Karnel Studenten zu erziehen, Biologie-Lehrer von morgen; auch dies versucht er auf neue Weise, er kämpft an gegen den toten Wissensballast einer bloß beschreibenden Wissenschaft; er sucht der Hochschulreform an seinem Institut schneller zum Durchbruch zu verhelfen. Gelegentlich erweist er sich dabei als Einzelgänger wider Willen, gelegentlich aber verbauen er und seine Freundin Jane sich auch selbst den Weg zu neuen Formen kollektiver Arbeit, die sie ja eigentlich anstreben. Es gelingt dem Autor, mit diesem Roman aus dem Milieu junger sozialistischer Wissenschaftler in einer spannenden Handlung Probleme jener Zeit zu gestalten. Immer geht es dabei um die Probleme und Konflikte von Menschen und um ihre Lösung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum
Heinz Kruschel
Wind im Gesicht
Roman
ISBN 978-3-95655-144-4 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1971 im Mitteldeutschen Verlag Halle-Leipzig.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2017 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Wissen ohne Gewissen ist der Ruin der Seele
Rabelais
Erster Teil
1.
Der Alte hatte die Ratte abgetötet.
Er saß breitbeinig auf dem Holzstuhl am Tisch, sein Bauch ruhte auf den Oberschenkeln. Er schnaufte und dachte: Wenn Karnel nicht bald kommt, fängt sie an zu stinken, draußen haben wir an die dreißig Grad, wir können froh sein, dass die Mauern hier so dick sind, stabil haben die Mönche gebaut, das muss man ihnen lassen. Kommen könnte Karnel bald, da sitzt er nun die ganze Ferienzeit über am Institut, verheiratet müsste der sein, aber da könnte einem ja die Familie leid tun, der wäre ja doch nur mit seiner Biologie verheiratet ...
Von seinem Platz aus konnte er beobachten, wie Robert Karnel aus dem löwenbewachten Portal des Hauptgebäudes trat, auf der Treppe stehen blieb und in den Himmel blinzelte, als wäre er überrascht, dass er so hoch war und so sonnig. Als Karnel über seinen widerspenstigen Haarschopf strich, lachte Engalke auf. Er erinnerte sich, dass Karnel einmal Pomade in sein Haar geschmiert hatte, weil ihm der Direktor in einer Feierstunde eine Auszeichnung geben wollte. Die Studenten hatten gefeixt, als sie Karnel erkannten, so fremd, so unnatürlich fremd wirkte der auf der Bühne mit dem angeklatschten, glatten Haar - wie ein Friseurkopf aus dem Werbefernsehen.
Seitdem hatte Karnel nie wieder den Versuch unternommen, seine Haare zu bändigen; es war, als fielen sie in alle Richtungen, auch in die Stirn. Aber das passt zu ihm, dachte Engalke vergnügt, ein Brausekopf ist er.
Karnel kam über den Hof. Man merkte seinem wiegenden Gang die Prothese nicht an. Sie werden ihn ja wohl befördern, dachte der Alte, er wird zum Lehrstuhlleiter gemacht, es gibt keinen besseren Mann dafür ...
„Hast du das Tier geschafft?“, fragte Karnel, als er in das Zimmer trat. „Du siehst so erschöpft aus, hat sie sich gewehrt?“
Engalke winkte ab und wies auf den Seziertisch. „Ich kann mir Schöneres denken“, meinte er, „als in den Ferien trächtige Ratten zu sezieren.“
„Ich auch. Aber ich brauche den gefärbten Schnitt durch den Embryo ...“
Engalke schüttelte seine weißen Loden. „Können das die Laboranten nicht besser?“
„Du traust mir nicht mal das zu, Fritze? Natürlich können es die Laboranten besser, aber sie sind nicht da, verstehst du, Ferienzeit. Die Fernstudenten sind nun auch weg, da habe ich Lust, ein bisschen Handwerk zu treiben, außerdem brauche ich ein paar frische Schnitte für die neuen Seminare.“ Er trat an den Tisch, auf dem das Tier lag, und öffnete geschickt mit Skalpell und Schere die Leibeshöhle und legte die Embryonen mit dem Uterus frei.
Engalke knöpfte sich den Hosenbund über dem Bauch zu und sagte: „Hörst du, da fährt ein Dampfer.“
„Die fahren doch immer in der Hochsaison, ins Grüne nach Hohenwarthe zum Bockwurstessen ...“
„Und du?“
„Was, ich?“
„Ich meine, fährst du nicht? Nicht mal an die Ostsee?“ Karnel injizierte die Embryonen mit einer Tempospritze, damit die feinen Gewebe nicht durch Autolyse zerstört werden konnten, und legte sie vorsichtig in Boinsches Gemisch aus Pikrinsäure, Formal und Eisessig. Dann wusch er sich sorgfältig die Hände, Engalke reichte ihm das Handtuch.
„Ich habe drei Wochen lang täglich fünf Lehrveranstaltungen mit Fernstudenten gehabt“, sagte Karnel, „wie hätte ich da an die See fahren können? Und jetzt, wo alle Räume leer sind, fehlt mir etwas, ich fühle mich plötzlich nicht mehr beschäftigt genug.“
„Dann fahre doch noch ein paar Tage.“
Karnel antwortete nicht, das einzige Geräusch im Zimmer war das Tropfen des Wasserhahns, eintöniges Klick-klack-klick. Der Alte ging zum Fenster und öffnete es weit. Alles war nah: die Rufe der Möwen über dem trägen, breiten Fluss, das gemütliche Tuten der Dampfer, das aufgeregte Bimmeln einer Straßenbahn. Engalke setzte sich wieder, nahm aus der Schachtel eine Zigarette, rieb das Streichholz an und blickte über das Flämmchen hinweg nachdenklich auf Karnel. „Wirst du dieses Jahr noch deinen Doktor haben?“, fragte er. „Doktor Robert Karnel, das klingt, was?“ Er lachte.
„Nein“, sagte Karnel und lächelte, „ich habe die Dissertationsschrift zurückgezogen, ich muss noch einmal anfangen ...“
Engalke schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. „Aber du bist fertig gewesen! Du hattest viele neue Arten entdeckt und beschrieben von diesen kleinen Viechern ...“
„Turbellarien, meinst du. Ja, das hatte ich, stimmt. Und vielleicht würde meine Dissertationsschrift auch durchkommen, so eine althergebrachte Beschreibung der Arten, aber in dem Thema steckt mehr, Fritze, das muss ich herausholen, ich muss es entschlüsseln. Aber ob ich es kann …“
Engalke brummte: „Und ich hatte den Wein schon bereitgestellt. Na, du wirst wissen, was richtig ist ...“ Er dachte: Ein Dickkopf ist er. Alle glauben, dass Karnel dieses Jahr noch promovieren wird. „Weiß das der Chef schon?“
„Das wissen erst mein Doktor-Vater an der Uni, ich, du und Posalaky ...“
„Dein ungarischer Kollege?“
„Ja.“
Engalke dachte: Zu gründlich ist Karnel, zu exakt, kein Pedant, aber bei ihm muss alles lückenlos sein. Er sagte: „Na, wenn du Zeit hast, Mensch, dann fahre doch noch zwei, drei Tage weg, verkriech dich nicht bei den blöden Ratten, die kann ich auch fertigmachen.“
Karnel lachte. „Perfekter Laborant.“
„Du denkst, ich kann bloß Tiere pflegen, ja? Gib mir zwanzig, ach was, zehn Jahre von deinem Leben ab, und ich mache euch allen einen echten Wissenschaftler vor ...“ Karnel sagte zögernd, den Blick auf das Blau gerichtet, das die Fenster ausfüllte: „Du musst das Objekt entwässern ...“
„Bin ich ein Anfänger?“
„Entschuldige, Meister.“
„Manchmal erschrecke ich vor eurer Biologie, Bob.“
„Nanu? Warum denn?“
„Ich habe da eine Sendung gehört. Man hat einige Hundert Ratten dressiert, auf ein bestimmtes Signal hin erschienen sie am Futterplatz, einzeln, nicht in Massen hat man sie gerufen. Na gut, das kann man dressieren. Aber dann hat man sie schnell getötet, ihnen die Ribonukleinsäure aus den Hirnen entfernt und die Säure anderen und nicht dressierten Ratten in die Bauchhöhle gespritzt. Dann wurde das Experiment wiederholt. Die nicht geimpften Ratten reagierten nicht, aber von dreihundertfünfundsiebzig injizierten Ratten reagierten dreihundertsiebzig sofort richtig und rannten zum Futterplatz, weil die Säure der getöteten Tiere ihnen diese Information übergeben hatte ...“
„Aber das ist wunderbar, Fritze, ein gutes Experiment.“
„Ich weiß nicht. Ich kann mir so den nächsten Schritt vorstellen. Man wird Menschen verändern können. Durch Drogen, wie? Durch diese Säure? Durch fremde Informationen? Da kennt man sich selber nicht mehr. Da wacht der Tierpfleger Fritz Engalke eines Morgens auf und spricht wie ein Hindu, oder er hat ein Referat über Molekularbiologie im Kopf, das er noch nie gehört hat und auch gar nicht begreift!“
Karnel lachte laut. „Ob Drogen oder nicht“, sagte er, „wir können diese Möglichkeiten der Biologie zurzeit nur unterschätzen. Sie wird Erkenntnisse bringen - und auch Veränderungen bei uns Menschen, die die Kernspaltung in den Schatten stellen werden.“
Die Aspekte sind klar, dachte er, die Lernergebnisse, das sind eingeschliffene, bedingte Reflexe, werden in der RNS determiniert. Das bedeutet, dass Lernergebnisse in keinem Falle vererbbar sind. Es müssen in der Schaltzentrale, in Rückenmark, Gehirn und Ganglien, mit der Zeit Matrizen für bestimmte Handlungs- und Planungsvorlagen entstehen. In der RNS verändern sich dann die Schaltzellen, die Folge der Stickstoffbasen wird verändert, was zum Entstehen bestimmter Eiweiße führen muss. Ja, mein Alter, die Biologie beginnt, die letzten Wunder zu entkleiden
„Was ist nun?“ Engalke zeigte auf das sezierte Tier. „Fährst du? Oder ist dein Hirsch nicht fit?“
Ich könnte wirklich fahren, dachte Karnel, ein paar Tage in Luft und Sonne ... „Das Auto ist schon in Ordnung.“
Engalke sagte: „Mach dir keine Sorgen, ich weiß Bescheid. Von Aqua destillata die Alkoholreihe hochführen, von dreißig auf sechsundneunzig Prozent, dann von Optal in Xylol legen ...“
„Du musst es dreimal in Xylol legen, sonst streikt das Paraffin.“
„Weiß, weiß, hau schon ab ...“
„Ich fahre wirklich.“
„Drohe nicht immer nur. Eine Ansichtskarte brauchst du nicht zu schicken, aber bring ’nen Eimer voll weißen Sand mit, fürs Aquarium, weißt du ...“
„Wird gemacht. In drei Stunden könnte ich das erste Mal ’rausschwimmen ...“ Er dachte: Über das Studium des Lebenden darf man das Leben nicht vergessen.
2.
Staunen bei den Sonnenanbetern über den Mann, der seine Prothese in den Schatten eines Strandkorbs warf, in drei Hupfsätzen im Wasser stand und mit wuchtigen Stößen hinausschwamm. Sie blickten ihm nach, bis nur noch sein Haar zu sehen war.
Bob Karnel machte sich nichts aus den Blicken der Leute. Früher, vor fünfzehn Jahren noch, hätte er anders darauf reagiert. Damals wäre er nicht an einem belebten Strand ins Wasser gegangen, jeder mitleidige Blick hätte ihm wehgetan, er hatte sich ja selber bemitleidet.
Es schmerzte ihn maßlos, als er aus der Gefangenschaft zurückkehrte, knapp achtzehn Jahre alt, und seine Freundin ihn zwar nicht aufgab, aber jede körperliche Berührung mied. Er spürte, dass sie nur aus mütterlicher Betulichkeit bei ihm bleiben wollte. Ein Krüppel! Den durfte man doch nicht verlassen, dem musste man beistehen und helfen. Dieses verdammte Anstandsgefühl seiner Mitmenschen hasste er, und so brach er mit dem Mädchen, das bald einen anderen Mann heiratete.
In den folgenden Jahren lernte Robert Karnel, die behutsamen Bemerkungen und die mitleidigen Blicke zu ertragen. Er lernte, seinen Bein-Ersatz zu bewitzeln. Das war nicht leicht. Aber in seinem Leben war nichts leicht gewesen.
Wenn er zurückdachte, stieß er auf Begegnungen mit Menschen, auf Situationen oder manchmal nur auf Bemerkungen, die er im Gedächtnis aufbewahrte, ein Credo, für ihn bestimmend.
Vor der Nachamputation in Karlsbad schnitt er sich die Pulsadern auf, kam von den Ohrfeigen des Stabsarztes wieder zu sich und starrte verwundert und immer noch benommen auf die dicken Verbände an seinen Handgelenken. „Merke dir den Augenblick, mein Junge“, sagte der weißhaarige Arzt zu ihm, „ich habe viel mehr von dir gehalten, du hast mich enttäuscht. Ein Kerl, dachte ich, ein Kerl ist dieser Karnel, er jammert nicht, er zeigt seine Tränen nicht, heulen wird er schon im Stillen, er ist ja kein Übermensch, aber ich wusste nicht, dass er sogar ein Feigling ist, einer, der sich heimlich davondrücken will ... Und einem Feigling habe ich auf die Sprünge geholfen! Ein Schwächling bist du, Karnel, ich schäme mich für dich ...“
Er ein Schwächling? Er, Robert Karnel, ein feiger Kerl? Ein Feigling war er nicht. Ein bisschen schwächlich war er schon als Junge, schwächlich und sehr empfindsam. Die gleichaltrigen Jungen trauten ihm nichts zu, sie ließen ihn links liegen. Er kümmerte sich auch nicht um sie, spielte mit kleineren Kindern, saß stundenlang in den angepflanzten Schonungen der Heide und beobachtete Eidechsen, Weinbergschnecken und Vogelschwärme oder versuchte, in seiner stillen Ecke auf dem Stallboden des elterlichen Hauses das Äderwerk eines Ahornblattes nachzuzeichnen.
Eines Tages sah er, wie zwei große Jungen aus der letzten Klasse über ein Mädchen herfielen. Es schrie und strampelte, aber in der stillen Heide war kein Mensch in der Nähe, nur Robert Karnel stand da und starrte, und einer der Jungen rief verächtlich: „Ach, bloß der Karnel! Mach, dass du weiterkommst!“
Bloß der Karnel. Robert hätte nicht sagen können, warum er, der so oft von den Jungen gestoßen und verprügelt worden war, warum er nach einem Knüppel griff und auf die Jungen einschlug, dass sie schreiend und mit blutigen Köpfen davonrannten.
Er war nicht feige. Aber er hatte die Angewohnheit, sich nicht gleich einzumischen, er wartete gern ab.
Die letzten Kriegsjahre unterbrachen seine Schmiedelehre. Er wurde eingezogen und machte, siebzehn Jahre alt, eine Kurzausbildung durch, dann noch einen Lehrgang als Funker. Während des ersten Gefechts wurde er verwundet, er hatte nicht einen Schuss abgefeuert.
Als sie ihn fanden, lag er in einer Blutlache, hatte die Augen geschlossen und atmete nur noch leise. Bei vollem Bewusstsein wurde er von den Sanitätern auf die Trage gelegt. Er schrie nicht, sondern nahm alles wie ein Außenstehender wahr, wie ein Wesen, nicht mehr von dieser Welt, in ihm war schon ein Schweben, ein Hinüberdämmern ...
Er war kein Feigling. Aber mit einem Bein? Ein halber Mensch, ein Krüppel! Der Stabsarzt hatte gut reden, er lief auf zwei gesunden Beinen. Karnel weinte nicht über den körperlichen Schmerz. Er weinte, weil das, was ihn draußen erwartete, nicht mehr das Leben sein konnte, nur ein Vegetieren, dachte er.
War er feige? Aber nun war doch alles anders, er war ein siebzehnjähriger Einbeiniger. Und alle Karnels wurden alt. Sollte er sechzig Jahre als Krüppel leben?
Ein Feigling wollte er nicht sein. Manchmal wachte er nachts auf und spürte, wie der Fuß zuckte, der doch gar nicht mehr da war - die Nerven, sagte die Schwester. Er weinte vor Wut und vor Hilflosigkeit.
Dann stand er auf rohen Achselarmkrücken am Zaun des amerikanischen Gefangenenlagers Helfta und sah, wie sich die Landser um die kleinen Rationen prügelten, wie sie zu Tieren wurden, wie sie von Amerikanern auseinandergejagt wurden, während andere GIs die Szenen filmten.
Er wollte überleben, nun erst recht. Aber er sah den Anfang des Weges nicht. Da wurden die Krücken zu seinem besten Erziehungsmittel. Er hasste den Krieg, weil er seine Krücken hasste. Er hasste die Nazis, weil er ihnen Krieg und Krücken zu verdanken hatte. Vorher hatte er über die Braunen gar nicht nachgedacht. Seine Gefühle diktierten ihm den Hass. So einfach war das. So schwer war das für einen, der mit einem Bein ins Leben musste. Als er im Herbst des Jahres fünfundvierzig zurückkehrte, bekam er seine erste Prothese, einen Holzstab mit einem Gummiaufsetzer am unteren Ende; der Stab war so lang wie der Unterschenkel und schloss mit einem viereckigen Holzklotz ab, auf dem ein Gipsabdruck des Stumpfes befestigt war. Er musste ohne Krücken und ohne Stock laufen lernen.
Der Schultergürtel drückte auf die Lungenspitzen des oberen Brustkorbs. Bob betrachtete diese Prothese wie einen Feind, mit dem man kämpfen musste, der einem blaue Flecke und Entzündungen zufügte, denn der Stumpf war plastisch, die Prothese starr, zwei verschiedene Materialien, sie schienen unversöhnlich.
Als er mit seinem Mädchen ein Tanzvergnügen im Dorfe besuchte und einige Polkaschritte wagte, unbeholfen und wankend, bildeten die Paare einen Kreis und hörten zu tanzen auf. Sie sahen stumm zu. Bob stampfte trotzig und schwitzend vor Anstrengung, das Mädchen weinte leise, er aber wurde immer fröhlicher, immer lauter und nahm eine Flasche Sprit mit auf sein Zimmer, betrank sich, betrank sich das erste Mal in seinem Leben. Er wollte nicht wieder an eine Kapitulation denken. Aber er dachte doch daran, er dachte nur daran.
Bei dem Versuch, Fußball zu spielen, zerbrach seine Prothese. Die zweite besaß eine Oberschenkelhülse aus schmiegsamem Leder. Die dritte war in Halle angefertigt worden und aus leichtem, von pergamentartigem Leder überzogenem Pappelholz; sie hatte schon zwei Scharniergelenke, die Federung wurde durch einen Hartgummibolzen bewerkstelligt, der in der Fersengegend eingelassen war.
Die neue Zeit stabilisierte sich, das spürte er auch an der Entwicklung seiner Prothesen. Die Zeit nannte sich: antifaschistisch-demokratische Ordnung.
Robert Karnel gewöhnte sich an seine Prothese und entwickelte sogar eine Philosophie über sie: Man muss Achtung vor ihrem Namen haben. Pro-These, Thesis-Antithese, da ist der Satz. Es gibt schon eine verwandtschaftliche Ebene zu dem Pythagoras und zu den Thesen Luthers. Und wie die Prothese mit ihrer Vorsilbe liebäugelt. Pro, als für etwas, verwandt mit Wörtern wie progressiv, Provokation und Progression. Ihren bürgerlichen Namen aber nennt man nicht; man sagt nicht Beinersatz; Ersatz mindert ab.
Und doch: Es gibt einen psychologischen Aspekt, ein Ersatz kann moralische Potenzen enthalten, ein Ersatz muss nicht nur ersetzen, sondern auch aufwerten.
Die Prothese wurde Karnel kostbar. Mit ihr lernte er ein zweites Mal springen, tanzen und Rad fahren. Und sie hatte einen kategorischen Imperativ: Sie veränderte den Menschen. Wenn man sie erhält, ist man ein labiler Mensch und seelisch erschüttert. Die Prothese verhilft mit zum Streben nach Vollwertigkeit. Nur der Willensschwache lässt sich treiben und jammert ein Leben lang über das Unwiederbringbare. Karnel verdankte es seiner Prothese, dass er oft vergaß, ein Amputierter zu sein.
Keine seiner Prothesen starb je an Altersschwäche, er strapazierte sie weidlich, seine plumpen Geräte, seine Kunstwerke mit ihren moralischen Wirkungen.
Nun konnte er darüber lachen, wenn ein vierjähriger Knirps gegen seine Prothese lief und sich eine Beule holte und über das „blöde Holzbein“ schimpfte. Er las Polewois Geschichte vom wahren Menschen, von dem notwendigen Kampf, sich selbst zu überwinden. Auch diese literarischen Bestätigungen brauchte er. Er überwand sich selbst. Das war sein schwerster Kampf. Er gewann ihn nicht von heute auf morgen.
3.
Bob Karnel schwamm auf der linken Seite, bis er sich erschöpft fühlte. Dann pumpte er die Lungen voll Luft und ließ sich, auf dem Rücken liegend, von den Wellen schaukeln. Dabei bewegte er die Hände wie fächelnde Schwimmflossen.
Er war allein. Bis hierher wagte sich selten ein Schwimmer, er fühlte sich frei und gelöst. Es war eine gute Idee, dachte er, ich bringe dem alten Engalke eine Kiste Zigarren mit.
Eine Möwe kreiste in niedriger Höhe über ihm.
Karnel schloss die Augen vor dem grellen Himmel. Er dachte: Ich weiß, was auf mich zukommen wird, ich kenne ja meine Kaderentwicklung. Der Professor, unser bisheriger Lehrstuhlleiter, hat uns verlassen und ist an die Universität der Hauptstadt gegangen, sein Posten ist vakant; Karnel, wir haben an dich gedacht, das entspricht deiner Perspektive bei uns, deinem Können und dem Vertrauen, das du genießt. Übernimm den Lehrstuhl, es ist nur logisch, klar? Und ehrenvoll dazu. So wird es kommen, ich kenne es genau. Und sie haben recht, es ist nur logisch. Aber sie wissen noch nicht, dass ich doch nicht in diesem Jahr promovieren werde, dass ich vielleicht noch zwei Jahre brauche, wenn alles glattgeht. Tut mir leid, aber ich muss euch vor vollendete Tatsachen stellen. Hast du dir das gut überlegt, Karnel? Ich halte nichts von Weißbrot, man muss beim Essen die Zähne bewegen können. Und Weißbrot würde ich kauen, wenn ich mich der Beschreibung der Arten alten Stils begnügen würde. Ich muss mich mit freuen oder ich muss mit leiden können, dazwischen gibt es für mich kaum ein Zwischenstadium. Ich ärgere mich, wenn ein Student bei mir eine Vier erreicht. Ich freue mich über die Zwei und über die Eins, ich verachte die Drei, dieses Mittelding. Fisch oder Fleisch. Vielleicht geht mir dabei viel verloren, vielleicht gibt es viel, was zwischen den Extremen liegt. Es leben viele Menschen, denen das Spiel der Dinge mehr bedeutet als sein Effekt, und sie sind sehr glücklich dabei. Ich denke immer nur an Ergebnisse. Vielleicht bin ich zu bequem, um den Kampf selber als ein Erlebnis zu betrachten? Ich bin vierzig Jahre alt, ich habe mich ausgelotet, ich glaube, meine Tiefen und Klippen zu kennen. Ich weiß auch, was sein wird, nehme ich den Lehrstuhl an: Ich muss die Dissertation noch weiter hinausschieben, vielleicht um drei oder vier Jahre, ich komme mit meinen Forschungen schon nicht schnell genug voran, weil mir philosophisch-kybernetische Kenntnisse fehlen, ich muss mich entscheiden. Jede Entscheidung aber fällt mir schwer, das weiß ich, das war immer so.
Nach der Gefangenschaft hatte Robert Karnel wieder in der Schmiede seines Dorfes gearbeitet. Er konnte mit großer Mühe und den Beziehungen seines Meisters die Lehre beenden. Das Stehen fiel ihm schwer; er schwankte, wenn er zum Schlag ausholte. Der Meister gab ihm schon die kleineren Arbeiten, und die Prüfungskommission hatte Mitleid mit dem jungen Krüppel und drückte ein Auge zu. Karnel merkte das, er bestand die Prüfung und kündigte den Tag darauf. Was sollte er tun? Wer konnte ihm einen Rat geben? Wer seine Entscheidung herausfordern?
Sein Vater befand sich in einem englischen Kriegsgefangenenlager an der Adria. Mutter tat viel für ihn, sie war ganz Fürsorge, ganz Mitleid: Nimm dich in acht, mein Junge, dass dir das auch passieren musste, was für ein Unglück, überanstrenge dich nur nicht! Einen Rat konnte sie ihm nicht geben.
Er sah sich als Gelegenheitsarbeiter um, half mal in der Bäckerei, kutschierte die Pferde eines Mittelbauern, tauschte auch Feuersteine gegen grüne Heringe auf dem schwarzen Markt, fischte die Kadaver der in den letzten Kriegsgefechten erschossenen Kühe aus dem Wasser des abgesoffenen Tagebaues und verkaufte schließlich ein knappes Jahr lang in einer Buchhandlung raues, faseriges Papier, einen Rest Feldpostkarten und wässerige Tinte. Als das erste Bücherpaket eintraf - einhundert Exemplare des gleichen Titels -, las Robert Karnel das Buch zuerst, bevor er es in die Auslage legte. Ein Buch war das, herausgegeben vom Verlag der Sowjetischen Militärverwaltung für Deutschland: minderwertiges Papier, flüchtiger Druck, schmutzig-grauer Pappeinband.
Der alte Besitzer des Ladens schien keinen Wert darauf zu legen, das Buch zu lesen; in seinem Wohnzimmer hing ein lebensgroßes Bild des Kanzlers Bismarck, der Alte war ein Monarchist geblieben.
Karnel las nicht in einem Zuge, mal las er einen Dialog, eine Feststellung, eine Szene. Das Milieu war ihm fremd.
Aber dann las er es von der ersten bis zur letzten Seite. Pawels Weg fesselte ihn, aber viel stärker packte ihn der Weg der Mutter, rührte ihn ihre tapfere Entscheidung. Fragen tauchten auf: Wozu ist so ein Mensch auf der Welt? Wo ist die Wahrheit zu suchen? Wo ist die Vernunft? Was soll so ein kleiner Mensch auf der Welt tun? Mit Fragen aber beginnt die Lust nach dem Wissen.
Im Dorf warb sein alter Lehrer Kirsch, ein ehemaliger Sozialdemokrat, der als Schulrat eingesetzt worden war, junge Leute für eine Kurzausbildung als Neulehrer. Einige meldeten sich, auch Maria, Karnels frühere Freundin, war darunter.
Zu Robert Karnel kam keiner. Wartete er denn auf sie? Auf ihn kamen sie gar nicht. Bürgermeister Landwehr sagte zu ihm: „Ja, Robert, wenn das mit deinem Bein nicht passiert wäre, was hättest du jetzt alles tun können, aber lass man, wir finden für dich schon was Passendes ...“
Robert ballte die Fäuste in den Hosentaschen. Da haben wir’s, dachte er, der Krüppel wird nicht gebraucht, ein humpelnder Lehrer, das darf nicht sein, die Kinder sollen endlich in Freude aufwachsen und Schönes sehen, ich aber erinnere sie nur an den Krieg.
Den Tag über saß er wütend grübelnd in seiner Kammer. Die Nacht schlief er nicht, lag mit offenen Augen und heißem Körper. Am Fußende des Bettes stand, dunkler Schattenriss in gelbem Mondlicht, das verfluchte hölzerne Gerät, die Prothese.
Er rang sich zu einer Entscheidung durch, er wollte es wagen. Den nächsten Tag ging er klopfenden Herzens in das Jugendheim, in dem das Werbebüro des Schulrats Kirsch war, und meldete sich an.
„Warum sind wir nicht früher auf dich gekommen?“, wunderte sich Kirsch und trug ihn ein.
Triumphierend ging Robert Karnel ins Gemeindebüro und teilte alles Landwehr mit. Er verließ das Amt mit Engels’ Schrift über Feuerbach, politischen Broschüren über Dialektik und einem Haufen unerledigten Schriftkram in der Mappe. Landwehr hatte ihn bis zum Beginn des Lehrgangs im Gemeindebüro angestellt und nahm ihn zu den Seminaren der Arbeiterpartei mit. Was soll der Mensch auf der Welt tun?
Als Vater im Jahre 1949 aus der Gefangenschaft zurückkehrte, war sein Sohn ein Student und Kandidat der Arbeiterpartei. Das war sehr einfach gewesen. Eigentlich hatte Robert schon eintreten wollen, den Entschluss aber hinausgezögert, er wollte nicht leichtfertig sein.
Eines Tages wurde er mit fünf anderen Studenten nach dem Unterricht zum Direktor gerufen. Der kahlköpfige, siebzigjährige Regierungsrat Doktor Vellow stand schnell auf, trippelte auf sie zu, legte jedem nacheinander die Hand auf die Schulter, schweigsam und betont feierlich. Dann hielt er eine kurze Ansprache. „Seid patente Jungs, mir schon lange aufgefallen, wirklich, solche wie euch brauchen wir, ich achte auf so was. Hier sind Fragebogen, wichtige Sache: Partei! Also ausfüllen, Bürgen besorgen, bald abgeben, ist das klar?“
Mit zeremonieller Verschämtheit drückte er jedem das Papier in die Hand. Karnel musste lachen, Vellow fuhr auf ihn zu: „Noch eine Frage?“
„Wir sind vielleicht“, sagte Karnel, „ich wollte sagen, ich meine, wenn ich von mir sprechen darf, ich bin noch nicht soweit, Herr Regierungsrat, das ist eine wichtige Entscheidung ...“
„Sehr richtig“, sagte Vellow, „seid darum froh, dass ich euch berate. Ich weiß, wie ihr diskutiert habt, ganz in unserem Sinne. Ich bin dreimal so alt wie ihr, habe fünf Jahre im Lager gesessen, nun verlassen Sie sich darauf, wen ein alter Genosse auswählt und wen nicht. Das kapiert ihr doch, wie? Noch eine Frage?“
Nein, keine Frage mehr. Sie rissen ihre Witze über den Alten und füllten doch die Fragebogen aus. Karnel hatte sich den Eintritt in die Partei anders vorgestellt, so schien es ihm unwürdig zu sein. Für ihn bürgten Landwehr, der Tränen über den Regierungsrat vergoss, und Schulrat Kirsch.
Drei Wochen später, in den ersten Tagen des fünften Jahrzehnts, übergab ein Genosse von der Kreisleitung die Kandidatenkarten, der alte Vellow schnäuzte sich gerührt und klopfte seinen jungen Genossen die dünnen Schultern.
Nachmittags zog Karnel mit dem Chor durch die Straßen der Stadt. Sie sangen Um uns selber müssen wir uns selber kümmern und Heraus gegen uns, wer sich traut und Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind, und sie geizte nie.
Am Abend musste Robert Karnel seinen wundgescheuerten Beinstumpf mit Mull bepflastern und die Scharnierschrauben an der Prothese nachziehen. Zu dieser Zeit hatte er schon eine mit lederner Oberschenkelhülse.
Lang ist das her, dachte Karnel, wie Bilder aus dem vorigen Leben. Der Himmel hatte sich grau überzogen. Die Wellen waren stärker geworden, sie führten auf ihren Rücken den Schwimmer auf die Kämme hinauf, und Karnel sah, den Blick zum Land gerichtet, den Strand nur noch als einen schmalen, ockergelben Strich, betupft mit nadelkopfgroßen Strandkörben. Er war weit hinausgetrieben worden.
Er schwamm zurück. Von der Höhe des Wellenhügels stieß er sich kraftvoll vorwärts, schwamm unter Wasser, tauchte wieder auf dem nächsten Wellenhügel auf und bemühte sich, diesen Turnus einzuhalten.
Blauschwarz färbte sich der Himmel. Der Wind hatte sich aufgemacht, Karnel dachte grimmig daran, dass er jetzt zwei gesunde Beine haben müsste. Er spürte, dass er viel Kraft brauchen würde, um den Strand zu erreichen. Die Wellen warfen ihn immer wieder zurück; er meinte, dem hellen Strich nicht näher gekommen zu sein.
Als er nicht auf einem Wellenkamm, sondern im Tal auftauchte, um Luft zu schöpfen, fiel mit Wucht eine Welle über ihn her, er verschluckte sich, tauchte wieder in einem Tal auf, erlebte einen neuen Anlauf, wieder keine Luft, der Rhythmus war unterbrochen, und die Angst überfiel ihn, die nackte, erbarmungslose Angst.
Er drehte sich auf den Rücken, ließ sich auf- und abwärtstragen und begann laut zu schreien. Robert Karnel rief nicht, es waren auch keine Wörter, die sein Mund formte, es waren unartikulierte Laute, er brüllte wie Menschen und Tiere in Todesangst brüllen können. Er brauchte viel Luft zum Brüllen und dachte nicht darüber nach, dass kein Mensch bei dieser Entfernung vom Ufer, bei dem Pfeifen des Windes, bei dem Rollen der Dünung sein Brüllen hören könnte, er brüllte sich die Angst aus dem Halse, und seine Lungen füllten sich wieder mit Luft, sein Brustkorb kam ihm nicht mehr eingeschnürt vor, er schien sich zu weiten und mit Leben zu füllen.
Robert Karnel wusste auch hinterher nicht zu sagen, wie lange er gebrüllt hatte, der Maßstab für Zeit und Raum war ihm verloren gegangen. Solange er den Landstreifen noch erkennen konnte, war in ihm Hoffnung, und er ließ sich nicht länger treiben, sondern warf sich wieder herum, schwamm in der Schräglage, seines Beinstumpfes wegen, schnitt die Wellen, durchtauchte sie, versuchte, kein Wasser mehr zu schlucken.
Der Himmel wurde schwarz. Plötzlich war es, als verlangsamten sich die Wellen, als halte der Wind vor dem Ausbruch des Gewitters den Atem an, Karnel nutzte die Zeitspanne und kraulte in schnellem Tempo. Er sah die bunten Tupfen auf dem blassgelb größer werden, für ihn wurden sie leuchtender. Die ersten schweren Tropfen fielen.
Weit vom ersten Buhnenkopf entfernt, spürte er Boden, er war auf eine Sandbank geraten und konnte sich ausruhen. Die Kälte kroch in seinen Körper, er war zu lange im Wasser gewesen. Hoch in der Luft schrien die Möwen, nutzten die Gelegenheit und stießen pfeilschnell in die Schwärme der Jungfische, die sich im flachen Wasser aufhielten.
Hier war das Wasser ruhig, der Regen fiel in harten, dünnen Strichen. Karnel schwamm ruhig und lächelte still, er dachte an sein Brüllen ...
Er blieb bäuchlings im Wasser, als er Sand unter sich spürte, schob sich mit den Händen vorwärts, lief auf ihnen im Wasser und ließ das Bein schleifen. Am Strandkorb lehnte seine Prothese.
4.
Es gab nur einen Tag an der See für Robert Karnel. Einen gemütlichen Abend in der Jugendherberge mit Jungen und Mädchen aus sechs Ländern, deren Freundschaft sehr ausgeprägt war, denn die Paare hatten sich schon gefunden, man saß, sang und trank, die Mädchen im Arm der Jungen, die Sonne des Tages und das Salz des Wassers auf der Haut. Eine tiefe, traumlose Nacht in dem engen Einmann-Zelt, das Karnel im Garten der Herberge aufgeschlagen hatte, eine Nacht, in der Karnel sogar das heftige Gewitter verschlief, den grollenden Donner, den sich zusammenkauernden und wieder aufbrechenden Himmel über dem Fischland, das alles verschlief er, um am Morgen von zwei kleinen Ungarinnen geweckt zu werden, die ihre hübschen Köpfe in den Zeltschlitz steckten und über den unrasierten Mann kicherten, der in den Tag hineinschlief.
Karnel lachte laut auf, als er sich bei dem Gedanken ertappte, die beiden Mädchen nach Posalaky zu fragen, nach Professor Doktor Posalaky, Kleinlebewesenforscher, Turbellarienfachmann, Strudelwürmerexperte, was, den kennt ihr nicht? Ungarn ist kein Dorf, mein Lieber, Doktoren und Professoren gibt es viele. Aber Turbellarienspezialisten habt ihr nur den einen von Rang und Namen, und der ist mein Freund, Budapest, Somloi, das ist auf dem Donauhügel ...
Als er beim Rasieren war, der Bart war drei Tage alt und wich erst beim zweiten Versuch, überlegte er: Eigentlich war es Posalaky, dem ich es verdanke, wenn ich noch nicht den Doktor in der Tasche habe, er war ein Anstoß. Als wir uns getroffen hatten, kam ich mir vor, als hätte ich die Aufgabe, einen riesigen Getreideberg umzuschaufeln, nur mit dem Ziel, herauszubekommen, dass das, was ich schaufele, auch Weizen ist.
Sie haben eigentlich nicht die Aufgabe zu schaufeln, machte mir Posalaky klar, sondern die Spreu vom Weizen zu trennen, Sie werden noch mehr Arten der Turbellarien entdecken und beschreiben, das reicht für hundert Staatsexamensarbeiten, für Dutzende Dissertationsschriften, aber Sie könnten mehr erreichen, erforschen Sie die Struktur der Turbellarien ...
Ich bereue nicht, mich darauf eingelassen zu haben, dachte Karnel, uns Biologen treibt es oft, hingerissen von der Vielfalt biologischer Erscheinungen, ins Detail. Das kann oft unseren Blick für den Zusammenhang trüben, und jeder Biologe kann jeden Biologen mit Details schlagen, aber die Mathematiker diskutieren über Gesetze, das ist der Unterschied, und dahin müssen wir kommen.
Ich bereue nicht, aber ich kann in dieser Phase nur weiterkommen, wenn ich mich mit einem Philosophen verbünde; ich setze auf Janne Turk, sie war vor Jahren Beststudentin in meinem Seminar und soll zum neuen Studienjahr an das Institut kommen und eine Lehrtätigkeit aufnehmen. Ich werde ihr noch eine Karte schreiben, dachte er.
Nicht einmal ein voller Tag blieb Robert Karnel. Mittags kam der Briefträger und übergab ihm ein Telegramm. Hier oben, in dem kleinen Inseldorf, war ein Telegramm ein Papier wie jeder Brief, und so wurde ein Telegramm nicht etwa schneller befördert, sondern mit den üblichen Kartengrüßen ausgetragen.
Das Telegramm kam vom Direktor: „donnerstag siebzehn uhr tagung des wissenschaftlichen rates stop erwarte dich unbedingt stop immer lebe die sonne stop dein mayerin“
Donnerstag war heute, siebzehn Uhr würde es in vier Stunden sein, und so riss Karnel sein Zelt ab, verabschiedete sich von den beiden Ungarinnen und bat sie, Posalaky einen Gruß zu bestellen, falls sie ihn treffen sollten, so ein charmanter Ungar mit Bart, aber die Mädchen verstanden sein Kauderwelsch nicht, und außerdem sind alle Ungarn charmant, und so fuhr er los, parkte den Wagen noch einmal hinter dem Deich und blickte sehnsüchtig auf den Badebetrieb, schaufelte einen Sack voll weißen Sand ein und jagte den Wagen nach Süden über die schmale Brücke, die die Insel mit dem Festland verbindet. Zuerst gefiel es dem kleinen Trabanten, aber dann hörte Karnel, wie er zu jammern begann, wie er wimmerte: Mach es nicht so toll, du quälst mich, aber Karnel blieb unerbittlich. Du musst, dachte er, du hast schon fünfzigtausend Kilometer geschluckt, nun gewöhne dich auch an die nächsten zehntausend, heute bist du nach zwei reichlichen Stunden schon erlöst.
Er kam eine Stunde vor der Sitzung in der Elbestadt an und fuhr nicht erst nach Hause in sein einsames möbliertes Zimmer bei Mutter Bergmann, sondern in den südlichen Außenbezirk, er wollte vorher noch mit Mayerin sprechen.
Karnel kannte Mayerin seit vielen Jahren, seit neunzehnhundertdreiundfünfzig. Als Karnel am Institut studierte, wurde Mayerin als Studentendirektor und Dozent im Lehrstuhl Marxismus eingesetzt. Karnel fasste wie die meisten Studenten schnell Vertrauen zu ihm. Man konnte mit allen Sorgen zu Mayerin gehen, er verstand private Nöte, weltanschauliche Bedenken wie den scheinbar geringsten Konflikt und war immer zu helfen bereit.
Der schlanke, salopp gekleidete Mayerin war ein glänzender Redner, er konnte gut überzeugen. Man holte ihn vom Kreis und vom Bezirk zu Kundgebungen, Jugendweihefeiern und zu den Begräbnissen der alten Funktionäre. Alle zwei Jahre wurde er wieder in die Kreisleitung gewählt.
Mayerin begriff leicht die Gedanken und Gefühle anderer Menschen, er konnte Optimismus erzeugen, Zweifel zerstreuen. Er möchte auch durch ein belangloses Gespräch die Menschen einen Deut bessern. Natürlich zog er auch aus solchen Gesprächen Gewinn für sich selber, natürlich argumentierte er auch manchmal mit den Gedanken, die er vorher von seinen Mitarbeitern gehört hatte, warum auch nicht, der Mensch lebt nicht von sich allein.
Robert Karnel bewunderte an Mayerin, wie schnell und sicher und mit welcher Spürnase er den rechten Augenblick zu wählen verstand.
Aber es gab Unterschiede zwischen ihnen. Mayerin war älter als Karnel, aber im Umgang mit den Studenten wirkte er wie ein schnell gealterter Junge, man nannte ihn „Mahdi“, denn er redete wie ein Prophet, besonders wenn er über seine Entwicklung sprach, er, der Sohn eines Hilfsarbeiters einer Kruppschen Gießerei.
Nachdem Bob Karnel sein Studium mit ausgezeichneten Ergebnissen beendet hatte, gab ihm der Mahdi eine Assistentenstelle. Alles schien für Karnel glattzugehen, alles schien ihm zu glücken, die Studenten liebten ihn und kamen gern in seine Vorlesungen. Aber auch sein Freund Mayerin wusste nicht, wie schwer es sich Karnel machte, wie ernst er alles nahm, wie er sich in die Wissenschaft einfraß, die Nächte, die Ferien, die Sonntage opfernd. Karnel redete nicht über sich selbst. Bei jeder neuen Problemstellung stand er wie vor einem verwunschenen Märchenschloss, suchte die Schlüssel und stellte fest, wenn er sie gefunden hatte, dass er sich wieder vor neuen Türen mit schwereren Schlössern befand. Er sprach mit keinem Menschen darüber und kam sich wie ein Spätentwickler vor. Die Wissenschaft, so hatte es der alte Doktor Vellow einmal gesagt, die Wissenschaft sei wie ein Diamant, der von Diamanten geschliffen sein will. Davon fühlte sich Karnel noch weit entfernt, er wusste: Ohne eigenes, originelles, infrage stellendes Denken kommt man der Wissenschaft nicht bei, sondern bleibt armselig wie eine Kirchenmaus ...
Helmut Mayerin lag in einem Liegestuhl auf der Terrasse des kleinen Hauses und arbeitete ein Konzept durch. Als er Karnel erblickte, sprang er erfreut auf. „Ich hatte mir schon keine Hoffnung mehr gemacht, Bob, aber ich brauche dich heute schon, du musst entschuldigen ...“ Karnel seufzte. „Endlich hatte ich mal zwei nette Mädchen kennengelernt ...“
„Dazu bist du noch zu jung“, Mayerin schmunzelte. „Wir haben die Weisung des Ministeriums erhalten, das Institut zur Hochschule zu entwickeln.“
„Das war vorauszusehen.“
Mayerin setzte eine schwere Cubazigarre in Brand und zog kräftig daran. Am Himmel schwammen dickbäuchige, weiße Wolken in dunklem Blau. „Die zweite Neuigkeit: Wir werden dich als Lehrstuhlleiter einsetzen. Ich brauche deine Zustimmung vor der Sitzung des wissenschaftlichen Rates.“
Karnel hatte damit gerechnet. Aber geschickt, wie das Mayerin mit der Entwicklung zur Hochschule verband, fand er, sofort bekommt das Angebot ein viel stärkeres Gewicht. Wir werden Hochschule, darum soll ich Lehrstuhlleiter werden? Nein, mein Lieber, da gibt es überhaupt keinen kausalen Zusammenhang. Er sagte: „Vielleicht bin ich ein passabler Dozent. Ob ich ein Leiter sein kann, möchte ich bezweifeln. Ich habe viel vor in diesem Jahre ...“
„Aber du forderst, dass es bei uns vorangehe. Du wirst dich doch nicht ausschließen, wir haben immer mit dir rechnen können.“
Karnel spottete: „Diese Welt ist eine Brücke. Gehe hinüber, aber baue nicht deine Wohnung dort ...“
„Komm mir nicht mit solchen chinesischen Sprichwörtern, Bob. Wir waren uns einig, dass wir nicht eine Verlängerung der Oberschule sein können. Du behauptest oft genug, die Biologie sei in der Schule nur ein beschreibendes Lehrfach, eine Art Blümchenkunde. Und du willst, dass die Philosophie in die Fachausbildung einbezogen wird.“
„Natürlich. Wir bilden heute Lehrer aus, die im Jahre zweitausend noch unterrichten werden. Und was werden sie unterrichten? Blümchenkunde? Wir wollen ja nicht in die Steinzeit zurück. Ökonomischer, also menschlicher Fortschritt hängt heute vom schnellen und richtigen Gebrauch wissenschaftlicher Errungenschaften ab.“
Mayerin nickte. „Es sind Änderungen notwendig, auch bei uns. Aber das ist auch eine Frage der Kader, auch der Zeit und der Entwicklung. Wenn es um hohes Niveau geht, kann man erst recht nichts übers Knie brechen. Aber für die Leitung solcher Prozesse brauchen wir die besten Dozenten, Bob.“
„Es gibt fähigere Lehrstuhlleiter ...“
„Zum Beispiel wen?“
Robert Karnel hatte sich auf diese Frage vorbereitet und sagte: „Doktor Itter, er hat in diesem Jahr promoviert.“
„Du bist mittendrin, im letzten Drittel.“
„Nein, ich bin noch nicht so weit.“
„Das ist mir neu.“
„Ich fange noch einmal von vorn an.“
„Darüber reden wir noch.“ Das passt mir gar nicht, dachte Mayerin, was hat er sich da wieder in den Kopf gesetzt. Karnel sagte; „Doktor Itter ist jung und ehrgeizig, ein guter Genosse, der sich nichts vormachen lässt.“
„Nicht dein Format.“
„Das ist sehr relativ. Er ist fast zehn Jahre jünger als ich, ein entwicklungsfähiger Kader, wie man so schön sagt. Itter ist wohl auch ein Mann, der sich vor Berichten, Sitzungen, Analysen nicht fürchten wird wie ich, Itter wird auf dem Instrument der Leitung spielen können, aber ich schaffe das nicht.“
„Du suchst krampfhaft nach Gründen, das passt nicht zu dir, Bob. Wir sind lange genug befreundet, ich sage dir, wenn es auch wie eine Binsenwahrheit klingt, man muss mal verzichten können, man muss etwas anderes tun können aus Einsicht in die Notwendigkeit. Ich habe mich immer auf dich verlassen können, du bist mein bestes Pferd im Stall.“ Er stand auf und lief erregt um Karnels Liegestuhl herum und blickte dabei auf die Uhr. „Wir müssen zur Sitzung. Überlege es dir gründlich und richtig, ich brauche eine definitive Entscheidung. Mir war es auch nicht leichtgefallen, hier am Institut Direktor zu werden, ich musste auch manches zurückstecken ...“
Ja, das stimmt, dachte Karnel, deine ganze Ausbildung zum Beispiel, ein Diplom aus den fünfziger Jahren reicht keine Ewigkeit, aber du hast dich anscheinend damit abgefunden. Er sagte: „Du hast mich nicht überzeugt.“ Er stand auf und reckte sich.
„Du mich auch nicht. Ich erwarte deine Zusage.“
Die bekommst du nicht, dachte Karnel, denn das ist eine Alternative für mich: entweder forschen oder leiten. Beides könnte ich nicht miteinander in Einklang bringen. Mayerin begreift das nicht, er will mich nicht verstehen. Als der Mahdi mit Schwung und Stolz vor sechs Jahren die neue Aufgabe als Direktor übernommen hatte, ließ er sich nicht auf Karnels Orakel ein. „Denke an dich auch dabei“, hatte Karnel gesagt, „du hast das Diplom. Wie lange reicht das? Promoviere doch erst, beende die wissenschaftliche Ausbildung, wenn man die jemals beenden kann. Du sollst ein naturwissenschaftliches Institut leiten! Aber leiten und die Ausbildung fortsetzen? Dich wird die organisatorische Technologie der Verwaltung und Leitung auffressen ...“ Er hatte recht behalten. Mayerin hatte sich voll eingespannt, er gab alles, Zeit für die eigene Ausbildung, geschweige denn für die Fortsetzung der Forschungsarbeit hatte er nicht mehr.
Die Freunde gingen zu Fuß zum Institut den alten Wehrgang entlang, von dem man den Strom sah und die stationäre Achterbahn auf dem Parkgelände der Strominsel. „In unserer Zeit“, sagte Mayerin, „muss man Aufgaben übernehmen im Interesse der Allgemeinheit und eigene Wünsche zurückstellen ...“
Halte mir keine Morallektion, dachte Karnel, es tat ihm leid, dass ihn der Freund nicht verstehen wollte.
5.
Karnels erste Etappe der Lehrerausbildung war kurz, notwendig kurz, und daher auch oberflächlich gewesen. Ein bisschen Kornilow-Psychologie, Urgeschichte und Naturwissenschaften in Taschenformat. Ein Häppchen Methodik der Unterstufe. Eine Menge Geschichte der Pädagogik. Robert Karnel hörte von den alten Knabenführern, von der „Didactica magna“, von den Rationalisten („Ich bezweifle alles, nur nicht meinen Zweifel“) und von dem Arbeitsschulbegriff Kerschensteiners. Er dachte über die pädagogischen Forderungen nach, die zu verschiedenen Zeiten aufgestellt worden waren, über „Töte den Affen und den Tiger“ und „Am Menschen ist das Wichtigste das Handeln“; ihm gefiel Herbarths „Durch Denken zur Wahrheit“ und das „Sapere aude“ der Alten, er las Tews und Wander und Salzmann und begeisterte sich an Makarenkos Erfolgen in der Gorkikolonie. Er schien ein Schwamm zu sein, der sich mit Wissen vollsog, er war dankbar, weil er eine Welt entdecken durfte.
An der Wandzeitung veröffentliche Bob Karnel Gedichte, Verse, zu denen es ihn gedrängt hatte, in Nachtstunden geschrieben: „So ungesättigt von der eignen Kraft, ging ich hin zu der Partei / Wie ein Junge fragte ich die Mutter, ob es möglich sei / dass man es noch schneller schafft. In die Hände legte sie das Buch / Mit den Fragen des Marxismus / Aus den Wörtern, den Gedanken formte sich die neue Tat / Mit dem Kumpel, den ich ehre / Worte, die die Faust gelenkt / Schranken, vor der Faust verloren / Hab’ ich der Partei geschenkt / Neues, das in mir geboren ...“ Darob lobten ihn die Dozenten über den grünen Klee und ließen seine Gedichte vor Partei- und Vollversammlungen der Anstalt rezitieren. Die Abiturienten aber meinten: Karnel hat wieder ein neues Transplakat verfasst, früh häkelt sich, was ein Krümmchen werden will, die neue Ordnung siegt, amen.
Die Grundsätze der materialistischen Dialektik hatte er in Landwehrs Seminaren gelernt, hier musste er sie der Reihe nach wörtlich lernen und wiedergeben. Er hämmerte sich alles wie einen neuen Glauben ein. Er lernte mechanisch.
Den Lehrgang absolvierte er mit dem besten Zeugnis. Sein Vater schlachtete ihm zu Ehren ein Schweinchen, spendierte Bergarbeiterschnaps, sein Deputat, Mutter Lina hatte feuchte Augen und trug täglich eine gestärkte Schürze.
Neulehrer Robert Karnel. Das machte Bob stolz. Vater redete Trinksprüche: „Mein Sohn ist durch eine Wüste gegangen und hat eine Oase gefunden.“ Er legte dem Jungen die grafitgrauen, rissigen Hände auf die Schultern und blickte ihn stolz an, Vater arbeitete wieder in der Braunkohle, er las Abenteuerbücher, die in Afrika spielten, und wählte seine Vergleiche aus diesem Milieu. Aber Otto Landwehr, inzwischen selber auf einer Schule, widersprach: „Alles beginnt erst, Bob steht mit dem Holzbein auf der Schwelle und muss mit dem gesunden Bein über den Drudenfuß hinweg.“ Er hatte recht, das begriff Bob später.
Neulehrer Bob Karnel in Kiselstedt gewann den Kampf mit einer renitenten siebenten Klasse, seinem ersten Schuljahr. Er pochte ungeduldig gegen seine Prothese, wenn die hungrigen Schüler schwer von Begriff waren, und dann musste er als Wanderlehrer in verschiedenen Schulen Biologie unterrichten. Ein Fach, von dem er nichts verstand. Er hatte nur einen geringen Vorsprung und war seiner Klasse um drei oder vier Lektionen voraus. Er lehrte lernend. Wenn er in der Klasse die grünen Geißelträger behandelte, hatte er erst die pflanzlichen Einzeller und die einfachsten Vielzeller gelesen und war noch nicht bis zu den Schwämmen vorgestoßen.
Zu dieser Zeit bekam er eine Prothese mit Neuerungen: kein Schultergürtel mehr, der auf die Lungenspitze drückte. Es war eine Saugprothese mit Ventil, man steckte den Stumpf hinein und drückte das seitlich angebrachte Ventil, der Stumpf wurde angesaugt.
Erste Lehrerprüfung mit Erfolg. Aber Bob war nicht zufrieden: Je mehr er wusste, desto stärker wurde ihm klar, was er noch nicht wusste. Er hatte Furcht, zu viel zu versäumen. Die Zeit lief ihm weg.
Als ein Hallenser Professor die Patenschaft über den Biologiezirkel in der Weiterbildung der Lehrer übernahm, paukte Bob auch nachts, er wollte aufholen; ein unruhiges, glückliches Gefühl war in ihm, obwohl er immer auf neue Probleme stieß.
In der Schule war Bob früher eingetrichtert worden: Die Erbanlagen sind unveränderlich und schicksalhaft gegeben, die Nachkommen haben das, was ihre Vorfahren besaßen. Die Rassen - es wurden ja auch Schädelindexmessungen durchgeführt - sind entscheidend für die erblich gegebene gesellschaftliche Stellung des Menschen, es gibt höhere Rassen (nordisch-germanische) und niedere (Juden, Slawen), und das - so sagte es die Genetik dieser Zeit - ändert sich nie.
Karnel hatte als Siebzehnjähriger seine Haut für eine schlechte Sache zu Markte getragen; er war dabei, sich zu ändern, aber während seiner Ausbildung gab es noch keine Lehrbücher der deutschen Biologie, die nachwiesen, dass der Mensch sich ändern kann. Nach der bisher gelehrten Genetik ging das nicht.