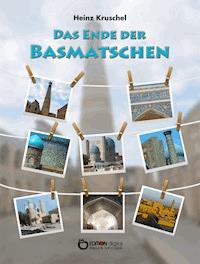6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1966, sieben Jahre nach der kubanischen Revolution, reist Heinz Kruschel mit einem Fotografen nach Kuba. Nach einer stürmischen Seereise mit dem DDR-Schiff „Fichte“ gehen sie am 25. November in Havanna an Land. Kruschel besucht Bildungs- und Kultureinrichtungen, trifft sich mit Künstlern, Technikern und Politikern, lässt sich von einfachen Menschen die Lebensgeschichten erzählen, besucht das Hemingway-Museum. Die daraus entstandene Reportage von 1967 gibt ein interessantes – und wegen der vielen Einzelschicksale – auch spannend zu lesendes Bild der Anfangsjahre der kubanischen Revolution. INHALT: Das erste Mal, dann aber gründlich … Der „Lange Wapper“ Märchenland bei Nacht Spiel und Kunst in Middelheim Karnevalseröffnung In Leixoes Besuch bei einem Seemann Helft unserm Mann! Ankunft in La Habana Erste Impressionen Hasta la vista! „Prometemos, wir geloben …“ Maria und Jesus und ihre Kinder Bei der kubanischen Fischfangflotte Der Fahrstuhlführer und der amerikanische Zerstörer Gloria Parrado und ihr Versprechen Wir kannten ihn alle gut ... Der „Poeta laureatus“ der Revolution „Zweige vom selben Baume …“ Im Schatten der Columbus-Kathedrale Teatro Mella Nebenbei bemerkt Haydée Santamaria Abschied vom Sommer Temperatursturz dreißig Grad
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Heinz Kruschel
Winterreise in den Sommer
ISBN 978-3-95655-110-9 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1967 im Deutschen Militärverlag, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Das erste Mal, dann aber gründlich …
Drei Tage Warnemünde.
Der kalte Oktoberwind rüttelt an zwei vergessenen Strandkörben. Winterlich vermummte Urlauber laufen auf dem glattgefegten Strand entlang und stemmen sich gegen die nasskalten Böen. Wir aber wollen nach Kuba, schauen sehnsüchtig den Schiffen nach und träumen von Palmen und Sonne und - warten.
Du hast geschimpft, wenn mal ein Zug vierzig Minuten Verspätung hatte? Der Dampfer sollte schon vor drei Tagen auslaufen.
Aber er kommt. Am dritten Tage ist er da, liegt an der Verladerampe zwei und schluckt Stückgut.
Achtern stimmen Männer in blauen Mänteln ihre blitzenden Instrumente. Einige Matrosenlehrlinge tauschen die Mützen so lange, bis sie passen. Kommandos. Die Jungen stellen sich auf. Reden werden gehalten. Die Fahne wird gehisst. Ein Marsch und noch einer: Die „Fichte" wird zum Jugendobjekt erklärt.
Inzwischen schleppe ich mit Karl-Heinz Stana, dem Fotoreporter, die dreizehn Gepäckstücke die Gangway hinauf. Wir warten eine Weile darauf, dass der „Kühling“ (d. h. Kühlingenieur) die Kajüte räumt,, in der wir ein paar Wochen wohnen sollen.
Wir warten gern. Der Kühling plaudert gut und weiß das auch und beantwortet unsere Fragen, Fragen von Landratten.
„Dieser Kahn macht es sehr sanft", sagt er, „vielleicht schaukelt’s in der Biskaya ein bisschen, keine Bange.“
Sein Wort in Gottes Ohr, denke ich. Auf kleinen Schiffen bin ich zwar an der Ortseeküste entlanggefahren und mal durch den Greifswalder Bodden, aber sonst? Na, die ,Fichte ‘ ist ein großes Schiff. Im Merkblatt für Passagiere steht es: 163 Meter lang, 19,6 Meter breit, eine Bruttovermessung von 11 942 BRT, die Ladekapazität beträgt. 6210 Tonnen. Hier werden 180 Matrosenlehrlinge und 50 Offiziersschüler der Seefahrtsschule Wustrow ausgebildet.“
An Bord sind dreihundert Menschen. Darunter zehn Passagiere, die nach Kuba wollen. Frau M. und Dr. H. von der Akademie der Wissenschaften, zwei zu ihren Männern reisende Frauen aus Sachsen, ein kubanischer Student, ein kubanisches Ehepaar mit Töchterchen, Karl-Heinz und ich.
Das Töchterchen heißt Simona, ist drei Jahre alt, braunhäutig, dunkeläugig und schwarzlockig und kommt uns im Gang entgegengetrippelt. Stana macht die Kamera schussfertig, er murmelt was von „Titel, gutes Vorzeichen, kleine Kubanerin auf großem Schiff.“ Ich erinnere mich an meinen Schallplattenkursus („Wir lernen Spanisch sprechen“) und reihe mühselig Wörter zu einem Satz, da blickt mich die Kleine verwundert an und sagt: „Ich mussde doch mol nausguggen.“ Das reinste Sächsisch. Eine Kubanerin?
Stana fotografiert, die Kleine ist niedlich. Mein erster Versuch, die erste spanische Frage zu stellen, ist gescheitert. Die Kleine ist die Tochter des Ökonomen Miguel Castillo (Absolvent der Hochschule Karlshorst und ehemaliger Beststudent) und seiner jungen deutschen Frau ...
Seit zwei Stunden schwimmen wir in der Ostsee, stehen an der Reling und sind ein bisschen blasser als sonst. Die Ostsee wiegt uns bei Windstärke sechs. Leicht aufgebriste See, heißt das hier. Ein Ausbildungsoffizier verrät: „Wir laufen in ein näher ziehendes Tiefdruckgebiet!“
Eigentlich reicht uns die Schaukelei schon. Wir schlucken vorbeugend Kinetosin, kauen Neukirchner Zwieback und hören uns willig die Ratschläge des Zimmermanns an. der auf dem Vorschiff verkeilt und festzurrt.
„Die Ostsee ist harmlos“, sagt er, „ein Ententeich. Setzt man Entenflott drauf, vermehrt es sich schnell. Wenn wir aber sechs behalten und in der Nordsee sind, dann werden andere Wellen auf uns zukommen. Werden Sie denn seekrank?“
„Das hoffen wir nicht.“
Er lächelt. Er ist stämmig und blond und trägt die Mütze auf einem Ohr. „Nur frische Luft und immer essen“, meint er. „und eine Tätigkeit suchen, das ist das beste Rezept.“
Für solche Rezepte sind wir dankbar. In der Messe gibt es ein ausgezeichnetes Essen. Im Musiksalon kann man noch unser Fernsehprogramm empfangen: Flax und Krümel, ein letzter Gruß aus der Heimat ...
Gegen Mittag sehen wir die dänische Küste, laufen in den Belt ein, und abends sagt der „Dritte“: „Macht alles fest, in fünf Stunden geht's los!“
In fünf Stunden. Ratschläge, Ratschläge. „Nicht soviel trinken, sonst schwabbelt’s im Bauch!“ - „Tüchtig Alkohol!“ - „Kein Alkohol!“ - „Krimis lesen, sich ablenken!“ - „Nicht daran denken!“ - „Keine Mayonnaise essen!“ - „Palavern, palavern!“
Nein, alle Ratschläge lassen sich nicht befolgen.
In fünf Stunden geht’s los. Ich wünschte, wir könnten das ganze Tiefdruckgebiet verschlafen, aufwachen bei glatter See und Sonnenschein.
Ein Wunsch, wie man ihn in der Schule hatte: Wenn doch bloß alles vorbei wäre.
Am nächsten Morgen ist das Meer zwar mit feinen Schaumköpfen bedeckt und der Himmel bezogen, aber wir sind munter auf den Beinen und unterhalten uns mit dem Kapitän, der Hein Meyer heißt, dreiunddreißig Jahre alt ist und aus der Gegend von Frankfurt an der Oder stammt. Er fährt diesmal in Vertretung des urlaubsreifen Stammkapitäns.
Ich bin auf ein langes Gespräch eingerichtet. Kapitän Meyer ist klug und belesen, und wir möchten beide mehr voneinander wissen. Während wir also plaudern unter der Seitenbrücke, in einer windgeschützten Ecke, die der Kapitän „Wintergarten“ nennt, da mache ich eine Entdeckung.
Ich sehe, wie sich das Heck der „Fichte“ hebt wie der Kahn einer Riesenschaukel und dann plötzlich senkt, sodass die See wie ein halbierter Himmel über uns hängt. Was ist nun bleigrauer Himmel? Was ist nun bleigraue See? In diesem Augenblick spüre ich das flaue Gefühl im Magen, das so oft beschriebene flaue Gefühl.
Moment bitte, Kapitän. Und schon bin ich an der Reling, betrachte die Bordwand von außen, als wollte ich den Anstrich prüfen. Zum Glück befinden wir uns nicht auf der dem Winde zugekehrten Schiffsseite.
„Ist was?“, fragt der Kapitän. Scheinheilig, finde ich.
„Später“, sage ich, „vielleicht können wir später ...“ Ich bemerke noch Stanas erstaunte Miene, so eine Nanu-was-hat-der-denn-Miene, murmle eine Entschuldigung, rase den Niedergang 'runter, halte mich fest, eingedenk der Warnung des Chefstewards: eine Hand immer dem Schiff. Dann in die Kajüte. In die Koje.
Das Schiff stampft und schlingert. Der Wind heult. Ach was Wind - Sturm! Ich denke: Eine Stunde nur liegen, mir ist ja schon wohler, eine Stunde, dann gehe ich auf die Brücke, mag kommen, was da wolle.
Zunächst aber kommt nur Stana: still, blass, kojenreif.
Ich erspare dem Leser die Schilderung vom Verlauf der Seekrankheit; ich finde alles bestätigt, was ich jemals darüber gelesen habe. Aber nicht jeder wird davon betroffen. Ist das ein echter Trost? Manchmal kommt die Sonne durch, sie tanzt wie ein Tischtennisball im Viereck des Fensters, huscht die Diagonale hoch, verschwindet wieder. Die Wellen platschen aufs Vorschiff. Die Gardinen schweben, wie von Geisterhand gehoben, in Richtung Zimmerdecke, senken sich wieder, entschweben in die entgegengesetzte Richtung.
Ich versuche, an mein halb fertiges Buchmanuskript zu denken, an meinen Helden, an seine optimistischen Niederlagen, an neue Situationen. Pustekuchen, der Tanz der Gardinen, der Schlag der Wellen, das Fauchen des Sturmes sind stärker. Frau M., die Wissenschaftlerin von der Akademie, kommt ins Zimmer, eine Zigarette rauchend. Eine Zigarette rauchend! Sie sagt: „Ich lasse Ihnen das Steak herbringen!“
„Bitte nicht.“
„Oder eine Apfelsine?“
„Nein. Auch nicht. Wir möchten nichts, gar nichts.“
„Dann gehe ich einen Wodka trinken und ein Tässchen Kaffee. Wenn Sie etwas haben möchten …“ Diese Frau, Zigarette Wodka und Steak und Kaffee, sie ist siebenundfünfzig Jahre alt und völlig frisch und lächelt. Uns kommt das Lächeln sehr diabolisch vor. (Später verriet sie uns ihr Geheimnis: Sie hatte schon wochenlang vor der Reite ein Vitaminpräparat geschluckt, dreimal täglich Vitamin B 6.)
Wir liegen. Bleiben liegen den Kojen, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Wir schlafen nicht, sondern halten uns am Gitter der Betten fest, um nicht rauszurollen.
Der Sturm wird stärker. Die Wellen schlagen sehr hart gegen und auf das Schiff. Der Hammerhai klopft den Rost ab, sagt der Seemann dazu.
In dieser Nacht muss der Kurs geändert werden. Stundenlang wird am Vorschiff gearbeitet. Das Meer ist aufgewühlt Die Wehen sollen uns einige Lecks geschlagen haben, berichtet uns ein Besucher.
Dreißig Stunden im Sturm. Dreißig Stunden Rollen und Schlingern und Stampfen. Gardinentanz und Magenkrämpfe.
Ala René, der kubanische Student, heißen Tee und Zwieback bringt, probieren wir vorsichtig und freuen uns, dass der Magen die Speise annimmt. Freude über einen Zwieback? In diesem Augenblick schmeckt er köstlicher als glasierte Kalbshaxe oder Schaschlik am Spieß. Es liegt hinter uns: die Seekrankheit und der Sturm mit Windstärke zwölf.
Und es sind tatsächlich Lecks in Schiff, hier wird kein Seemannsgarn gesponnen, acht oder neun klaffende Lecks, die in harter Arbeit abgedichtet wurden.
Ein Matrose erzählt: „Es war schwierig, denn die Lecks waren zwischen Schanzing, Außenhaut und Deck, das Wasser stürzte auf uns herab, wir kamen schwer heran: sogar ein Bullauge wurde eingedrückt.“
Als der Zimmermann achtern in seine Werkstatt wollte, stand plötzlich eine graudunkle Wasserwand vor ihm, näherte sich blitzschnell, drückte die Tür der Werkstatt ein und schwemmte sie mit fort. Zum Glück konnte er sich in eine Nische des Niedergangs drücken und festhalten …
Wellen schlugen Löcher in das Schiff. Uns Laien schwer erklärbar, aber ich denke an die Wirkung der Wasserkanonen, mit denen man Felsen sprengen kann.
Die Matrosen sind fröhlich wie immer. Sie reden schon nicht mehr über die Sturmnacht, sie lachen darüber und basteln an den ersten Witzen. Prächtige Kerle.
Ruhige Fahrt durch die Schelde.
Dann in Antwerpen: Sonne und strahlend blauer Himmel. Am Verladekai nehmen wir Stückgut für Veracruz und Tampico an Bord und laufen einige Kilometer weiter in die Werft Mercantile. Für die Überfahrt muss die „Fichte“ erst wieder fit gemacht werden. Der Kapitän meint: „Es hat Sie das erste Mal erwischt, das erste Mal und dann gleich gründlich, es war auch für uns happig, aber dafür sind Sie jetzt gefeit.“ - Hoffen wir das Beste.
Eigentlich wollte ich den Kapitän noch nach den Manövern fragen, die er im Sturm gefahren ist. An Bord erzählt man viele Geschichten („Ein kluges Manöver, er ist in Uhrzeigerrichtung mit dem Sturm gefahren! Wäre er nach Süden ausgewichen, hätten wir leicht auflaufen können!“). Aber ich weiß, dass er nicht gern von sich selber spricht, und ich fürchte auch, dass er nur sagen würde: „Meine Pflicht. Die Matrosen an Deck, die Maschinen unten, wir auf der Brücke - das ist eben unser Beruf, mein Lieber.“
Als die Gangway ausgefahren wird, läuft auf ihr der Bordhund hinunter, dreht sich noch einmal um, blafft kurz auf und ward fortan nie mehr gesehen. Weiß man denn, ob nicht Hunde viel stärker unter Seekrankheit zu leiden haben als Menschen?
Der „Lange Wapper“
„Antwerpen ist eine schöne alte Stadt. Eine flämische Stadt, auf diese Feststellung legen die Bewohner großen Wert. Die Stadt soll zwölfhundert Jahre alt sein. Ihre Geschichte ist wechselhaft: Normannen, Burgunder, Flamen und Spanier herrschten über sie, eroberten, benannten sie, die spanische Furie äscherte sie ein. Dann kamen die Franzosen, im ersten Weltkrieg die Deutschen, und im zweiten Weltkrieg wurde die Stadt mit dreitausendsiebenhundert V-Geschossen bombardiert.
Die Stadt lebt. Stolz und bereitwillig zeigen uns die Bewohner ihre Sehenswürdigkeiten.
„Dort, diese Figur vor dem Rathaus, das ist Silvius Bravo. Er bezwang den bösen Riesen Antigoon, der auf dem Steen (d, h. Burg) hauste und von den Schiffern mitleidlos Zoll verlangte und den Widerspenstigen durch Abhacken der Hand bestrafte. Silvius kämpfte mit dem Riesen, schlug ihm zur Strafe die Hand ab und warf sie in die Schelde. Daraus wurde Ant-Werpen.“
„Stammen Sie aus Antwerpen?“
„Ik ben erin geboren.“
„Und hier, am Steenlein, wer ist diese lustige Figur?“
„Das ist der ,Lange Wapper‘, eine Statue des Bildhauers Poels.“
„Der ,Lange Wapper‘? Davor stehen ein paar Bürger und verstecken ihre Weinflaschen. Und der Wapper macht sich lustig über sie? Was hat es damit auf sich?“
„Der Wapper kijkt glückstrahlend. Sie haben in Deutschland den Eulenspiegel und auch diesen Mann, dem die Kinder nachliefen. Wie heißt er?“
„Der Rattenfänger von Hameln.“
„Ja. In deze tijd hatten wir den Wapper, eine Mischung zwischen Eulenspiegel und Rattenfänger. Er bestraft die bösen Buben und beschützt die kleinen Bürger. Wir sagen hier: Sei vernünftig, sonst holt dich der lange Wapper. Eigenaardig, dunkt me, hij guckt mich an, inderdaad.“
Der Verkehr ist stark. Er fließt zähe durch die enge Innenstadt, von baumlangen Polizisten in knallgelben Umhängen dirigiert.
Hat sich Antwerpen die Beschaulichkeit des Mittelalters bewahrt? Auf dem Rummelplatz spielt man Wiener Walzer. Kleine Mädchen füttern die zahmen Tauben mit Reis. Die Zeilen der Patrizier- Zunft- und Gildenhäuser wirken wie eine Filmkulisse, geschaffen für Egmont und Alba. Die unzähligen Cafés sind in den Nachmittagsstunden leer, ihre Besitzer stehen vor den Türen und blinzeln in die warme Herbstsonne. Wir trinken Kaffee im „Spinnewiel“. Der Wirt ist höflich und freut sich über die einzigen Besucher.
An der nächsten Ecke aber schreit es uns an. Der pompöse „Grand Bazsar“ lässt aus vielen Lautsprechern amerikanische Musik auf die Straße fallen. Ramsch verheißendes Kaufhaus, in dem die Besucher an den Ständen in den Artikeln wühlen können. Der Käufer meint, billiger zu kaufen als in den kleinen, soliden Geschäften, und er kauft auch billiger - die minderwertige Ware.
In Antwerpen macht man mit der großen Kunsttradition Geschäfte: Die Kitschläden, in denen röhrende Hirsche, Elfenreigen, Wassermühlenidylle, Alpenglühen und Sturmfluten in Öl angeboten werden, nennen sich „Gemäldegalerien“ und tragen Namen wie „Van Dijk“, „Teniers“, „Pieter Verbruggen“ und „Pieter Pauwel Rubens“. Und sogar die Bierwagen, die durch die Straßen rumpeln, fahren im Auftrage einer Firma „Breughel“.
Wir sind mit dem Lift bis in den 24. Stock des „Torengebouws“ am Schönmarkt gefahren und sehen uns die Stadt vom Panoramasaal aus an. Die Fensterscheiben sind beschmiert. Stana möchte seine heiß geliebten Panoramabilder schießen, aber die Wirtin hinter dem Schnellbüfett sagt: „Die Fenster sind nicht zu öffnen.“ Draußen jault der Wind.
Mit Franken gefüttert, spuckt ein automatischer Reiseführer in vier Sprachen Wissenswertes aus: „Wir sind jetzt 112 Meter hoch. Vor uns die Kathedrale, von der Kaiser Karl V. einmal sagte: Dieses Kunstwerk verdient es, in ein Futteral gepackt, dem Volke nur alle hundert Jahre gezeigt zu werden.“ Wie hochherzig von dem Monarchen.
„Über uns, im 25. Stock, befinden sich die Anlage zur Wasserversorgung der Stadt und der Fernsehsender. Das Fundament dieses Hauses ist 27 Meter tief. Es gibt in Antwerpen 31 Pfarrkirchen und über 20 Museen. In der Rubensstraat befindet sich die Rekonstruktion des Wohnhauses des großen Malers und Diplomaten Peter Paul Rubens. Von dieser Seite aus können Sie die Schelde verfolgen, die, das Land von Dedermonde durchfließend, ihren Weg zum Meer sucht. Bei gutem Wetter sieht man bis Kempen und Flandern. Wir danken Ihnen und wünschen guten Aufenthalt.“ Klick, der Apparat schaltet sich aus, das war geliefertes Wissen für fünf belgische Franken.
Bei einem Bier komme ich mit einem flämischen Techniker ins Gespräch. „Woher kommen Sie?“, fragt er. „Ost oder West?“
„Ost. DDR.“
Er bestellt noch zwei „bitschen batsch“, das beißt Bier, und meint: „Sind mir sympathischer als die Westdeutschen. Ich habe geschäftlich viel zu tun mit den Deutschen.“ Er hält inne. „Sie sind ein schrijver?“
„Ja“, sage ich, „stört Sie das?“ Denke: Erzählt er nun nicht weiter? „Nein, bewahre. Die Westdeutschen treten arrogant auf, als gehöre ihnen Belgien. Als Junge habe ich die Besetzung erlebt, wissen Sie. Aber diese Leute haben sich nicht geändert. Wir sind ein kleines Land, die Westdeutschen glauben, es in ihrer Tasche zu haben. Vielleicht haben Sie es auch schon wieder ...“ Bei Ihnen ist das anders. Ihre Menschen sind anders geworden, sie treten bescheiden auf, manchmal sogar zu bescheiden, finde ich … Schreiben Sie ruhig, was ich sage, aber erwähnen Sie besser meinen Namen nicht, ich habe Frau und vier Kinder.
Märchenland bei Nacht
Im Sportpalast tritt die Wiener Eisrevue auf. Im „Empire“ läuft der Streifen „Tarzan de Wunderbare“. Im „Cine Paris“ kann man für fünfzig belgische Franken den amerikanischen Film „Secret society“ sehen: Es bleibt dunkel im Kinosaal, der Einlass ist ständig- Ein Publizist erzählt, welchen Neigungen der amerikanischen Millionäre er auf die Spur kam. Und das zeigt er dann auch. Er zeigt, welche „Kunststreifen“ die Herren bestellten, wie diese Streifen hergestellt wurden. Auspeitschungen nackter Mädchen, Orgien, Einzel- und Massenstriptease. Folterungen gefesselter Frauen - man hört sie schreien, stöhnen, die Kamera geht nahe heran, macht Großaufnahmen. Im Saal aber keuchen die biederen Bürger Antwerpens. Es widert uns an, wir gehen vor dem Finale.
Spezialitäten in den belgischen Restaurants sind Muscheln mit pommes frites (mosselen met frieten) und Hühnersuppe mit Gemüse (waterzooi).
Die Sprache ist wunderbar gemütlich. In den Straßenbahnen hängt das Warnschild; „Vor haalde eenmal bellen.“
In einem eleganten Schallplattenladen zuckt ein Senor (diese noch heute übliche Anrede ist ein Rudiment aus der Zeit der spanischen Niederlande) die Schultern. „Was typisch Belgisches habe ich nicht, tut mir sehr leid. Vielleicht Presley? Er singt deutsche Volkslieder. Die rolling-stones, die beatles natürlich und dann die vielen belgischen beatles, tut mir sehr leid, ongelukkigerwijze ist das heute so.“
In der Schipperstraat zeigen sich mit Anbruch der Dunkelheit hinter breiten, erleuchteten Scheiben der „Bars“ die käuflichen Frauen, spielen Skat oder Domino, warten, stellen sich in Positur, kämmen sich, ziehen sich an oder aus. Eine Frau, die wie eine Sechzigjährige aussieht, lockt mit knöchernem Finger wie die Hexe aus dem Märchen ...
Aber es irr Realität Das zwanzigjährige Mädchen Bianca, das uns eine rührende, erfundene Lebensgeschichte erzählt. Die Fünfzigjährige, die gemein und zotig wird, als Stana nicht mit ihr tanzen will. Die Mädchen in der mit ultraviolettem Licht ausgestatteten Cosmos-Bar, die verkleidete homosexuelle Männer sein sollen. Die als Teufel geschminkte Striptease-Tänzerin.
Die Mädchen gehören zum Geschäft. Bestellt der Gast Sekt, so sind sie verpflichtet, ihn auf jede Weise zu unterhalten. Die Zimmer der Mädchen sind gleich hinter dem Barraum.
Überall dröhnt Musik aus den Boxen: Schrammeln und „volle Pulle“ und „Märchenland bei Nacht“.
Märchenland bei Nacht. Wir trinken in jeder „Bar“ ein Glas Bier. Man lässt uns sitzen und beobachten. Leute, die nur ein Bier trinken, sind uninteressant. Fotografieren kann Stana nicht, es ist überall zu dunkel.
Märchenland bei Nacht. Trinkt der Gast eine Flasche Sekt, dann muss Bianca - laut Arbeitsvertrag - mit ihm gehen. Sie ist zwanzig und kann sich ausdrücken. „Meine Mutter würde mir blaue Augen hauen, wenn sie wüsste!“ Ein dummes Mädchen?
Es dauert nicht lange, dann sieht sie so verkommen aus wie die keifende Alte mit dem Rattengesicht, vor deren Schimpfkanonaden es einen fröstelt. Aber: Es ist doch ein Mensch. Sie war vielleicht einmal eine Mutter. Tragik, menschliche Tragik. Nur Tragik? Nur individuelle Tragik? Wir kennen ihr Leben nicht. Aber heute ist es entmenschlicht.
In der Appelmansstraat tun sie es vornehmer. Dort heißen die Animiermädchen „playboys“, tragen knappe Häschenkostüme und wenden raffinierte Tricks an. Nach einer halben Stunde sollen wir siebenhundert belgische Franken mehr bezahlen, als wir überhaupt verzehrt haben. Das Mädchen Christine, in dessen Auftrage der Sekt für uns angeblich geliefert wurde, ist verschwunden.
Märchenland bei Nacht. In der Einzimmerwohnung eines Bekannten trinken wir einen starken Mokka. Zur Ernüchterung. Die Wohnung kostet, in unsere Währung umgerechnet, dreihundertzwanzig Mark im Monat.
Spiel und Kunst in Middelheim
Der 7. November ist ein sonniger Tag. Die „Fichte“-Besatzung fährt in gemieteten Bussen durch die sonntäglich stillen Straßen in den Middelheimpark am Rande der Stadt.