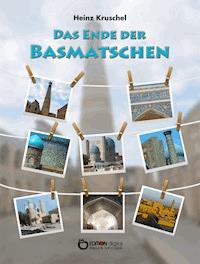7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das ist eine starke, berührende Geschichte, die Titelgeschichte und zugleich die längste der insgesamt 16 Erzählungen dieses Bandes, wobei sich der ungewöhnliche Titel tatsächlich erst beim Lesen erschließt. Denn was soll „Lamyz“ bedeuten? Dann stellt sich heraus, dass diese fünf Buchstaben nicht nur für eine gewisse Ordnung, sondern auch für eine Art Geborgenheit und für einen besonderen Schutzraum stehen. Denn diese Titelgeschichte ist vor allem auch eine Liebesgeschichte. Ein Junge, ein Jüngling noch von knapp fünfzehn Jahren, der begehrt ein attraktives und nahezu gleichaltriges Mädchen und stellt sich vor, wie er sie erobern würde: „Hör mir zu, Cilly, du gefällst mir. Ehrenwort. Mir gefallen deine festen, langen Beine, dein schlanker Hals, der so weiß leuchtet, und manchmal dachte ich schon, wenn du tief einatmest, sprengten deine Brüste das enge Mieder, dass die Knöpfe abfallen würden. Und überhaupt, wenn ich dich sehe, nehme ich auch einen Duft wahr. Warum hast du keinen Freund? Wollen wir zusammengehen? Entschuldige, aber das nennt man so. Ich bin stolz auf dich. Wollen wir ins Kino gehen? Diese Ansprache an Cilly habe ich mir zurechtgelegt. Jeden Tag änderte ich sie, sagte sie mir vor, dachte mir dazu aus, wie sie reagieren, was sie antworten könnte, ob sie überhaupt antworten würde. Ich blieb feige. Täglich sah ich sie nicht, weil sie in eine andere Schule ging und in einem anderen Stadtteil wohnte, dem altersgrauen Wendelitz, wo die Türme und Mauern noch aus Muschelkalk waren. Natürlich wusste ich, was sie mochte, Schwimmen und Paddeln zum Beispiel, ich kannte ihre Freundinnen und wusste, wo sie wohnte, in der Apotheke, die ihrem Vater gehörte.“ Doch der Junge traut sich nicht und muss erst auf einen Zufall warten, der ihn und das Mädchen zusammenbringt. Allerdings sind die Zeiten der Liebe nicht günstig. Es herrscht Krieg in Europa und der ist dabei, zu seinem Ausgangspunkt zurückzukehren: Zu dieser Zeit näherten sich russische Truppen der Oder. Und der Junge, der sich eine Zukunft mit Cilly vorstellen kann, gerät in schlimme Umstände und sogar in Todesgefahr. Doch dann ist der Krieg aus. Er hat überlebt. Aber was ist mit ihm und mit Cilly? Auch in den anderen 15 Erzählungen dieses Bandes mit Texten von 1986 bis 1995 geht es um Leben und um den Tod, um Lebenssinn und Menschenpflichten, um Schuld und Unschuld, um Gerechtes und Ungerechtes und nicht zuletzt um die Gewissheit, dass Eulenspiegel und mit ihm der Schalk nicht ausstirbt. Zum Glück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Heinz Kruschel
Lamyz
Erzählungen
ISBN 978-3-95655-104-8 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1995 im dr. ziethen verlag, Oschersleben.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digitalaramondItcT-Light",serif'>®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Das Buch entstand mit freundlicher Unterstützung des Kultusministeriums des Landes Sachsen-Anhalt.
Vorbemerkung
Zwei junge Menschen, Schüler noch, wollen sich während des Krieges eine Heimat schaffen, eine Geborgenheit, und erleben, wie brüchig allein schon der Wunsch ist.
Der Tod eines Tieres macht einem Kinde klar, dass es Etwas gibt, das so stark ist, dass es behütetes Leben beenden kann.
Ein Mensch will zur Quelle vorstoßen und nähert sich damit der Hölle. Abseits vom Trubel der Zeit lebt in der Einsamkeit eine junge Frau und versucht, ihre Sehnsucht zu besiegen.
Der fünfundzwanzigste Schüler seiner Klasse bürdet dem Lehrer ein Leben lang eine Schuld auf, die der gerne auf sich zieht.
Einer, der meint, von seinem Mädchen verstoßen und darum verloren zu sein; der Lehrer, der plötzlich aus der Geborgenheit seiner Kollegen herausfällt; das kleine Mädchen, das der Uralten zu einem wunderbaren Gefühl des Zuhauseseins verhilft; die jungen Freunde des Andersartigen, der für sie immer da war; das Zigeunerkind, das Heimat sucht und Ratten findet; die Familie Eulenspiegels, die nicht aussterben darf, solange es Menschen gibt; die alte Frau, die das Unausgesprochene und Verheimlichte nicht mit in die Grube nehmen will; der Angeber, der in die Klasse einbricht und sie zerstören will - das sind Geschichten Kruschels, die in diesem Band veröffentlicht werden.
In den Geschichten geht es um die Sehnsucht nach Geborgensein, nach einer Heimat, die dort ist - wie Brecht sagt -, wo der Himmel höher, die Luft würziger wird, wo die Stimmen kräftiger schallen und der Boden sich leichter begeht.
Wie oft aber schwankt der Boden. Wird der Himmel zerrissen. Versagen die Stimmen und verstummen schließlich. Reicht dem Menschen die Luft nicht aus. Immer sind Gefährdungen da.
In Kruschels Erzählungen wollen die Helden das Geborgensein absichern: junge Leute ihre Liebe in einer Turnhalle, die Alte ihre grausamen Erinnerungen, die verstoßene Frau ihre Einsamkeit und die Jungenclique den Andersartigen, den die Erwachsenen ablehnen.
Lebendiges kann nicht vorausberechenbar festgelegt werden, auf Dauer ist kein Glück.
Es geht immer um Freunde und liebe Menschen, ohne die es sich schwer leben lässt. Oder gar nicht, auch davon erzählt eine Geschichte. Nichts erstarrt zu Stein. Auch die schlimmen Störungen gehören zum Leben. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen können nur zufällig sein.
Colaparty
1. Kapitel
Erst brachte das Radio die Meldung über den Bau eines Supermarktes auf unserem Gelände, von dem man den Kiefernwald einfach weggeschoben hatte, dann folgte ein Gespräch mit einem Räuber, der bloß in den Knast wollte, weil er ein warmes Zimmer brauchte, und dann kam endlich die Meldung über uns.
KINDERBANDE AUF DEM FRIEDHOF
Die wissen nichts. Die haben keine Ahnung. Die Kinder sollen wir sein.
KRIMINELLE JUGENDLICHE FEIERN PARTY AM GRAB
Das trifft es schon eher, das haben sie sich schön und fast richtig ausgedacht, aber ‘feiern’ und ‘Party’, nee Leute. Da lagen unsere Colabüchsen auf dem Grab, das haben sie bestimmt auch für BILD oder SUPER fotografiert, Mann, ihr schwätzt dummes Zeug, von wegen kriminell, aber Leo hätte gesagt: Wer viel schwätzt, der lügt auch viel.
Die Colabüchsen lagen auf dem frischen Grab von Herrn Leonid Eisewicht, geboren am 11.11.1944.
Dass der Eisewicht hieß, habe ich gar nicht gewusst.
Der hieß für uns Leo, also Leonid, wird schon stimmen, wie Leonid Leonow, der russische Raumfahrer. Für mich war Leo so was wie der liebe Gott.
Drei Colabüchsen stammten von mir. Ich könnte nur noch heulen, zu Hause werde ich einen Flying horse schlucken und einen wummernden Sound reinlassen, bei dem ich nicht mehr denken kann.
TOTENRUHE GESTÖRT. GESUCHT WERDEN JUNGEN IM ALTER VON DREIZEHN BIS FÜNFZEHN JAHREN, ROTZJUNGEN
Leo, sag einen Spruch, das konntest du doch so gut: Die rotzigsten Jungen werden die besten Kerle. Na also. Wir haben dich nicht gestört. Die das geschrieben und gesagt haben, die kannten dich gar nicht, und wenn sie dich je getroffen haben, sind sie dir doch aus dem Wege gegangen, weil du torkeltest wie ein Besoffener.
2. Kapitel
Drei alte Leute waren da, eine Achtzigjährige, ein Neunzigjähriger und ein mittelalterlicher Mensch, von dem man nicht wusste, ob Mann ob Frau, jedenfalls redete der oder das Mensch und las aus der Bibel vor. Christian kannte die Stellen, der Himmel hat für solche wie dich geöffnet ... Christian hat zurzeit mal wieder einen Bock auf Jesus, mal Hool, mal Zecke, mal Modepunk, bei dem weiß man nie. Als die Alten wegschlurften, gingen wir erst hin zum Grab, so lange hatten wir uns versteckt gehalten. Sie sahen uns ganz komisch an und schlurften etwas schneller, als müssten sie vor uns davonlaufen. Und dann haben wir die Colas aus unseren Taschen geholt und angestoßen. Es lag ein Strauß auf dem Grab, kein Kranz und keine Schleife.
Also mussten wir das Grab wohl schmücken und haben wir eine Cola nach der anderen ausgetrunken und aufs Grab gelegt, in Form eines großen Kreuzes. Prost, Leo. Bist jetzt im Himmel, wo es sauber, windig und kühl ist, oder in der Hölle, in die man rutscht, ohne bremsen zu können.
Du hast mir doch den Weg dahin erst vor Kurzem gezeigt.
Prost Leo.
Du hast mit uns oft einen Date gehabt.
Zu Hause haben sie uns gesagt, dass du eigentlich in die Klapsmühle gehörtest. Was wissen die schon zu Hause.
Du konntest das, was die zu Hause nicht können. Barfuß über knirschendes Glas laufen, ohne dir die Füße zu zerschneiden. Du konntest eine Eisenstange biegen, eine Tür ohne Schlüssel öffnen, einen bissigen Hund beruhigen, eine Handvoll Käfer essen, einen betrunkenen Bengel, der auf Skin mimte, in den Hintern treten und Warzen und Ausschlag besprechen.
Prost, Leo.
Die Hunde liefen dir nach. Du hattest aber auch einen Geruch, mein lieber Scholli, der echt gut war, du rochst wie Wildtöter, nach Moder, Leder und abgestandenem Bier.
Dabei warst du nur so groß wie die Vierten aus unserer Schule und hattest einen Wasserkopf, der manchmal pendelte, als drohte er, vom Hals abzufallen. Und weil der Kopf so pendelte, konntest du nicht auf einer Bordsteinkante geradeaus gehen.
Der Vater von Robby hat gesagt, dass Leo von den Nationalsozialisten vernichtet worden wäre. Vernichtet als unwertes Leben, das hat der gesagt, so wie sie Ratten vernichten, und deren Leben hat einen Wert, die kann man zähmen, mit denen kann man spielen und die Lehrerinnen erschrecken.
Wenn Robbys Vater wüsste, dass das ‘unwerte Leben’ sein kostbares Terrassenfenster eingesetzt hat, nachdem wir es eingeschossen hatten. Robby wäre geschlagen worden, da kannte der Alte kein Pardon, da griff der zu jedem Knüppel.
Keiner konnte Robby leiden, aber das wollten wir ihm denn doch nicht antun. Robbys Eltern arbeiten auf dem Landratsamt.
3. Kapitel
Schön war Leo nicht. Er hatte im Gesicht lauter kleine Knötchen und einen aufgestülpten Mund und ging selten auf die Straße.
Wir sollten ihm die kaputten Fensterflügel nach Hause bringen, er wohnte in Nietleben, also taten wir es, hakten die schweren Dinger aus und ließen Robby als Posten zurück, damit kein Dieb in die Villa einsteigen konnte. Wir anderen aber durften in Leos Tür stehen bleiben und ihm zusehen. In dem Zimmer, in dem er arbeitete, da kochte und schlief er auch. Davon kann man nur träumen, echt super, und keiner nervt einen und verlangt aufzuräumen oder solchen Quatsch. Bevor Leo anfing, maß er nach, und dann sagte er seinen Satz: „Dann wollen wir mal die Butter bei die Fische tun.“ Das heißt: Jetzt geht es um den Kern der Sache. Er schnitt zu, setzte sehr sorgsam ein, verkittete und wischte die Spuren des Kitts sauber weg. Jeder Handgriff saß bei ihm.
Wir sahen ihm zu, und dass wir ihm zusehen durften, empfanden wir als Auszeichnung. Erwachsene ließ er nicht in seine Höhle. Er hat seine Gründe gehabt.
Wir sahen gar nicht, dass der hässlich war. Für uns war es es nicht.
4. Kapitel
Randalierer sollen wir also sein. Die Ruhe eines Toten sollen wir stören. Dabei war nur Asche von ihm übrig geblieben.
Wir waren fünf und tranken unsere Runden. Und vor jeder Runde sagte einer einen Spruch, der von Leo stammte.
Dirk, du bist dran. Dirk ist unser Computerfreak und oft nicht von dieser Welt, er klinkt sich von seinem Bildschirm aus bei wildfremden Leuten in das globale Netz ein und vergisst über dem elektronischen Geschwätz alles. Diesmal hob Dirk den Arm in die Höhe und sagte: „Sauf dich voll und groß und dick und halt das Maul von Politik!“ Darauf stießen wir an. Von Cola kannst du besoffen werden.
Die Großen sagen, Leo hätte gern einen getrunken. Und wenn es so gewesen wäre, stimmte aber nicht. Leo trank nur Milch. Was eine Kuh am Tage an Milch rausbrachte, das trank der auch.
Schade, Leo, du fehlst uns jetzt schon, was soll das erst morgen werden.
5. Kapitel
Vor zwei Jahren, als wir noch in der sechsten Klasse waren, verlangten einige Große aus der Zehnten von uns immer zwanzig Pfennige, wenn wir den Schulhof betreten wollten. Natürlich wollten wir nicht zahlen, und da traten und schlugen sie uns.
Bis Kai auf die Idee kam, Leo zu informieren, ausgerechnet Kai, der Leo oft verspottet hatte und der Nietenarmbänder trägt und auf dem Lacoste-T-Shirt einen großen Totenkopf.
Die großen Schüler waren einen Kopf größer als Leo und lachten, als er ankam, so klein und wackelnd auf seinen Säbelbeinen und mit seinem Wasserkopf.
Wir hatten Angst um ihn, ehrlich. Er hatte eine meterlange Eisenstange bei sich.
Nicht, was ihr denkt, der wollte damit nicht schlagen, auf seine Weise tat er die ‘Butter bei die Fische’, fasste die Stange an beiden Enden und bog sie, mir nichts, dir nichts, zu einem Ring zusammen und dann wieder auseinander.
Als das der lange Rutscher aus der Zehnten nachmachen wollte, bewegte sich die eiserne Stange unter seinen Fäusten keinen Millimeter, und Rutscher hing dran wie Qualle.
Nun sahen alle, mit wem sie es zu tun hatten, und das war unser Leibwächter, Leute, wehe, wenn ihr uns nicht in Ruhe lasst. So war er. Und der Leo ist nun nicht mehr.
Echt normal, wenn wir auf den einen heben.
Prost, du bist dran, Christian.
Und Christian grient und sagt: „Wenn ein Affe hoch klettert, sieht man viel von seinem Hintern.“ Stimmt, der Satz stammte auch von Leo. Er hatte ihn gesagt, als ein Regierungsschlitten voll durch die Pfütze geprescht war und ihn von oben bis unten eingesaut hatte.
6. Kapitel
Jeder könnte eine Geschichte erzählen, Christian zum Beispiel, als er am ganzen Körper Ausschlag hatte, selbst auf den Lidern, sodass er nicht mehr aus den Augen sehen konnte.
Da soll Leo keine Butter, sondern halb verfaulte Frösche und Ameiseneier ‘bei die Fische’ getan haben. Jedenfalls behauptete das Kai, aber woher wollte der das wissen, denn Christian durfte keinen Zauberspruch verraten. Jedenfalls war unser Kumpel nach zwei Tagen geheilt.
Diese Art Pest hat Christian nie wieder bekommen. Wenn wir Leo brauchten, war er für uns da und half.
Nun haben wir nie erfahren, ob er nicht manchmal unsere Hilfe gebraucht hätte.
Nun ist er tot.
Und ich, ich habe ihn zu Tode gebracht.
Ich habe vor einer Woche Leo an einem langweiligen Freitagnachmittag zu Tode gebracht. Meiner Schusseligkeit wegen. Ich wartete auf meine Eltern, die von der Messe in Hannover zurückkommen wollten. Sie kamen und kamen nicht. Und weil es so langweilig war, saß ich auf der Bordsteinkante, spielte mit dem dicken Schlüsselbund, das ich zu bewahren hatte, und ließ es über die eisernen Stäbe des Gullys klirren, bis es kam, wie es kommen musste: es flutschte durch die Stäbe in die Tiefe. Ich legte mich auf den Bauch und sah hinunter, aber ich sah nichts. Was tun. Sagen, dass Skins mich beraubt hätten. Das machen öfter welche, die Skins müssen für alles herhalten. Natürlich, ihr wisst es, Leo fiel mir ein. Ich klopfte an seiner Tür, er hörte nicht. Als ich in sein Zimmer kam, lag da ein Fahrrad auf der Werkbank und er selber fieberheiß im Bett. Angezogen und zitternd. Glaubt mir, dass ich mich zurückziehen wollte, aber da hatte er mich entdeckt, und ich musste ihm alles erzählen, die ganze Chose.
Er stand auf und holte eine lange Stange aus dem Stall, eine Stange, an der ein Schöpfeimer befestigt war. Ein Seil musste ich tragen. Wir sahen aus wie die Kelten bei Asterix. Es ging ihm sauschlecht, er torkelte stärker noch als sonst.
Dennoch griff er mit seinen starken Fäusten in die Streben des Gullys und wuchtete ihn hoch. Die Schweißtropfen sprangen ihm von der Stirn. Er begann zu schöpfen. Schwarzes Wasser kam zutage, stinkender Schlamm und vermodertes Laub, aus dem viele kleine Lebewesen heraushüpften. Die torkelten und sprangen, wie geblendet von der Sonne, solche Sprünge haben sie in ihrem Leben noch nie machen dürfen.
Alle Gören aus der Straße kamen an und fingen sie ein. Die Mädchen kreischten, Frösche hatten wir genug, aber das Schlüsselbund fehlte. Leo stützte die Stange auf und hielt sich daran fest. Er atmete hastig, als hätte er in Rekordzeit den Brocken bestiegen. „Auch kluge Hühner scheißen sich ins Nest“, sagte er und wickelte mir das Seil vom Leib. Wollte er mich da runterschicken? „Besser Schlamm als Flut“, sagte er mühsam.
7. Kapitel
Ja, der kannte sagenhafte Sprüche.
Nun ist er verbrannt, zu Asche geworden, in einem komischen Topf und unter der Erde. Ach, Herr Leonid Eisewicht.
Ob ich die Schlüssel wiederhabe? Als ob die noch wichtig sind.
Er band mir das Seil um, nachdem ich mich bis auf die Badehose ausgezogen hatte, und ließ mich mit dem Kopf voran in das Nichts hinab. Erst war noch ein bisschen Sonne da, dann nur noch Finsternis und Gestank und glitschige Wände und endlich, ganz unten, da sprang mir das Drachengezücht entgegen, Gewürm, eintausend Frösche.
Eigentlich konnte man Leo immer vertrauen. Aber nun war er krank und nur ein halber Leo. Stark war er. Einmal hat er ein Auto, das den Eingang von Dirks Mietshaus blockierte, glatt um die eigene Achse gehoben, damit die Schnelle Hilfe bis zur Tür ranfahren konnte. Wenn er aber das Seil losließe, müsste ich ersticken.
Auf Ehre, daran dachte ich zuerst nicht. Aber heute denke ich daran, immerhin ist man auch im Kopfe krank, wenn man Fieber hat. Dass er es auch mit dem Herzen hatte, das wusste doch keiner von uns. Leute mit solchen Wasserköpfen sollen nicht lange leben, sagte man bei uns zu Hause.
Aber die mochten doch alle den Leo nicht. Der war eben nicht von hier, der war ein Fremder und sein Vater ein russischer Kriegsgefangener und seine Mutter auch eine Wasserköpfige, die man beschimpft und undeutsch genannt hatte.
Kai sagte am Grab: „Wenn man sich kratzen muss, dann am besten mit den eigenen Nägeln, Prost, Leo.“ Er schien das gleiche wie ich gedacht zu haben, nämlich an Leos Eltern, die sie zum Selbstmord getrieben hatten. Aber davon spricht keiner in unserer Stadt, und unsere Großeltern müssen doch dabei gewesen sein.
Leo hatte auch nicht darüber gesprochen.
Viel wussten wir nicht von ihm.
8. Kapitel
Ich tastete mit gespreizten Fingern durch die Herde des Teufels und fand eine Flasche, einen Schraubenzieher, drei Geldstücke und eine verbogene Schere. Und dann endlich einen metallenen Ring, von dem ich gleich wusste, dass er nur der sein konnte, an dem unser ganzes Schlüsselbund hing.
Verdammt langsam zog mich Leo hoch. Je langsamer seine Hände wurden, desto größer wurde meine Furcht, ja, jetzt schlich sie mich an, ich fühlte mich nicht mehr sicher.
Aber ich kam höher, weg von dem Hölleneingang, vor dem ich gehangen hatte. Stundenlang, so war es mir vorgekommen.
Ich kann euch sagen, da ist es schwärzer als schwarz. Aber ich hatte die Schlüssel und roch nicht einmal, wie ich stank. Jedenfalls wichen manche Kinder vor mir zurück. Aber seinen eigenen Gestank soll man riechen können.
Auf der Straße hüpfte kein Frosch mehr, sie waren alle eingefangen worden.
Leo torkelte. Er war ein angeschlagener Boxer, manchmal ging er in die Knie. Ich begleitete ihn und wollte einen Arzt rufen. Aber da sagte er: „Ein Arzt, drei Krankheiten, komme schon wieder in Gang.“ Aber er war wirk!ich nur noch ein halber Leo.
9. Kapitel
Wer hebt da die Cola? Wer hebt sie nicht? Komisch, wie die Augen unter den Schleiern tanzen. Robby sagt: „Nun müssen wir den Igel doch im Ganzen runterschlucken.“ Auf dich, Leo.
In der Nacht nach dem Gullyeinsalz starb er. In dieser Nacht träumte ich von Fröschen, die mir aus engem Schlund entgegenhüpften, die nicht quakten, sondern mich taub wisperten.
In dieser Nacht erreichte ich träumend das Ende des Schlundes und damit das Licht. Ein riesiger Kopf lächelte mir zu. Das konnte nur der liebe Gott sein, von dem mir meine liebe Oma manche liebe Geschichte erzählt hatte. Das Gesicht des lieben Gottes hatte viele kleine Knötchen, es wackelte und der Mund war aufgestülpt wie bei einem chinesischen Goldfisch.
Dann sagte der liebe Gott zu mir, dass man doch endlich Butter bei die Fische tun sollte. Ach, Leo, du lieber Gott. Wenn ich mir den vorstellen muss, werde ich immer dich im Kasten haben, Leo, denn du hast uns wunderliche Typen verstanden und geholfen, ohne gleich mit der Bibel zu schmeißen.
10. Kapitel
DIE JUNGENBANDE, VON DER WIR IN UNSERER GESTRIGEN AUSGABE BERICHTETEN, IST ERKANNT WORDEN ...
Kunststück, wir haben ja keine Masken getragen. Angeblich sind sie uns auf der Spur. Die Meldung kam gleich nach dem Aufschwung Ost, dem Sieg über Werder Bremen und einer Erkältung des dicken Präsidenten der Russen. So wichtig sind wir. Nein, ihr Schreiber, so wichtig ist Leo.
Wir gingen wieder auf den Friedhof. Robby kam nicht mit, er hatte Schiss. Sein Vater ist ein hohes Tier im Landratsamt, und da darf der Sohn keine Party am Grab eines Asozialen feiern. Dabei hat er Zoff, er hält nichts von den Entwürfen auf die Menschheit, die sein Vater aus dem Amt mitbringt.
Wir gingen, obwohl wir um die Gefahr wussten. Vom Hauptweg des Friedhofs aus sahen wir schon den schnapsfarbenen Stoff der Polizeiuniformen durch das Grün des Buschwerks. Sie hatten uns regelrecht umstellt und warteten ab, mit ihren Waffen und Handfesseln war ihnen ja der Sieg sicher.
Wir hoben die Colabüchsen hoch und ließen sie aufzischen, dann wollen wir mal. Prost. Prost ist auch ein Trost. Als wir ausgetrunken hatten und die Büchsen wieder aufs Grab stellen wollten, kamen sie im Laufschritt auf verschiedenen Wegen auf uns zu.
Wir liefen nicht weg. Keiner von uns versuchte es. Das waren wir Leonid Eisewicht schuldig.
Amen.
1995
Katze mit dem weißen Stern
Wir haben heute viel gesehen, wir sind dem Lauf des Baches an den Stelzenkiefern entlang gefolgt, und ich habe dem Jungen von den Flamen erzählt und wie sie dieses Land urbar gemacht haben.
Vögel flogen über uns, Rohrweihen und Lachmöwen und Pirole. Ich habe dem Jungen das Urstromtal gezeigt. Wir waren in Saldernhorst, wo es vor vierzig Jahren noch kein elektrisches Licht gab, und hier waren es Kiebitze und Wasserläufer, die über die kurzrasigen Wiesen stolzierten.
Der Junge fragte, ich antwortete, so gut ich eben konnte. Wenn ich eine Frage nicht beantworten konnte, sagte er: „Merk dir das, da schlagen wir zu Hause in einem schlauen Buch nach.“ Für ihn muss ein Erwachsener nicht alles wissen.
Es passiert am späten Nachmittag. Wir rasten vor einem Haus an der Straße, sitzen auf der warmen Holzbank, und der Junge spielt mit einer schwarzen Katze, die einen weißen Stern auf der Brust trägt und zu dem Anwesen gehört. Mich interessiert das Haus, weil es in luftiger Höhe noch einen alten Giebelspieß trägt, und das ist selten geworden.
Die Straße, die von Süden kommt, führt an uns vorbei. Hinter uns wachsen Ginster, uralter Flieder, Rotdorn und Kiefern, und in dieser Ruhe passiert es. Die Katze dreht ihre Kreise, bis wir sie nicht mehr sehen. Bremsen quietschen, und etwas fliegt durch die Luft. Der Junge sieht dieses Etwas wie ich, es muss von einem der Autos hochgerissen worden sein. Die Katze, wo ist die Katze.
Schon liegt sie uns gegenüber, sie könnte nochmals überfahren werden. Der Junge lässt sich nur mit Mühe zurückhalten. Endlich wartet er an meiner Hand ab, bis wir die Straße überqueren können. Die Katze, sie ist in das staubige Gras geschleudert worden. Aber man sieht kein Blut.
Der Junge kniet sich nieder und sieht mich an. Ich nicke ihm zu. Tot. Ja, tot, mein Junge, tot.
Der Junge erlebt zum ersten Male, was das ist: tot sein. Zum ersten Male sieht er es. Eben noch gesprungen, geatmet, gefaucht, geschnurrt, gemauzt und gespielt, und nun ausgestreckt, wie im großen waagerechten Sprung erstarrt, also tot.
Vom Blitz getroffen der ebenmäßige Körper, der kräftig und auf eine sonderbare Weise auch zierlich aussieht.
Der Junge streckt seine Hand aus.
Ich will ihn warnen, aber er lässt seine Hand nur über der Katze schweben, über den kugligen Kopf, den starken Hals, den buschigen Schwanz. Er streichelt, ohne das Fell zu berühren. Die Katze, seine Spielfreundin vor Minuten noch, ist einfarbig schwarz mit einem weißen Stern auf der Brust.
Ich sage: „Sie kann nichts gespürt haben, es ging so schnell, sie hat keine Schmerzen gehabt.“
„Das denkst du so“, sagt er. Tränen beginnen aus seinen Augen zu tropfen. Er ist sieben und geht in die erste Klasse. Soll ich ihm zureden, aber jetzt zureden, das kann ich nicht, weil ich seine Trauer verstehe. Ich hocke mich zu ihm nieder und umarme ihn. Er hat zum ersten Male ein totes Wesen gesehen und wird den Anblick vielleicht nicht vergessen. Er hat etwas gesehen, das so stark ist, dass es Leben beenden kann. Er könnte also etwas ahnen von einer Macht über alles, was lebt. Ich bemerke, wie der Junge die Katze so aufmerksam ansieht, als müsste er sich alles einprägen, selbst die Ballen der Sohle und die eingezogenen Krallen. Und doch scheint für ihn etwas Fremdes von dem toten Tier auszugehen.
Er möchte die Katze begraben. Ich hole aus dem Auto eine Zeitung und schlage in ihr das Tier ein. Der Junge sieht zu und folgt mir, als ich alles in das Haus bringen will. Aber da steht eine robuste Frau in der Tür: nein, zu mir nicht. Und wir sehen noch andere Katzen im Vorgarten, also gehen wir zum Auto zurück und nehmen den kleinen Spaten aus dem Kofferraum.
Der Junge will graben, natürlich lasse ich ihn, und dann sucht er einen blühenden Zweig von einem Gebüsch und bricht ihn und legt ihn auf das Grab. Was für einen Enkel erlebe ich heute.
An einer Beerdigung hat er noch nie teilgenommen. Spielt er einen Film nach?
Nun weint er nicht mehr, steigt ins Auto, schnallt sich wortlos an. Blass sieht er aus.
Ich will ihn ablenken und erzähle auf der Fahrt von Großtrappen und Seeadlern und beobachte den Jungen im Rückspiegel. Seine schmalen Arme rühren mich, ich möchte gern zärtlich zu ihm sein, denke aber, dass ich ihn jetzt nicht sinnieren lassen darf, also reden, fragen, reden, fragen.
Kurz beantwortet er meine Fragen. Er selber fragt nicht.
So fahren wir der Havelstadt entgegen.
Weinte er doch nur, denke ich und male mir aus, wie er das Erlebnis verarbeiten wird und ob er das überhaupt kann. Das Gesehene erklären, das möchte ich nicht, man könnte ein starkes Erlebnis zerreden. Aber sprechen sollte man doch darüber.
Wir fahren an der alten Kirche vorüber, deren Turm noch geborsten ist, seit dem letzten Kriege noch, und dann sehen wir rechter Hand das Panorama der Stadt, die Skyline, wie man neudeutsch sagt, sehen den uralten Dom und linker Hand auf der weiten Ebene die bläulichen Nebelschwaden.
Sieh’, wie der Nebel tanzt, wie er sich dreht, sind das nicht Figuren, Märchenfiguren? Aber der Junge schließt die Augen, als wollte er zeigen, dass er mit seiner kleinen großen Trauer in Ruhe gelassen werden wolle. So denke ich, aber ich weiß auch, dass der Junge nicht so denken muss.
Zu Hause angekommen, helfe ich ihm, sich abzuschnallen und berühre ihn dabei behutsam, weil ich ihn am liebsten in die Arme nehmen möchte. Ich tue es nicht, weil ich fühle, dass er sich sperren könnte, und frage: „Wollen wir noch zum Fluss gehen? Vielleicht wartet Boris auf dich.“
Boris ist ein seidiger, lebhafter Dackel. Der Junge und der Dackel mögen sich, sie können nicht lange genug toben. Aber heute gibt der Junge vor, müde zu sein. Das hat es noch nie gegeben, darum denke ich, dass ihm die lote Katze nicht aus dem Sinn geht.
Wir essen, dann dusche ich ihn, und beim Abtrocknen sagt er: „Eigentlich war das ein sehr schönes Tier.“
Ich bestätige seine Worte, also ist er noch nicht über den Tod hinweg, und darum sage ich, dass sich Katzen normalerweise bei einem Sturz zusammenrollen können.
Der Junge schüttelt den Kopf, als wüsste er gar nicht, was denn ‘normalerweise’ heißen soll, und er hätte recht mit seiner Meinung über diesen Erwachsenen, der einen solchen Satz sagt, nachdem alles vorbei ist. Und dann sagt er: „Es war ja kein Sturz, und dann hatte meine Katze dazu keine Zeit mehr.“
Es wird ein langes Gespräch vor dem Schlafengehen geben. Hoffentlich finde ich die richtigen Worte, er soll nicht so traurig einschlafen.
Ich bringe ihn zu Bett, und er macht sich ganz schmal und klopft mit der Hand auf die freie Seite. Leg dich hin, leg dich zu mir, heißt das. Die Geste kenne ich, dann hat er immer Fragen.
Ich lege mich zu ihm und hole tief Luft, mache mal einem Kind klar, wie ein Tier stirbt, warum Lebewesen überhaupt sterben, der Mensch, alle Menschen, er ist doch erst sieben Jahre alt und hat das erste Mal den Tod erlebt.
Alles kommt anders.
Er lächelt mich strahlend an, tippt auf meine Nase und fragt: „Also, was ich dich schon immer mal fragen wollte ...“
„Frage, mein Junge, frag’ nur.“
„Ich wollte dich schon immer mal fragen, also, woher kennen wir beide uns eigentlich?“
1990
Lamyz
Hör’ mir zu, Cilly, du gefällst mir. Ehrenwort. Mir gefallen deine festen, langen Beine, dein schlanker Hals, der so weiß leuchtet, und manchmal dachte ich schon, wenn du tief einatmest, sprengten deine Brüste das enge Mieder, dass die Knöpfe abfallen würden.Und überhaupt, wenn ich dich sehe, nehme ich auch einen Duft wahr. Warum hast du keinen Freund? Wollen wir zusammengehen? Entschuldige, aber das nennt man so. Ich bin stolz auf dich. Wollen wir ins Kino gehen?
Diese Ansprache an Cilly habe ich mir zurechtgelegt. Jeden Tag änderte ich sie, sagte sie mir vor, dachte mir dazu aus, wie sie reagieren, was sie antworten könnte, ja, ob sie überhaupt antworten würde. Ich blieb feige.
Täglich sah ich sie nicht, weil sie in eine andere Schule ging und in einem anderen Stadtteil wohnte, dem altersgrauen Wendelitz, wo die Türme und Mauern noch aus Muschelkalk waren. Natürlich wusste ich, was sie mochte, Schwimmen und Paddeln zum Beispiel, ich kannte ihre Freundinnen und wusste, wo sie wohnte, in der Apotheke, die ihrem Vater gehörte.
Wenn sie mir begegnete, wurden mir die Innenflächen meiner Hände feucht. Nun kannst du ihr nicht mal die Hand geben, dachte ich und hatte wieder einen Grund gefunden, sie nicht ansprechen zu müssen. Cilly trug weiße Kniestrümpfe, die nur bis zu den Waden reichten, enge Blusen und die Haare lang. Cilly. Cilly Heinrichs.
So sah ich sie aus dem Kino kommen, in das ich sie eigentlich hatte einladen wollen. ‘Immensee’ war gespielt worden. Cilly ging vor mir, ich sah auf ihren weißen Hals und das leuchtende Haar. Von hinten konnte ich nicht kommen, sie überholen, vor ihr stehen bleiben und sagen, hör mir zu, Cilly, du gefällst mir. Im Kino hatten sie ganz andere Worte gefunden.
Manchmal lächelte sie mich an. Man hatte ihr von mir und meiner Schwärmerei erzählt. Ich lächelte zurück und tat so, als hätte ich eine sehr eilige Besorgung.
Aber dann begann ich, sie zu grüßen, und sie grüßte zurück und blickte mich lange an. Länger, als ich sie ansehen konnte. Diesen langen Blick musste ich nun aushalten, und genau das gelang mir nicht. Ich sagte mir: Erst wenn du den Blick aushalten kannst, darfst du sie ansprechen. In der Klasse spotteten sie schon, und auch ihre Freundinnen schienen um meine Wünsche zu wissen. Wie nur spricht man ein Mädchen an?
Der Zufall sollte mir zu Hilfe kommen. Oder war es nicht der Zufall. Ist das, was wir Zufall nennen, also das, was uns in den Schoß fällt, einfach endlich reif?
Fremde kamen in die Stadt. Sie stammten aus dem Rheinland und wurden Evakuierte genannt. Fast jede Familie bekam Einquartierung. Güterzüge trafen ein und brachten die vorausgeschickte Habe der Evakuierten, die noch kommen sollten. Die Züge mussten schnell entladen werden, sie wurden für den Transport von Waffen gebraucht. Die Habe wurde aufbewahrt. Dazu brauchte man uns, die Mädchen und Jungen aus den oberen Klassen, die Fünfzehn-und Sechzehnjährigen. Höhere Klassen gab es nicht mehr, die waren schon an den Fronten.
Also wurden Sack und Pack in der größten Turnhalle, die im Stadtpark lag, aufbewahrt, dem Alphabet der Familiennamen nach zusammengestellt und gestapelt, sodass man alles leicht finden konnte: Koffer, Schränke, Truhen und verpackte Kronleuchter, Bücherkisten und Bronzefiguren.
Wir bekamen die letzten Stunden schulfrei und mussten nachmittags nicht zum Dienst auf dem Feuerwehrplatz, um Runde für Runde zu marschieren, zu singen, zu hüpfen oder die Teile eines Karabiners auswendig zu lernen. Keine Zeit für diesen Dienst. Ich musste nicht meiner Jungenschaft, den zwölfjährigen Knaben, beibringen, wie man sich nach Kommando auf dem rechten oder linken Hacken zu drehen hatte.
Zu dieser Zeit näherten sich russische Truppen der Oder.
Es war kalt, und die Sirenen heulten täglich. Voralarm, Vollalarm, Entwarnung, Voralarm. Tag wie Nacht. In den Kellern hatten sich die Alten, Frauen und Kinder eingerichtet. Aber einen Voralarm nahmen nur noch die Ängstlichsten ernst. In den Kellern lebte man auf Tuchfühlung, den Kindern gefiel das.
In der Turnhalle traf ich Cilly wieder. Ich mag Turnhallen heute noch nicht. Dieser Geruch: eine Mischung von Schweiß, gerissenem Leder, Urin, beißenden Putzmitteln und tanzenden Staubflocken. Und diese auf mich bedrohlich wirkenden Geräte, die bulligen Pferde und Böcke, die sich einem in den Leib rammen konnten, die sperrigen Barren, die aalglatten Holzstangen, die immer höher wuchsen, wenn ich an ihnen hing, die schweren Medizinbälle, die mich zu Boden rissen, die harten Sprossenwände und das Reck erst, an dem mich der Turnlehrer in den Felgaufschwung knuffte.
In der Halle stapelten wir die Habe der Evakuierten, vorläufig konnte hier kein Sportunterricht stattfinden.
Wir holten die Sachen vom Bahnhof ab, brachten sie in die Halle und ordneten das viele Gepäck der Familien und bildeten dabei, der besseren Übersicht wegen, aus den Sachen Straßen, Winkel und Karrees. Da sah ich Cilly. Sie trug eine schwere Last und bewegte sich darunter so aufrecht wie auf der Straße, trug ihre weißen Kniestrümpfe, obwohl schon Frost war, und einen schwingenden Rock. Die meisten der anderen Mädchen hatten beulige Trainingshosen an. Das Haar hatte Cilly zu einem Zopf gebunden, die obersten Knöpfe ihrer strammen Weste waren geöffnet, das bemerkten leider die anderen Jungen auch und pfiffen ihr nach.
Es war schön, zu sehen, wie leicht sie sich bewegte, fast tänzerisch, dabei war die Last schwer, die sie trug. Aber vielleicht wurde die Last leichter, da sie von einem so schönen Mädchen getragen wurde.
„Du bist auch hier“, sagte ich endlich, als wir einander in einer der Gassen begegneten. Die Turnhalle hatte ihren Schrecken verloren, und ich hatte den ersten Satz gesprochen, einen wenig originellen Satz, zugegeben, aber immerhin, ich hatte es gewagt.
Cilly sah mich an und schlug wieder nicht die Augen nieder. Was hatte sie auch für einen Blick. Es soll Tiere geben, die mit Blicken ihre Opfer bannen können. Ich versuchte vergeblich, ihren Blick auszuhalten. Dabei strich sie mit langsamen Bewegungen ihren Rock glatt und betonte dabei ihre Schenkel. Der Rock wäre nach dem Geschmack meiner Mutter zu kurz gewesen, aber mir gefiel er, denn Cilly hatte lange, gut geformte Beine. Auch der Rock saß stramm. Sie war zu schön für mich. Dieses Mädchen konnte an mir keinen Gefallen finden, schlag’ sie dir aus dem Kopf. Aber wie denn nur.
Cilly war viel schöner als diese Elisabeth aus ‘Immensee’, die war zu elfenhaft und wenig körperlich.
„Es wird bald dunkel“, sagte sie, „ich gehe nicht gern allein durch den Stadtwald. Hast du schon einmal von den Edelweißpiraten gehört?“