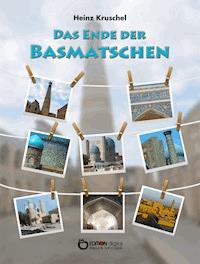8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Renate Jago ist eine erfolgreiche junge Frau: Sie hat ihr Journalistikstudium abgeschlossen, in der Redaktion bieten sich ihr alle Aufstiegschancen, die sie unbekümmert nutzt. Sie lebt mit der kleinen Tochter Suse allein — nicht mit Suses Vater, dem verheirateten Riska, nicht mit dem Bildhauer Friedrich Perr, den sie einmal liebte. Sie will auf eigenen Füßen stehen, sie will ihre Ziele erreichen, ohne kräftezehrende Bindungen. Da geschieht etwas, das ihr ganzes bisheriges Leben verändert, alle Zukunftspläne in Frage stellt: Suse verunglückt tödlich. Wie soll Renate nun weiterleben? Wie sollen sich die anderen gegenüber dem maßlosen Leid verhalten? Taugt Arbeit als Therapie? Oder wäre ein Kind von Riska eine Lösung? Heinz Kruschel erzählt vom schwierigen Weg Renates aus der Isolation hin zu einem Leben — nicht allein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum
Heinz Kruschel
Leben. Nicht allein
Roman
ISBN 978-3-95655-132-1 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1982 im Mitteldeutschen Verlag Halle-Leipzig.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2017 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Teil 1
Die wahre Tapferkeit besteht darin, dass man ohne Zeugen tut, was man vor den Augen der ganzen Welt zu tun imstande wäre
La Rochefoucauld
1.
Vera Severin erschrak doch, als die junge Frau den Sekretär nicht weiterreden ließ. Denn nach dem Programm, das durchgesprochen und beschlossen worden war, hätte er weiterreden müssen.
Aber Renate Jago sprach, unter dem beifälligen Gemurmel der Erwachsenen, selber weiter, und zwar frei. Es war so, als habe sie diesen Sekretär, ihren Vorgesetzten doch, schon abgelöst von seiner Funktion, als habe sie über ihn das Urteil gesprochen: Du bist fehl auf deinem Platze.
An dem Tage lernte Vera Severin, Journalistin und verantwortlich für die Unterhaltungsbeilage der Tageszeitung dieser Gegend zwischen dem Mittelgebirgsrand und den Flüssen, die der Elbe zuflossen, Renate Jago kennen. Die Jago war eine Frau von zwanzig Jahren. Schwarze Haare, offen auf schmalen Schultern liegend, von fester, kleiner Gestalt. Sie rauchte stark und sprach schnell. Für Vera war sie irgendeine Mitarbeiterin in irgendeinem Bereich der Leitung des Jugendverbandes.
Renate Jago stand hinter dem Sekretär, einem dicken jungen Mann, der eine rote Mappe unter dem Arm hielt und sehr aufgeregt war.
Klasse um Klasse marschierte auf. Wimpel und Fahnen flatterten in dem frischen Wind, der von der Elbe her über die Wiesen wehte. Die Kinder waren aufgeregt. Sie hatten das Aufmarschieren geübt, den Ablauf des Appells, sie hatten sich die Kommandos eingeprägt. Alles war oft geprobt worden, und dennoch waren sie neugierig geblieben. Neugierig auf die Ehrengäste. Zum Beispiel auf die alte Frau, die mit dem Manne zusammengelebt hatte, dessen Namen ihre Schule tragen sollte. Neugierig auf den roten Sergeanten, der den Mann einmal befreit hatte, vor vierzig Jahren.
Der Gedenkstein noch verhüllt, auch die Schrift an der Stirnseite der Schule. Trommeln und Lautsprecher übertönten das Hundegebell im Dorf. Die Musiklehrerin dirigierte mit ausholenden Armbewegungen einen kleinen Chor. Aber das Lied flog schnell hinweg in den Wind. Es war viel zu dünn, um den weiten Platz zu füllen.
Vera Severin sah die Gesichter der Kinder: so erwartungsvoll. Diese großen Augen, so ernst. Diese schönen, offenen Gesichter, hoffentlich werden sie nicht enttäuscht.
Für die Kleinen aus den ersten und zweiten Klassen hatte man Bänke hingestellt. Vera wusste, dass sie sich erst dagegen gewehrt hatten. Sie wollten wie die Großen stehen, auch wenn es Stunden und Stunden dauern sollte. Nun saßen sie aufgereiht, die Knie aneinandergepresst. Das Lied konnten sie nicht verstehen, dennoch blieb in ihnen die Vorfreude wie eine Brücke in Unbekanntes.
Vera Severin stand in der zweiten Reihe, hinter der alten Frau, die ihren hellen Mantel offen trug, und hörte, wie sie den Direktor leise fragte: „Können denn nicht alle Kinder gemeinsam ein Lied singen? Früher, da ...“ Mehr konnte sie nicht verstehen, weil aus den Lautsprechern Lieder und Märsche dröhnten. Die alte Frau schüttelte den Kopf. Ihr dünnes, weißes Haar bewegte sich im Wind wie zartes Geseide.
Oder die Hymne, dachte Vera Severin, seit Jahren singen wir unsere Hymne nicht mehr, weil der Text nicht mehr zeitgemäß ist, weil zwei Staaten mit ganz unterschiedlichen Systemen auf deutschem Boden existieren, weil der Staat des Gestern das Deutschland-einig-Vaterland deuten würde zu seinen Gunsten, ummünzen zu seinen Forderungen, dienlich machen seinen Zielen, die Geschichte zurückzudrehen. Aber unser Land, dachte Vera, hat doch seine Dichter, es hätte einen neuen Text geben können, eine Hymne muss man singen, so aber stehen unsere Sportler als Sieger stumm auf den Podesten, wenn AUFERSTANDEN AUS RUINEN UND DER ZUKUNFT ZUGEWANDT ertönt, und halten die Lippen geschlossen.
Die Begrüßung durch mehrere Redner. Auch die alte Frau sagte wenige Worte. Eine erste Amsel sang dazu im Gesträuch des gelben Ginsters. Die alte Frau sprach ohne einen Zettel in der Hand. Sie trat einen kleinen Schritt vor, sie sprach, stark berlinernd, erregt auch, stockend. Es war fast vierzig Jahre her, seit der Mann in einem fensterlosen, auszementierten Raum guillotiniert worden war. Sie hatte ihn als Vierzigjährigen in Erinnerung. Kann sie sich vorstellen, wie er heute aussähe, weißhaarig vielleicht, sich auf den Stock stützend. Er hatte immer volles, schwarzes Haar und war ein trainierter Sportler, kann sie sich vorstellen, wie er aussehen würde, lebte er noch?
Die alte Frau sprach nicht lange, aber eindringlich. „In mir lebt noch viel Schmerz. Er rührt sich heute wieder, und ich glaubte schon, er wäre für immer versteinert. Aber es ist gut, dass sich der Schmerz rührt, hier, bei euch. Diese Schule wird seinen Namen tragen. Ihr werdet erfahren, wie er lebte, wie er kämpfte und auch, wie er starb. Entschuldigt, dass ich euch das nicht selber erzähle, ich ... Ich kann das nicht.“
Nicht jedes Wort konnte Vera verstehen, so laut sprach die kleine alte Frau nicht. Ein Mädchen weinte und ließ ihre Tränen laufen. Vera schluckte. Sie zwang sich, einen großen Jungen anzusehen, der die Fahne, die er trug, höher nahm, ohne dazu aufgefordert worden zu sein. Andere Jungen stießen sich untereinander an. Vielleicht dachten sie: Ausgerechnet der Lange, was ist in ihn gefahren, will er gesehen werden von der Alten oder vom Direktor?
Der Große sah so aus, als gehörte er zu denen, die abends mit ihren Mopeds die Dorfstraßen und den stillen Anger unsicher machten. Vera dachte: An dieser Stelle hätte mein kluger Frank gesagt, dass jedes Erlebnis, das ein Mensch hat, irgendwie dispositionsbildend wirken kann. So trocken kann der das sagen: Was dieser Junge tut, kann schon der Ansatz zu einer künftigen Haltung sein.
Ein anderer stieß den Großen von hinten in den Rücken. Ganz langsam senkte er die Fahne wieder.
Ruhe. Nur die Jago flüsterte mit dem Sekretär und strich das lange Haar aus ihrem Gesicht, sie hatte schönes, schwarzes Haar. Vera Severin verstand nicht, wie man nach solchen Worten flüstern konnte.
Die alte Frau verneigte sich vor dem noch immer verhüllten Gedenkstein und trat rasch in die Reihe zurück. Sie schwankte, wenig nur. Vera bemerkte es und legte ihre Hand auf die dünne Schulter der Frau, die sich nicht umdrehte, sondern mit ihren kühlen Greisenfingern Veras Hand suchte und die Finger verschränkte. Eine stumme Geste. Sie verstanden sich. So stehen, das kann stark machen und Kraft geben und das Gefühl, nicht allein zu sein.
Vera dachte an die Alten, von denen nun nicht mehr viele lebten: Was verdanken wir ihnen alles, was haben sie alles der Idee geopfert, ihrer Sache, unserer Sache. Das Leben, das kann man doch so groß sagen, ihre Freiheit, ihre Gesundheit. Sie haben gekämpft, sie waren entmutigt, sie sind wieder angetreten unter hundert Losungen. Für Brot, gegen Arbeitslosigkeit, gegen den Krieg, gegen die Nazis, für Wiederaufbau, für Vereinigung der Arbeiterparteien. Sie waren wachsam und trauten doch oft falschen Leuten. Sie mussten Freund und Feind erkennen, wenn er sich tarnte. Sich verteidigen auch dann, wenn sie müde und alt und krank waren. Gehorchen, sich der Disziplin fügen und sich wehren. Das Wort Kampf ein Synonym für Atem. Das Wort Ruhe unbekannt. Immer für einen Staat, einen idealen, in dem Frieden, Arbeit, Fortschritt, ja, natürlich, aber sind sie zufrieden? Enttäuschen dürfen wir sie nicht. Oder sind sie es schon? Davon, dass man sich diesem Idealbild, dieser Wirgemeinschaft nur anzunähern vermag? Sind sie von uns oder von diesen Kindern da enttäuscht? Denken sie an Traum und Ziel und an das, was da klafft und sie schmerzen muss?
Vera Severin hielt sich gern in dieser braunvioletten Landschaft auf. Hier welkte die Luft zu keiner Jahreszeit. Man konnte kilometerweit sehen, bis zu den Weiden im weichen Grün, die einen krummen Buckel machten. Bis zu den Herden von dicken Kühen, die sich mühsam trugen. Hier konnte man den Fluss ahnen, der im Zittern des Windes war und der hundert Tümpel und Wasserläufe geschaffen hatte, ornamentengleich. Lilafarben stieg der Nebel empor. Hier ging die Sonne unbedrängt auf und musste ihre Macht nicht wie in den Bergen durchsetzen. Sie zeigte, wie sauber die roten und blauen Fahnen, wie blank die Fenster der Schule, wie ordentlich die Blumenbeete, wie frisch die Gesichter der Kinder waren. In diesem Moment, da ihre Strahlen auf Gedenkstein und auf die Stirnseite des Gebäudes trafen, hätte man die Tücher herunterreißen müssen.
Aber nun sprach der Sekretär im Aufträge des Jugendverbandes.
Als er die ersten Sätze ablas, schlug die alte Frau die Hand vor den Mund, und Vera Severin meinte, sich zu verhören. Andere mochten glauben, der Sekretär habe ein falsches Manuskript aus der brandroten Mappe herausgeholt, und wieder andere Ehrengäste besahen sich die geduckten Gehöfte im saftigen Land neben der Schule und die Mühle mit den zerbrochenen Flügeln.
Seine ersten Sätze handelten von einem jüngsten Beschluss, der in allen Zeitungen abgedruckt war, von der notwendig gewordenen Verbesserung massenpolitischer Arbeit, von Direktiven und von solchen Begriffen, die den kleinen Kindern völlig unbekannt waren und den größeren zu dem einen Ohr hinein und zu anderen hinausfliegen mussten, wenn sie überhaupt aufgenommen wurden.
Die alte, kleine Frau wandte sich halb um und sagte zu Vera Severin: „Nein, wie er das macht, das ist doch fatal, er ist so jung und spricht so, nein, sag doch, so hätte früher bei uns keiner reden dürfen. Er ist Jugendfunktionär. Sieht er denn nicht, wie die Kinder reagieren?“
Vera verstand ihre Bestürzung. Sie hatte in ihrer Jugend an den Treffen in Berlin teilgenommen, gemeinsam mit Mädchen und Jungen aus aller Welt. Sie hatte vor zwanzig Jahren auch vor Kindern gesprochen, aber doch nicht mit dieser gleichmütigen Routine. Sie legte ihren Arm um die Frau und blickte zu dem Redner hinüber. Der drückte mit der linken Hand das Manuskript der Rede fest gegen die Platte des Pults und fuhr mit seinem dicken Zeigefinger Satz für Satz nach. Er las ab und blickte nicht auf.
Unruhe kam auf. Die Lehrer gingen die Reihen ab und sahen mahnend ihre Klassen an. Ruhe im Glied, haltet Disziplin. Was sie selber dachten und empfanden, das merkte ihnen keiner an.
Vielen Kindern aber würde dieser Tag in Erinnerung bleiben, der Mann mit seiner Rede. Sie würden den Tag ablaufen lassen können wie einen Film. Da hatte einer zerredet, hatte kleingeredet, was groß war.
Der Sekretär hatte an die zehn mit der Maschine beschriebene Seiten vor sich auf dem Pult. Der Wind zog, und die kleinen Kinder auf den Bänken trugen weiße Kniestrümpfe. Nur ein Mädchen trug dunkelrote Söckchen und verschränkte darum die Füße unter der Bank. Das wirkte rührend. Die Durchbrechung des Genormten und Uniformen bewegt immer, dachte Vera.
Der Sekretär musste wohl, in einer Windpause, in der die Rauchsäule über der nahen Ziegelei nicht mehr flatterte, die Hand von der Rede genommen haben, wohl meinend, dass er einmal aufsehen, die Wirkung seiner Worte prüfen oder das Taschentuch nehmen und sich die Nase schnäuzen konnte, jedenfalls gerade da fegte ein heftiger, kurzer Windstoß über den Platz und die dünnen Blätter seiner Rede hinweg: zu den Pappeln am Rande des Schulhofs, in die Ginsterhecke hinter dem Fahnenmast und in einen Holunderbusch.
Lachen flatterte auf wie übermütiger Elsternruf.
Der Sekretär blieb ohne sichtbare Bewegung hinter dem Pult stehen und sah zu, wie einige Jungen aus der Zehnten, von dem Direktor mit Handbewegung beauftragt, den Blättern nachliefen. Man merkte ihnen den Spaß an, sie nicht gleich einfangen zu können, sie in der Luft zu haschen und zu verlieren und sich gegenseitig zu behindern.
Dieses Lachen. Nun schmunzelten auch die Ehrengäste. Nun kicherten auch die ernsthaften Schülerinnen aus den oberen Klassen.
Die Lehrer gingen zu den Reihen ihrer Schüler, schritten die Front ab und zischelten. Direktor und Pionierleiter holten die Jungen aus der Zehnten zurück.
Vera Severin kannte den Sekretär nicht, aber sie ahnte, dass er nicht frei weiterreden könnte. Er war seines wichtigsten Hilfsmittels beraubt, ein Zauberer ohne Utensilien; es war, als flögen Verstand und Wissen mit davon.
Die alte, kleine Frau bebte in den Schultern und schob Veras Hand weg. Sie wollte nach vorn gehen. Sie wollte sagen: Sprich endlich weiter, du. Du machst dich lächerlich, das ist deine Sache. Aber du machst auch ihn lächerlich, ihn, dessen Namen die Schule tragen soll. Und das ist auch meine Sache, das ist unsere Sache doch. Er, den ihr ehren solltet mit guten Worten, er hatte immer die rechten Worte gefunden, er hatte die Zeitungen aufgeschlagen und gelesen, wenn in einer Schulung einer ablas, was man in der ROTEN FAHNE tags zuvor hatte lesen können.
Die Lehrer stellten die Ruhe her.
Nun dehnte Schweigen den Platz zwischen den lebendigen Seiten des großen Vierecks.
In diesem Augenblick geschah etwas Unerwartetes. Die Jago, die zierliche Renate Jago ging dicht an die Kinder heran, Mikrofon und Pult nicht achtend, blieb nur einen Meter vor der ersten Reihe stehen und rief mit heller Stimme: „Ich will euch nun erzählen, wie er so war, als Junge. Er hat nämlich auch Streiche gemacht, er wurde wütend, wenn er im Spiel verlor. Und er hat gerne gelesen, am liebsten Tiergeschichten und solche Märchen, in denen Hexen und Prinzessinnen vorkamen, und Romane über solche Ritter, die von den Hansabrüdern bekämpft wurden. Und wenn er die Angabe hatte beim Volleyball, dann schmetterte er ihn so übers Netz, dass der Gegenspieler bereits beim Versuch, ihn zu parieren, hinflog, er hatte nämlich sehr große Hände, richtige Schaufeln, und konnte die besten Angaben machen. Und manchmal, da hat er selber Geschichten geschrieben, einmal fand der Mathematiklehrer eine im Heft, das er kontrollierte, und dafür bekam er eine gute Note, denn es war eine schöne Geschichte von einem Eichhörnchen, das in einer Trompete lebte ...“
Vera Severin wunderte sich, was da alles erzählt wurde, denn nichts davon war in der Rede des Sekretärs gewesen, bis die alte Frau, bei einem Satz zustimmend nickend, bei einem anderen heftig den Kopf schüttelnd, sagte: „Das stimmt, manches stimmt, aber vieles stimmt gar nicht, wo hat sie das nur her.“
Der alte Schulze, neben dem Direktor stehend, sagte: „Wenn diese Kleene nicht lagemäßig geklärt hätte, na also, geredet hätte ich schon, wo ich den Genossen damals rausgebracht, eine Schweinerei das, nicht weiterreden, wo gibt es denn so was.“ Schulze wurde der rote Sergeant genannt. Er hatte den Mann, der hier geehrt wurde, aus der Zelle befreit. Er galt weit und breit als eine legendäre Figur. Pioniere legten Mappen über sein Leben an und schrieben Aufsätze über ihn. Schulen luden ihn ein, vor den achten Klassen zu sprechen, und nahmen hin, dass er während der Veranstaltung seine starken Zigarren rauchte.
Der Sekretär stand noch immer hinter dem leeren Pult.
Nun brachten die einzelnen Boten die Blätter zu dem Redner zurück, der sie ordnete, mit dem stummligen Zeigefinger die Reihen entlangfuhr, bis er jene Reihe fand, auf der er geendet hatte. Dann erst sah er auf und sagte: „Renate, Renate.“ Und viel schärfer: „Genossin Jago.“
Es sollte leise klingen und nicht von allen gehört werden, aber die Anlage war nicht ausgeschaltet worden. Die Schüler der älteren Klassen fiel ein schnelles Lachen an, das die Mädchen mit den Händen verdeckten.
Renate Jago drehte sich nur halb um und sah kühl zu ihm herüber und sagte: „Ach, lass mich nur machen.“
Vera Severin wusste nicht, was zwischen den beiden vorging. Dass etwas vorging, dass die Szene nicht nur komisch war und zum Lachen reizte, das begriff sie, aber nicht diese abrupte Weigerung der Jago.
Wenn Vera damit gerechnet hatte, dass sich der dicke Sekretär wehrte, beiseite gestellt und einfach abgetan zu werden, so sah sie sich enttäuscht. Während Renate Jago weitersprach, von den Reaktionen der Schüler bestärkt, auch von den zuhörenden Erwachsenen, während sie Anekdoten erzählte, tat der Sekretär die Blätter seiner Rede in die kunstlederne rote Mappe und sagte entschuldigend zum Direktor: „Aber die Rede ist vom Sekretariat bestätigt worden, man kann das doch nicht aus dem Handgelenk machen.“
Der Direktor sah an ihm vorbei auf die wehenden Haare der Jago. Die ging auf einen Jungen zu. „Genau, so ähnlich wie du, so ähnlich wie du muss er ausgesehen haben, so groß war er und so blass auch.“ Während sie ihr lauschten, klemmte der Sekretär seine Mappe unter den Arm, ging langsam zur Seite auf dem geharkten, unkrautfreien Weg, als fürchtete er, noch einmal aufzufallen.
Vera Severin sah ihm nach. Sie glaubte, der einzige Mensch zu sein, der ihm nachsah, wie er langsam in das Schulgebäude ging. Sie sah seinen Rücken. Er ging gegen den Wind und strengte sich an, gerade zu gehen. Die Sonne überm Fluss war Bernstein in blauer Fassung. Die Erde wurde warm.
Er tut mir wohl noch leid, dachte sie, er hat sich unmöglich verhalten, er muss mir nicht leid tun. Sie sah nur seinen Rücken, den gepolsterten Rücken eines fettsüchtigen jungen Mannes. Sie bemerkte die Anstrengung, mit der er sich aufrecht hielt, und dachte für sich: Er ist traurig, er wird sich doch nichts antun.
Es hat ihm noch ein Mensch nachgesehen, kurz, mit einem raschen Seitenblick: die Jago. Jedenfalls schien es Vera so, als hätte sie einen raschen spöttischen Blick bemerkt. Mit Recht, zu Unrecht, jedenfalls ging da einer weg, weil er versagt hatte. Da fiel einer, nicht ehrenvoll. Da fiel einer schmählich, und ein anderer sprang für ihn ein.
Aber in dem raschen spöttischen Blick lag wohl auch Selbstgefälligkeit: du bist zwar mein Vorgesetzter, und ich bin gar nicht befugt, eine Rede zu halten, aber ich kann es besser als du. Und ich werde nicht zulassen, dass du noch einmal versagst, schon der alten Genossin wegen werde ich das nicht zulassen, du bist ein mieser Vorgesetzter, du bist ein schlechter Sekretär, und das haben sie heute alle gesehen.
Vera Severin ging dem Sekretär nach. Natürlich bemerkte es Renate. Natürlich bemerkten es auch die anderen, aber die meisten taten so, als sahen sie es nicht.
Vera fand den jungen Mann im Lehrerzimmer. Er hockte nicht kraftlos auf einem Stuhl, wie sie erwartet hatte. Er weinte nicht. Er stand nicht vor dem Spiegel und sah sich zitternd sein Bild an, nein, er stand vor dem aufgebauten kalten Büfett, ein Brötchen essend, das mit fetter Bauernwurst belegt war, und ein Bier aus der Flasche trinkend. Er öffnete noch eine Flasche, als Vera Severin in den Raum kam, und schob sie ihr zu. Vera schüttelte den Kopf. Sie verstand das nicht. Dann entsann sie sich der Artikel, die sie in jedem Jahre wieder in der Beilage abdruckten. Dass es Menschen gibt, die aus Kummer dick werden, die sich von ihren Sorgen und unbewältigten Konflikten wegessen wollen. Sie war ihm nachgegangen, um mit ihm zu sprechen, um ihn zu trösten: ein Wort unter Genossen. Wie sollte sie einen Menschen trösten, der mit vollem Munde kaute, der Bier trank, während draußen eine Fanfare das Motiv UNSTERBLICHE OPFER blies und Blumen und Kränze niedergelegt wurden? Es fehlte nur noch, dass er sich nach dem Bier müde in einen kurzen Schlaf legte.
Sie wollte gehen, da sagte er: „Bitte, Genossin Severin, ich lese immer gerne, was du in der Zeitung schreibst, es hebt sich von anderem ab. Bitte, bleib noch, mein Herz, weißt du, einmal erwischt es mich noch total, es soll nur nicht auf der Straße geschehen, vor allen Leuten.“
Er zerbiss ein paar grüne Kapseln, spuckte die Hülsen in die hohle Hand und sagte: „Wie das die Jago macht, was, sie wird noch studieren und dann groß rauskommen, die hat Zukunft, das ist uns allen klar, ein wichtiger Kader wird das mal, sage ich dir, vorgesehen ist sie dafür.“
„Sie macht es besser als du“, sagte Vera Severin. Sie wusste nicht, wie der Sekretär hieß, und wollte nicht danach fragen.
„Ja, ich kann das nicht, ich kann eben nicht frei reden, ich habe Angst, frei zu reden, weißt du, ich fühle mich hinter einem Schreibtisch am wohlsten.“
„Du arbeitest immerhin im Jugendverband und hauptamtlich dazu.“
„Du meinst, dass ich da fehl am Platz bin?“
„Ich kann das nicht beurteilen, ich will es nicht und muss es nicht. Geht es darum, ob man frei reden kann oder nicht? Nein. Ich weiß nur, dass man solche Reden nicht vor Kindern halten darf.“
„Aber die Rede, die wurde bestätigt.“
Es klang treuherzig, wie er das sagte. Und Vera Severin hörte genau hin. Sie ließ sich nicht so leicht täuschen, doch nicht von so einem, der sich herausredete, der unausgesprochen mit dieser Bemerkung verkündete: Ich hätte ja sehr gerne, aber die Umstände sind gegen mich, wir müssen wohl nicht darüber sprechen, du lebst wie in einer Mühle. Nein, solche Entschuldigungen waren Vera Severin zu fadenscheinig. Darum sagte sie: „Wenn das so sein sollte, dann musst du eben eine bessere Rede ausarbeiten, schließlich bist du Sekretär.“
Die Unruhe sprang in ihre Finger, die nervös auf den Tisch trommelten, sie sprang in ihre Stirn, dass sie wieder die stechenden Schmerzen verspürte, wie immer, wenn sie verschwieg, was eigentlich gesagt werden müsste. Aber manchmal muss man auch das nicht sagen, was gesagt werden müsste, man muss es sich verbeißen können, das hat sie von Frank gelernt. Frank forscht, der hat es leichter.
„Aber die Rede ist mir ausgearbeitet worden“, sagte der Sekretär.
Du gibst dich treuherzig, dachte sie, dass es schon an Dummheit grenzt. Was bist du für ein Tropf, wenn du eine Rede hältst, die dir ein anderer geschrieben hat, wenn du fremde Gedanken und Formulierungen ablesen musst, solche vielleicht, die dir selber nicht gekommen wären. Und indem du das mir weismachen willst, bist du auch noch frech und bildest dir ein, ich nähme dir alles ab.
Begänne sie nun mit ihm zu diskutieren, so sähe er bestimmt plötzlich ein, aus Saulus würde ein Paulus werden. Schweig, sagte sie sich, es hat keinen Sinn.
Er fragte Vera Severin, ob das die richtigen Worte sind, die draußen die Jago findet vor den Kindern und Gästen. „Da hören alle zu. Sie kann frei sprechen. So muss man es tun, nicht wahr, sag selbst, für diesen Anlass muss man so sprechen, ja?“
Vera Severin nickte nur. Und er nickte auch und lächelte dabei. Für dieses Lächeln hätte sie ihn am liebsten geohrfeigt. Vorbereitet, auf einen verzweifelten, traurigen, weinenden jungen Mann zu treffen, stieg in Vera der Ärger auf. Der da war nicht traurig oder verzweifelt. Der tröstete sich, indem er aß und trank. Wie konnte er alles so hinnehmen? Zeigte er etwa kein Gefühl, weil er ein junger Mann war? Vielleicht haben es die jungen Männer schwerer, ihre Gefühle zu zeigen, schwach zu sein und es zuzugeben, zu weinen, Kleinmut und Ängstlichkeit einzugestehen. Sie möchten vielleicht getröstet werden und geben es nicht zu, weil es nicht zu der Vorstellung passt, die man sich über junge Männer macht.
Wut über sich selbst, ja, wenn er doch wenigstens wütend über sich geworden wäre, aber nichts dergleichen war zu bemerken, kein sichtbares starkes Gefühl. Aber es müsste doch etwas in ihm vorgehen.
Ein freundliches Gesicht, aufgeschwemmt und nichtssagend. Nicht sympathisch, nicht unsympathisch.
Der Sekretär stand auf, ging zum Wasserhahn, feuchtete seine rechte Hand an und rieb sie auf der bloßen Brust trocken. Das Herz also, dachte Vera, sein Herz, und er ist noch so jung, und er soll junge Menschen führen. Sie ging zum Fenster und blickte hinaus über die braunviolette Landschaft, die wie eine Grafik vor ihrem Blick lag. Graue große Gräber inmitten der Feldflur, Hünengräber, vor Jahrtausenden übereinandergetürmt von Menschenhand. Ritter gegen Slawen haben hier gekämpft, das Blut hat diesen Acker gedüngt. Fürsten starben, weil sie voller Vertrauen zu einem Fest des Christenherzogs gekommen waren, sie starben wehrlos, weil sie ihre Waffen nicht mitgenommen hatten.
Dieses braune Land atmete breit. Auf eine Schilfinsel, deren Federbüsche Vera sehen konnte, landete ein Storchenpaar. Eine Lerche, noch aschgrau, da sie hier überwintert hatte, stand im Wind und sang.
Dann lärmte es draußen auf dem Schulhof. Der Sekretär seufzte auf und sagte: „Nun hat die Schule einen Namen, diese Schule hat ihn verdient, keine Sitzenbleiber in den letzten drei Jahren, und das will etwas heißen ...“
Vera sah ihn an, aber er meinte es wirklich anerkennend, nicht spöttisch oder hintergründig. Darum winkte sie ab, als wollte sie sagen, ob es nicht andere, wichtigere Maßstäbe gäbe.
Die Ehrengäste kamen in den Raum, allen voran die alte Frau, von Renate Jago geleitet. Dahinter der rote Sergeant, der Bürgermeister, der Direktor und die Abgesandten der Betriebe und Organisationen. Der Sekretär drückte sich an ihnen vorbei, er wollte nicht im Raum bleiben, murmelte eine Entschuldigung und bemühte sich, keinen anzusehen. Er wirkte wie ein runder, unbeholfener Vogel, dessen Gefieder verklebt war, wie eine aus einer Regentonne gefischte junge Amsel.
„Unmöglich das, zu meiner Zeit“, sagte der rote Sergeant Schulze, „unmöglich das, auch heute noch, schon rein funktionärsmäßig betrachtet.“
Natürlich Schulze, der konnte reden, der trat vor den Schulklassen auf, der sprach auf Begräbnissen, der konnte erzählen, wenn er dabei nur seine Zigarre rauchen konnte. So manchem Fahrer der Redaktion hatte er schon ein Loch in die Polster gebrannt, wenn er mit seiner Zigarre auf der Rückfahrt von einer Veranstaltung eingenickt war. Schulze liebte einen guten Tropfen und eine gute Zigarre. Er war bis vor fünf Jahren Kaderleiter in der Redaktion gewesen. Ein lächelnder Mann mit großen Händen, der jedes von seinem Gesprächspartner gesagte Wort zu gegebener Zeit präsentieren konnte, wenn der andere es schon längst vergessen hatte. Wurde er aber kritisiert, so konnte er rabiat werden.
Vera Severin hatte ihre Erfahrungen mit ihm. Als sie vor zwanzig Jahren eingestellt wurde, hatte er sie auf der Versammlung aller Redakteure gefragt: „Und stimmt es wirklich, Genossin Severin, dass Ihr Vater Mitglied der Nazipartei war?“
Es stimmte, und Vera hatte es zu erklären versucht, die lange Arbeitslosigkeit, die Chance der kleinen Bürger, die Versprechungen, natürlich der Irrtum, natürlich glaubend mit vielen anderen Deutschen, dass der „nationale Sozialismus sich einspannt in dieses Erdteils alte Geschichte“, aber gelähmt hatte er sie mit dieser Frage. Und das hatte sich noch einige Male wiederholt, bis die graue Aktion anlief. Als aus irgendeinem Grunde die Aktion gegen graue und schwarze Schalen, Vasen und Krüge zu Beginn der sechziger Jahre gestartet werden sollte, weil diese Töne nicht zu unserer Zeit passten, protestierte Vera Severin in der Versammlung und nannte die Kampagne Unsinn und Bilderstürmerei und fragte, ob sie nicht die Zeit verwenden sollten für Wichtigeres, das die Leser besorgt, unzufrieden und unruhig machte, da hatte der rote Schulze diese Frage wiederholt: Es stimmt doch, oder irre ich mich, dass dein Vater, nicht wahr ...
Ja, es stimmte, und erst da hatte sie den Mut gefasst, öffentlich zu sagen: „Ja, Genosse Schulze, und stell dir vor, obwohl ich schon fünf Jahre alt war, konnte ich meinen Vater nicht davon abhalten. Ich gebe ja zu, dass ich versagt habe.“
Lacher hatte Vera auf ihrer Seite, und Schulze hatte sich für einen kleinen Moment nicht in der Gewalt; Vera sah sein nacktes Gesicht ohne Lächeln, und dieses Gesicht erschreckte sie.
Nun war er ihr gleichgültig. Er arbeitete nicht mehr in der Redaktion, obwohl er schon über das Rentenalter hinaus weitergearbeitet hatte. Er war bei jeder Ehrung zugegen, darum trafen sie sich des Öfteren, und er kam ihr herzlich entgegen. Wie geht es, du hast wieder einen schönen Artikel geschrieben, ich habe es immer gesagt, auch dem Chefredakteur gegenüber, du bist sehr begabt, die beste Journalistin der Redaktion.
Schulze, der rote Sergeant, vereinfachte, und darum verstanden ihn viele Menschen gleich. Er trug seine Würde mit Verantwortung, wie er seine Verantwortung mit Würde trug.
Diesmal widersprach sie ihm nicht.
Die alte Frau errötete wie ein junges Mädchen, sie hatte eine zarte, weiße Haut und sagte: „Lass nur, Genosse, lass nur, es ging ja alles gut, man muss nur in die Gesichter der Kinder sehen, dann findet man die richtigen Worte, ich habe es immer so gehalten, vor solchen Blicken darf man nicht phraseln und nicht schwafeln. Du hast das gut gemacht, Genossin Jago, Renate, ich darf doch Renate sagen, könntest meine Enkelin sein und bist es ja auch, du hast nicht immer die Wahrheit gesagt, aber du hast sein Wesen damit charakterisiert, ja, und wenn die Geschichten nicht alle stimmten, er war so, oder es hätte so sein können.“
Die Lehrer nickten Renate Jago zu, und einige junge Lehrerinnen, die nicht viel älter wirkten als die Schülerinnen aus den zehnten Klassen, blickten die alte Frau an, als wäre sie herabgestiegen aus der Vergangenheit auf unseren Planeten, der sich in ebenmäßigen Runden durchs Weltall dreht, halb in Nacht getaucht und halb von der Sonne erhellt. Ein Gast aus der Vergangenheit, der ausgerechnet ihr Dorf am Ufer des Flusses, in dem noch Fische tanzten, ihr braunes Land und ihre kleine Schule für einen Besuch auserkoren hatte, um zu berichten, wie es früher war, um zu zeugen für einen Mann, über den Geschichten schon in den Lesebüchern standen, als sie selber noch in den sechsten Klassen gesessen hatten.
Auch sie, auch die jungen Lehrerinnen schüttelten ihre Köpfe über den dicken Sekretär und dachten: Das ist typisch, das ist wieder einmal typisch. Und eine, die Musiklehrerin, sagte es laut.
Da sagte die Severin, diese Redakteurin, die über den Tag, der immer schneller davonlief, zu berichten hatte: „Man sollte nie voreilig urteilen.“ Rascher Blick von Renate Jago, ein Lächeln, dann sagte sie ernst: „Für die nächste Wahlperiode kommt der nicht mehr infrage, er ist nicht fähig, schade, aber man muss einer Wahrheit ins Auge sehen können.“ Sie goss der alten Frau ein Glas Weißwein ein. „Es ging ja noch alles gut.“
„Ja, dank deiner Hilfe“, sagte der Direktor. Beifallgemurmel und Stühlerücken. In der Turnhalle nebenan, die mit Girlanden geschmückt war, feierten die Klassen. Die Vorfreude der Kinder hatte sich gelohnt, die Brücke war nun geschlagen. Überraschungen warteten auf sie, Würstchen und Lutscher und Spiele und Musik, nach der sie tanzen und singen konnten.
Vera Severin sah Renate Jago an, und keine der beiden Frauen wich den Blicken aus. Die Jago: ein glattes, junges Gesicht, die Augen so dunkel, dass Vera nicht vermuten konnte, was sie dachte. Mit ruhiger Hand der Griff nach der Zigarette.
Vermuten, sich vorstellen, was Renate Jago dachte, warum fiel Vera das so schwer?
Die Severin: größer und sportlicher, blond und herb wirkend, ein Gesicht, in dem sich lesen ließ, die Zufriedenheit, die Antipathie, das Glück und der Widerwille. Nicht alle, die mit ihr zu tun hatten, kamen mit ihr aus. Sie konnte Menschen brüskieren, bissig, wenn es sein musste, oder verhalten ironisch.
Renate Jago hatte die Journalistin beobachtet. Die Bezirksredaktion hatte eine der besten Reporterinnen geschickt, die Severin interviewte Professoren und solche Künstler, an die Journalisten schwer herankamen. Sie nahm eine Sonderstellung ein. Renate Jago dachte einfach: Ich will sie nicht reizen, warum auch, sie mag mich nicht, sie missbilligt mein Verhalten, nur Ruhe, Renate, die geht auch wieder weg.
Vera fragte sie: „Warum und woher wissen Sie denn, dass er nicht mehr infrage kommt? Sie arbeiten in seiner Abteilung, und er ist in einer gewählten Funktion.“
„Ach, das weiß jeder bei uns im Hause“, sagte die Jago, „der Mann ist absolut unfähig.“
„Unfähig? Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass er krank ist, dass er es mit dem Herzen hat.“
Renate Jago lächelte leicht. Solche Krankheit kennen wir, immer dann, wenn er versagt, schützt er diese Krankheit vor, immer dann auch, wenn es darauf ankommt.
Die alte Frau sah auf und nahm die Brille mit den dicken Gläsern ab. Die müden, schönen Augen mahnten. „Zankt euch nicht, Kinder, es ist ein wunderbarer Tag für mich, ein wunderbarer und wichtiger Tag.“
Wieder beifälliges Nicken. Der Gast aus naher Vergangenheit, auf der grünen Kruste des Planeten gelandet, verdient Respekt, wir achten und verehren ihn, er soll uns nicht im Streit erleben, er soll eine gute Meinung von uns mit zurücknehmen. Unsere Schule hat es verdient, den Namen des Mannes zu tragen.
In die Runde kam Leben. Die Bauern wurden munter beim Wein. Die Offiziellen amüsierten sich über einen Melker, der dünn wie ein Aal war und ihnen den Zusammenhang zwischen Wetter und Politik beizubringen versuchte. Renate Jago lachte mit, hörte zu, und es war nicht so, dass sie sich in den Vordergrund drängen musste. Sie konnte zurücktreten und wirkte bescheiden, wie sie neben der alten Frau saß, die Enkeltochter neben der Großmutter.
Dabei wusste Renate, dass diese Journalistin, diese Genossin Doktor Severin, alles erfahren würde, bald, denn der Fahrer des dicken Sekretärs bastelte am Auto herum, bei dem die Kupplung nicht mehr funktionierte. Also würde der Sekretär wohl mit dem Wagen der Journalistin fahren, und sie würde alles erfahren.
Ich werde hierbleiben, dachte Renate, ich werde in die Turnhalle gehen und mit den Kindern tanzen, und dann werde ich, zusammen mit der alten Genossin, zum Abendessen in das Haus des Bürgermeisters gehen, ein Essen im kleinen Kreis, und mir ist es gleichgültig, was die Severin über mich denkt. Ich habe das getan, was man Pflicht nennt. Möglich, dass die Severin anders darüber denken wird.
Ich musste eingreifen. Bei einer solchen Gelegenheit, während einer feierlichen Namensverleihung, versagt ein Sekretär und spricht nicht weiter, da musste ich eingreifen und retten, was zu retten war. Wer denn sonst? Die Kreisleitung zeichnet verantwortlich, und durch uns beide war sie vertreten. Wer, wenn nicht ich.
Aber noch weiß die Severin nicht alles. Noch weiß sie nicht, dass ich diese Rede ausgearbeitet habe, Wort für Wort und Satz für Satz, so habe ich die Rede in die Maschine diktiert, und so ist sie auch im Sekretariat bestätigt worden, neben fünf oder sechs anderen Beschlussvorlagen im Schnellverfahren. Ich habe gelernt, solche Reden auszuarbeiten. Aber als die alte Frau sprach, als ich die Erwartung der Kinder sah, dachte ich: Du müsstest sagen, was du weißt und was alle interessieren würde.
Ich könnte mich freuen, ich freue mich nicht. Wenn ein Genosse versagt, so muss ein anderer an seine Stelle treten und sagen: Hier. In einem Film habe ich das einmal gesehen. Das Versagen des Sekretärs wird bekannt werden, man wird ihn zur Verantwortung ziehen, man wird mich fragen. Ich werde die Funktion besser als er ausüben können. Nicht lange, denn ich habe andere Pläne. Aber schadenfroh, das wäre das falsche Wort. Ich habe meine Pflicht erfüllt, den Auftrag unserer Leitung. Ich bin nicht für einen Versager verantwortlich.
Als die Genossin Doktor Vera Severin mit dem Sekretär, den sie in der Kreisstadt absetzen wollte, wegfuhr, stand Renate Jago draußen, in der sternklaren Nacht und unter einem Eichendorffschen Mond. Sie dachte: Es war, als hätt’ der Himmel die Erde still geküsst. Sie sah dem Auto nach und rauchte ruhig eine Zigarette. Sie war mit sich zufrieden und sah zu dem Mond hinauf. Als Kind hatte sie stundenlang in den Mond sehen können, bis sie das Weben und Wabern in seinem milchigen Weiß wahrnahm.
Sie bereute nichts, sie fühlte sich ruhig. Sie hatte alle Möglichkeiten noch vor sich. Sie dachte: Diese Severin hat die Mitte des Lebens überschritten. Journalistin, das werde ich eines Tages auch sein, das ist mein Traum, und sie werden mich zum Studium delegieren.
Alles, alles wird mir gelingen. Ich werde ein Kind zur Welt bringen, das Kind, das sich schon von mir ernährt. Großmutter wird das Kind versorgen, wenn sich ihr erster Schreck gelegt hat. Den Vater des Kindes werde ich nicht bemühen, nein, es macht mich stolz, dass ich ganz allein von diesen Zielen und Möglichkeiten weiß. Alles werde ich von meinem Kinde wissen, ich allein, ich werde alle seine Gedanken kennen.
Renate Jago strich, während sie unter diesem Mond und unter diesem Himmel stand, der sich auf die Erde senkte, über ihren straffen, festen Leib und drückte gegen das Sonnengeflecht. Noch war nichts zu spüren. Sie wusste es seit zwei Monaten. Er wusste es nicht. Sie wollte nur das Kind, den verheirateten Mann wollte sie nicht. Riska sollte sich nicht ihretwegen scheiden lassen, nur das Kind war wichtig.
Es war so schön zu wissen, das alles vor sich zu haben. Sie genoss diesen Moment.
2.
Renate schlug aus der Art der Jago-Frauen.
Großmutter Emma warnte sie: „Das Menschenleben ist kurz, ich werde achtzig und sehe mich fast täglich als Kind. Wie ich Teekräuter auf den Wiesen sammelte oder meine schöne Charakterpuppe im Zuber wusch, ich rieche sogar das Waschwasser, in dem ich sie wusch, und ich rieche die braunen Dielenbretter in der Schulstube. Alles war gestern erst. Ich weiß noch, wie die Kreide schmeckte, die ich aß, um eine weiche Stimme zu kriegen.“
Renate lachte und sagte, sie habe Zeit, sie habe so viel Zeit, dass sie alles versuchen, alles tun, alles probieren könne, alles, alles.
Großmutter Emma verstand das nicht. Ihre Tochter Lore, Renates Mutter, fahre einen Kran in einer Fabrik, das sei nicht viel, aber immerhin etwas Handfestes und für Lore genau das Richtige. Ein Ziel müsse der Mensch haben und dieses eine Ziel verfolgen. „Ich habe mit deinem Großvater nur ein Ziel gekannt: heraus aus der Kate und ein eigenes Haus. Das ist wichtig, ein Ziel und dann nur leben, ruhig leben und zufrieden sein.“ Emma, keine wetterwendische Natur, war glücklich, als aus dem Knecht des Barons ein Wächter für Apfelbäume wurde, Ston, ihr Mann, der rebellische Kommunist, im Chausseehaus, kein eigenes, aber immerhin, das sind die Abstriche, die das Leben bereit hält, damit unsere Träume nicht wie bunte Falter in die Sonne taumeln, einer toller, blinder, trunkener als der andere. „Ich will meine Zeit nutzen“, sagte Renate.
„Und was willst du? Was willst du erreichen? Oder hoffst du auf das große Los? Du hast ein Abitur, das hatte noch keiner von den Jagos. Du arbeitest in diesem Büro, dirigierst junge Menschen, ist das Arbeit, dass ich nicht lache.“
„Ich werde noch studieren“, erwiderte Renate, „Journalistin werde ich sein, vielleicht auch Dramaturgin, Regisseurin, mein Name wird bekannt, ich will viel Neues ausprobieren, im Neuen liegt ein Zauber.“
„Du willst von einem Leben in ein anderes springen, ja? Bist du gierig auf Neues?“
„Ja, neugierig bin ich.“
„Das Leben ist anders, glaube mir.“
Bei solchen Gesprächen sah Emma ihre Enkelin an und dachte an Ston, ihren toten Mann, den sie gehalten hatte mit List, Tücke und Kind, sonst wäre er vor Neugier auf und davon gegangen, weg nach Amerika, China oder Afrika. Von ihm könnte Renate das Blut geerbt haben. Nur groß, das wollte er nie sein, ihm genügte es, dazusein, wenn man ihn brauchte, die Landarbeiter konnten sich auf ihn verlassen, seine Partei. Seinen Namen mussten die Zeitungen nicht drucken, das Reden liebte er nicht, das Handeln ja, der verrückte Kerl. Renate aber will groß sein.
„Ja“, sagte Renate, „wenn schon, dann Spitze und oben sein und vorn stehen.“
„In der Schule habe ich das noch verstanden“, sagte Großmutter Emma und horchte tief in sich hinein, ob sie nicht auch irgendwann einen solchen Wunsch gehabt hatte. Aber da war nur der eine gewesen: das Haus und ein Stück Garten und Vieh und den Streifen Acker hinter einem besonnten Bach. Als dieser Wunsch erfüllt war, gab das ihr eine Zuversicht und eine Dankbarkeit und eine tiefe Ruhe. Geschafft, ich habe das Richtige gewollt, und jeden Tag tue ich das Richtige, füttere Tiere, nähe, ernte, hacke und grabe und pflanze, ob Krieg, ob Frieden, ob im Regen oder bei Sonne, es wiederholt sich Jahr für Jahr, und das ist gut so, das hat etwas von Ewigkeit.
Ston hatte über ihren Glauben gelächelt und gemeint, eigentlich sei sie mehr Kommunistin als er, er sei ein Anarchist, sie eine Ketzerin, die man früher, ganz früher, verbrannt hätte. Dagegen stritt sie, gegen Ston stritt sie immer. Und dabei hatte sie ihn geliebt. Renate hatte, als sie einmal krank war, nachgestöbert und Briefe in einer unbeholfenen Handschrift gefunden, die Ston seiner Emma geschrieben hatte, zärtliche Briefe in steiler, deutscher Schrift. Unvorstellbar, einer so strengen Frau solche Briefe zu schreiben. Und da waren auch schöne Briefe, die Ston von anderen Frauen erhalten hatte, ein Bündelchen, extra verschnürt. Emma hatte sie nicht verbrannt.
„Du spielst mit deinem Leben“, sagte Emma zu ihrer Enkelin Renate, „du wirst eines Tages gar nichts haben und gar nichts sein, du spielst mit dem Leben, wie du mit Stons hölzernen Puppen und den Hamstern als Kind gespielt hast. Deine Jahre vergehen, und eines Tages wirst du achtzig sein wie ich. Achtzig wirst du nur, wenn du das Rauchen aufgibst. Und nun kommst du mir damit!“
Das Kind. Renate hatte ihr gebeichtet, ein Kind, kein Mann. So sah also die Neugier auf das Leben aus? Nein, ein Heidenspaß sei das Leben wirklich nicht.
„Es wird aber getauft“, sagte Großmutter Emma.
Renate sprach nicht dagegen. Sie war auch getauft worden nach Emmas Willen und später aus der Kirche ausgetreten. Um den Preis sprach sie nicht dagegen.
„Ich verstehe dieses Leben nicht“, sagte Emma, „werde Lehrerin, das ist sehr viel. Das andere, Larifari.“
„Du wirst noch stolz sein auf mich.“
„Mit achtzig soll ich nun noch ein Kind aufziehen, wie denkst du dir das, Mädchen?“
„Du schaffst es schon.“
„Nein, nun nicht mehr.“ Und kein Vater, schon Renate war ein Kind der Sünde. Ohne den Mann Renates, diesen ‚Geliebten‘, zu kennen, hasste sie ihn. Sie verstand das Leben, das sie selber gelebt hatte. Sie hätte es wieder so gelebt. Und von solchen Parolen, wie ‚Seid umschlungen, Millionen!‘ oder ‚Proletarier aller Länder, vereinigt euch!‘ hielt sie gar nichts, ihr Wirdenken bezog sich nur auf die Familie, nicht auf Fremde oder gar auf Ausländer oder Orthodoxe. Sie hatte die Familie zusammengehalten.
Renates Kind traute sie sich nicht mehr zu.
3.
Renate Jago löste den Sekretär von seiner Funktion ab und arbeitete noch einige Monate in der Leitung. Sie erfüllte die Aufgaben besser als ihr Vorgänger, wurde gelobt ob ihrer Ideen, prämiert sogar, und brachte dann ihr Kind zur Welt: ein Mädchen von sieben Pfund, ihre Suse.
Susanna Jago. Susanna, wie die schöne babylonische Jüdin, die von Daniel gerettet wurde. Diesen Namen billigte Emma. Susanna würde endlich auf einen Daniel stoßen.
Renate nannte den Namen des Vaters nicht.
Es war eine leichte Geburt. Sie kam in die Klinik, und die starken Wehen setzten schon während der Aufnahme ein, sodass sie die Angaben zur Person erst hinterher machen konnte, so schnell kam das Kind. An Schmerzen konnte sich Renate nicht erinnern.
Großmutter Emma, die es abgelehnt hatte, das Kind in das Chausseehaus zu nehmen und dort aufzuziehen, nahm es, wie Renate einkalkuliert hatte, schließlich doch, obwohl sie nun ihre Mühe hatte mit dem Laufen.
Ihre Thrombose verschlimmerte sich. In den Garten rollte sie nun mit dem gleichen alten knarrenden Stuhl, in dem schon ihre Mutter die letzten fünfzehn Jahre ihres Lebens mit dem gleichen Gebrechen zugebracht hatte. Der Mutter hatte man in hohem Alter noch ein Bein amputieren müssen.
In der Wohnung hielt sich Emma fest, an Schrankkanten und Türpfosten. Sie stützte sich auf Tisch, Kommode, Stuhlrücken, sie sicherte sich und wirkte trotzdem nicht hilflos, sie ließ sich nur von ihrer Tochter abends die weißen, dünnen Haare kämmen. An Susanna ließ sie Lore nicht heran, die war ihr zu grobschlächtig. „Du mit deinen großen Flossen“, sagte sie, „Pass lieber auf, dass die Milch nicht überkocht und der Kaffee nicht anbrennt, das Mädchen lass mir in Ruhe.“
Heimlich streichelte Lore das Kind. Emma, Lore, Renate und nun Susanna, vier weibliche Wesen in dem Chausseehaus, und kein Mann.
Renate begann das Studium der Journalistik, wie sie es gewollt hatte.
Renates Beurteilungen waren sehr gut, und die Empfehlungen erst, kaderpolitisch. Sie war die Tochter einer Kranführerin, Arbeiterkind also, und die Enkelin eines Landarbeiters, eines Kommunisten, der einen Streik gegen den Baron in den zwanziger Jahren organisiert hatte.
Zu solchen Empfehlungen hatte Emma ihre besondere Meinung. „Und ihr Vater ist in der Fremdenlegion, davon spricht wohl keiner, was? Und der alte Ston?“ Da fiel sie in das Platt der Gegend. „Wat heißt dat, awer nee, an einem Dage haben Ston und Pottschulte un Schottschenmüller seggt, ob morjen lassen wir mal alle Fünfe jrade sein, dann jibt es mehr Deputat, un dat kam denn ok so, arledigt der Fall.“ Mehr war nicht, versicherte sie.
Aber Redakteure schlachteten alte Zeitungen aus und fanden mehr, Stons Anklage, seine Bestrafung und dass er ‚gesessen hatten. Großmutter Emma hatte es verschwiegen, ein Makel war das für sie. Und Pottschulte war kein anderer als Schulze, der ‚roter Sergeant’ genannt wurde. Als Ston noch lebte, kamen viele Bekannte in das Chausseehaus, viele Freunde, die sich nach seinem Tode zurückzogen, weil sie mit Emma nicht reden konnten wie mit Ston. Sie war auch stark, aber von ganz anderer Art.
Nein, Emma hielt ihren Ston nicht für einen Revolutionär. Dennoch studierte Renate, die Enkelin, Tochter einer Arbeiterin, Enkelin eines Revolutionärs, und sie fühlte sich manchmal, wenn diese Fakten erwähnt wurden, selber wie eine Kämpferin aus Gorkis MUTTER, mindestens so. Ston, das war eine Legende, da konnte Emma reden, was sie wollte.
An den Wochenenden besuchte Renate den Vater ihres Kindes, den Brigadier Riska, im Bauarbeiterwohnheim. Sie lud ihn nicht ein, das Kind zu sehen. Dazu hätte er in das Chausseehaus kommen müssen. Sie wollte ihm die lauten, bissigen Vorwürfe ihrer Großmutter ersparen und die kummervollen Blicke ihrer Mutter. Und sich selber auch einiges, zum Beispiel die Erklärung, warum er seine Ehe getrost erhalten sollte. Hanna hieß seine Frau. Sie wusste, dass er sie liebte. Renate reichte die Freude, die sie an ihm hatte und die er an ihr hatte, wenn sie ihn besuchte; mit Rändern um die Augen kehrte sie zurück. Für ein langes Lebe, ein gemeinsames, wollte sie ihn nicht haben, er war viel älter, ihr schien er auch viel klüger zu sein, auf jeden Fall durchschaute er sie leicht. Das ärgerte sie.
Die Besuche wurden seltener, und die Verbindung lockerte sich, als sie in Leipzig einen jungen, stillen Bildhauer kennenlernte, Friedrich Perr.
Riska machte auch das nichts aus. Der Mensch hatte das Recht, über sich und über seine Freunde zu entscheiden. Riska behandelte sie manchmal nicht ihrem Wert entsprechend, fand sie und ärgerte sich, als er die Nachricht von der Existenz eines Bildhauers Friedrich Perr so gleichgültig hinnahm. Ich wünsche dir viel Glück und das ganz ehrlich. Und schenkte ihr einen Scheck, der auf eine hohe Summe ausgestellt war. Sie lehnte ihn ab und nahm ihn dann doch mit.
Perr und Renate bauten sich in einem Abrisshaus eine kleine Wohnung aus, so schön, dass die Frau vom Amt, die kontrollieren kam, eigentlich sogar, um sie auszuweisen, wieder abzog und keine Meldung machte.
Manchmal nahm sie Friedrich mit in das Chausseehaus. Ihn konnten die Frauen im Hause Jago gut leiden, hilfsbereit, freundlich. Er ließ Suse schon drauflosmalen, als sie erst stehen, aber noch nicht laufen konnte. Die Uralte sagte ‚Jungchen’ zu ihm, er lächelte darüber.
Der Bildhauer hieß Friedrich wie der alte Fritz. An dem Tage, da er sich — natürlich auf ihr Dängen hin — von der evangelischen Kirche abmeldete, fiel sie durch die Prüfung des dialektischen Materialismus und mit ihr fünf andere Kommilitonen ihrer Seminargruppe. Der Tag war grau, und sie kam von der Uni zu ihm mit dem Gefühl, wohin sie auch immer ging, wo sie auch stehen blieb, in eine Tiefe zu fallen. Die erste Prüfung ihres Lebens, die sie nicht bestand, eine wichtige dazu, und das an dem Tage, da Friedrich sie überraschte mit dieser Nachricht, sich von der Kirche und von dem Glauben, dem seine Vorfahren seit hundert Jahren angehörten, getrennt zu haben. Ihr zuliebe? Er sagte: Aus Überzeugung. Aber sie glaubte, er habe ihr eine Freude machen wollen, nichts Hemmendes und Trennendes sollte zwischen ihnen sein.
Er gab ihr das Gefühl, nicht zu fallen, und hielt sie fest. Er liebte sie so, dass sie meinte, aufzusteigen aus diesem Novembertag zu den Wolkenschleiern.
Öffentlich wurden die Versager in der Parteiversammlung zwei Tage darauf gerügt. In dem Fach, das sie gefälligst besser als die Nicht-Genossen beherrschen sollten, hatten sie versagt. Das kränkte Renate nicht. Sie dachte, während der Parteisekretär alles lang und breit erläuterte, an ein Zimmer im Hinterhaus, an die breite Liege und an ihren Friedrich und konnte sich jede Stunde heranholen. Das machte sie stark und erschreckte sie zugleich.
Die Wiederholungsprüfung bestand sie mit der Note eins. Sie staunte auch darüber, dass ein schlechtes Gewissen so rasch unter einer starken Freude dahinschmelzen kann.
Als Friedrich Perr, gemeinsam mit seinem Studienfreund Veit, im Refektorium des Klosters Plastiken des letzten Studienjahres ausstellte, fuhr sie mit ihm zur Eröffnung. Sie sollte an diesem Tage wieder mit der Journalistin Vera Severin zusammentreffen.
Renate studierte im letzten Jahr. Es war schon klar, dass sie in der Bezirksredaktion anfangen sollte, in der Doktor Vera Severin arbeitete. Sie ließ sich jeden Artikel, jedes Porträt und jede Reportage und jeden Leitartikel ausschneiden, den Vera Severin geschrieben hatte. Sie studierte, wie die Severin das machte, welche Aufhänger sie benutzte, wie sie den roten Faden entwickelte, wie sie Menschen skizzierte. Das war schon gekonnt. Sie las in der Bibliothek auch die Kritiken, die von der Severin in anderen Zeitschriften erschienen, sie wollte die Tricks, das gewisse Etwas herausbekommen: die Meisterschaft also.
Der Chefredakteur Buschmann gab ihr in einem Kadergespräch zu verstehen, dass sie, als Kind einer Arbeiterfamilie, zu wichtiger Funktion innerhalb des Zeitungswesens ausersehen sei, zunächst innerhalb seines Blattes.
Über die Ausstellung der beiden Bildhauer hatte Vera Severin wieder zu berichten, wie seinerzeit über die Einweihung der Schule.
Perr hatte sieben Werke ausgestellt, aus dem Stein herausgeschlagene Skulpturen, die unvollkommen wirkten. Wie zur Hälfte beendet und doch auf eine schwer erklärbare Weise vollkommen. Der Leib eines Menschen, einer Frau, einer Landschaft gleich, vor der man den Atem anhielt, weil sie so schön war. Und ein geborstener Körper, aufsteigend in heftigem Kampf, kräftiges Atmen unter schwerer Last. Und ein Liebespaar wie ein gewölbter, sich spannender Block, der dennoch leicht wirkte, unbekümmert angehoben und schwebend.
Es war, als fürchtete Friedrich Perr, die Struktur des gewachsenen Steins zu zerstören.
Sein Studienfreund Veit wies mit seinen Exponaten eine größere Breite auf. Er wirkte experimentierfreudiger, hatte in mehreren Techniken ausgestellt und zeigte kleine Plastiken, die ob ihrer Originalität verblüfften.
Veit zeigte stehende und liegende Akte, wie Wasserspeier und Türklinken gearbeitet, Gruppen in Bronze und aus einem neuen Material, das sehr billig sein sollte. Er bekannte sich engagiert mit der Darstellung einer südamerikanischen Familie, deren Ernährer, ein Junge noch, erschossen worden war.
Friedrich Perr stand mit stillem Gesicht dabei und hörte das Lob, das die offiziellen Besucher, mit denen die Ausstellung eröffnet worden war, seinem Kollegen Veit spendeten.
Dann kamen sie zu seinen Arbeiten, umschritten sie, hielten die Köpfe schief, sahen sich nicht an, nickten vor sich hin, traten ein paar Schritte zurück und sagten endlich: „Ja, doch“, und „Ein schönes Stück“ und „Diese Maserung im Material.“ Perr sah nur zu. Es blieb dahingestellt, ob er überhaupt auf eine Reaktion wartete. Aber Renate wusste, dass sie ihm nicht gleichgültig war.
Die beiden Bildhauer waren äußerlich sehr verschieden. Perr groß und grätendünn, Veit von untersetzter Statur, aber sie waren ähnlich gekleidet, trugen Jeans, die gleichen spitz zulaufenden Knebelbärte, die früher Henriquatres genannt wurden und die ihr Professor an der Kunsthochschule wieder in Mode gebracht hatte, und schwarze, dünne Lederjacken.
Renate ärgerte sich. Das merkte ihr nur Friedrich Perr an, denn Renate lächelte verbindlich, beteiligte sich an dem Gespräch über Veits Arbeiten, begrüßte Vera und stellte den Bildhauer an ihrer Seite vor. Perr blickte die Journalistin interessiert an. Das also war die Frau, deren Arbeiten Renate sammelte und analysierte.
Renate ärgerte sich über Perrs stures Schweigen. Wie er steif und hölzern dastand. Und wie die Leute umhergingen. Wie sie sich für den anderen interessierten.
Endlich sagte sie, vor dem blockhaften Liebespaar stehend, zu dem Stadtrat für Kultur, der fortwährend trocken hustete: „Es ist sehr schwierig, von außen her in das Material einzudringen, nicht von innen mittels einer Drahtkonstruktion aufzubauen, sondern alles wegzuschlagen, was nicht wesentlich ist.“
„Aber das kommt mir so unfertig vor, entschuldigen Sie“, sagte eine Frau, die für eine Lokalzeitung schrieb und demzufolge auch über Katzenausstellungen und Schriftstellerlesungen.
Perr steckte die Hände tief in die Taschen seiner Jeans, als müsste er an sich halten. Die Fragerin ließ nicht locker, hatte sie einmal Mut gefasst zu reden, wollte sie es auch genauer wissen. „Kann man sagen, das sind erste Experimente, das ist ein Rohstoff, es handelt sich um Entwürfe?“
Perr zog ein wenig die Schultern hoch. „Entwürfe, nun ja, gewiss, alles, was ich mache, ist Entwurf im Sinne des Wortes.“
Nun kamen auch noch die berüchtigten Fragen: Was wollen Sie denn damit ausdrücken? Was bedeutet das? Warum fehlen am Leib der Frau, wieso sind beim Block, wie kommt es, dass die Proportionen, weshalb, erklären Sie bitte, warum sehen Sie so und nicht anders?
Perr fragte zurück: „Gefällt es Ihnen eigentlich?“
Vera Severin lächelte zustimmend. Das Schweigen dauerte eine lange Weile. Dann sagte sie: „Ihre Frage trifft den Kern, Herr Perr, ich finde, bei uns müsste der Betrachter von Kunst zunächst sagen, ob er etwas schön oder unschön findet. Er könnte sich selber mal Mühe geben. Soll man denn die Kunst immer erklären müssen?“
Ihre Kollegin von der lokalen Zeitung schrieb viel in ihren Notizblock, ob dieser Fragen der Severin wegen, ob aus purer Verlegenheit, das wusste sie allein.
Perr sagte: „Sie sprechen mir aus dem Herzen.“
Und auch Renate Jago nickte und sagte in forschem Ton: „Man muss von dem Betrachter heute neue Sehgewohnheiten fordern können.“
Vera spürte die Unsicherheit in Renates Stimme. Das war keine eigene Meinung, sondern ein angelesener, gehörter, nicht von ihr verarbeiteter Satz, oberflächlich dahingesprochen. Als sie den Satz ausgesprochen hatte, wusste Renate schon, dass ihr die Severin, diese Genossin Doktor, widersprechen würde.
„Mit welchem Recht verlangen Sie das von den Menschen, die nach ihrer Arbeit, nachdem sie Kinder und Haushalt versorgt haben, noch in eine Ausstellung gehen?“
Für einen Augenblick wirkte Renate Jago unsicher. Der Stadtrat sprach, darum musste sie nicht antworten. „Sie zeigen hier eine Andeutung, ein Segment, meine ich. Die Auswahl haben Sie getroffen, das ist Ihr Recht. Gut so. Aber ist diese Auswahl nicht dem Zufall überlassen, einer Stimmung? Nun stehen Sie daneben und lassen uns staunen und raten. Mir ist da zu viel Natur und zu wenig Kunst.“
Friedrich Perr nickte. Das Gespräch gefiel ihm jetzt anscheinend. Er stand mit ein wenig nach innen gekehrten Füßen da und schwieg. Die Severin interessierte ihn sehr, weil sich Renate so sehr für sie interessierte, weil sie diese Journalistin sogar zu fürchten schien und auch, weil das, was die Severin sagte, noch das Vernünftigste in diesem Kreise war.
Renate war unzufrieden mit ihrem Bildhauer. Er verteidigte sich nicht.
„Warum also so?“, fragte der Stadtrat noch einmal.
„Das wirkt eben sehr stark auf mich“, sagte Perr, „und ich kann nur machen, was mich berührt, das ist wie ein Zwang.“
Ein Betrachter wollte wissen, ob das schon ausreiche. Muss das, was auf den Künstler stark wirkt, auch auf andere gleich stark wirken?
„Nein, natürlich nicht“, erwiderte Perr, „aber doch auf einige Menschen, daran muss ich glauben, sonst müsste ich aufgeben.“ Der Pulk zog wieder zu den formschönen Exponaten Veits, der in trockener Weise erklärte, wie er Ideen fand, wie er sie verwirklichte, er war sich über den Prozess der Schöpfung im Klaren.
Auf Vera Severin wirkte er wie ihr Lehrer Hermes, von dem sie immer dann träumte, wenn sie zuvor kurz Gebratenes gegessen hatte. Dieser Hermes hatte ihr sämtliche Flüsse und Gebirge der Welt beigebracht, auch den Puscht-i-Kuh und Tista und Hoang-ho. Aber im Traum konnte sie seine Fragen nicht beantworten und wachte schweißig und erlöst auf. Dieser Veit schien auch alles zu wissen, und Einfall und Idee und Ausführung waren für ihn anscheinend nicht mehr als Puscht-i-Kuh und Hoang-ho für den kleinen Lehrer Hermes. Vielleicht tat sie Veit unrecht, denn auszusetzen hatte sie wenig an seinen Arbeiten, sie waren durchgestaltet.
Der Stadtrat für Kultur, unter Heuschnupfen leidend, wandte sich noch einmal an Friedrich Perr: „Wie kommen Sie ausgerechnet zu diesen Formen, zu dieser Aussage? Das interessiert uns doch alle sehr.“
Darauf Perr: „Der Stein, nicht wahr, er lebt doch, er diktiert mir die Form, sie ist vorgegeben, und ich folge nur den Linien des Steins und seiner Struktur und seiner Farbe, ich helfe vielleicht nur nach, der Natur, meinetwegen helfe ich der Natur nach. Auch die Leute, die Höhlen bemalten, haben nicht jeden Stein und nicht jede Stelle genommen. Ich weiß ja, indem ich’s sage, dieser Vergleich hinkt schon wieder. Aber gegen den Stein, da kann ich gar nichts machen.“
Der Kritikerdame vom lokalen Blatt leuchtete das nicht ein.
„Dann wissen Sie also nicht, was am Ende herauskommen wird, ich meine, beim ersten Schlag wissen Sie das noch nicht?“
Friedrich Perr hob wieder die Schultern, eine unbewusste Bewegung. Aber seine Geste wirkte schuldbewusst, als müsste er ein Versehen beichten. Er gefiel Vera Severin, weil er jene innere Sicherheit besaß, die sie bei vielen Menschen vermisste, auch bei Renate Jago.
Renate ärgerte sich. Sie erklärte für ihren Bildhauer. „Er weiß es natürlich. In jedem Menschen gibt es wiederkehrende Erlebnisse, in rhythmischer Folge, dagegen kann man nichts unternehmen. Sie wiederholen sich unbewusst und daher gegen unseren Willen, wie das Thema in einem Rondo. So ist es bei ihm auch, nicht wahr, Fritz.“
Die Bemerkung veranlasste Vera zu einem erneuten Angriff gegen Renate. „Sie meinen also, ein Mensch fällt immer in die gleichen Gruben? Hat er einmal Pech, so ist das wie angeboren? Das soll also von innen her bestimmt sein, von außen nicht beeinflussbar? Ich führe Ihren Gedanken weiter. Sie meinen, der Mensch komme immer in die gleichen Lebenslagen, wie er sich auch mühen und placken mag, im Leben wie in der Kunst? Von vornherein sind die Glücklichen und die Unglücklichen bestimmt, die Dummen und die Klugen, die Gerissenen und die Einfältigen, die depressiven Menschen und die optimistischen? Mir scheint, wenig marxistisch gedacht, Genossin Jago.“
Als sie geendet hatte, merkte sie schon, dass sie zu weit gegangen war, sie hatte sich hinreißen lassen, und die Jago sagte: „Mit einer Kanone braucht man nicht auf mich zu schießen, Genossin Doktor Severin. Sie wissen, dass ich das nicht meine.“
Perr aber lachte so laut, dass sich die Leute umdrehten, die weitergezogen waren und mit Veit vor der kleinen Plastik einer Frau standen, die krummen Rückens ein Bündel Äste schleppte.
Sein Lachen gefiel Vera. Menschen, die so lachen, sind stark.
„Mein Vater“, sagte er, „das ist genau die Theorie meines Vaters: Alles ist bestimmt und angelegt, du kannst dich drehen, wie du willst.“
„Ich bitte dich“, sagte Renate. „Diese Deutung geht mir zu weit.“ Sie sah Vera an, die dem Blick nicht auswich.
Wieder diese dunklen Augen, in denen man keinen Grund erkennen konnte. Ob Renate diesem jungen Bildhauer ein guter Partner sein kann? Wer von beiden mag der wohlwollende Partner, wer der stabile, wer der erregte, wer der störanfällige sein? Warum interessierte sie das überhaupt? Er sah nicht außergewöhnlich aus, kein schöner Mann, kein interessanter Typ im landläufigen Sinne.
Und Vera Severin, die wusste, dass sie zu weit gegangen war, erkundigte sich nach Aufträgen, nach Atelier und Wohnung und Arbeitsbedingungen, und Renate nannte für Perr den Namen eines großen Werkes. Die Arbeiterklasse als Mäzen, feste Bindung der Künstler an ein Kollektiv, vielleicht an Elektriker oder Anlagenfahrer. „Daher werden für ihn Aufträge und wichtige Anregungen kommen. Es wird sich bald niederschlagen, davon bin ich überzeugt.“
Anders als jene Sachen, die heute in dieser Kollektion zu sehen sind, schien sie damit sagen zu wollen, und Vera erwiderte: „Nur keinen Ersatz für Vorgartenzwerge. Es gibt nämlich schon den Stahlwerker mit der großen Schürze und die Veterinärin mit dem Ferkel auf dem Arm und den Torwart, der im Flug einen Ball fängt, und das alles so niedlich und handlich, dass sie auf den Fernseher gestellt werden können.“
„Das trauen Sie ihm wirklich zu?“, fragte Renate.
„Nein. Nach dem, was ich hier sehe, nicht. Ich halte viel vom eigenen Auftrag.“
Perr sah Vera an und sagte zu Renate: „Meine Rede.“
Und Vera dachte, dass dieser Perr frei von Koketterie ist, dass er nicht mit Tricks arbeitet. Sie hörte die Frage Renates: „Worin sehen Sie denn die Aufgabe der Kunst?“
Vera hätte erwidern können, lesen Sie im Lexikon unter Ku nach, aber sie sagte: „Mit ihrer Hilfe sollte der Mensch gute und richtige Gedanken von Einbildungen und Illusionen unterscheiden lernen.“
„Darüber muss ich nachdenken. Aber ohne Aufträge kann er nicht leben. Das war schon im Mittelalter so, und die Bildhauer bewundern wir heute noch.“
„Ich will nicht die Gesetze des Steins verletzen, um gefällig zu sein, ich will mich seinem Widerstand stellen. Ich möchte nie darstellen, was ich sehen soll.“
„Das verlangt keiner von dir.“
Perr schwieg und kraulte den Bart.
Vera Severin sagte, dass sie gern eine Arbeit von ihm kaufen würde, bereute aber sogleich ihre Worte. Er sah sie an, als wollte er sagen: Alle seid ihr bloß eitel, auch Sie, meine Dame, Entgegenkommen kann eitel sein.
„Die können Sie gar nicht bezahlen“, sagte er.
„Aber Friedrich“, sagte Renate.
„Die sind alle unverkäuflich.“