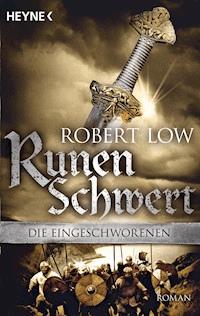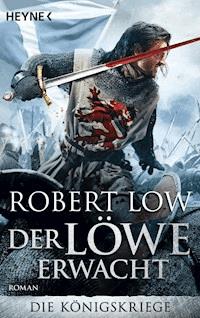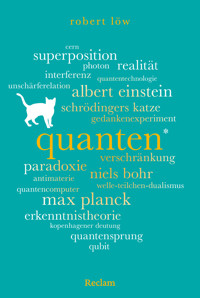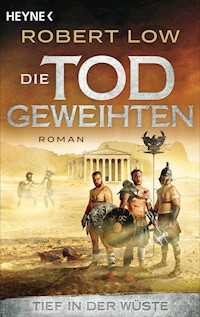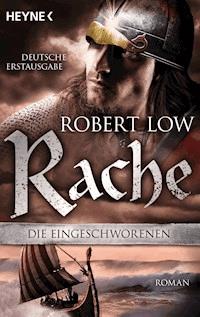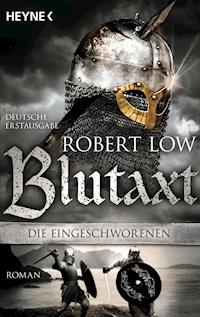6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Todgeweihten-Serie
- Sprache: Deutsch
2 Jh. n. Chr.: Die beiden Gladiatoren Drust und Kag werden in einer gefährlichen Mission an die Grenzen des Römischen Reiches entsandt. Jenseits des Hadrianswalls, tief im Land der Kaledonier, sollen sie eine entführte Frau und ihren kleinen Sohn wiederfinden. Fragen zu den Hintergründen der Tat stellen sie erst spät. Zu spät, wie sie schmerzvoll erfahren müssen, als sie bereits in einen blutigen Bandenkrieg verwickelt sind. Wenn sie unterliegen, müssen sie um ihr Leben fürchten. Denn sie haben mächtige Gegner aufgeschreckt, die das Römische Reich von innen her zerstören wollen und die vor nichts zurückschrecken …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
»Sie waren die Procuratores, die Brüder des Sandes – Männer, die einander gut kannten, die durch ihre gemeinsame Vergangenheit verbunden waren, durch die Erinnerung an den Angstschweiß in den unterirdischen Gewölben schäbiger Amphitheater und an irgendwelche heiligen Wüstenorte, wo sie am Lagerfeuer gesessen und eine Ziege gebraten hatten. Männer, die Rücken an Rücken und Seite an Seite gekämpft hatten, über und über bespritzt vom Blut der Toten. Sie hatten es mit Feiglingen und niederträchtigen Bastarden zu tun bekommen. Sie hatten miterlebt, wie Menschen, die sie kannten, einen wenig glorreichen Tod starben, Menschen, die in ihren letzten Worten nicht ihren Kaiser oder ihr Vaterland würdigten, sondern einfach nur ›Scheiße‹ hervorstießen. Manchmal hatten sie Leute getötet, die vor ihnen auf dem Boden knieten und unter dem Johlen der Menge auf den Todesstoß warteten.«
Wo andere sich nicht die Hände schmutzig machen wollen, werden Drust, Kag und ihre ehemaligen Kampfgenossen hingeschickt. Doch diese Mission, die sie an die nördlichen Grenzen des Römischen Imperiums führt, stellt alles in den Schatten, was sie bisher erlebt haben …
Der Autor
Robert Low, Journalist und Autor, war mit 19 Jahren als Kriegsberichterstatter in Vietnam. Seitdem führte ihn sein Beruf in zahlreiche Krisengebiete der Welt. Um seine Abenteuerlust zu befriedigen, nahm er regelmäßig an Nachstellungen von Wikingerschlachten teil. Robert Low lebte in Largs, Schottland – dem Ort, wo die Wikinger schließlich besiegt wurden. 2021 ist der Autor verstorben.
Lieferbare Titel
978-3-453-53409-4 – Runenschwert
978-3-453-41000-8 – Drachenboot
978-3-453-43714-2 – Rache
978-3-453-41074-9 – Blutaxt
978-3-453-41168-5 – Der Löwe erwacht
978-3-453-41181-4 – Krone und Blut
978-3-453-41244-6 – Die letzte Schlacht
ROBERT LOW
JENSEITS DES WALLS
DIETODGEWEIHTEN
Aus dem Englischen von Norbert Jakober
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe Beasts beyond the Wall (Brothers of the Sand 1) erschien erstmals 2019 bei Canelo, London.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstausgabe 06/2022
Copyright © 2019 by Robert Low
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Barbara Häusler
Printed in Germany
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, unter Verwendung von Motiven von © Canelo Digital Publishing Limited
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-25813-9V001
www.heyne.de
ROM
Im 10. Jahr der Herrschaft von Kaiser Lucius Septimius Severus Augustus, Pater patriae, Eroberer des Partherreichs, Pontifex Maximus
Der Mann stürmte brüllend auf Drust zu, den dicken Knüppel drohend erhoben; hinter ihm rückten unter lautem Geheul andere nach. Nur einer lachte, wie Drust mit einem kurzen Seitenblick registrierte.
Er senkte die Schulter, machte einen Schritt zur Seite und rammte dem Angreifer die Faust in die Magengrube. Der Getroffene taumelte ein paar Schritte und prallte gegen den hünenhaften Pacuvius. Der blickte mit einer Mischung aus Staunen und Verachtung auf den Mann hinunter und schickte ihn mit einem mächtigen Faustschlag zu Boden.
»Auf sie. Schnappt euch den Dicken.«
Drust sah, dass die Aufforderung von dem Kerl kam, der gelacht hatte. Er trug eine komische Bucco-Maske, doch das Gesicht der dümmlichen, pausbäckigen Theaterfigur strahlte im flackernden Lichtschein der abgelegten Fackeln etwas Gespenstisches aus. Riesige Schatten huschten über die Wände.
Pacuvius versetzte dem Mann, den er niedergeschlagen hatte, noch einen Tritt, worauf dieser seine Maske verlor – sie stellte Pappus, den lüsternen Alten, dar, wie Drust nun sah. Die Angreifer verkörperten beliebte Figuren der derben römischen Komödie.
»Achtung – rechts!«
Kag blockte den Angriff eines weiteren Maskierten ab – ohne große Mühe, da die Hiebe nicht sehr gezielt waren. Etwas weiter entfernt war Tarquinus von den Angreifern überrascht worden und lag mit einer blutenden Kopfwunde am Boden, während zwei Maskierte ihn mit ihren Knüppeln bearbeiteten. Die Fackelträger waren geflohen, die Sänftenträger taumelten, das vordere Ende der Sänfte neigte sich bedrohlich nach unten.
Drust wandte sich dem nächsten Angreifer zu, blockte dessen Hieb ab, ließ sein Bein vorschnellen und brachte den Mann zu Fall. Die Maske des buckligen Dossenus flog zur Seite – darunter kam das Gesicht eines Jungen mit aufgerissenen Augen zum Vorschein, der aufschrie, als Drust den Knüppel hob.
Ein junger Bursche, vielleicht fünfzehn Jahre alt. Drust zögerte mit dem Knüppel in der Luft. Es waren junge, wohlbehütete Nichtsnutze aus gutem Hause, die aus purem Zeitvertreib durch die nächtlichen Straßen zogen und über Unschuldige herfielen. Wahrscheinlich war der Kerl nicht zum ersten Mal mit seiner Bande unterwegs. Viele flohen, wenn sie die grotesken Masken sahen und das schaurige Geheul hörten – aber wer nicht schnell genug war, den schlugen sie gnadenlos nieder.
»Mach ihn fertig«, grollte Kag und fegte heran wie ein kalter Wind. Sein junger Gegner wand sich unter Schmerzen am Boden und drückte eine Hand zwischen die Beine.
»Er ist noch ein Kind«, erwiderte Drust.
»Trotzdem – er hat’s nicht anders verdient«, rief Kag über die Schulter zurück und knöpfte sich den Bucco vor. Der Junge auf dem Boden kroch zu seinem Knüppel, packte ihn und rappelte sich hoch. Drust stieß einen Fluch aus, schüttelte den Kopf und versetzte ihm zwei kräftige Schläge in die Nieren. Mit einem spitzen Schrei sank der Junge zu Boden und fing an zu schluchzen.
Der wird drei Wochen Blut pinkeln, dachte Drust. Im Augenwinkel bemerkte er eine Bewegung, fuhr herum und sah zwei Angreifer zur Sänfte rennen. Bucco lieferte sich ein Gefecht mit Kag, während Pacuvius versuchte, Tarquinus zu helfen; der Lanista war verletzt – vor allem sein Stolz. Quintus und Ugo waren nirgends zu sehen; die Sänfte war auf der Straße abgestellt – immerhin war sie nicht umgekippt, doch die Träger hatten das Weite gesucht. Die beiden Angreifer schickten sich an, die Vorhänge zurückzuziehen.
Drust war der Einzige, der eingreifen konnte. »He!«, rief er.
Einer der beiden drehte sich um. Er trug die Maske von Manducus, dem Vielfraß, und war eindeutig kein junger Bursche. Ein gefährlicher Gegner, wie Drust sofort erkannte. Als der andere sich umdrehte, knurrend unter seiner Clownsmaske, wusste Drust, dass er es mit zwei Kämpfern aus der Gladiatorenschule zu tun hatte. Sie trugen schwere Übungsschwerter aus massivem Holz, mit denen man problemlos jemandem den Schädel einschlagen konnte.
Drust wehrte vier Hiebe ab, doch dann traf ihn ein Holzschwert in die Rippen und ließ ihn nach Luft ringend zurücktaumeln. Der andere hob seine Waffe und setzte zu einem vernichtenden Schlag auf Drusts Schädel an. Drust war nicht der beste Kämpfer, das wusste er selbst, aber er war kein Stümper. Er wich geschickt aus, sodass ihn das schwere Holzschwert nur an der Schulter traf.
Dennoch war sein Arm einen Moment lang taub, der Knüppel glitt ihm aus der Hand. Er taumelte nach hinten und versuchte auszuweichen, als die beiden aufs Neue angriffen.
Ein fröhlich klingendes Brüllen ließ die Angreifer innehalten. Maccus, der Narr, fuhr herum und sah Quintus aus einer Seitengasse stürmen, mit einem Grinsen so breit wie der Circus Maximus. Maccus sah gerade noch die strahlend weißen Zähne auf sich zukommen, dann rempelte Quintus ihn mit der Schulter um. Der Mann stürzte rücklings zu Boden, und Quintus hämmerte ihm das stumpfe Ende seines Knüppels in den offenen Mund der Maske. Zähne gingen zu Bruch, und mit den Schreien des Getroffenen spritzten Holzsplitter und Blut aus dem Mund.
»Schnappt euch den Anführer«, rief eine Stimme aus der Sänfte. »Diesen Bucco.«
Drust blickte sich um. Quintus und Manducus, der Vielfraß, kämpften verbissen, die anderen Angreifer lagen entweder reglos auf dem Boden oder suchten kriechend das Weite.
»Schnappt euch den Bucco«, rief die Stimme erneut, dann erschien Servilius Structus’ zorniges Gesicht zwischen den zerrissenen Vorhängen. »Lasst den kleinen Scheißkerl nicht entwischen …«
Kag war auf ein Knie niedergegangen und parierte einen Schlaghagel des Bucco. Drust eilte zu ihm, versuchte angesichts des Schmerzes in den Rippen nicht zusammenzuzucken und hoffte, dass er mit der linken Hand kämpfen konnte. Bucco wich einen Schritt zurück, deutete mit seinem Knüppel auf Kag und Drust und lachte.
»Mein Knöchel«, stieß Kag zähneknirschend hervor. Drust nickte, holte Atem, um festzustellen, ob der Schmerz erträglich war, und beugte die Finger seiner Kampfhand; das Kribbeln sagte ihm, dass das Gefühl zurückkehrte.
»Schnappt ihn euch«, drängte die wütende Stimme. Drust verfluchte den Mann in der Sänfte, doch dann folgte er dem fliehenden Bucco in eine Seitengasse.
Sie hetzten durch die stinkende, mit Gerümpel verstopfte Gasse, sprangen über schemenhafte Gegenstände und ernteten zornige Rufe aus den Fenstern. Schließlich landete Bucco in einer Sackgasse, sprang an einer Mauer hoch, rutschte ab und glitt zu Boden. Drust blieb keuchend stehen. Bucco lachte kurz auf, wenn auch etwas angespannt. Dennoch schien er sich im Vorteil zu wähnen und ging zum Angriff über. Er ist nicht älter als der andere, den ich niedergeschlagen habe, dachte Drust, aber ein Knüppel ist ein Knüppel.
Er blockte den Hieb ab und spürte augenblicklich, dass es kein Knüppel war. Mit einem scharfen Knacken wurde die Spitze seines Holzprügels gekappt. Bucco knurrte unter seiner Maske, der blanke Stahl seiner Waffe schimmerte im schwachen Licht.
»Na, ist dir die Lust am Kämpfen vergangen, Damnatus?«
Der Kerl weiß ein paar Dinge über mich, dachte Drust. Zum Beispiel, dass ich dazu verdammt bin, in der Arena zu kämpfen. Und dass ich verdammt wenig Lust habe, mit dem Knüppel gegen ein scharfes Schwert zu kämpfen. Er schaute sich nach einem Ausweg aus der bedrohlichen Situation um. Auf einer Seite sah er eine Tür mit einem Vorhang aus Perlenschnüren. Kurz entschlossen sprang er durch den Eingang und hörte im nächsten Augenblick Buccos polternde Schritte hinter sich.
Drust befand sich mitten in einem kleinen, schmuddeligen Schankraum. Ein Mann mit einer Lederschürze schwenkte eine dampfende Pfanne über dem Ofen und blickte erstaunt auf, als Drust hereingestürmt kam. Hinter ihm und dem Tresen mit den Amphoren standen ein paar grob gezimmerte Tische, an denen mehrere Gäste saßen und von ihrem Spiel aufblickten. Stinkender Rauch und schwere Fleischgerüche hingen in der Luft.
»Wer zum Hades bist du?«, fragte der Koch.
»Ein toter Mann – das ist er.«
Der Koch stieß einen empörten Schrei aus, als er das Schwert in Buccos Hand sah. Drust schwang sich über den Tresen, und die Gäste sprangen von ihren Plätzen auf; es waren Vigiles, die für die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Straßen sorgten. Seine Rettung …
Bucco eilte zum Tresen, um Drust nicht entkommen zu lassen – der machte noch zwei Schritte, als würde er fliehen, dann wirbelte er herum, schnappte sich einen Topf und hämmerte ihn gegen das maskierte Gesicht. Mit einem erstickten Schrei sackte der Bursche zu Boden. Der Koch schrie auf und brachte sich in Sicherheit.
Drust schwang sich über den Tresen, keuchend, unter Schmerzen und wütend auf diesen missratenen Bengel, der ihnen allen so viel Ärger machte. Er hob das Schwert auf und riss dem Jungen die Maske vom Gesicht. Zu seiner Überraschung grinste der Kerl ihn an. Ein junges, schweißglänzendes Gesicht unter einem Haarschopf aus ungebändigten Locken, die Augen glasig vom Schmerz, das Kinn von kümmerlichem Bartflaum umrahmt. Er war gerade alt genug, um eine Toga zu tragen, doch sein Blick war boshaft und verschlagen.
»Missio«, sagte er und hob grinsend einen Finger.
»Recipere ferrum«, knurrte Drust unbeirrt.
Der Junge sah, dass er es ernst meinte, und sein Lächeln erlosch.
»He«, erwiderte er. »Das war doch nur Spaß …«
»Lass deinen Kaiser in Ruhe.«
Das Gesicht des Ordnungshüters wirkte so hart und grimmig wie eine Felswand, er hielt seinen eisenbewehrten Knüppel wie einen Wurfspieß in der Hand. Drust sah ihn einen Moment lang verwirrt an, ehe ihm die Wahrheit dämmerte. Der Junge verfolgte die Szene mit einem spöttischen Grinsen.
Caracalla. Der kleine Mistkerl war Marcus Aurelius Severus Antoninus, Sohn des Kaisers und seit einigen Jahren sogar Mitherrscher. Drust erinnerte sich noch gut an den Tag seiner Erhebung zum Augustus, als der Junge mit ausgebreiteten Armen dagestanden und einen der Ihren zum Tod in der Arena verurteilt hatte. Plötzlich kam ihm ein Gedanke, während die anderen Vigiles näher traten, um den Jungen abzuschirmen.
»Gut, nun weiß ich, wer du bist«, erklärte Drust. »Weißt du auch, wer ich bin?«
Der Junge musterte ihn verwirrt. Die Vigiles runzelten die Stirn.
»Nein«, sagte der junge Kaiser.
»Gut.« Drust schnappte sich den Griff der heißen Pfanne. Wie von einem Katapult abgeschossen, flog die Pfanne durch die Luft und ergoss heißes Öl und schlechtes Essen über die schreienden Vigiles.
Drust versetzte dem römischen Kaiser einen kräftigen Tritt zwischen die Beine und machte sich aus dem Staub.
TRIPOLITANIEN
Fünf Jahre später
»Wer hätte gedacht«, sagte Kag, als würde er damit ein großes Geheimnis enthüllen, »dass Wasser die Leute so verrückt machen kann.«
Nach Drusts Einschätzung waren die meisten schon verrückt gewesen, lange bevor sie sich wegen des Wassers die Köpfe einschlugen. Sie gerieten sich darüber in die Haare, wer den besseren Draht zu den Göttern habe. Sie kämpften um Land, um Gold. Die Griechen hatten einst einen erbitterten Krieg um eine Frau geführt. Manchmal kämpften Männer um all das zugleich, und manchmal kämpften sie bloß zur Belustigung der Massen.
Sie saßen vor dem Goldenen Schweiß, was für Drust etwas verrucht klang, in Wahrheit aber nur eine Schenke war – oder was man in dieser Gegend unter einer Schenke verstand. Das Wort »Schweiß« stand für ein hierzulande aus Datteln gewonnenes berauschendes Getränk.
Kag hatte sich auf Säcken niedergelassen, die kurz zuvor von einem Wagen abgeladen worden waren. Drust saß neben ihm; beide beobachteten die belebte Straße im rötlichen Licht der Abenddämmerung.
»Verrückt«, fuhr Kag nachdenklich fort. »Schau sie dir an.«
Sie waren ein kunterbunter Haufen, wie Drust zugeben musste. Leute in weiten, weiß und braun gefärbten Gewändern, mit Turbanen, Schleiern, Strohhüten, manche in Sandalen, andere barfuß – jeder mit seinen Hoffnungen und Erwartungen. Sie kamen mit Ziegen, Datteln oder Stoffen und mit einer gehörigen Portion Gier, um sich eine goldene Nase zu verdienen, indem sie ihre Waren den wirklich Verzweifelten anboten – denen, die sich mit Spaten und Hacke auf den Weg machten, um irgendwo in der Wüste nach Wasser zu graben, bis sie irgendwann tot umfielen, auf der Suche nach dem klaren, flüssigen Gold.
»Verrückt«, wiederholte Kag. Er war ohnehin der Ansicht, dass sie beide nach Hause zurückkehren sollten. Eigentlich seien sie eindeutig noch verrückter als die anderen, denn sie hockten hier in der Wüste und taten nichts anderes, als auf irgendeinen hohen Herrn zu warten, der ihnen angeblich etwas Wichtiges zu sagen hatte.
Er hat nicht ganz unrecht, dachte Drust bei sich. Nur wäre es noch verrückter, nach Hause zurückzukehren. Vor allem jetzt, da der junge Mitkaiser ihnen bestimmt nicht wohlgesinnt war, seit Drust ihm in die Kronjuwelen getreten hatte. Er hoffte, dass Caracalla und sein Bruder sich mitsamt ihrem widerlichen Gefolge bei ihrem Vater aufhielten, Kaiser Lucius Septimius Severus. Dann wären sie weit weg im Norden, in einer Stadt namens Eboracum, wo der alte Severus seinen Söhnen zeigen konnte, wie man ein Weltreich schuf und zusammenhielt.
Vielleicht war in Rom für den Augenblick die Luft rein, da das Imperium zurzeit von irgendeinem Dreckloch in Britannien aus regiert wurde, dachte Drust. Dennoch war er nicht so verrückt, sich auch nur in der Nähe des Palatins blicken zu lassen.
Der Tag ging bereits zur Neige, und eine schattenhafte Gestalt huschte barfuß mit tappenden Schritten umher, um Lampen anzuzünden. Sie hatten sich an einen Tisch in einem schwach beleuchteten Raum gesetzt. Die Gestalt war nun als ein alter Mann zu erkennen, der ihnen Oliven brachte und sich gleich wieder aus dem Staub machte, während die Hitze des Tages ein wenig nachließ.
Wenig später erschien der Alte erneut. »Er kommt«, meldete er. Mehrere Schatten tauchten auf, kaum zu erkennen in dem düsteren Raum. Der Alte brachte eine breite Schüssel mit einer kleinen Flasche und mehreren Bechern. Kag und Drust wechselten erstaunte Blicke. Von der Schüssel ging Kälte aus und sie war außen feucht von Kondenswasser; sie war mit zerstoßenem Eis gefüllt.
Der Alte schenkte ein, während eine dunkle Gestalt sich ihnen gegenüber niederließ. Drust wandte sich an Kag, doch dessen obere Hälfte war in der Dunkelheit kaum zu erkennen – ebenso wenig die Gestalt, die ihnen gegenübersaß. Drust hörte nur, dass Kag ein leises Grunzen ausstieß, als der Alte ihnen einschenkte. Sie kosteten von dem Getränk und gaben sich unbeeindruckt, auch wenn es ihnen schwerfiel. Was man ihnen hier kredenzte, war reinster Nektar.
Der Alte verschwand in einem dunklen Winkel, und die schattenhafte Gestalt beugte sich ins Licht vor. Zu Drusts Enttäuschung war es ein Mann; insgeheim hatte er irgendein geheimnisvolles Wesen mit exotischen Reizen erwartet, mit Glutaugen oder den wilden Locken einer Medusa. Stattdessen blickte ihm ein ledriges, wettergegerbtes Gesicht entgegen. Es war schwer, die Größe des Mannes einzuschätzen, der hier vor ihnen saß, doch er war trotz seines fortgeschrittenen Alters noch recht muskulös. Sein Gesicht war eher unauffällig, zeigte keine Merkmale, die auf irgendwelche herausragenden Eigenschaften schließen ließen – bis auf die Augen, aus denen eine gebändigte Wildheit sprach.
Servilius Structus hatte ihnen einiges über Julius Yahya erzählt, hatte ihn als einen Mann mit Löwenzähnen und Tigerkrallen beschrieben, als würde er über die Kräfte einer Heldengestalt verfügen. Ein Wesen, das von den Göttern abstammte. Ein Mann, der prächtige Häuser besaß, der reichen Männern Befehle erteilte, obwohl er selbst ein Sklave war. Kein ehemaliger Sklave, sondern immer noch ein Sklave der kaiserlichen Familie hier in Leptis Magna, ihrer Heimatstadt. Der Geburtsstadt des Kaisers.
Servilius Structus war ein gewiefter Mann – ein korpulenter, durchtriebener Kerl, der sich in Rom ein eigenes kleines Reich im Elendsviertel der Subura aufgebaut hatte. Er handelte mit Getreide, Sand für die Zirkusarena, Sklaven, exotischen Tieren, fremdländischen Genüssen und gelegentlich auch mit roher Gewalt. Zu diesem Zweck hatte er Drust, Kag und die anderen – seine Procuratores – wie Werkzeuge benutzt, deshalb wussten sie um seine Macht.
Und dennoch hatte Servilius Structus mit einer erstaunlichen Ehrfurcht von Julius Yahya gesprochen. Herrscher und Generäle hören auf sein Wort, hatte er gemeint. Er hält die Welt in seinen Händen. Umso seltsamer erschien es Drust, dass ein solcher Herkules hier vor ihnen saß und einen Schatten warf wie ein gewöhnlicher Sterblicher. Dass er seine mit Altersflecken bedeckten Hände zeigte und einen leichten Geruch von salzigem Schweiß, teurem Duftöl und noch etwas anderem ausströmte – etwas, das der Geruch von Erfolg, von Stärke oder auch nur von Angst sein mochte. Oder von allem zusammen.
Drust vermied es, Kag anzusehen, doch er wusste, dass sein Freund wahrscheinlich ähnliche Gedanken hatte. Servilius Structus hatte sie vorgeblich hierher gesandt, weil sie nicht in Rom bleiben konnten, doch da war etwas zutiefst Beunruhigendes in seiner Stimme und seinen Augen gewesen, als rechne er damit, sie nicht wiederzusehen.
Und nun fragte sich Drust, wieso der reiche, mächtige Julius Yahya sich die Mühe gemacht hatte, von so weit her zu kommen, um sich mit ihnen zu treffen, die ihrerseits von Servilius entsandt worden waren. Und was dieser Mann mit Servilius Structus zu tun haben mochte, der offensichtlich Angst vor ihm hatte.
Für Drust war das alles ein einziges Rätsel, und er sah nur eine Möglichkeit, es zu lösen: Ich kann ihn fragen.
»Was willst du von uns?«
»Danke, dass ihr gekommen seid«, begann Julius Yahya zu ihrer beider Verblüffung. Dann wandte er sich dem Schatten des alten Mannes zu und lächelte. »Abu – Scharbat für mich.«
Der Alte musste es vorhergesehen haben, denn der eisgekühlte Becher kam augenblicklich. Der feine Duft machte Drust den Mund wässrig. Es erschien ihm so unwirklich, hier im sanft flackernden Licht zu sitzen und sich von einer Schüssel voller Eis kühlen zu lassen – ein unvorstellbarer Luxus inmitten himmelschreiender Armut, als hätte jemand eine Handvoll Gold auf einen Misthaufen geworfen.
»Ich danke dir, Abu. Drusus, Kagiza – danke noch einmal, dass ihr gekommen seid.«
Das ist seine Art, erkannte Drust. Er nimmt dir den Wind aus den Segeln mit seiner Höflichkeit, windet sich hin und her wie eine Schlange, die den richtigen Moment abwartet, um zuzuschlagen. Julius Yahya drehte sich zu dem Schatten hinter ihm um.
»Möchtest du Wein?«
Der Mann hinter ihm hob seine dunkle Hand mit einer sparsamen, eleganten Geste, wie um seine innere Anspannung aufrechtzuerhalten. Julius Yahya registrierte die wortlose Verneinung, als hätte er nichts anderes erwartet, wandte sich wieder Drust und Kag zu und hob seinen mit Mänaden und Weintrauben verzierten Becher.
»Vor dreißig Jahren benötigte man über hundertdreißig Kannen Wasser, um eine dicke Amphore hiervon zu bekommen«, erklärte er. »Heute genügt dafür die Hälfte. Für den Wein, den ihr trinkt, wurden ungefähr zwanzig Kannen Wasser benötigt – fast ausschließlich für die Bewässerung. In Ländern wie diesem braucht es immer noch täglich fünftausend Kannen Wasser, um den täglichen Nahrungsbedarf einer vierköpfigen Familie wachsen zu lassen. Das spärliche Wasser wird nach und nach vom Sand verschluckt, mit jedem Tag ein bisschen mehr. Da kann man Aquädukte und Leitungen bauen, so viel man will.«
Drust schwieg, doch Kag richtete sich auf seinem Stuhl auf und hob seinen Becher.
»Danke für den Wein«, sagte er. »Das hier erinnert mich ein bisschen an die Lebensmittelverteilung in der Subura. Auch dort nimmt man das Geschwätz in Kauf, um zu Brot zu kommen.«
Julius Yahya zeigte keine Spur von Verärgerung – im Gegenteil, er nickte zustimmend. »Du denkst, ich halte euch hier einen Vortrag über den Wert des Wassers. Du glaubst, alles über diese Dinge zu wissen, weil ihr beide, du und Drust, mit den harten Seiten des Geschäfts zu tun habt und den Blutzoll kennt, der jeden Tag für einen erfolgreichen Handel entrichtet werden muss.«
Er hielt inne und nahm einen Schluck.
»Du irrst dich. Du hast keine Ahnung, was die Dinge wirklich kosten. Das wissen nur wenige; die meisten machen sich darüber gar keine Gedanken – und wenn, dann nur, um sich über den Preis zu beklagen. Natürlich ist das Imperium auf den Handel angewiesen, auf die Erträge, die damit verbunden sind.«
Einige Augenblicke sprach keiner ein Wort, doch die Stille hielt nicht lange an.
»Das kostbarste Gut ist nicht Getreide, auch nicht Gold«, fuhr er fort. »Nicht einmal Wasser, obwohl es hier so knapp ist. Das wertvollste Gut ist Vertrauen. Der Glaube daran, dass die Leute eine Vereinbarung einhalten. Das befördert den Handel, das bringt letztlich die Erträge.«
»Bis jetzt erzählst du uns nichts Neues«, erwiderte Drust. »Jeder kleine Straßenhändler in irgendeiner Stadt des Reichs weiß das. Es verrät uns nicht, was du von uns willst.«
»Geduld, Geduld«, meinte Julius Yahya lächelnd.
Drust begann allmählich, eine Abneigung gegen diesen Mann zu entwickeln.
»Ich erzähle euch das alles, weil ihr aus eurer begrenzten Sicht vielleicht zu der Auffassung gelangt seid, dass der Handel sich durch nichts und niemanden aufhalten lässt, dass die Leute immer kaufen und verkaufen werden.«
Wieder nahm er einen Schluck, dann schob er den Becher zur Seite.
»Aber so ist es nicht. Wenn jemand ›Nein‹ sagt, einfach nur ›Nein‹, dann kommt der ganze Mechanismus zum Stillstand, als würde jemand Knüppel in ein Schöpfrad werfen. So ist es auch im Handel – wenn irgendwo ein Rad blockiert wird, kommt alles zum Erliegen, mit furchtbaren Folgen für alle.«
Er breitete die Hände aus. »Das ist der Kampf, den ich jahrein, jahraus führen muss. Dafür zu sorgen, dass das Vertrauen überall gewahrt bleibt – das ist die Aufgabe, die ich zu erfüllen habe, im Namen meines … Patrons. Vertrauen lässt sich auf verschiedene Weise herstellen und sichern, unter anderem durch Einschüchterung – und deshalb seid ihr hier.«
»Genau das frage ich mich schon die ganze Zeit«, erwiderte Kag. »Weshalb wir hier sind.«
Er hatte seinen Becher geleert und saß ganz ruhig da, ein angedeutetes Lächeln auf den Lippen, das Drust gut kannte; es bedeutete Gefahr.
»Meinem Patron ist etwas Wertvolles abhandengekommen«, fuhr Julius Yahya fort. »Etwas, von dem das Vertrauen eines ganzen Volkes abhängt. Deshalb muss es gefunden und zurückgeholt werden.«
Drust vermied es, Kag anzusehen, und hoffte, sein Freund würde schweigen. Kag tat ihm den Gefallen nicht.
»Dein Patron«, sagte er und ließ das Wort auf seiner Zunge zergehen wie zuvor das zerstoßene Eis. »Du meinst, dein Herr.«
Seine Worte klatschten auf den Tisch wie ein Kothaufen. Drust spürte, dass der Schatten hinter Julius Yahya sich bewegte, und spannte sich innerlich an. Kag lehnte sich lächelnd zurück. Julius Yahya, ein Sklave mit mehr Pfeilen im Köcher als das Heer eines mittelgroßen Reichs, sah Kag unverwandt an, den freigelassenen Sklaven mit einem Tonbecher in der Hand und einem Lächeln auf den Lippen. Ihre Blicke verkeilten sich ineinander wie Hirschgeweihe.
»Patron oder Herr«, sagte Julius Yahya langsam, »du magst es nennen, wie du willst. Es spielt keine Rolle, wer er ist. Es genügt, dass er euren Patron in der Hand hat, so wie euer Patron euch in der Hand hat. Das ist der Lauf der Welt.«
Drust spürte, wie es ihn eiskalt überlief. Er bemühte sich, Kag nicht anzusehen, doch es ließ sich nicht verhindern. Kag spürte seinen Blick, wandte sich ihm zu und zuckte mit den Schultern.
Wenn es stimmte, was Julius Yahya sagte, musste der Mann, dem dieser einflussreiche Sklave gehorchte, über eine enorme Macht verfügen. Wenn ein so mächtiger Mann wie Servilius Structus vor diesem Sklaven auf die Knie ging, dann konnte man erahnen, welche Macht hinter Julius Yahya stehen musste.
Diese Stadt, Leptis Magna, war der Geburtsort des Kaisers, rief sich Drust in Erinnerung. Erneut lief ihm ein eisiger Schauer über den Rücken, und er warf Kag einen kurzen Blick zu, um ihm seinen Gedanken wortlos zu übermitteln. Kag nickte kaum merklich.
Julius Yahya war zufrieden mit dem Eindruck, den seine Erklärung auf die beiden Männer gemacht hatte, und streckte eine Hand aus. Dies war das Zeichen für den Mann hinter ihm, aus dem Schatten hervorzutreten. Er trug eine schlichte Tunika mit einem Gürtel um die Taille. Sein Kopf war lang und schmal, er hatte auffällig geformte Ohrläppchen und eine Haut so weiß wie Kreide. Er trug ein Amulett, was Drust überraschte; er hatte eher den Eindruck gehabt, dass diese Schattengestalt keine Furcht kannte und nicht darauf angewiesen war, die Götter mit solchen Mitteln gnädig zu stimmen. Im Licht der Lampe schimmerten seine Handrücken wie glatt poliertes Elfenbein, als er seinem Herrn mehrere Wachstafeln reichte; seine Handflächen waren jedoch dunkler und kein bisschen glatt, wie Drust nun erkannte.
Dieser Mann vertrug keine Sonne, nicht einmal für fünf Minuten, dachte Drust. Seine Haut würde sich nicht bräunen, sondern regelrecht verbrennen. Er musste sich fühlen wie eine Schildkröte in der Wüste, die in der ständigen Bedrohung lebte, von irgendwelchen grausamen Spaßvögeln auf den Rücken gedreht und liegen gelassen zu werden – nur dass er gegen solche Späße sicherlich gewappnet war. Und in der Dunkelheit schlug er wahrscheinlich so lautlos und tödlich zu wie eine Schlange.
»Danke, Verus.« Julius Yahya klappte die erste Wachstafel auf.
»Die Brüder des Sandes«, las er und krümmte die Lippen zu einem spöttischen Lächeln. »Das klingt schrecklich pathetisch. Seid ihr wirklich wie Brüder? Ich dachte immer, Gladiatoren dürfen keine Freunde haben.«
»Das gilt nur für Sklaven«, widersprach Kag. »Sklaven haben keine Freunde.«
Julius Yahya zuckte mit keiner Wimper, sondern saß einfach ganz ruhig da, die Wachstafel in seinen breiten Fingern, und las.
»Ihr seid sechs, wenn ich mich nicht irre. Ehemalige Gladiatoren und Sklaven. Heute seid ihr auf verschiedene Weise für Servilius Structus tätig.«
Er blickte auf und musterte Kag. »Hast du keinen anderen Namen als Kagiza? Das ist ein Sklavenname – hier steht, du bist ein freier Mann.«
Er wartete nicht auf eine Antwort – allerdings hatte Kag auch nicht vor, sich dazu zu äußern; sein kalter Blick sagte genug. Sein vollständiger Name erinnerte Kag allzu sehr an seine Zeit als Sklave, deshalb behielt er ihn für sich.
Julius Yahya wandte sich wieder seiner Wachstafel zu. »Du stammst aus dem Süden von Thrakien. Dein Vater war römischer Bürger und Legionär in der Dreizehnten Legion, starb ebenso wie deine Mutter an einer Seuche – ein schlimmes Jahr für dich. Danach hast du dich mit Diebstählen über Wasser gehalten – verständlich, aber trotzdem ein Verbrechen. Du wurdest verurteilt – Galeere oder Arena. Die Mittagsvorstellung.«
Als Julius Yahya angefangen hatte vorzulesen, hatte Drust zunächst angenommen, dass es sich um die üblichen Fakten handeln würde, die die römischen Behörden immer vermerkten, sobald man mit ihnen in Konflikt geriet – doch die Informationen, die Yahya zusammengetragen hatte, gingen deutlich weiter. Solche Dinge wusste normalerweise nur jemand wie Servilius Structus – und der würde sie nur unter Zwang oder für viel Geld herausgeben. Oder aufgrund einer Verpflichtung, der er sich nicht entziehen konnte. Drust spürte, wie ihm der kalte Schweiß ausbrach.
»Die Strafe wurde umgewandelt.« Julius Yahya musterte Kag nachdenklich. »Servilius Structus muss irgendetwas an dir gefunden haben, sonst hätte er dir nicht seine Zuchtpferde anvertraut, um mit ihnen zu arbeiten. Womit hast du ihn beeindruckt?«
Kag schwieg, weil Julius Yahya allem Anschein nach bereits alle Antworten kannte, und er nicht die Absicht hatte, sich auf die Spielchen des mächtigen Sklaven einzulassen. Dieser zeigte sich kein bisschen enttäuscht – im Gegenteil, wie sein Lächeln erkennen ließ.
»Du hast bewiesen, dass du mit Pferden umgehen kannst und mit Waffen ebenso. Du hast die Gladiatorenschule besucht, hast fünfzehn Kämpfe bestritten, davon ein Dutzend gewonnen. Zweimal unentschieden – stans missus. Du hast lesen gelernt und Philosophie studiert, wahrscheinlich nur, weil dein Herr dich für eine plebejische Familie, die Gens Acilia, arbeiten ließ, wo du dem jungen Marcus Acilius Glabrio als Leibwächter gedient hast.
Du hattest dafür zu sorgen, dass der Bengel seinen Unterricht besucht und sich nicht aus dem Staub macht«, fuhr Julius Yahya fort. »Wie es scheint, hast du mehr gelernt als er.«
Er blickte von seiner Tafel auf und lächelte erneut. »Du musstest nichts weiter tun als zuzusehen, wie der Junge seine Möglichkeiten ungenutzt ließ, und dabei selbst lernen. Die Erziehung der Jugend ist das Fundament eines Staates.«
Drust vermutete, dass der Ausspruch von irgendeinem berühmten Mann stammte. Kag kannte ihn, wie Julius Yahya vorhergesehen hatte.
Kag wartete einen Moment, ehe er seinerseits mit einem Ausspruch konterte. »Hunde und Philosophen sind überaus nützlich – doch es wird ihnen nicht gelohnt.«
»Ich bin ein Hund, weil ich die, die mir etwas geben, anwedle, die, die mir nichts geben, anbelle, und die, die mir lästig fallen, beiße«, gab Yahya zurück.
»Im Haus eines reichen Mannes«, erwiderte Kag leise, »gibt es keine schmutzige Stelle, wo man hinspucken kann – außer ins Gesicht des Hausherrn.«
Julius Yahya lachte vergnügt und zeigte seine weiß schimmernden Zähne. »Diogenes von Sinope«, erklärte er, an Drust gewandt, als wäre dieser ein Kind, das noch viel zu lernen hätte.
»Du irrst dich, wenn du glaubst, dass mich das auch nur einen Furz interessiert«, schoss Drust zurück.
Zum ersten Mal verdüsterte sich Julius Yahyas Miene.
»Drusus Servilius, besser bekannt als Drust. Aus dem Volk der Kaledonier, vor dreißig Jahren als kleines Kind bei einem Angriff verschleppt. Sehr ungewöhnlich, dass du lange genug überlebt hast, dass Servilius Structus dich kaufen konnte – als hätten die Götter noch etwas mit dir vor. Die Mutter gestorben, als du neun warst. Hast für Servilius Structus gearbeitet, hauptsächlich Getreidetransporte, und später die Gladiatorenschule besucht. Acht Kämpfe – sechs verloren, zwei gewonnen.«
Er hielt für einen Moment inne. »Nicht gerade erstklassig. Du bist in der einen oder anderen Arena in der Provinz aufgetreten, hast in kleinen Städten ohne Amphitheater auf dem Forum gekämpft. Trotzdem müsstest du eigentlich tot sein, wenn man deine kümmerliche Bilanz betrachtet. Angeblich wurdest du jedes Mal verschont, weil du dich tapfer geschlagen hast.«
Drust war sich bewusst, dass die Leute oft eine falsche Vorstellung von der Tätigkeit eines Gladiators hatten. Die meisten dachten, der Verlierer eines Kampfes müsse unweigerlich sterben. Da die Ausbildung der Gladiatoren jedoch viel Geld kostete und sie nur etwa drei- oder viermal im Jahr kämpften, wurden sie normalerweise verschont. Sie starben lediglich durch einen Unfall, wenn der Spielgeber für ihren Tod aufkam oder wenn sie den Kampf verloren und dabei keine gute Figur machten.
Drust hatte sich stets wacker geschlagen, er hatte tatsächlich in Provinzarenen gekämpft, sogar auf staubigen Marktplätzen. In solchen kleinen Städten saßen die Veranstalter der Spiele immer im Stadtrat und mussten mit ihrem Geld sparsam umgehen; tote Gladiatoren konnten sie sich nicht leisten. Drust hatte in sorgfältig einstudierten Schaukämpfen heroische Rollen gespielt und war damit vier Jahre lang gut gefahren.
Er behielt seine Gedanken jedoch für sich und zuckte nur mit den Schultern. »Nicht jeder kann ein Spartacus sein.«
Julius Yahya musterte ihn einen Moment lang. »Du hast deinem Lanista einmal das Leben gerettet, als du ihn auf den Straßen der Stadt begleitet hast. Hast ein Dutzend junge Rüpel abgewehrt. Einen hast du mit einem Holzknüppel getötet.«
»Wenn man die richtige Stelle erwischt«, erwiderte Drust ungerührt, »kann sogar ein Löffel zur tödlichen Waffe werden. Trotzdem stimmt einiges nicht von dem, was du da von deinem Täfelchen abliest. Nicht ich habe den Kerl getötet, und er war auch kein ›Rüpel‹, sondern ein Kämpfer aus einer anderen Gladiatorenschule, der für den Überfall angeheuert wurde. Außerdem waren es nicht ein Dutzend Angreifer, sondern höchstens eine Handvoll. Und gerettet wurde nicht der Lanista, sondern Servilius Structus. Der Lanista ist der Gladiatorenmeister – unserer war ein Scheißkerl namens Sophon. Hätte ihn jemand angezündet, hätte ich ihn nicht mal angepisst, um ihn zu retten.«
Er erinnerte sich an das grinsende Gesicht des jungen Kaisersohns, seinen dreisten »Missio«-Ruf, um verschont zu werden, nachdem er versucht hatte, Drust mit seinem Schwert niederzumachen. Caracalla hatte Servilius Structus mit voller Absicht angegriffen und deshalb ein paar richtige Kämpfer aufgeboten, um ihm eine Lektion zu erteilen oder ihn zu töten. Warum – das war Drust immer noch ein Rätsel, aber wahrscheinlich steckte nichts anderes dahinter, als dass ein verwöhnter Bengel Lust hatte, seine grausamen Neigungen auszuleben.
Servilius Structus hatte nur mit den Schultern gezuckt, als Drust ihn danach gefragt hatte, doch er war leichenblass geworden. Es habe sich um eine alte Geschichte gehandelt, hatte er erklärt, und Drust solle sich deswegen keine Gedanken machen. Am besten wäre es, Drust würde für eine Weile aus Rom verschwinden.
Drust war im ersten Moment geschockt gewesen, fast so wie an dem Tag, als der fette Alte ihn aus seinem Dienst entlassen und ihm die Freiheit geschenkt hatte. Es war, als hätte Servilius ihn ins eiskalte Meer geworfen.
Die Freiheit hatte sich als eine bittere Frucht herausgestellt. Ein Sklave, der in der Arena kämpfte, bekam täglich seine vier Mahlzeiten, freies Quartier, beste medizinische Betreuung, dazu als Gladiator auch noch die Möglichkeit, sich jederzeit mit den Huren zu vergnügen, die Servilius Structus für seine Kunden aus gutem Hause bereitstellte, die es eigentlich besser wissen sollten.
Der frischgebackene Freigelassene Drusus Servilius musste nun selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen – und das Einzige, was ihm einfiel, war, weiter für Servilius Structus zu arbeiten, für den gleichen Lohn, den er zuvor als Sklave erhalten hatte. Der einzige Unterschied bestand darin, dass er nicht mehr in die Arena musste und stattdessen die Aufgabe übernahm, den Transport wertvoller Güter in entlegene Teile des Reichs zu eskortieren und somit der Aufmerksamkeit des angesäuerten Kaisersöhnchens zu entgehen.
Streitwagen, Pferde und Kämpfer in die Provinzen, Zuchtpferde nach Afrika, Getreide und weißer Spezialsand nach Rom – die Geschäfte führten Drust und die anderen oft für längere Zeit weit weg von Rom. Wenn sie zurückkehrten, wurden sie für andere Aufgaben eingesetzt, die für das jeweilige Opfer unweigerlich tödlich endeten.
Als freier Mann musste er erkennen, dass ehemalige Sklaven überall als Abschaum galten. Somit änderte sich für ihn nicht viel, denn schon als Gladiator hatte er im allgemeinen Ansehen noch eine Stufe unter den Huren gestanden. Drust fand das in gewisser Weise sogar recht passend. In beiden Tätigkeiten trug man seinen Körper zu Markte und versuchte irgendwie zu überleben. Zwei Seiten derselben Medaille. Er hatte gedacht, als freier Mann endlich ein anderes, besseres Leben führen zu können. Ein Irrtum. Die Leute wussten, woher er kam, und wenn er das Sklavenzeichen an seinen Händen selbst an den heißesten Tagen unter der Tunika verbarg, wussten sie erst recht Bescheid.
»Nun bist du der Anführer dieser sogenannten Brüder des Sandes«, fuhr Julius Yahya fort, »zu denen auch unser philosophisch geschulter Stallbursche hier gehört. Wie sagte schon Heraklit: Dadurch, was du Tag für Tag wählst, was du denkst, was du tust, wirst du der, der du bist.«
»Zum Hades mit dir«, erwiderte Kag liebenswürdig. Drust beobachtete, dass der Mann hinter Julius Yahya ein wenig zurückzuweichen schien, als sammle er seine ganze Kraft. Drust wollte etwas sagen, seinem Freund die Hand auf den Arm legen, um ihn zu zügeln, doch er rührte sich nicht und sagte kein Wort.
»Wir sind Prokuratoren, nach den Procuratores dromi«, fügte Kag hinzu.
Einen Moment lang war Stille, dann lachte Yahya leise und nickte. Die Procuratores dromi hatten die Aufgabe, während der Wagenrennen auf die Bahn zu laufen und herumliegende Trümmer ebenso zu beseitigen wie Tote und Verletzte, aber auch gestürzte, schreiende Pferde. Danach streuten sie frischen Sand aus, um das Blut zu binden, und glätteten die Bahn, damit das Spektakel weitergehen konnte. Mit dieser gefährlichen, undankbaren und schlecht bezahlten Tätigkeit verglich Servilius Structus offenbar die Aufgaben, die er Drust und den anderen übertrug, da er sie im Scherz als Prokuratoren bezeichnete. Sie selbst nannten sich Brüder des Sandes.
»Sibanus Servilius«, fuhr Julius Yahya fort. »Seltsamer Name, aber er stammt aus dem Volk der Garamanten, ein Mavro. Euer ehemaliger Herr hat ihn als Wagenlenker angeheuert; wie ich sehe, hat er sechsunddreißig Rennen bestritten, davon neunzehn gewonnen, ist in zwölfen Zweiter geworden und die restlichen unplatziert geblieben. Anscheinend ist er so etwas wie ein Kundschafter in eurer kleinen Gruppe.«
Drust stierte ihn ausdruckslos an. Mavro – »Schwarzer« – so nannten die Römer spöttisch Menschen von dunkler Hautfarbe, wenngleich sich das inzwischen gelegt hatte, da der Kaiser selbst eher dunkel- als hellhäutig war, was – leicht abgeschwächt – auch für seine Söhne galt. Sib war geschmeidig und in der Nacht so gut wie unsichtbar, solange er nicht gerade lächelte. Doch das tat er nicht oft. In Wahrheit stammte er nicht aus dem Volk der Garamanten, sondern aus einem weiter südlich ansässigen Stamm in den Tiefen der Wüste.
»Er ist ein richtiger Wüstenkrieger«, bestätigte Julius Yahya und seufzte. »Wenn du von hier aus einen Stein wirfst, egal in welche Richtung, wirst du ein halbes Dutzend wie ihn treffen. Es war eine Gnade der Götter, dass er gefangen genommen wurde und Servilius Structus in die Hände fiel. Der Mann scheint ein Auge für fähige Leute zu haben. Andernfalls wäre er bloß ein junges Leben mehr gewesen, das sinnlos erlischt.«
»Aber jetzt«, warf Kag leise ein, »blutet er natürlich für das Imperium.«
»Das Imperium hat ihm immerhin das Leben gerettet«, erwiderte Yahya gelassen. »Sonst wäre er in der Garnison von Tingis ans Kreuz geschlagen worden. Die haben dort nämlich keine Spiele zur Unterhaltung – ihr Zeitvertreib ist daher von etwas grausamerer und tödlicherer Art.«
Das alles wussten sie nur zu gut. Ebenso wussten sie, wer noch auf Yahyas Liste stand. Manius Servilius, ein Mann, der nach außen so gutmütig wirkte wie ein Priester der Göttin Ceres, der die Gläubigen zum Erntedankfest empfing, mit seinen Lachfältchen und seinen ebenmäßigen Zähnen, die gelb verfärbt waren von irgendwelchen Kräutern aus den östlichen Provinzen, die er kaute, wenn er sie irgendwo bekam.
Es konnte vorkommen, dass er jemandem herzhaft die Hand schüttelte und mit der anderen Hand seinen krummen Dolch zog, eine tödliche Klinge aus Judäa, die an den Giftzahn einer Schlange erinnerte. Er bewegte sich völlig lautlos und tötete ohne Skrupel. Wenn er seinen Bogen zur Hand nahm und einen Pfeil in die Sehne legte, gab es für sein Opfer kein Entrinnen.
Auch er stammte aus irgendeiner Wüstengegend, doch Sib traute ihm nicht über den Weg; er sah in Manius etwas Dunkles, Dämonisches. Manius kümmerte sich nicht darum. Er war im Ludus Ferratus ausgebildet worden, der Eisernen Gladiatorenschule von Servilius Structus, hatte sechzehnmal gekämpft und ebenso oft gewonnen, doch seine Freiheit hatte er sich durch die mitunter etwas unappetitlichen Aufgaben erworben, die er an Drusts Seite für Servilius Structus ausführte.
Ugo war ein hünenhafter, strohblonder Spezialist im Umgang mit der Streitaxt, den Aufzeichnungen zufolge ein Germane, genau genommen aus dem Volksstamm der Friesen. Für ihn selbst war seine Herkunft längst nebensächlich, ebenso wie die Art der Waffe, mit der er in der Arena kämpfte. Früher hatte er oft die Rolle des Hoplomachus, eines schwer bewaffneten Gladiators, übernommen, doch die Streitaxt war sein bevorzugtes Werkzeug. Ugo behauptete, in seiner alten Heimat einst ein Stammesführer gewesen zu sein. Er hatte kein Problem damit, Befehle auszuführen, verfügte aber gleichzeitig über die Fähigkeit, selbstständig zu denken, und hatte nie Geld in der Tasche.
Quintus Servilius war ein Kerl, der sich durch seine gerade, direkte Art auszeichnete. Er war schlank und drahtig gebaut und hatte das versonnene Lächeln eines Vagabunden. Quintus hatte die ganze bekannte Welt gesehen, alle möglichen Tätigkeiten ausgeübt und verfügte über einen ausgeprägten, bisweilen auch bissigen Humor, mit dem er jede Art von Verrücktheit aufs Korn nahm, dabei aber eine überraschende Nachsicht mit den Narren zeigte. In der Arena hatte er als Retiarius mit Wurfnetz und Dreizack gekämpft, eine Rolle, die Schnelligkeit, Schlauheit und Präzision verlangte. Er hatte etwa ein Dutzend Einsätze in den Provinzen absolviert, doch die Leute verabscheuten den Retiarius, weil er fast nackt kämpfte, was allgemein als zu griechisch empfunden wurde. Er selbst war besonders unbeliebt, weil er seine Kämpfe überlebt hatte. Der Retiarius trug einen offenen Helm – die Zuschauer liebten es, die erlöschenden Augen eines sterbenden Kämpfers zu sehen.
Drust erinnerte sich, wie Quintus bei dem Vorfall in den Straßen Roms aus der Gasse gestürmt war wie ein Wirbelwind. Er hatte gelacht, so wie früher, wenn er an der Seite von Supremus, dem Gallier, gekämpft hatte. Als Supremus eines Tages aus der Arena geschleift wurde und man ihm vorsichtshalber noch einen kräftigen Schlag auf den Kopf versetzte, um sicherzugehen, dass er tot war, hatte Quintus sich als Einziger um eine angemessene Bestattung des Toten gekümmert.
Das alles war nur ihnen selbst und Servilius Structus bekannt, und es gefiel Drust gar nicht, dass Julius Yahya, dieser leicht nach Zimt und Rosen duftende Sklave, es ebenfalls wusste. Es war, als würde man sie auf dem Sklavenmarkt nackt zum Verkauf feilbieten.
Sie waren die Procuratores, die Brüder des Sandes – Männer, die einander gut kannten, die durch ihre gemeinsame Vergangenheit verbunden waren, durch die Erinnerung an den Angstschweiß in den unterirdischen Gewölben schäbiger Amphitheater und an irgendwelche heiligen Wüstenorte, wo sie am Lagerfeuer gesessen und eine Ziege gebraten hatten. Männer, die Rücken an Rücken und Seite an Seite gekämpft hatten, über und über bespritzt vom Blut der Toten. Sie hatten es mit Feiglingen und niederträchtigen Bastarden aller Hautfarben und Völker zu tun bekommen. Gemeinsam hatten sie die letzten Worte der Sterbenden vernommen und manchmal ein Stöhnen der Lust, auch wenn es vielleicht nicht immer echt war.
Einmal hatte man sie ins römische Heer eingegliedert, wo sie sich in der Rolle der Befreier sonnen konnten, als sie zusammen mit den Soldaten der Dritten Augusteischen Legion in Dörfer und Städte einmarschierten und einen Aufstand irgendwelcher in Lumpen gehüllter Kerle niederschlugen. Der Aufstand selbst ging Servilius Structus im Grunde nichts an – sein einziges Interesse bestand darin, dass seine schwer beladenen Wagen sicher in Rom ankamen. Die Legion hatte angenommen, dass sich in den Wagen Getreide für die römische Bevölkerung befand, doch in Wahrheit handelte es sich um feinen weißen Sand für die Arena. Drust und die anderen hätten dafür beinahe ihr Leben geopfert.
Nachdem sie in die Stadt einmarschiert waren, hatten sie zunächst die Gefangenen befreit und dann alles an sich genommen, was nicht niet- und nagelfest war. Die Herrschaft hatten sie in die Hände der hiesigen Anführer gelegt, die daraufhin alle »Verräter« an den Balken ihrer eigenen Häuser aufhängten, sodass sie aussahen wie seltsam geformte Flaschenkürbisse.
Sie hatten miterlebt, wie Menschen, die sie kannten, einen wenig glorreichen Tod starben, Menschen, die in ihren letzten Worten nicht ihren Kaiser oder ihr Vaterland würdigten, sondern einfach nur »Scheiße« hervorstießen, oder »Sagt meiner Mutter nicht, dass ich mir in die Hose geschissen hab«. Manchmal hatten sie Leute getötet, die vor ihnen auf dem Boden knieten und unter dem Johlen der Menge auf den Todesstoß warteten.
Irgendwann, dachte Drust, fing man an, sich zurückzuziehen – das war das erste Zeichen. Man entfernte sich von den anderen, als würde es das beiden Seiten irgendwie leichter machen, wenn der Tag kam. Selbst als freigelassener Sklave. Man ging den leichteren Weg, übernahm die einfacheren Transporte, bei denen die einzige Gefahr darin bestand, einem gelegentlichen Dieb in den Arsch zu treten, der sich schleunigst aus dem Staub machte. Servilius Structus hatte es gewusst, so wie er alles über seine Männer wusste. Sie waren nicht mehr dieselben, verloren den Biss, die Schärfe, die Kampfkraft.
Drust wollte keine größeren Herausforderungen mehr annehmen, als Wagen und Fuhrwerke zu eskortieren – das erkannte auch Julius Yahya; er wusste genau, wann er ein bisschen an der Angel ziehen musste, um den Fisch dazu zu bringen, sich in den Köder zu verbeißen. Er hob wortlos die Hand, worauf ihm eine Schriftrolle gereicht wurde. Er entrollte sie und drehte sie so, dass Drust und Kag sie sehen konnten. Sie war weiß wie ein neugeborenes Lamm, das Siegel darauf wie ein frischer Blutstropfen.
»Dieser Brief enthält eine Vollmacht, die selbst einen Legaten vor Neid erblassen ließe«, erklärte er. »Damit kommt ihr durch jede Sperre, die irgendein noch so hoher Amtsträger im Imperium errichten kann.«
Drust sah ihn wortlos an. Julius Yahya neigte die Schriftrolle leicht, sodass sie sich aufzurollen begann, und lächelte.
»Ihr alle, die ganze seltsame Bruderschaft, werdet reicher sein als die Götter. Dies ist ein Vertrag. Jeder von euch wird ihn unterzeichnen. Von dem Lohn, den ihr erhaltet, könnt ihr fünf Jahre im Luxus leben. Nur wer allzu verschwenderisch damit umgeht, sitzt schon nach einem Jahr auf dem Trockenen.«
Sein Lächeln gefror. »Euer Geld wird euch natürlich nicht viel nützen, wenn ihr nichts habt, worauf ihr sitzen könnt.«
Drust hielt den Atem an. Freigelassene Sklaven verfügten zwar über gewisse Rechte, aber es gab mehr als das …
»Bietest du uns etwa das Bürgerrecht an?«, fragte er, und Yahya nickte. Kag lachte laut auf, und Yahyas Kopf zuckte in seine Richtung; für einen kurzen Moment ließ er die Maske fallen, und etwas Wildes blitzte auf.
»Du verschmähst das Bürgerrecht?«
Kag zuckte die Schultern. »Was soll ich damit? Seit Kaiser Nero kann selbst ein Sklave vor Gericht gehen – aber Leute mit genug Geld können immer einen Richter bestechen, um sich das gewünschte Urteil zu erkaufen. Wenn du mich zum Bürger machst, habe ich das Stimmrecht; die Frage ist, ob ich mir die Reise in die Stadt leisten kann, denn man muss persönlich anwesend sein. Vor dem Gesetz spielt es keine Rolle mehr, ob ich den Honestiores oder den Humiliores angehöre – der Elite oder dem Abschaum. Wir sind alle gleich unwichtig, weil wir so oder so nichts zu sagen haben. Der Kaiser regiert, wie es ihm gefällt.«
Julius Yahya starrte ihn mit großen Augen an. Drust hätte jubeln können vor Genugtuung, dass Kag den Mann sprachlos gemacht hatte. Er schwieg jedoch und rutschte auf seinem Platz hin und her. Ein Bürger der Stadt Rom zu sein war für viele sicher erstrebenswert, allerdings nicht mehr das, was es einmal war.
»Besser ein römischer Bürger als ein bloßer Freigelassener«, brachte Yahya schließlich hervor – sichtlich bemüht, die Bitterkeit in seiner Stimme im Zaum zu halten. »Oder ein Sklave.«
»Du sitzt als Sklave hier«, erwiderte Drust, »darum mag es dir verlockend erscheinen. So wie es für uns verlockend war, in die Freiheit entlassen zu werden. Aber römische Bürger zu sein war nie ein Ziel für uns. Etwas anderes ist es mit dem Geld, das uns dieser Vertrag verspricht. Wenn es stimmt, was du sagst, und wir dadurch reicher als die Götter werden, dann wäre ich vielleicht auch als einfacher Freigelassener in der Lage, selbst dich zu kaufen.«
Einen langen Moment herrschte bleierne Stille; der Hass, den Julius Yahya ausstrahlte, war mit Händen zu greifen.
Drust beugte sich vor und hob beide Hände, die Handrücken Yahya zugewandt. »Ein Sklave gehört seinem Herrn voll und ganz. In jedem Augenblick, und selbst in seinen Träumen, wenn sein Herr es so will. Sein Besitzer kann über jede Stunde seines Tages verfügen, und das ist kein angenehmes Leben. Wenn dann im Alter die Kräfte schwinden, wird der Sklave nicht mehr gebraucht und durch einen jüngeren ersetzt. Was immer geschehen mag, dieses Zeichen bleibt uns erhalten, solange wir unsere Hände haben.«
Julius Yahya betrachtete Drusts Fingerknöchel mit den verhassten Buchstaben darauf: E.S.S.S. Drust sah Yahyas rechte Hand zur linken Schulter zucken, wo er sein Zeichen trug, diskret und verborgen, wie es bei besonders teuren Sklaven üblich war.
Drust lächelte. »Ego sum servus Servilius«, erklärte er. »Jeder Gladiator trägt dieses Stigma oder eines in dieser Art. In unserem Fall auf den Händen, wo es sich nicht verbergen lässt, denn wir sind Sklaven der Arena und doppelt verflucht in jeder Gesellschaft.«
Er legte seine Hände mit den Handflächen nach unten auf den Tisch und sah auf sie hinunter. »So wird man zum Sklaven gemacht – nicht durch Geburt oder Erziehung, nicht durch Klotho und die anderen Parzen, die den Lebensfaden spinnen und abschneiden. Alles, was es braucht, ist ein Pfund ägyptische Pinienrinde, zwei Unzen Bronze, zwei Unzen Galle, eine Unze Schwefelsäure. Dazu eine gehörige Portion Schmerz und Scham. Das alles wird gut vermischt, die Fingerknöchel werden mit Lauchsaft gewaschen, dann werden die Buchstaben mit spitzen Nadeln eingeritzt, bis das Blut fließt. Zuletzt wird die Tinte eingerieben.«
Drust blickte in Julius Yahyas funkelnde Augen. »Aber das weißt du ja alles selbst. Als Sklave kannst du noch so klug sein – wie du oder Kag –, du kannst trotzdem nie wirklich verbergen, was du bist – habe ich nicht recht? Du magst wertvoll sein, vielleicht gibt dein Herr mehr für dich aus als ein durchschnittlicher Händler für seine Kinder. Dennoch bist du nicht frei, auch wenn du mehr Freiheiten haben magst als ein Fischer, der jeden Morgen seine Netze auswirft, oder ein Sänftenträger, der Leute wie Servilius Structus durch die Stadt schleppen muss. Du magst mehr Freiheiten genießen als wir Freigelassenen, die wir immer noch die Zeichen unserer Unfreiheit tragen. Wir sitzen hier auf Geheiß von Servilius Structus, um zu tun, was dein Herr von uns will … falls wir dieses Dokument unterschreiben.«
Drust lehnte sich zurück. »Ein Freigelassener kann seinen Weg machen, wenn er Gelegenheit bekommt, sich zu beweisen, egal ob Bürger oder nicht. Was nützt mir das Bürgerrecht, wenn ich trotzdem meine Hände unter der Tunika verstecken muss?«
»Soll jedem alles offenstehen, gibt es keine Grenzen mehr?«, knurrte Julius Yahya.
»Keiner ist als rundum fertiger Mensch aus Jupiters Haupt entsprungen«, schoss Kag zurück. »Jeder fängt klein an.«
»Und was kommt als Nächstes?«, erwiderte Yahya zornig. »Legionen, die von germanischen Generälen mit wilder Mähne angeführt werden?«
»Wie wär’s damit, dass Rom von einem Mavro gelenkt wird, einem Afrikaner?«, warf Kag mit leiser Stimme ein.
Julius Yahya hob ruckartig den Kopf, dann lächelte er gequält und schob ihnen die Schriftrollen über den Tisch hinweg zu.
»So oder so, es wird euer Leben verändern.«
Drust sah ihn wortlos an, spürte Kags Blick auf sich ruhen, wagte aber nicht, ihn anzusehen. Es wird unser Leben verändern …
»Ich darf hinzufügen, dass euer Patron, Servilius Structus, ebenfalls seinen Lohn für eure Mühe erhalten wird«, fuhr Yahya fort.
»Na, dann ist ja alles gut«, meinte Kag lakonisch.
Drust erinnerte sich an die Worte, die Servilius ihnen mit auf den Weg gegeben hatte: Tut, was er euch sagt, ohne Wenn und Aber. Es war seine Art, Lebewohl zu sagen. Wir werden uns wahrscheinlich nicht wiedersehen.
Er lässt uns für einen anderen arbeiten, war es Drust in jenem Moment durch den Kopf gegangen. Wie Zuchtpferde, die ihre beste Zeit hinter sich haben und die man bereitwillig verleiht. Aber es ist noch viel schlimmer, dachte er nun. Er hat uns verschachert.
Julius Yahya schien Drusts Gedanken zu erahnen und lächelte.
»Wir müssen uns also kümmern um das, was Glückseligkeit schafft. Wenn sie da ist, so besitzen wir alles, wenn sie aber nicht da ist, dann tun wir alles, um sie zu besitzen.«
Kag zuckte mit den Schultern. »Wenn du dieses wesenhaft Schöne erblicken solltest, dann wird es dir nicht mit der Schönheit des Goldes und der Kleidung und mit schönen Knaben und Jünglingen vergleichbar erscheinen.«
»Applaudo«, meinte Julius Yahya bewundernd und sichtlich erfreut.
Drust hingegen hatte langsam genug von diesem Austausch kluger Sprüche irgendwelcher bärtigen Philosophen; bei solchen Gefechten kamen meistens unbeteiligte Zuschauer zu Schaden, dachte er. Außerdem ging es ihm gegen den Strich, dass sie ihn zunehmend ignorierten. Er fühlte sich so fehl am Platz wie in der Gesellschaft eines Liebespaars. Es war Zeit, daran zu erinnern, weswegen sie eigentlich hier waren und wie viel dabei auf dem Spiel stand.
»Gut, wir werden alle zu reichen römischen Bürgern«, warf er in rauem Ton ein. »Mir soll’s recht sein. Es macht mich richtig glücklich. Und genau das macht mir Angst. Denn immer, wenn ich glücklich bin, passiert irgendwas Schlimmes. Das habe ich einmal auf einer Mauer am Forum gelesen.«
Das Geräusch kam so überraschend, dass sie kurz erschraken, sogar Julius Yahya. Alle drehten sich zu Verus, dem stillen Mann im Schatten, um, der laut aufgelacht hatte.
»Was müssen wir für so viel Glück tun?«, fragte Drust in die darauffolgende Stille.
KAPITEL 1
Britannia inferior, sechs Monate später
Es war ganz einfach. Sie mussten nur eine Frau und ihr Kind zurückholen, die von Banditen verschleppt worden waren. »Die Epidier«, hatte Julius Yahya hinzugefügt und das Wort einen Moment lang auf sich wirken lassen, als wäre es ein exquisiter Wein. »Die sind alle Banditen. Eine bestimmte Frau muss zurückgebracht werden; sie hat ein Kind – und ihr könnt euch vorstellen, dass sie alles tun würde, falls es bedroht wird, deshalb müsst ihr den Jungen ebenfalls zurückbringen. Beide sind Sklaven – ihr dürft der Mutter kein Wort glauben, falls sie etwas anderes behauptet. Ihr bringt die beiden zu einem gewissen Kalutis in Eboracum, einer Stadt in Britannia inferior – oder was man dort unter einer Stadt versteht. Von dort wird das Imperium zurzeit regiert, bis der Kaiser mit den Fellträgern fertig ist. Verus wird auch dort sein; er wird sich um die Frau und das Kind kümmern und euch bezahlen. Wenn alles vorbei ist, wärt ihr gut beraten, die Sehenswürdigkeiten des Reichs zu genießen, überall – nur nicht in Rom.«
Banditen. Ein hübsches Wort, dachte Drust. Es hatte so einen romantischen Klang nach Draufgängertum und Abenteuer. Die Epidier hatten allerdings nichts Romantisches an sich. Sie existierten eigentlich nur als Name, unter dem die Römer verschiedene Stämme zusammenfassten – den Stamm vom Blauen Fluss, den Stein-Clan, den Schwarzbärstamm und einige mehr, die das Gebiet bis hinauf zu den Wäldern im Norden bewohnten. Sie waren einmal Drusts Volk gewesen, wenngleich sie heute für ihn nur noch Fremde waren – schließlich war er schon als kleines Kind verschleppt worden. Er glaubte aber nicht, dass man ihn deswegen für diese Aufgabe ausgewählt hatte.
Die Armee war bereits dort und quälte sich durch das sumpfige Land, durch dunkle Wälder, und ließ eine Spur von Blut und Leichen zurück. Doch sie waren viele, und einige tapfere, fähige Kämpfer hätten sich sicher für eine solche Unternehmung finden lassen. Wie es schien, sollten jedoch möglichst wenige von der Sache erfahren.
»Dann zahlt ihnen doch einfach ein Lösegeld«, hatte Kag gemeint. »Gut möglich, dass die Banditen Wort halten und die Frau lebend freilassen. Sie ist die Tochter irgendeines hohen Tiers, oder? Vielleicht eines Stammeshäuptlings? Bestimmt haben die es auf das Geld der Familie abgesehen.«
»Der Mann, der sie entführt hat, will kein Lösegeld, das hat er klar gesagt«, hatte Julius Yahya erwidert. Kag und Drust hatten einander verwundert angesehen.
Liebe oder Politik, dachte Drust. Vielleicht auch beides – und irgendwie mussten die Mächtigen auf dem Palatin damit zu tun haben. Ihm gefiel die Sache jedenfalls gar nicht, sie machte ihm regelrecht Angst. Es war, als würden dunkle Schatten aus der Unterwelt nach ihm greifen, um ihn an den Ort zurückzubringen, an dem er am allerwenigsten sein wollte. Er hatte Rom verlassen, um sich vor den Rachegelüsten des Kaisersohns in Sicherheit zu bringen, dem er eine schmerzhafte Lektion verpasst hatte – und jetzt bot man ihm viel Geld dafür, dass er dorthin zurückkehrte. Es war eine Falle, doch er würde ihnen nicht den Gefallen tun und hineintappen …
Julius Yahya hatte ihn angesehen wie ein Fischer, der sich völlig sicher war, dass ihm die Forelle nicht mehr entwischen konnte.
»Der Mann, der diese Frau und ihr Kind entführt hat, heißt Colm. Ich glaube, du kennst ihn.«
Und ob Drust ihn kannte. Für die Brüder des Sandes war Colm immer nur »der Hund« gewesen. Wenn Drust an ihn dachte, sah er ein verzerrtes Gesicht vor sich und Hände, die sich vergeblich gegen die Ketten wehrten. Er hatte Drust verflucht für das, was er seiner Frau antat.
Drust kannte seine Frau gar nicht, doch der Hund hatte immer irgendwo eine, also war das keine Überraschung. Überraschend war nur, was er für diese Frau getan hatte – er hatte sich Bulla, dem Anführer einer Bande von Räubern und Aufständischen, angeschlossen. Sechshundert Mann zogen plündernd über die italische Halbinsel. Während der Kaiser neue Territorien eroberte, vernachlässigte sein Sohn Antoninus seine Aufgaben als Mitkaiser. Lieber zog er selbst mit seiner Bande durch die Straßen von Rom und fiel über unschuldige Bürger her. Zwei Jahre hatte es gedauert, bis er Bulla gefasst hatte; für viel Gold hatte jemand den Anführer verraten, worauf seine Bande sich auflöste. Der Hund hatte wie immer Pech gehabt, hatte zu spät die Seite gewechselt, um am Geldsegen teilzuhaben, und war nur um Haaresbreite entwischt.
War das Kind dieser Frau von ihm?, fragte sich Drust. Wäre Colm lange genug geblieben, hätte Servilius Structus ihn ebenfalls in die Freiheit entlassen. Als er dann hörte, dass Colm mit Banditen losgezogen war, schickte er seine Prokuratoren aus.
»Ich will ihn nicht tot«, hatte er gemeint. »Er soll sich bloß wünschen, er wäre es.«
Sie hatten ihn lange gejagt, nachdem Bullas Bande sich aufgelöst hatte. Am Ende waren sie frustriert und mit leeren Händen in die Stadt zurückgekehrt. Doch der Hund hatte sich nicht lange von Rom fernhalten können. Er war noch nicht lange in der Stadt, als sie ihn fanden – zum Glück ohne Frau und Kind, denn Ugo verprügelte ihn, bis er Blut pisste, dann ließen sie ihn in Ketten in einem Keller des Armenviertels liegen, in dem sie ihn aufgestöbert hatten.
Colm hatte sie angefleht, ihn freizulassen, schließlich habe er seine Strafe bekommen. Später hörte Drust, dass er sich mit der Frau hätte treffen sollen und dass sie von ihm abhängig war, doch auch ohne Ketten hätte er nicht zu ihr gehen können, weil sie ihm das Bein gebrochen hatten.
Drust dachte lange darüber nach, dann kritzelte er seinen Namen auf den Vertrag und sah Kag an; der blies die Backen auf und machte es ebenso.
Sie hätten nicht erklären können, warum sie es taten, aber die anderen setzten ebenfalls ihr Zeichen unter das Schriftstück, als sie erfuhren, dass Colm, der Hund, in die Sache verwickelt war, auch wenn keiner zugeben wollte, dass er es seinetwegen tat; sie behaupteten, es ginge ihnen nur ums Geld und das römische Bürgerrecht.
Drust drängte den Gedanken beiseite, zusammen mit allem anderen, mit dem er sich nicht mehr beschäftigen wollte. Stattdessen konzentrierte er sich auf die Frage, wie sie möglichst unbemerkt nach Norden gelangen konnten.
Der Junge sah sie schon von Weitem, als sie auf der Südseite der Mauer aus Richtung Westen auftauchten. Sie hatten kurze Haare, rochen aber irgendwie nach langen Haaren und sahen auch ein wenig abgerissen aus, abgesehen von ihren Waffen. Der Junge hatte ein Ende seines aus rauem Stoff gewobenen Umhangs über den Kopf gezogen, um sich selbst und die Stöcke, die er gesammelt hatte, vor dem Regen zu schützen. Es waren gute Stöcke, gerade und ohne Knoten – daraus ließen sich gute Hackenstiele machen, dachte er.
Langsam, aber entschlossen marschierte er los, um zu seinem Vater zurückzukehren. Wenn Fremde auftauchten, war es nie verkehrt, ihn zu warnen, auch wenn sich in letzter Zeit viel mehr von ihnen hier herumtrieben als je zuvor.
Sein Vater hörte zuerst gar nicht zu, er war zu beschäftigt damit, einen Hackenkopf am Stiel zu befestigen – vom unteren Ende her. Das war zwar schwieriger, als den Kopf von oben aufzusetzen, lieferte dafür aber ein dauerhafteres Werkzeug. Da die Hälfte seiner Kunden von der Armee war, konnte er ihnen unmöglich Hacken verkaufen, deren Stiel sich schon nach kurzem Gebrauch löste.