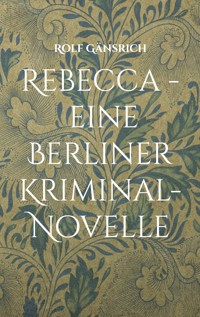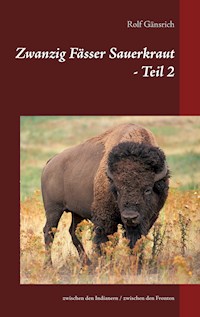7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was einem im Einzelhandel der DDR so passierte und wie man darin die Wende erlebte ist der erste Teil. Er war aber für ein einzelnes Buch nicht ausreichend. Was ich mit meinem Hund, einer süßen Pudeline, erlebte, war leider auch nicht ausreichend für ein Buch. Deshalb und weil ich im April 2020 seit fünfzwanzig Jahren im Radio "on air" bin, noch die Radiogeschichten. Was kann man alles für interessante Menschen im Studio kennenlernen und warum macht "Radio machen" einfach Spaß, kann man hier erfahren. Die Hintergründe immer journalistisch korrekt recherchiert, die Texte im Radioformat, .... kurz halt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Kaufhallengeschichten
Prolog
HO
Ratten in der Kantine
Wollen sie auch Kaffee?
Wie der Einzelhandel funktionierte
Ein Pfund
Lieferung aus West-Berlin
Brokkoli
Das vergessene Sauerkraut
Tüten drehen, Blumenkohl brechen und andere alte Techniken
Hygienekontrolle
Spitzkohl und Melonen
MHO
Echtes Bananeneis
Der eingeschlossene Peter
Kurt Böwe und andere Merkwürdigkeiten
Die Jagd nach der Wochenpost
Erwin braucht seinen Anschreier
Mit Marina im Kühlhaus
Die Ratte im Papierbunker
Der Ratten highway
Rattenwurst
Vier verschiedene Kantinenversorgungen
Urlaubspannen
Wie ich zu Roland Kaiser wurde
Vadderns Wassermelone
Flaschenkasse
Die Facharbeiterarbeit (mit einscannen)
Zwei Lieferungen Erdbeeren
Angriff auf die Männlichkeit … oder … Wie ich verführt werden sollte
Fehlende Bierflaschen
Heimfahrt
Da werden wir mal besser die Feuerwehr holen
Diebstahl zum Frauentag
Kein Strom
West-Osterhasen
Tomaten, Erdbeeren und Melonen und weiße Mäuse
Kaffee-Lieferung
Parteiausschlußverfahren
Vierzehn Paletten Kirschsaft
Kleingartenaufkauf und das Problem mit den Walnüssen
Vaddern schlachtet ein Huhn
Knappes Scheuerpulver
EVP, GAP und „unverbindliche Preisempfehlung“
Berliner Weiße mit echtem Blut
Baumkuchen gegen Berliner Pilsner
Hund, Katze, Maus
Erdbeersand bei Engelke
NVA
Kundennummern
Made in Kirsche
Saisonware
Der fliegende Schrubber
Die Crux mit dem Schnaps
Zimmer 13
Kakerlaken im Waschpulver
Das Leid mit den grünen Bierflaschen
Eine Nacht lang eingesperrt
Das letzte DDR-Geld
Nudeln mit Nagellack
Geburtstag
100.000 DM für Bärenquell
150 Jahre Zoo und der Grufti
Radio
Springer
Chef für einen Tag
Das System „Lego“
Im Bund mit der Gewerkschaft
Ein Strauß Tulpen und die Radiorache
Das Kreuz mit dem Kreuz
Peggchen
Jeder speist allein für sich
Das Kaninchen
Motivation 1
Motivation 2
Motivation 3
Zwickmühle
Ein Dreiviertel-Kilo … und ehrliche Worte
Tag der Befreiung
Epilog
Unterbrechung
Schuld
Hunde-Geschichten
Prolog
Bona und Trolli
Utschi
Goldi und anderes Hundefutter
… mit den Wölfen
Der Onkel aus Steglitz
Zerbissene Schuh
Flugknochen
Der Wolf in ihr
Der Hund in Nachbars Garten
Pampers
Rettung auf dem Darß
Essen in Bodstedt
Geben wir die Pilze erstmal dem Hund
Der Biskuit
Böse Miezekatze
Flaschenkind
Zerbissene Hände
Heiße Kartoffeln
Erdbeerenernte
Saure Gurkenzeit
Kein Seehund
NVA
Ihr zweites Leben
Ein schnelles Ende
Radiogeschichten
Anfänge
Nur Radio
Der DD-Bus Unter den Linden
7 – 10 und Hans Rosenthal
Das lügende Radio 1967
Der Westsandmann bei Frau Wicht
Lord Knud
Fernsehen
Der alte Fuchs
Der kleine braune Kasten
Die Vorabendserien
Die ZDF-Hitparade live aus Brieselang
Prügelei auf dem Schulhof
The Beatles
Schlager der Woche
Andere Sendungen
Cassettenrecorder
Schuldisko
Barry Graves
Gedichte lernen
On Tape – Bänderaustausch
Die Berliner Radiolandschaft 1987
Die eigene Morningshow
RIAS-TV
DT
Wende
Bruder Alkohol
Einführung von CD
Sendung vom Balkon
Das letzte erhaltene gemeinsame Dokument
OKB
Meine Berliner Vereinigung
Prenzlberger Ansichten
OKbeat in den ersten Jahren
Mariechen
Sendeplatz um 0.00 Uhr
Rolling Stones 1998
The trashman - surfin' Bird
Fast zweiundzwanzig Stunden am Stück
UFO-Sichtungen
Andreas Uhlig
Nutzerbeirat
Molly Luft
The Rutles
Peru Manta am Alex
Oben ohne
Ick mach TV
Bei KW-TV
OKbeat im TV
Kranke Heimfahrt mit dem nichtbestellten Taxi
Mein letztes Stück aus den Charts (2002)
Kleinkunst
Crash 1, Crash 2, Crash
Der neue OKbeat
Pi-Radio
Rockradio
Intermission, Unterbrechung ab 12./13./14./15./16./17.2.2020
Arbeits- und Sende-PC
andere Internetradios
alex-radio
Ein Hotel am Ostbahnhof
Führungen im Radiostil
15 min für Fountainhead
Mit Co-Modi
Sprechverbot
Knapp 30 Kinder
Miss Germany
20 Jahre
Clara
Keine Antwort von der Band
Tolle Gäste
Wiederkehrende Themen
Rio Reiser Nacht
Tsutschi und der ungetreue Thom
Änderung bei der Arbeitsweise in der Musikauswahl
Der OKbeat heute
No-Goes und Was-muß-man-beachten beim Radio machen
Anhänge
Hinweis auf Radiotexte als extra Buch
Radiomanuskripte anhängen von prw + okbeat
Daten
am Ende den EVP angeben
Bilder
Kaufhallengeschichten
Prolog
Ich denke, es ist mal an der Zeit, lang genug ist es ja her, ein paar meiner Erlebnisse aus dem Lebensmitteleinzelhandel der DDR zum Besten zu geben. Zwei der Texte sind nicht ganz neu, alles andere sind Erinnerungen frisch aufgeschrieben (wann die neuen Texte entstanden sind, das ist ganz am Ende zu lesen). Die Texte sind nicht in sich chronologisch geordnet. Die Idee, das alles einmal aufzuschreiben, hatte ich, als meine gute Freundin Dr. Clara West (SPD) aus dem Berliner Abgeordnetenhaus im Bürgerbüro ihres Wahlkreises einen ihrer regelmäßigen Termine des „Seniorencafés“ hatte, der angekündigte Gast leider kurzfristig auf Grund anderer Termine absagte, ich als Freund des Hauses mit im Büro war und sich die Senioren plötzlich zwanglos über das Thema „Ratten“ unterhielten und ich daran dachte, was mir so alles mit Ratten im Einzelhandel passiert war.
Danke Clara, Du warst mal wieder sehr positiv inspirierend!
HO
Vom 1. September 1978 bis 15. Juli 1980 war ich Lehrling als Wirtschaftskaufmann in der „Wirtschaftsvereinigung Obst Gemüse Speisekartoffeln“ (WV OGS) in Berlin. Das war der Großhandel für alles, was mit Gewächsen zu tun hatte. Ich war dort nach der Lehre noch ein Jahr weiter beschäftigt. Kurz vor Ende meiner regulären Lehrzeit machte ich eine Extraausbildung zum „Obst und Gemüse Gutachter“, wobei man mir beibrachte, welches die Kriterien für welche Qualitätsstufe waren, wie man die verändern konnte, Proben nahm und welche Handels- oder Güteklassen es in der DDR überhaupt gab.
So war ich als Gutachter von ab Ende der Lehrzeit, also vom 16. Juli 1980, bis etwa 15. Oktober 1980 von Nachts 0.00 Uhr bis morgens um 7.00 Uhr, an sieben Tagen in der Woche, auf dem Wriezener Güterbahnhof (neben dem Ostbahnhof) beschäftigt. Dort mußte ich die Waren in den anlandenden Güterwagen aus Rumänien, Ungarn und Bulgarien, in denen Wassermelonen, Weintrauben, Pfirsiche und Aprikosen ankamen, auf ihre Handelsklasse hin einordnen. Das hieß ab Dienstbeginn mit einer Taschenlampe bewaffnet in die Waggons zu kriechen, das Obst zu begutachten und festzulegen, welche Einzelhandelsgeschäfte im Einzugsbereich unseres Betriebsteils, das waren die damaligen Bezirke Lichtenberg (mit Marzahn und Hellersdorf), Treptow und Köpenick welches Obst davon und wieviel erhielt. Woher die beiden anderen gleichartigen Betriebsteile dieses Obst bezogen, weiß ich nicht. Diese Arbeit war meist gegen 1.00 Uhr erledigt. Anschließend holte ich mir in der Kantine auf dem Gelände, die rund um die Uhr offen war, zwei Currywurst mit Kartoffelsalat. Das Büro an der LKW-Waage auf dem Gelände hatte zwei Räume. In dem einen waren die Mitarbeiter für die Waage, das andere hatte ich. Nach der Currywurst machte ich mich meist auf drei bis für Bürostühlen lang und ein Nickerchen, bis so gegen halb fünf Uhr die ersten unserer LKW anrollten. Um 7.00 Uhr übergab ich das Büro an die Tagesschicht, die dort bis 16.30 Uhr arbeitete und dann den Schlüssel nebenan bei den Waage-Mitarbeiter abgaben, wo ich ihn mir in der kommenden Nacht wiederum abholte.
Zum Feierabend nahm ich wie selbstverständlich täglich eine Melone, ein paar Hände Trauben, Pfirsiche oder Aprikosen, natürlich ohne dafür irgendwo irgendwas zu bezahlen, mit.
Ab 1. Juli 1981 wechselte ich die Seiten und ging in in den Einzelhandel zum damals noch eigenständigen „HO Kaufhallenverband Berlin“, der aber … ich bin mir da nicht mehr sicher, finde aber auch keine Zahlen mehr … zum Jahreswechsel 81/82 aufgelöst und in die normalen Bezirksbetriebsteile der HO WtB Berlin eingegliedert wurde. Die HO (Handels Organisation) wurde am 15.November 1948 in Berlin gegründet, war der staatliche Einzelhandel in der DDR und hatte damit den Status eines „VEB“ (Volks Eigener Betrieb).
Zur HO gehörten unter anderem der Bereich „WtB“ (Waren des täglichen Bedarfs), die „Exquisit-Läden“ (für hochpreisige Mode), „Delikat“-Läden (für hochpreisige Lebens- und Genussmittel), die HOG (HO-Gaststätten) und die Goldbroilergaststätten, die ein eigener Betriebsteil in der HOG waren, dazu die Jugendmodegeschäfte, und überhaupt gab es zu jedem Spezialartikelladen auch einen entsprechenden Betriebsteil der staatlichen HO. Selbst die „Centrum-Warenhäuser“ waren der HO hinzu zu rechnen. Auch die „Forum Handelsgesellschaft“, die die „Intershops“ betrieb (das waren Läden, in denen man nur gegen Devisen oder „Forum-Coupons“ … DDR-Bürger durften offiziell keine Devisen besitzen, bzw. wenn man Devisen geschenkt bekam, hatte man diese unverzüglich auf der nächsten Bank eins zu eins in diese Forum-Coupons einzutauschen … einkaufen konnte) und „Genex“, eine Firma, die in Westeuropa einen Katalog vertrieb, in dem der Westler für seine Freunde und Verwandtschaft in Ostdeutschland Waren für Devisen bestellen konnte, die dann in der DDR ausgeliefert wurden, gehörten dazu. Sehr beliebt waren da zum Beispiel Autos. Wartete man sonst auf den PKW Trabant etwa achtzehn Jahre ab Bestellung, so dauerte es von der Bestellung bei Genex bis zur Selbstabholung des Wagens ab Werk gerade einmal vier Wochen. Selbst die Farbe und eingebaute Extras konnte man da wählen, was sonst nicht der Fall war. Der Trabant kostete etwa 8.500,00 DDR-Mark, bei Genex etwa 4.500,00 D-Mark (Westmark). Aber dazu brauchte man halt Verwandschaft im Westen, die auch entsprechend flüssig war.
Bei der HO stieg ich ab dem 1. Juli 1981 als „1.Fachverkäufer Obst Gemüse“ ein und war damit der dritte Leitende der Gemüseabteilung in dieser Kaufhalle, damals Franz-Jacob-Straße, direkt am S-Bf. Storkower Straße (bis 1977 „Zentralviehhof“). Mitte 1984 wurde ich als „Leiter Waren-Annahme“ in eine Mini-Kaufhalle in der Rummelsburger Straße in Lichtenberg versetzt, aus der mich nach einem Vierteljahr der Chef der Kaufhalle „Leninallee 116“ (am Steuerhaus in Sichtweite des Ringbahnhofs – da ist heute ein russischer Supermarkt drin) von dort rettete, denn das eingeschworene Team in der Rummelsburger Straße bestand aus lauter Frauen, die doppelt so alt, wie ich damals, waren und die mich schlicht fertig machten. In der Leninallee 116 war ich nur noch normaler Warenannehmer. Vom 2.Mai 85 bis 31. Oktober 86 mußte ich zum Grundwehrdienst in die NVA (siehe mein Buch „Still gestanden, die Augen links“), kehrte anschließend in diese Kaufhalle zurück und war dann erst einmal nur wieder Warenannehmer. Ab März 87 wurde ich zum „Leiter der Warenannahme“ und ab Mai 87 kommissarisch zum stellvertretenden Filialleiter ernannt. Das machte ich bis zu meiner unehrenhaften Entlassung aus der SED im August 1989 (ich hatte auf Grund der politsichen Lage mein Parteibuch geworfen), nach der man „plötzlich“ feststellte, daß mir irgendeine Qualifizierung fehlte, die mich zum „Leiter“ machte und so wurde ich zur Aufpackkraft herab gestuft.
Mit der Deutschen Wiedervereinigung übernahm Kaiser's-Tengelmann die HO in weiten Teilen Ost-Berlins und beschäftigte mich weiter. Bereits 1991 wechselte ich die Filiale und ging in die Georgenkirchstraße im Friedrichshain, ab Januar 1994 in die Filiale am Hamburger Platz in Weißensee und als diese geschlossen wurde, weil man eine nagelneue Filiale in der Wigandstaler Straße eröffnete, ging ich dort ab Mai 1995 mit. Meist war ich da für den Getränkebereich zuständig, immer verbunden mit der Pfandflaschenrücknahme, meist gab es dann noch ein „Nebenbeisortiment“ dazu. Mal war das Tiernahrung, mal Waschmittel, mal Kaffee und Marmelade. Immer war das aber auch verbunden mit einigen Stunden Kassierertätigkeit. Bereits im April 94, noch am Hamburger Platz, hatte ich mich als „Springer“ in der Firma registrieren lassen, der alle paar Tage in andere Filialen im gesamten Berliner Stadtgebiet geschickt werden konnte. Das war eine freiwillige Entscheidung von mir, denn auf diese Weise wollte ich die Arbeitsweise und die Kunden vor allem in West-Berlin kennen lernen. Meine Rechnung ging auf. Die nettesten Kunden gab es damals in Schmargendorf, in Wannsee und in Steglitz, die anstrengendsten Kunden gab es hingegen in Hellersdorf, Hohenschönhausen und Marzahn. Ich lernte in der Zeit über die Stadt Berlin insgesamt sehr, sehr viel.
Mit Ankündigung einer achtwöchigen Kur ab Januar 98 wurde ich ab November 97 fest dem Supermarkt im Lindencenter in Hohenschönhausen, Hansastraße, zugeteilt. Bis zur Kur war ich dort für den Gemüsebereich zuständig, ab nach der Kur wurde ich zum Fleischfachverkäufer. Am 7.Mai 98 bekam ich meine „Betriebsbedingte Kündigung“ und noch ein halbes Jahr von Kaiser's-Tengelmann mein volles Gehalt ohne zu arbeiten.
Ende 98 half ich für ein Trinkgeld mal für ein paar Stunden in einem griechischen Gemüseladen in der Bötzowstraße / Hufelandstraße aus, aber die Chefin wollte mich nicht fest anstellen und schwarz arbeiten wollte ich nicht. Im Weihnachtsgeschäft half ich einem Kumpel, der einen Spar-Markt in Potsdam hatte, für ein Trinkgeld auf drei Tage aus, aber auch er wollte mich nicht fest anstellen. Das war auch der Punkt, an dem ich für mich feststellte: ich will Einzelhandel nicht mehr. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt alles schon mal gesehen, alles schon mal gemacht, alles verkauft, alles verarbeitet, alles erlebt, was man nur im Einzelhandel erleben kann und ich konnte mich da schlicht nicht mehr weiterentwickeln. Es geht mir selbst heute noch, über zwanzig Jahre, nachdem ich da raus bin, so, daß ich im Supermarkt oder beim Krauter um die Ecke sofort sehe, welche Arbeiten da als nächstes zu tun wären und ICH will es nicht mehr tun. Hab teilweise sogar noch Albträume davon.
Vielleicht braucht es noch dieses Buch zur Aufarbeitung.
Innerlich gelacht hab ich schon, als ich mitbekam, daß Kaiser's-Tengelmann ab nach einem halben Jahr nach meiner Entlassung damit begann, buchhalterisch rote Zahlen zu schreiben und nur noch Verluste einzufahren.
In den Handel bin ich seitdem nie wieder zurück gegangen.
Ratten in der Kantine
In meiner Lehre war es so, daß wir im ersten der beiden Lehrjahre als Wirtschaftskaufmann immer drei Wochen Berufsschule und eine Woche praktischer Einsatz im Ausbildungsbetrieb hatten. Ab dem zweiten Lehrjahr war das Verhältnis dann ein zu eins und es wechselte von Woche zu Woche. Wobei ich im Großhandel im halbjahreswechsel jeweils in andere Bereiche hinein schnuppern mußte. Zuerst war ich im Betriebsteil Konserven in der Eldenaer Straße auf dem Zentralviehhofsgelände, dann in der Firmenzentrale in der Jacobsohnstraße in Weißensee und dort speziell in der „Grundmittelbuchhaltung“, anschließend war ich in der Buchhaltung in der Chausseestraße in Mitte, wo die Lohn- und die Finanzbuchhaltung der WV OGS untergebracht war und schließlich landete ich im Handelsbetrieb 1 (für Frischware) in Karlshorst in der Verlängerten Waldowallee, direkt hinter der Trabrennbahn.
Der erste Tag im Betrieb ist mir noch gut in Erinnerung. Ich im Büro der Chefin der Buchhaltung des Betriebsteils an einem Schreibtisch, die Chefin im Wortsinne im Nacken und ich soll als erstes Rechnungen sortieren. Plötzlich klingelt das Telefon auf meinem Schreibtisch.
… Mh … Was tun?
Erstmal ignorieren. Ist wohl das Beste. Nach etwa fünfmal klingeln faucht mich die Chefin an: „Wollen sie nicht ran gehen?“ Ich frag schlotternd zurück: „Was soll ich denn sagen?“ „Na vielleicht erstmal, wer sie sind und wo sie sind.“ Der Telefonhörer flattert in meinen Händen und an meinem Ohr und ich stammel irgendwas von „Handelsbetrieb Konserven, der Herr Gänsrich am Apparat.“ „Hier ist der Udo! Gib mir mal die Chefin.“, krieg ich zu hören und reiche den Hörer weiter. „Geht doch.“, sagt die Chefin anschließend knapp.
Kantinen kannte ich bis dato nur aus der Produktiven Arbeit in der Schule, aber vom wenigen Taschengeld war da höchstens mal 'ne Bockwurst mit Schrippe drin. Meine Mutter war als Halbtagsschreibkraft in Heimarbeit tätig und kochte täglich. So bin ich nie in den Genuss von Schulspeisung und solch exotischer Gerichte wie „Tote Oma“ oder Graupensuppe gekommen. Auch in der Berufsschule in der Greifswalder Straße gab es keine Möglichkeit irgendwo eine warme Mahlzeit einzunehmen, weshalb es da bei belegten Broten blieb. Deshalb war ich auf die Kantine in der Eldenaer Straße neugierig und die mußte ich natürlich, auch um mich mit den anderen Lehrlingen aus meiner Berufsschulklasse auszutauschen, besuchen.
Dabei fielen mir auf dem Gelände recht große Tiere auf.
Endlich zu hause erzählte ich meiner Mutter von meinem Erlebten und von den Tieren. Ich so: „Ich weiß nicht, was das für Tiere waren. Die waren so groß, wie Opas Karnickel, hatten aber eher mit unseren Mäusen, die wir hier im Käfig halten, Ähnlichkeit. Nur ebend viel größer, auch mit dem nackten Schwanz.“ Muttern: „Junge, das waren Ratten.“ Und Vaddern ergänzte: „Die Ratten auf dem Zentralviehhof werden vermutlich richtig schön fett sein.“
Ich aß und trank fort an in dieser Kantine nichts mehr, was dort zubereitet war. Kopfkino! Ich sah ständig im Kaffee hängende Rattenschwänze und Wurst anknabbernde Ratten vor meinem inneren Auge.
Wollen sie auch Kaffee?
Im zweiten Lehrhalbjahr war ich in der Firmenzentrale. Üblich war, daß die „Lehrpiepse“ überwiegend mit Kaffee kochen beschäftigt waren. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt, es war bevor Kaffeemaschinen die Küchen der Welt eroberten, bereits ordentlich Kaffee kochen, denn wenn ich Sonntags meinen Eltern das Frühstück samt Kaffee ans Bett brachte, konnte ich um so ungestörter das „Sonntagsrätsel“ im RIAS mit Hans Rosenthal, „Onkel Tobias im RIAS“ und „7 – 10, Sonntagmorgen in Spreeathen“ auf dem Berliner Rundfunk ungestört in der Küche, in der das alte Röhrenradio stand, hören.
Meine Lehrkolleginnen mußten ständig für irgendwen Kaffee kochen.
Um so erstaunter war ich, als ich am ersten Tag an diesem Ausbildungsplatz in der Firmenzentrale von der Sekretärin des Chefs gefragt wurde: „Wollen sie auch Kaffee?“
Das hat sich dann bis zum Ende meiner Lehrzeit so durchgezogen. Trotz aller Gleichberechtigung brauchte ich in meiner Lehre nie Kaffee kochen.
*
Dieser Text ist älter. Er wurde von mir einst für ein Kunstprojekt in Köpenick 2009 geschrieben, von diesem aber leider nur in kleinen Auszügen benutzt, als (Vor-)Lesetext 2012 überarbeitet, war er hingegen für Kleinkunstveranstaltungen und offene Lesebühnen weitaus zu lang und landete schließlich als mehrteilige Folge in meiner Sendung auf Rockradio.de … und wurde für die Kaufhallengeschichten am 15.6.2019 erneut geschliffen.
Wie der Lebensmitteleinzelhandel in der DDR funktionierte
Rolf Gänsrich 1./8.3.09 + 29.4.2012
Über Jahrzehntausende in der Menschheitsgeschichte wurde mit Lebensmitteln eher selten gehandelt, da sie ganz einfach zu schnell verdarben. Der Mensch war überwiegend Selbstversorger und sammelte und jagte. Später als er sesshaft wurde, baute er Getreide an und hielt Vieh.
In den allmählich aufkommenden Städten bildeten sich erste Handwerksberufe heraus.
Märkte entstanden, auf denen Bauern ihre überschüssigen Erträge verkauften.
Bis noch vor knapp einhundert Jahren waren Wochenmärkte die wichtigste Quelle der Lebenmittelversorgung der Städter.
Gleichwohl versorgte sich der Stadtbewohner noch zum Teil selbst.
Es war darüber hinaus durchaus üblich, dass die Frauen in den Familien ihr eigenes Bier selbst brauten.
Die Wochenmärkte fanden auf dem zentralen Platz einer Ortschaft statt.
Der Marktplatz war eingerahmt von der weltlichen Obrigkeit, dem Rathaus und der geistlichen Obrigkeit, der Kirche. In großen Städten wie beispielsweise London gab es bereits seit dem frühen Mittelalter auf einzelne Waren spezialisierte Märkte.
Das geschah auch in anderen großen Städten der Welt, wie zum Beispiel in Berlin.
Auf dem Molkenmarkt wurden Molkereiprodukte verkauft, am Spittelmarkt, der Name abgeleitet von der Spindel mit der man Garn spann, …. wir kennen sie aus dem Volksmärchen “Dornröschen”, wo sich die Königstochter an einer Spindel, Spittel sticht und hundert Jahre lang schläft …. am Spittelmarkt verkaufte man alles was mit Kleidung und nähen zu tun hatte und der Alexanderplatz war nur ein Viehmarkt.
Im Sommer und Herbst stakten und treidelten die Werderaner Bauern ihre Lastkähne entlang von Havel, Spree und Teltowkanal nach Berlin und verkauften an Anlegestellen teilweise direkt vom Lastkahn ihr Obst und Gemüse. … Aus jener Zeit stammt der Begriff vom “ollen Äppel-Kahn”.
Für uns heute unvorstellbar, dass bis weit nach dem zweiten Weltkrieg die Versorgung der Bevölkerung fast ausschließlich in den Händen der kleinen, heute würde man sagen “Tante-Emma-Läden” lag.
Allein im Prenzlauer Berg gab damals dreimal mehr Menschen, als heute und alles kaufte in kleinen Läden ein! Allerdings hatten viele Städter damals irgendwo ihre Parzelle, auf der nicht nur Nahrungsmittel angebaut, sondern meist noch Kleintiere gehalten wurden.
Nach dem Krieg wurde obendrein in Blumenkästen Tabak angebaut und wurden Kaninchen auf Balkonen und Hühner in Küchen gehalten.
Supermärkte im heutigen Sinne gründete die King Kullen-Kette aus den USA, die ihren ersten Laden im August 1930 in einer ehemaligen Autowerkstatt in Queens (NY) eröffnete.
Der erste europäische Supermarkt überhaupt wurde 1948 in Zürich von der Migros-Genossenschaft eröffnet und fand alsbald regen Zulauf.
Der erste Supermarkt in Deutschland wurde ein Jahr später in Osnabrück eingerichtet, das Selbstbedienungsprinzip konnte sich zu dieser Zeit aber in Deutschland noch nicht durchsetzen und der Laden ging wieder ein.
So kam es, dass in Deutschland erst wieder beispielsweise der Edeka-Verbund um 1954 zum Selbstbedienungsprinzip überging, ab 1959 wurden dort auch Non-Food-Produkte neben den Lebensmitteln angeboten.
Mit dem Selbstbedienungsprinzip hielten fertig abgepackte Waren, sowie vermehrt Markennamen Einzug in den Betrieb.
In der DDR, die immer unter chronischem Arbeitskräftemangel litt, wurde das Prinzip der Selbstbedienung recht zügig ab mitte der 50er Jahre eingeführt.
Ich kann mich noch an die winzigen Läden erinnern, in denen Muttern bei uns in Hohenschönhausen kaufte. Im Lebensmittelfachgeschäft gab es zwar Selbstbedienung, aber kein Obst/Gemüse, kein Fleisch, kein Waschpulver und keine Brötchen, dafür aber Kaffee und Zigaretten, so dass Muttern uns quengelnde Bälger von einem Laden zum anderen und von einer Schlange zur nächsten schleifen musste.
Die ersten Kaufhallen gab es ab etwa 1956 in den Neubausiedlungen mit den berühmten “Q3A” Bauten. Diese Verkaufstellen boten auf ihren meist ca. 450 m2 Verkaufsfläche alle Waren des täglichen Bedarfs an. An Fleisch/Wurst-Theken wurde dazu noch einzeln bedient, aber gezahlt wurde wie heute insgesamt an der Kasse.
Grundsätzlich hatten alle Filialen, gleich welcher Größe, immer einen eigenen Tabak/Kaffeestand im Bereich vor den normalen Kassen, an dem bedient und sofort abkassiert wurde.
Die ersten dieser 450 m2 - Verkaufsstellen waren, ohne jetzt eine genaue zeitliche Zuordnung geben zu können und garantiert als Liste unvollständig, im Dammweg in Treptow, am Hamburger Platz in Weißenssee (noch bis 1995 von Kaiser’s betrieben), “Kaufhalle Strauchwiese” in der Blankenburger Straße in Niederschönhausen, die später innerhalb der HO einen äußerst schlechten Ruf wegen ihrer hygienischen Zustände hatte, “Leninallee 116” am “Steuerhaus”, Prenzlauer Allee Ecke Erich-Weinert-Straße (bis 2005), Kaufhalle Roelkestraße (1995 geschlossen und abgerissen), eine Kaufhalle in der Oberspreestraße in Spindlersfeld und wohl einige mehr.
Nun muss man sich den Einzelhandel in der DDR anders vorstellen, als heute, mal abgesehen von der Bezahlung der Angestellten, die damals wie heute einfach beschissen ist.
Heute würde es sich kein Lieferant wagen, seine Kunden zu betrügen und kein Einzelhändler wiederum seine Kunden, denn die kauften bei ihm nie wieder.
In der DDR war das dagegen normal. Offiziell gab es keine Kundendiebstähle, aber natürlich klauten die Kunden genauso viel, wie heute.
Das Gehalt eines Mitarbeiters im Einzelhandel setzte sich aus dem Grundlohn und dem Leistungslohn zusammen. Dieser Leistungslohn war auch abhänging von den Inventuren in den Filialen. Waren die halbjährlichen Inventuren o.k., stimmte auch das Geld so halbwegs.
Es war deshalb allgemeine Verrahrensweise, dass an den Fleisch-, Wurst-und Käsetheken und beim Gemüseverkauf, also überall da, wo man Waren für den Verkauf abwog, der Kunde ständig betrogen wurde.
Aber schon bei der Warenannahme lief das so.
Bei gut zwei dutzend Lieferanten, die so eine HO-Kaufhalle hatte, gab es gut zwei dutzend verschiedene Anweisungen der Waren-Annahme.
Mal wurden nur die Kistenanzahl insgesamt gezählt, mal mussten die Kisten aufgerissen und deren Inhalt gezählt werden, wie zum Beispiel bei der Anlieferung von Kaffee. Achtundvierzig Tüten Moccafix mussten in einer Kiste enthalten sein. Alle gerade im hinteren Bereich einer Kaufhalle Anwesenden wurden dazu verdonnert, bei Kaffee-Anlieferung mit zu zählen.
Wieder andere Waren mussten bei Anlieferung gewogen werden, weil die Kisteninhalte bei Obst, Gemüse, Fleisch und Wurst differierten.
Die angelieferten Paletten waren nicht fertig in Folie eingeschweißt, sondern oft wurde die Warenlieferung erst vom LKW herab zusammengestellt.
Schon beim Großhandel für die Filialen fertig kommissionierte Paletten wurden durch ein, manchmal auch durch zwei, einfache Hanfseile zusammengehalten. Keine Spur von „eingeschweißt in Folie“. Da „verrutschte“ auch schon mal was beim Transport auf der Ladefläche.
Tja und wenn man bei der Warenannahme nicht aufpasste, verschwanden halt wieder einige Kisten auf dem LKW, weil der Fahrer sie für sich klaute oder der LKW-Fahrer war abgelengt und man moppste selber für die Filiale noch die eine oder andere Kiste vom LKW herunter.
Es war ein ständiges: du bestielst mich, ich bestehl dich!
Das war so allgemeine Verfahrensweise.
Ich war selbst lang genug Leiter der Warenannahme von HO-Kaufhallen. Man musste darauf achten, vom Kraft- und dessen Beifahrer nicht betrogen zu werden, man versuchte hingegen selbst, den Kraftfahrer zu betrügen.
Alles immer im Sinne der Senkung der Inventurminusdifferenzen der eigenen Filiale.
Der Handel aus sich heraus funktionierte in der DDR grundsätzlich anders.
Für jedes Sortiment gab es einen eigenen Großhandel, der aber, so kurios es klingt, keine eigenen LKW hatte. Die LKW und dessen Fahrer stellten der “VEB Handelstransport” oder “VEB Autotrans”.
Bei der Auslieferung durch den Großhandel an den Einzelhandel waren entsprechend immer zwei Personen auf einem Wagen, der Fahrer der Spedition und als Beifahrer jemand aus dem Großhandelsbetrieb. Es waren aber fast ausnahmslos auf einander eingespielte Teams, die ihre Liefertouren oft über Jahre gemeinsam fuhren.
Nur in Ausnahmefällen wurde nicht vom Erzeuger zum Großhandelslager und von dort per umladen an den Einzelhandel geliefert, sondern der Einzelhandel, mittels staatlicher Spedition, mit nur einem Fahrer, vom Erzeuger direkt beliefert.
Das waren zum einen im Sommer Kirschen und Erdbeeren aus Werder, zum anderen ganzjährig und nur für große Kaufhallen Blumenkohl aus der Magdeburger Börde, Äpfel aus Werder und Gurken und Kohlrabi aus dem Oderbruch.
Dass es in Ost-Berlin gerade an den Sommer-Wochenenden Wassermelonen, Weintrauben und Pfirsiche gab, hing damit zusammen, dass der West-Berliner Fruchthof diese Waren am Wochenende nicht mehr abnahm und die DDR dann die teils überreifen Früchte billig bekam. Ausgeliefert wurde direkt ab Eisenbahnwaggon vom Wriezener Güterbahnhof.
Obwohl diese Waren recht gleichmäßig “gestreut” werden sollten, gab es beim Großhandel, meinem Lehrbetrieb, einen internen, staatlich verordnenten “Verteilschlüssel”.
Danach hatten die großen HO-Kaufhallen die höchste Priorität, beginnend ab der größten Verkaufsfläche, dann folgten die großen KONSUM-Kaufhallen, dann die kleinen HO- und KONSUM-Hallen, es folgten die normalen HO- und Konsumgeschäfte, dann die HO-Kommissionshändler und schließlich die privaten Läden ... 1980 gab es in ganz Köpenick noch einen davon, “Engelke” in Alt-Köpenick direkt am Rathaus.
Außerdem gab es Sonderzuteilungen für die Geschäfte an der “Protokollstrecke” entlang der Greifswalder Straße und für Betriebsverkaufsstellen innerhalb großer Firmen, wie zum Beispiel dem Kabelwerk Oberspree, Werk für Fernsehelektronik oder VEB Elektrokohle, in denen teilweise bis knapp zehntausend Menschen arbeiteten.
Noch bis etwa 1982 wurden in die großen HO-Kaufhallen neue Regalreihen eingebaut und die Gänge verschmalert, um das stetig wachsende Sortiment aufzunehmen. Ab 1983 kehrte sich dieser Prozess, aber bereits um und Regalreihen wurden wieder entfernt.
Alle Obst-Gemüse-Verkaufsstellen mussten das Obst von Kleingärtnern entgegennehmen und diesen abkaufen. Durch die staatlich gestützten Preise kam es dann zum Beispiel zu dem Kuriosum, dass der Kleingärtner für seine eigenen Walnüsse ca. 9,00 Mark erhielt, diese Nüsse aber vorn im Laden für nur 6,80 Mark verkauft wurden, so es denn welche gab.
Die kleineren Kaufhallen, halt die mit einer größe um 450m2 , arbeiteten im Zwei-Schicht-Wechsel-System. Erste Schicht 6.00 – 14.00, zweite Schicht 12.00 – 20.00 Uhr.
Vor Ladenöffnung waren ganze zwei Stunden für die Warenbearbeitung vorgesehen, nach Schließung nochmals eine Stunde.
Ich darf an dieser Stelle mal an die Samstagsöffnung von 8.00 bis 11.30 Uhr erinnern, die niemanden am Wochenende verhungern ließ.
Diese kleinen Filialen hatten eine eigene Warenschleuse, in der bei der Nachtanlieferung durch die Kraftfahrer Brot, Frischmilch und Zeitungen abgeliefert wurden. Zeitungen mussten morgens sofort gezählt werden. Während die Kolleginnen Kaffee kochten, zählte ich schon Zeitungen und überprüfte die tatsächlichen Milch- und Brotlieferungen mit den Zahlen auf den Lieferscheinen.
Schon an dieser Stelle landete vieles von den Zeitungen nicht mehr im Verkaufsraum.
Unsere Filiale erhielt beispielsweise nur zwei Exemplare der damals wöchentlich erscheinenden Satirezeitschrift “Eulenspiegel”, um die sich dann mein Chef und ich “prügelten”.
Von den dreißig Exemplaren der “Wochenpost” gingen allein fünfzehn unter den Kollegen weg.
Während in diesen Filialen um 450m2 Verkaufsfläche etwa dreißig Personen arbeiteten, waren beispielsweise in der Filiale am S-Bahnhof Storkower Straße, mit ca. 1200 m2 Verkaufsfläche etwa neunzig Personen beschäftigt, in der Bölschestraße in Friedrichshagen gab es über 120 Angestellte.
Diese Kaufhallen hatten obendrein individuelle Bedienung an einer Käsetheke, eine Kuchen- und Tortentheke und einen eigenen Kosmetikstand mit richtiger Kosmetikfachverkäuferin. Filialen dieser Größe hatten eine Warenannahme, die im rotierenden Vier-Schicht-System arbeitete und die entsprechend viele Waren Nachts annahm. Diese großen Filialen waren beim Personal recht beliebt. Mit ein Grund dafür dürfte darin liegen, dass es in ihnen eine eigene Kantine mit Kantinenbewirtschaftung gab, also ein oder zwei Köchinnen, die belegte Schrippen anboten und die zum Mittag selbst warm kochten und noch Bockwurst mit Salat und ähnliches im Sortiment hatten. Ja, es wurde dort täglich frisch gekocht!
Auch sonst lief so einiges anders, als heute. So war es üblich, dass das Personal den Verkaufsraum täglich selbst fegte, mit grünen Fettspänen, damit der Staub nicht aufwirbelte und einmal wöchentlich den Laden feucht mit Schrubber und Feudel wischte. Eigenständige Putzfirmen gab es dafür nicht.
Betrat man als Mitarbeiter zum Schichtbeginn die Filiale durch den Personaleingang, hatte man all sein Bargeld samt Portmonnaie beim Schichtleiter abzugeben. Heißt, man zählte sein Bar-Geld vor, dann wurde die Brieftasche in einen Tresor eingeschlossen und das Geld, das man im Portemonnaie, (hab als Schüler dieses Wort mal als „Portmoney“ geschrieben und dem Pauker erklärt, daß ich dachte, es käme aus dem englischen und hieße „Hafen für Geld“) in einem persönlichen “Verzehrheft” (A 6) vermerkt. “Verzehrheft” deshalb, weil alle Waren, die man sich für den persönlichen Verzehr aus dem Lager oder dem Laden entnahm, von einer anderen Person abgezeichnet und im Heft vermerkt wurden. Bezahlt wurde alles aus dem Verzehrheft, gemeinsam mit dem eigenen Einkauf, zum Feierabend an der Personalkasse am Personaleingang. Außerdem hatte jeder Mitarbeiter in einem Regal im Personaltrakt seinen eigenen, gekennzeichneten Einkaufskorb zu stehen, in dem die privaten Einkäufe landeten. So brauchte man nicht extra erst noch einkaufen zu gehen, sondern konnte bei Wegen innerhalb der Filiale immer mal das eine oder andere im Vorbeigehen mitnehmen und in diesem Korb bis zum Feierabend lagern. So machte man beispielsweise auf dem Weg von der Warenannahme zur Mittagspause in der Kantine einen Schlenker durch den Laden und nahm sich Brot und Margarine als Einkauf und noch eine Brause zum Sofortverzehr mit. Der Sofortverzehr wurde im Verzehrheft eingetragen, der Rest landete im eigenen Einkaufskorb. Durch die vorgeschriebenen Festpreise in der DDR für “Waren des täglichen Bedarfs” machte es für einen Mitarbeiter im Einzelhandel keinen Sinn, außerhalb der eigenen Filiale einkaufen zu gehen.
Tja ... und dann gab es da noch diesen einen Raum, der in jeder Filiale anders hieß. Bei uns war es “die Dreizehn”. In diesem speziellen Raum, der immer verschlossen und mit der Alarmanlage extra gesichert war und in den nur bestimmte Personen vom Personal hinein durften, lagerten eigentlich die wertintensiven Waren. Dieser extra verschlossene und gesicherte Lagerraum mitten im Lager war gedacht für Tabakwaren, Kaffee, teure Spirituosen und für die “Delikat-Erzeugnisse”, die am Kaffee-/Tabakstand mit verkauft wurden. In diesem Raum lagerte aber auch die “Bückware”. Wir hatten immer einige Kartons mit Papiertaschentüchern, Rosenthaler Kadarka (Wein), etliche Kollies Letscho und Kisten mit Sauerkirschsaft darin gelagert, für den Fall, dass einmal ein Kollege in Not geriet und einige dieser Waren benötigte, um andere Waren zu erhalten.
... äh? ...
Beispiel: Als ich einmal sehr schnell von meiner Wohnungsverwaltung einen Handwerker brauchte, bekam ich von diesem Handwerker schneller einen Termin, nachdem ich ihm einfach einmal zehn Gläser Letscho, die ich pro Glas natürlich in meiner Filiale käuflich für 1,60 M pro Stück erworben hatte, in seinem Büro “stehen gelassen” hatte. Bestechung zum kleinen Preis!
Wie gesagt, der Einzelhandel funktionierte in der DDR anders.
Dann gab es die “eiserne Reserve”, eine Zwangseinlagerung, die jede Filiale zu übernehmen hatte und die von ihrer Menge her von der Filialgröße abhängig war. Diese bestand aus ... kennen Sie noch diese Gitterboxen, von der Fläche her halb so groß, wie eine Euro-Palette aus Holz, ... mehreren dieser Gitterboxen mit Speisesalz, Mehl, Zucker und aus mehreren Paletten Bier, vorzugsweise dem haltbareren “Berliner Pilsner” und einigen Behältern Kartoffeln. Diese Waren wurden regelmäßig im Lager gewälzt bevor man sie nach einigen Wochen Lagerzeit in den Verkauf brachte.
Der eine oder andere wird sich sicher noch an den “Wechselkorb” der Kassierer erinnern. Es gab damals noch keine Förderbänder, auf denen die Waren am Kassierer vorbei glitten, statt dessen und das war Anweisung, musste jeder Artikel vom Kundenkorb in einen anderen, halt den Wechselkorb, vom Kassierer umgepackt werden. Der Kunde übernahm nach dem kassieren den Wechselkorb und sein bisheriger Einkaufswagen wurde zum Wechselkorb für den nächsten Kunden. Da es keine Einkaufswagenchips gab, mußten in großen Kaufhallen durch einen Mitarbeiter alle halbe Stunde die Einkaufskörbe im Eingangsbereich geordent und zusammengeschoben werden.
Die dauerhaften Einheitspreise hatte man als Kassierer, Sie merken, ich habe damals an allen Stellen gearbeitet, sehr schnell im Kopf.
So ich mich noch recht erinnere und damit möchte ich hier enden, mal eine kleine Preisliste:
1 l Frisch-Milch im Schlauch: 0,66 M
½ l H-Milch: 0,55 M
Stück Butter 250 g: 2,40 M
125 g Mocca-Fix (gemahlener Kaffee): 8,75 M
1 Fl. (0,7 l) Nordhäuser Doppelkorn: 17,60 M
Schachtel “Cabinett”, “Semper”, “F6” (Mittelklasse-Filterzigaretten): 3,20 M
Joghurt 250 g Becher: 0,40 M
0,33 l Bier (normales Pils): 0,61 M
0,5 l Berliner Pilsner: 1,28 M
Zitronen: 5,00 M je kg (wurden einzeln im Lager ausgewogen)
Salatgurken: 6,00 M je kg (gleichfalls gewogen und nicht als Stückware verkauft, wie heute)
Erdbeeren: 4,80 M je kg
Wassermelonen: 0,85 M je kg
Schrippe (die hieß in Berlin offiziell laut Lieferschein so!): 0,05 M
geschnittenes Toastbrot: 1,05 M
250 g Marella (gute Frühstücksmargarine), 250 g: 1,30 M
250 g Sonja (einfachste Backmargarine): 0,50 M
Schnitt-Käse allgemein: ca. 9,90 M je kg
Toilettenpapier einfachste Sorte: 0,30 M je Rolle
Pulax (Scheuermittel): 0,95 M pro 400g Dose
Packung Spee (Waschmittel): 4,65 M
Spee-Color: 4,95 M
... und an der Tankstelle: 1 l Normalbenzin: 1,50 M
Ein Pfund
Berlin-Prenzlauer Berg am 17. Juni 2019 auf einem Wochenmarkt.
Ein Facebookpost von mir.
Bin ich schon so weit aus der Zeit gefallen?
Wollte heute an einem Obststand "ein Pfund Erdbeeren".
Gibt mir der Verkäufer eine große Schale.
Ich erneut, geduldig: "Ich möchte bitte nur ein Pfund Erdbeeren."
Nimmt er drei Erdbeeren aus der Schale.
Ich jetzt weniger geduldig: "Ich möchte nur ein Pfund Erdbeeren! In dieser Schale ist aber mindestens ein Kilo!"
Offensichtliche Ratlosigkeit beim Verkäufer.
Ich nochmal: "Ich möchte nur ein Pfund Erdbeeren. Ein Pfund ist ein halbes Kilo oder 500 Gramm."
Darauf er: "Das hab ich aber in meiner Ausbildung nicht gelernt."
Jetzt Ratlosigkeit bei mir!
Was lernen die im Einzelhandel heute noch?
Lieferung aus West-Berlin
Ab Freitagmittag nahm der Fruchthof in der Beusselstraße bis zum Sonntagabend keine Lieferungen mehr an. Güterzüge aus Polen, Ungarn, Bulgarien und Rumänien, die Wassermelonen, Pfirsiche, Weintrauben, Tomaten oder Gurken geladen hatten, wurden oft noch vor Erreichen West-Berlins über den Außenring zum Wriezener Güterbahnhof (neben dem Ostbahnhof) umgeleitet.
War der Zug schon in West-Berlin und abzusehen, daß man diese Lieferung in der Beusselstraße nicht mehr los wurde, manchmal war der Beusselstraße das Obst auch schon zu reif, wenn es eintraf, dann wurden diese Güterzüge über die Stadtbahn (meist in den späten Abendstunden) zum Wriezener Bahnhof umgeleitet.
Direkt von diesem Bahnhof aus wurden dann die Lieferwagen zu den Kaufhallen und kleinen Geschäften geschickt. So kommt es, daß der Ost-Berliner wenn er sie bekam, dann nur sehr reife Früchte dieser Art erhielt.
Ein weiteres Phänomen waren die Senatsreserven an vor allem Schmalzfleisch. Diese wurden regelmäßig gewälzt und ausgetauscht. Die „alten“ kaufte Ost-Berlin dem Senat ab. Es waren diese goldenen Büchsen von Dreistern, die es z.T. noch heute gibt, nur hatten sie damals weder Aufdruck, noch Etikett und niemand wußte so ganz genau was darin war. So provitierte Ost-Berlin bis zum Ende der DDR von der West-Berlin-Blockade.
Das war meist unser Samstagessen: Spaghetti mit Schmalzfleisch und geriebenem Käse, der in Ermangelung von Parmesan oft alter, harter Gouda war.
Brokkoli
Brokkoli sollte ab 1980 in „Berlin – Hauptstadt der DDR“ eingeführt werden.
„Ist'n dit?“, fragte mich in meiner Ausbildung meine schon seit fünf Jahren im Berufsleben stehende Kollegin Susanne.
„Weeß ick och nich. … Soll jrün sein.“, erwiderte ich.
Fakt war, dadurch daß ich zu diesem Zeitpunkt immer ab nach der Mittagspause unterwegs war, um im Einzelhandel nach zu schauen, ob dieser auch das von uns als Großhandel verordnete Pflichtsortiment an Obst und Gemüse hatte, war ich näher dran an der Ware und hatte Brokkoli deshalb auch schon einmal auf einem unserer LKW gesehen. Daher wußte ich, Brokkoli ist grün. Susanne allerdings kam aus dem Büro, in dem jeden Tag von 7.00 – 19.00 Uhr im Zweischichtsystem die Telefondrähte heiß liefen, weil hier der Einzelhandel seine Warenreklamationen bei uns, innerhalb von sechs Stunden nach Anlieferung, los wurde, nie heraus. Ich war da fein raus.
Brokkoli ist grün!
Die kleine DDR wollte eigentlich ihren Bürgern etwas Gutes tun und so war es der staatlichen Plankommission gelungen, beim Ministerrat durchzusetzen, daß einige LPG rund um Berlin künftig Brokkoli anzubauen hätten. Brokkoli ist schließlich gesund, hat viele Mineralstoffe und gab es in West-Berlin schließlich schon eine Zeit lang.
Theoretisch war zwar alles was aus dem Osten und der Sowjetunion kam gut, hier hatten sich nun aber endlich einmal Prakmatiker durchgesetzt und sich einmal an Gutem aus Westeuropa orientiert.
Folglich wurden LPGen dazu verdonnert, das Zeugs anzubauen und wir es zu vertreiben.
Das Problem war, daß niemand so genau wußte, was er mit diesen grünen Stengeln anfangen sollte. War das grüner Blumenkohl? Aß man den mit Holländischer Soße oder mit in Butter braun gebratener Semmelbrösel und damit in beiden Fällen auch wie Blumenkohl? Kein Mensch wußte das und ein Internet zum Nachschauen gab es noch nicht.
Deshalb kam nach einigen Wochen die staatliche Plankommission zu dem Ergebnis, daß man Brokkoli der Bevölkerung anders nahe bringen müsse und so wurden die Kantinen der Berliner Betriebe dazu verdonnert, Gerichte aus Brokkoli anzubieten.
Auch in unserer Kantine gab es dann eine Woche lang Brokkoli in den verschiedensten Varianten. Wir brauchten diese Mahlzeiten nicht einmal zu bezahlen, denn nur so könnten wir ja im Einzelhandel, in der Familie und unter Freunden unvoreingenommen darüber berichten, wie lecker Brokkoli doch sei und auf welche Arten er zubereitet werden könne.
Aber irgendwie mochte der kleine, spießige, miefige DDR-Bürger dieses Gemüse nicht. Frei nach dem Motto: „Wat der Buer net kennt, frißt er nich.“ Und so kam es, daß Brokkoli nur ein sehr kurzes Intermezzo in der Versorgung der Berliner Bevölkerung hatte und nach zwei Jahren schon nicht mehr lieferbar war.
Bis heute ziehe ich im übrigen Blumenkohl dem Brokkoli vor.
Ein Faß Sauerkohl (*
Sauerkraut gab es, so wie heute, bei uns in der Kaufhalle als Dauerkonserve fertig im Glas, in der Dose, frisch, abgepackt im Beutel mit 500 Gramm Inhalt und lose. Was für den kleinen Krauter noch möglich war, auch das Muttchen zu bedienen, das nur achtzig Gramm wollte, war bei uns in der Kaufhalle mit der Selbstbedienung schlicht unmöglich. Dennoch bekamen auch wir noch dreiviertel des frischen Sauerkohls lose, also im Faß.
Fünfzig Liter Sauerkraut aus dem Plastik-Faß heraus je halbpfund weise in Cellophan-Beutel abzutüten war eine der Aufgaben in der Gemüseabteilung einer Kaufhalle. Und das wurde dann nicht hygienisch mit der Zange gemacht. Im Gegenteil war es eher so, daß diejenigen, die an diesem Tag bereits Rotkohl verputzt hatten und dabei war meist mehr, als nur das äußere Blatt zu entfernen, sich anschließend freiwillig dazu meldete, Sauerkraut abzutüten. Der frische Rotkohl ätzte seine rote Farbe so sehr in Haut, Nägel und Nagelbetten ein, daß man diese am besten durch Sauerkrautsaft wieder heraus ätzte. Deshalb war das Sauerkraut abtüten gar nicht so unbeliebt bei uns. Und außerdem, Sauerkraut direkt aus dem Faß schmeckt nochmal anders, besser, als jedes andere und so landete hin und wieder eine Hand voll im eigenen Mund.
Eines Tages tauchte es wieder auf. Hinter Kisten mit bereits moderndem Kohlrabi stand da dieses eine von uns vergessene Faß Sauerkraut. Oben auf dem Kraut hatte sich bereit eine ca. 10 cm dicke Schicht blauweißlichen Schimmels gebildet.
Das Faß einfach buchhalterisch abschreiben und den Inhalt wegwerfen (auf dem Faß selbst war nochmal ordentlich Pfand), ging nicht, denn das hätte Ärger gegeben. Das Faß bei der nächsten Lieferung von frischem Sauerkraut beim Großhandel, meinem Ex-Lehrbetrieb, als frisch angeliefert mit Schimmel zu reklamieren, ging auch nicht, denn auf dem Faß klebte ein Zettel mit dem Verfallsdatum und dieses war bereits seit vier Wochen abgelaufen.
Da erinnerte ich mich sogenannter „alter Techniken“, die mir während meiner Zeit im Großhandel der eine oder andere kleine Krauter mal bei einem Bier anvertraut hatte.
Zuerst stellten wir zehn Packungen à je ein Kilo kaputte Salzpackungen her, die die entsprechende Kollegin bei „ihrem“ Großhandel als „Bruch bei Anlieferung“ reklamierte. Diese zehn Kilo Salz und den Schimmel auf dem Sauerkraut vermengten wir mit dem restlichen Sauerkraut. Wobei das kaum noch Fasern enthielt, sondern mehr „Pampe“ war. Vier Bunde frischer Möhren, die wir morgens bekommen hatten, meldeten wir dem Großhandel als „schimmlig bei Anlieferung“. Ich wußte aus meiner Zeit im Großhandel: so lange man nicht mehr als zehn Prozent einer Lieferung dort wieder reklamierte, so lange gab es garantiert keinen Kontrollbesuch durch den Großhandel und sechs Stunden nach der telefonischen Durchgabe, konnte man das Zeugs dann auch offiziell wegwerfen. Darauf baute ich und gewann das Spiel. Diesen Möhren entfernten wir das Laub und rieben sie mit einer von der Käsetheke entliehenen sehr groben Käsereibe an das Sauerkraut. Vier Kilo Äpfel, die faulig waren und die wir bereits am Tag zuvor beim Großhandel reklamiert hatten, entfernten wir die faulen Stellen und rieben es ebenfalls ans Sauerkraut.
Dann vermengten wir alles. Es sah recht bunt aus und roch sogar lecker.
Mein Gott, dachte ich, was kann an Sauerkraut noch sauer werden?
Dann tüteten wir es ab.
Nach vier Tagen war es verkauft.
In der Woche drauf bestürmten uns die Kunden mit der Frage, ab wann wir denn wieder dieses leckere Delikatesssauerkraut bekämen, das wir in der letzten Woche hatten, denn es habe hervorragend geschmeckt.
(* Anspielung auf meinen Abenteuerroman, der irgenwann unter dem Titel „Zwanzig Fässer Sauerkraut“ erscheinen wird)
alte Techniken
Als ich 1981 begann, im Einzelhandel zu arbeiten, war bereits das Wissen um viele der sogenannten „alten Techniken“ fast verschwunden und vermutlich bin ich die letzte Generation, die diese noch gelernt und vor allem selbst gelehrt hat. In diesem einen Jahr nach der Lehre, die ich noch im Großhandel verbracht hatte, hab ich dem einen oder anderen kleinen Krauter über die Schulter gesehen und auch hin und wieder einmal ein paar Tipps bekommen. Als ich dann als „1.Fachverkäufer“ zur HO ging, war das mein Vorteil, wie man in dem vorherigen Abschnitt bereits lesen konnte.
Ich bin bereits in der Zeit des Taschenrechners aufgewachsen. Zur Jugendweihe bekam ich meinen vom Onkel aus Steglitz. Insofern hatte ich schon einiges an Kopfrechnen verlernt, was ich aber wieder auffrischen mußte, weil wir im Einzelhandel wirklich noch die Preise pro Gewicht im Kopf berechneten.
Aber das, was die kleinen, privaten Krauter noch konnten, lernte man als Einzelhandelsverkäufer in der DDR zu meiner Zeit in den Kaufhallen bereits nicht mehr. Das war teilweise Wissen aus den „schlechten Zeiten vor und nach dem Krieg“, das nur noch bestimmte Personengruppen hatten. Alles wurde noch irgendwie verarbeitet, so wenig wie möglich weg geworfen.
Zu den „alten Techniken“ bzw zu dem alten Wissen gehörte, daß Berlin beim Kohlrabi eine Ausnahme machte und nur in Berlin Groß- und Einzelhandel den Kohlrabi mit Laub anboten. Die Berlinerin kocht nämlich das Laub mit, egal ob der Kohlrabi zu Eintopf oder kurzgebraten als Beilage verarbeitet wird. Mir blutet innerlich immer das Herz, wenn ich sehe, daß die Leute im Supermarkt dem Kohlrabi das Laub abdrehen. Hey, das kann man mitessen!
Genauso braucht man Rhabarber nur kurz zu schälen und die Stangen dann in Zucker dippen und roh essen. Davon sollte man jetzt nicht, wegen der im Rhabarber enthaltenen, leicht giftigen Oxalsäure mehrere Kilo in sich hinein schaufeln, aber zwei, drei Stangen am Tag sind kein Problem.
Blumenkohl kam bei uns meist noch mit komplettem Laub an. Wollte man ihn einige Tage frisch halten, so mußte man den Blumenkohlkopf in sein eigenes Laub einflechten. Vor dem Verkauf mußte aber das Laub ab. Das konnte man entweder mit dem Messer machen, oder die Stengel nur abbrechen. Beim Laub abschneiden säbelten die Azubis leider oft in den Kopf hinein, beim Laub brechen geschah das erst gar nicht … und mit der richtigen Technik ging es sogar schneller.
Da ich von meinen Lehrlingen niemals mehr verlangte, als ich selbst konnte, lud ich sie einmal zu einem Wettstreit um die nächste Tasse Kaffee in der Kantine ein. Ein LKW mit Anhänger aus dem Oderbruch, der ausschließlich Blumenkohl für uns geladen hatte, hatte seine Lieferung bei uns auf der Anlieferungsrampe abgestellt und ich schlug meinen Lehrlingen vor, daß sie zu viert für die Bearbeitung des gesamten Blumenkohls, der auf dem Triebwagen gewesen war, genauso viel Zeit hätten, wie ich, der sich um alles kümmerte, was auf dem Hänger des LKW, immerhin nochmals ein Drittel mehr, gewesen war. Wenn ich eher fertig wäre, müßten sie den Kaffee ausgeben, anderenfalls ich.
… und ich war schneller als die vier.
Äpfel und Zwiebeln kamen bei uns meistens lose an und mußten von uns erst noch abgepackt werden. Über ein etwa zwanzig Zentimeter langes Plastik-Fallrohr aus dem Sanitärhandel wurde ein Netzschlauch aufgefädelt und gespannt unten mit einem Knoten verschlossen. Dann wog man ein Kilo, also 850 Gramm, in so einer Topfwage ab, schüttete den Inhalt in dieses von dem Netzschlauch umgebene Fallrohr, ließ das ganze durchfallen, schnitt über der Ware ab, machte oben einen Knoten und wieder direkt unten am Fallrohr. Das machte man am besten zu zweit. Dies war eine der täglich für zwei bis drei Stunden anfallenden Arbeiten.
Fast alles, was es an Obst und Gemüse gab, mußte im Lager erst noch für die Selbstbedienung in der Kaufhalle vorbereitet werden. Deshalb hatten wir dort insgesamt nur in diesem Bereich zwölf Mitarbeiter in zwei Schichten, wobei immer wieder mal jemand an die Kassierer abgegeben werden mußte, die Leute auch mal krank wurden oder Urlaub machten.
Rot-, Weiß- und Wirsingkohl mußten verputzt und ausgewogen werden. Den Preis schrieb man mit rotem Kopierstift auf den Strunk. Porree und Kohlrüben mußten auf gleiche Art verputzt und ausgewogen werden. Viele Dinge, die heute als Stück verkauft werden, mußten damals gewogen werden. Gurken für 6,80 M/kg, Orangen 4,00 M/kg, Zitronen 5,00 M/kg, falls es Tomaten gab und diese noch fest waren, wurden sie wie Äpfel und Zwiebeln von uns je Pfundweise in Netzschlauch abgepackt, waren sie schon weich, wurde vor unserer Lagertür aus Gemüsekisten und Paletten ein Verkaufsstand improvisiert und dann über einzelne und persönliche Bedienung in Papiertüten verkauft. Wobei dann der Preis mit Kugelschreiber auf die Papiertüte geschrieben wurde.
Extra Sonderverkäufe mit eigener Waage und eigener Kasse auf einem Tisch aus der Kantine, im Sommer über eine der Türen, die eigentlich als Notausgang gedacht waren, im Winter im vorderen Kassenbereich, fanden regelmäßig statt. Bananen wurden so verkauft, im April die ersten Tomaten, in der Vorweihnachtszeit spanische Orangen (siehe Kapitel: Wie ich zu Roland Kaiser wurde), im Frühsommer Erdbeeren und Kirschen und ab August Melonen, Weintrauben, Pfirsiche und Aprikosen.
Das lief dann meist so ab, daß ich an der Waage stand, eine Kassiererin, ohne Registierkasse, sondern nur mit so einer Geldschatulle bewaffnet, nahm den Leuten die Preise ab, die ich ihr ansagte und zwei Lehrlinge tüteten, was zu tüten war, schon mal vor, bzw reichten mir Melonen oder Spankörbe mit Erdbeeren zu.
Es gab so gut wie keine Plastikverpackungen in der DDR, denn Cellophan-Beutel wurden aus Erdöl hergestellt und Erdöl mußte die DDR teuer importieren. Deshalb wurde fast alles in Papier verpackt. Fleisch, Wurst und Käse wurden auf Papptellern mit Pergamentpapier als Trenner von Packpapier umwickelt und dann der End-Preis für das Päckchen oben drauf geschrieben, den dann die Kassiererin vorn im Eingangsbereich an der Kasse eintippte.
Zu diesen alten Techniken gehörte auch, daß man ab einem gewissen Punkt in der Lage war, fast Blind in die Tasten der Registierkasse zu hauen. Daß einem die Kasse gar das herauszugebende Wechselgeld anzeigt, an so etwas war damals überhaupt noch nicht zu denken.
Hin und wieder fehlte es bei Sonderverkäufen an entsprechenden Papiertüten. Nicht verkaufte Zeitungen mußten dafür herhalten. In Absprache mit dem Lieferanten „Post-Zeitungs-Vertrieb“, das ging auf oft im Nachhinein, wurden übrig gebliebene Zeitungen vom Vortag verwendet und nicht in die Retoure gegeben. Ich wußte, wie man aus „Neues Deutschland“, „Berliner Zeitung“, ,Junge Welt“ und „BZ am Abend“, um nur einige zu nennen, schnell Tüten für den Verkauf drehte, die stabil genug waren, selbst bereits vor sich hin suppende Süßkirschen aufzunehmen.
Wenn man Erdbeeren verkaufte und das ging nur zwei-Kilo-Weise im Spankorb, mußte man das Eigengewicht des Korbes an der Wage, als das „Tara-Gewicht“ abziehen. Von jeder Erdbeerlieferung schütteten wir im Lager stichprobenartig zwei oder drei der Körbe aus, wogen die Leerkörbe und schlossen dadurch auf das Gewicht der Körbe bei der restlichen Lieferung. Oft wogen die Körbe zwischen und 900 und 950 Gramm, bei einem Kilopreis von 4,80 Mark rechnet sich das aber an der Waage schlecht. Die Erdbeerkörbe kamen meist in solchen Gitterboxen an und um die Körbe etwas schwerer zu machen, weichten wir im Lager diese Gitterboxen mit Hilfe eines Schlauchs in Wasser ein. Dadurch wogen die Körbe etwa mehr als ein Kilo, die Erdbeeren sahen frischer aus und wir verkauften pro Korb immer etwa 50 g an vom Spankorb aufgesogenes Wasser mit.
Salzgurken aus dem Spreewald wurden wie Sauerkraut in 50-Liter-Fässern lose angeliefert. Der Inhalt der Fässer bestand aus ca. 30 kg Gurken und etwa 20 Liter sie umgebende Flüssigkeit.
Die Salzgurken wurden gleichfalls in Cellophan-Beutel etwa Pfundweise, also 450 – 480 g verpackt.
Durchlöchterte man diese Gurken allerdings mit einer Rouladennadel einmal von vorn bis hinten und ließ sie über Nacht in der Salzlake liegen, saugten sie diese komplett auf. Die Gurken wurden saftiger und wir verkauften das von uns nicht bezahlte Salz-Wasser mit.
Kräuter und Suppengrün wurden „im Bund“, fast so wie heute, verkauft. Schwächelte die Petersilie im Verkaufsraum, wurde das Schnittlauch schon gelb und der Dill vertrocknete, dann bekamen diese bei uns im Lager eine Dusche mit frischem Wasser und wurden anschließend bei minus 18°C ins Tiefkühlhaus gestellt. Nach einer halben Stunde sah alles wieder wie frisch aus. Man mußte aber solcher Art behandelte Kräuter im Laden im Auge ständig behalten, weil diese Pracht nach einer weiteren halben Stunde bereits wieder vergangen war und man das Spielchen wiederholen mußte.
Da der direkte Verkauf für mich bereits nach kurzer Zeit zur Routine wurde, hörte man recht schnell am Tonfall, welche Menge der Kunde wollte.
„ein“ … das konnte noch alles heißen, deutete aber schon auf „Pfund“, also 500 Gramm, hin, denn „ein Kilo“ sagte kaum jemand.
Wollte jemand ein Kilo, dann begann er meist mit dem Wort „zwei“, was auf zwei Pfund schließen ließ. „Ein dreiviertel Kilo“ sagte auch niemand, sondern eher „anderthalb Pfund“, „Pfund“, „halbpfund Butter bitte“, also ein Stück, oder der Klassiker bei den Bauarbeitern in ihrer Mittagspause, das viertelpfund Hacke(peter), 125 g.
Ich werde später darauf zurück kommen.
Beim Geld blieb das 10-Pfennigstück der Groschen. Zur Unterscheidung zwischen dem 5-Mark/Euro-Stück/Schein und dem 5-Pfennig/Cent-Stück ist letzteres für mich immer noch der „Sechser“, der aber leider aus dem allgemeinen Sprachgebrauch zu verschwinden scheint.
Es wurde zwar in Berlin zusehends weniger, aber bis zum Ende der DDR kauften die Menschen direkt beim Großhandel im Herbst ihre Einkellerungskartoffeln. So ich mich recht entsinne, wurden die Kunden, die mindestens einen halben Zentner (25 kg) vorbestellten, aus unserem Kartoffellager in Alt-Blankenburg per LKW direkt beliefert.
So nach und nach setzten sich aber vor allem Nudeln und Reis als besser haltbare Alternative für den Notfall im Winter in den Haushalten durch.
Aus unserem Garten kenne ich noch das Anlegen von sogenannten „Mieten“. Vor allem Möhren und Kartoffeln, aber auch Äpfel und Birnen wurden in eigenen „Mieten“ über den Winter hinweg gelagert. Dazu wurde ein etwa 25 – 30 cm tiefes Loch ins Erdreich des Gartens gegraben. Unten wurde als Drainage einen Finger breit grober Kies gelegt, dann der Boden und die Wände mit Walnusslaub ausgelegt, denn das mögen Mäuse nicht, dann die einzulagernden Früchte zusamen mit Stroh da hinein gestapelt und schließlich nochmals alles mit Walnusslaub, einer passenden Holzplatte und Erde abgedeckt.
Auch das Einwecken, Einkochen kenne ich noch. Die Ernte aus dem Garten wurde in Körben nach Berlin geschleppt, dann die Früchte, vor allem an Bohnen entsinne ich mich, bearbeitet, in Gläser mit Wasser, Salz oder Zucker verpackt und schließlich in einem speziellen Topf pasteurisiert. Probleme gab es damit, wenn Muttern ihre Tage hatte. Dann wurde das Eingeweckte nach zwei bis drei Tagen, trotz aller Hygienemaßnahmen, milchig trüb und verdarb. Wenn Muttern in dieser Phase war, mussten wir Gänsrich-Männer ran, vom Bohnen schnippeln, über das desinfizieren der Gummidichtungen der Gläser unter kochendem Wasser bis zum Gläser befüllen und abdichten.
Hygienekontrolle
Diese staatlichen Kontrolleure besuchten uns regelmäßig und kamen fast immer unangekündigt. In meinem Bereich fanden sie selten etwas.
Aber da! Was war das? Staubige Schubfächer, die wir nie benutzten, in unseren Arbeitstischen im Lagerbereich.
Damals lernte ich für mich: wer etwas sucht, woran er Anstoß nehmen kann, der findet auch etwas. … und in diesem Fall war es vermutlich so, daß sie irgendetwas bei uns für ihre eigenen Vorgesetzten finden mußten. Das waren halt diese staubigen, nie benutzten Arbeitsschubfächer.
Spitzkohl und Melonen
Spitzkohl ist ganz junger Weißkohl. Sein Kopf ist noch nicht rund und fest, sondern die Blätter liegen etwa so fest an, wie bei einem Salatkopfkern, die man heute oft im Zweierpack eingeschweißt in einer Tüte bekommt. Der Kopf des Spitzkohls ist nicht rund, das sagt ja schon der Name, sondern ähnelt eher der geschlossenen Blüte einer Tulpe, ist aber halt Kohlkopf groß. Er eignet sich auf Grund seines noch relativ hohen Wassergehaltes hervorragend zur Herstellung eigenen Sauerkrauts oder von Kohlrouladen (in Berlin auch gern „Fußlappen“ genannt). Im Gegensatz zum vollends reifen Kohlkopf verdirbt er allerdings relativ leicht. Die Kunden unserer Kaufhalle liebten ihn.
Wir hatten an einem Samstag kurz vor Ladenschluss im Frühjahr des Jahres … weiß ich nicht mehr … etwa zwölf Gitterboxen voll Spitzkohl bekommen und sie erst einmal in unser Kühlhaus gestellt, um ihn am Montag auszuwiegen und in den Verkauf zu bringen.
Eine Kaufhalle unserer Größe arbeitete im Zwei- und im Vierschichtsystem. Die Waren-Annahme und die Schichtleiter hatten das Vierschichtsystem, alle anderen das Zweischichtsystem. Das hatte für uns alle Vorteile. Die übliche DDR-Wochenarbeitszeit betrug zu meiner Zeit noch 43 Stunden plus 45 min bei einer 5-Tage-Woche, eingeführt 1967. Im Zweischichtsystem arbeitete man nur noch 42 Stunden in der Woche, bei drei- und mehr Schichten waren es nur noch 40 Stunden. Außerdem gab es bei beiden auch noch finanzielle Zulagen, einige Pfennige pro Stunde, aber es summierte sich.
Das heißt, bei uns im Laden war eigentlich immer jemand da, auch an den Wochenenden. Nahm die Waren-Annahme keine Ware ab, dann packte sie im Verkaufsraum Schnaps, Nährmittel, Konserven und Getränke.
Unser Gemüsekühlraum war gewissermaßen ein Vorraum für den Tiefkühlraum.
Wie es unter diesen, doch relativ günstigen Umständen in Bezug auf die Beobachtung der Geräte, dazu kommen konnte, daß übers Wochenende nur bei unserem Kühlraum die Kühlung ausfiel, weiß ich nicht. Als ich jedenfalls am Montag das Kühlhaus öffnete, kam mir ein bestialischer Gestank entgegen. Bei über zwanzig Grad plus hatte sich der Spitzkohl selbständig gemacht und lief im Wortsinne aus seinen Boxen.
Den Geruch nach diesem modernden Gemüse hab ich mir eingeprägt.
Ein paar Wochen später fiel dort die Kühlung erneut aus. Die Wassermelonen in den zwei Gitterboxen, die für den Personalverkauf gedacht waren, waren aufgeplatzt und stanken nochmals anders. Auch den Geruch hab ich mir gemerkt.
Ich muß schon einige Jahre in meiner Wohnung gelebt haben, als in einer Wohnung genau am anderen Ende unseres Mietshauses ein alter Mann, um den sich niemand wirklich gekümmert hatte, verstarb und wohl etwas über drei Wochen tot in der Wohnung lag. Der Gestank brannte sich ins Haus und mir ins Gedächtnis ein. Ich weiß noch, daß ich wohl einige Wochen in meiner Wohnung ein Atemschutzflies trug, das ich immer in Eukalyptusöl tränkte.
MHO
Das war die Militärhandelsorganisation, der militärische Ableger der HO. Diese Geschäfte gab es überall in den Kasernen der NVA. Sie wurden von Zivilangestellten betrieben. Während meines Grundwehrdienstes in Klietz war dies ein Haus mit Reetdach. Unten die MHO, oben der ebenfalls zivil angestellte Schuster für unsere Stiefel.
Ich kann mich nicht daran erinnern, daß es bei uns in der MHO irgendwelche Frischwaren gab, wie z.B. Salat, Eier, Brot oder Obst, denn all das gab es ja bereits zubereitet für uns in der Kantine. Außerdem, das was wir da in Klietz zum Teil machten, frühstücken und abendessen alles komplett auf der Bude, war eigentlich nie zugelassen. Wir machten es trotzdem. Gegessen werden sollte eigentlich auf den Stuben nicht, aber wo sonst sollte man die leckere Knoblauchrohwurst, die Dose Ananas oder den leckeren Gouda aus Mutterns Freßpaket schnabulieren, als auf der Bude. Daß eigene Fach für Lebensmittel im Spind hatte keine Kühlung, so daß wirklich nur Dauerlebensmittel in der MHO verkauft wurden. Das waren überwiegend Dosenwurst, Dosenbrot (wir nannten es „Atombrot“), Gläser mit Apfelmus und Pflaumen. Dazu die ganze Stange der DDR-Süßwaren, wie „Bon-Riegel“, „Schlager Süßtafel“, „Hallorenkugeln“ oder Erdnußflips. Alle zwei Tage mußte von uns jemand aus der Bude dort Kaffee holen. Auch hier war die Auswahl nicht groß. Es gab „Mocca-Fix“, also filterfein gemahlener Kaffee oder „Rondo“, den man sich dort erst mahlen lassen musste. Beides à Viertelpfund (125 g) zu 8,75 Mark.
Neben dem Kaffee war die MHO für uns sehr wichtig, um Zigaretten einzukaufen. Wobei ich als Berliner dann schon wieder „verwöhnt“ war. In der DDR gab es recht viele Zigarettensorten, die mit richtig schlimm parfümiertem Balkan-Taback hergestellt waren. Die schmeckten fürchterlich! Oft war deren Taback auch nicht richtig zerhackt und bestand aus halben Strünken, die darin steckten.
Meine Lieblingssorte war die „Cabinet“, die es außerhalb Berlins leider nicht gab, die aber mit 3,20 M pro Packung mit 20 Zigaretten auch relativ teuer war. So ähnlich, aber um etwa anderthalb Zentimeter die Zigarette kürzer, war die „Juwel – alt“ für nur 2,50 M. Die gab es außerhalb Berlins selten, so daß ich mir immer im Urlaub von der NVA eine Stange davon in Berlin kaufte. In einer Stange waren aber „nur“ 25 Schachteln, so daß sie knapp einen Monat hielt. Für die „Cabinet“ gab es in der DDR die „Semper“ und die „f6“ zum gleichen Preis, die aber nicht schmeckten, die „f6“ hatte obendrein einen nur sehr groben Filter. Statt der „Juwel – alt“ wurde auf dem Land die „Juwel 72“ oder die „Kenton“ angeboten, mit diesen schlimmen bulgarischen Tabaken. Die nahm ich nur im alleräußersten Notfall. Wurde das Geld zum Monatsende knapp, stieg ich auf die Filterlose und komplett unparfürmierte, legendäre „Karo“ um. Vom Geschmack und der Stärke her der „Rothändle ohne Filter“ nicht unähnlich. Die „Karo“ kostete, wie auch die „Salem rot“ (runde Zigaretten) und „Salem gelb“ (ovale Zigaretten, die es wieder fast nur in Berlin gab) pro Packung 1,60 Mark. Kaum etwas minderte Hunger, vertrieb Mücken oder ließ einen nach dem Frühsport noch vor dem Frühstück so sehr husten, wie die gute „Karo“.
Dann gab es in der MHO Deo, Zahncreme, schwarze Schuhcreme, Rasierseife und -klingen, denn die meisten rasierten sich nass, ich war bei uns in der Einheit einer von nur zweien, die sich trocken rasierten, normale Handseife und ein paar Schreibwaren, also Briefblöcke und -papier, Kugelschreiber, Patronenfüller, Bleistifte. Zeitungen und Zeitschriften gab es nur in der Poststelle im Objekt.
Tja und dann führte die MHO auch Produkte, die es in der normalen HO nicht gab und die zum Soldatenleben dazu gehörten, wie z.B. Kragenbinden für die Uniform, das Essgeschirr, das man bei Übungen mitschleppte, die allseit (un-)beliebten braunen Plastik-Kaffeebecher, Waschmittel in kleinen Abpackungen und zum waschen mit Kaltwasser und vor allem Armeesocken, die sich nach spätestens viermal tragen im Nichts auflösten.