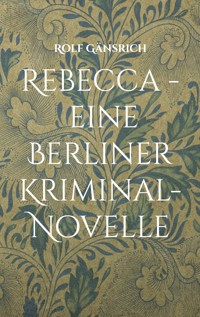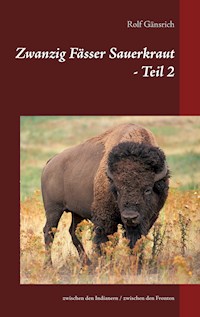Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Rolf Gänsrichs Prenzlberger Ansichten
- Sprache: Deutsch
Im Laufe von 28 Jahren habe ich in fast jeder monatlichen Ausgabe dieser Kiezzeitung mindestens einen Artikel gehabt. Richtig gesammelt habe ich die Texte erst seit 2004. Weil die Zeitung zum Jahresende 2024 eingestellt werden soll, habe ich mal all mein Material dafür zusammengefasst. Es ist sehr viel und reicht für vier Bände. Ziel war bzw. ist es, in der Zeitung selbst noch Werbung für diese Bücher zu machen, um ihren Verkauf zu fördern. In diesem Band 4 sind die Artikel, die abgelehnt wurden. Auf Grund des inhaltlichen Zusammenhangs von Band 2 mit Band 3 lasse ich Band 4 zeitlich vor Band 3 erscheinen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Himmel, dass das solche Mengen an Texten für die Zeitung sind, hätte ich nicht gedacht. Hier also die ungedruckten Artikel.
Und wieder zeitlich bunt gemischt nach dem jeweiligen Dateinamen auf meinem Rechner geordnet. Außerdem sei mir der Hinweis gestattet, dass Sie hier wie immer drei deutsche Rechtschreibungen finden, die alte, die neue und meine. Die Interpunktion erfolgt dem Klangbild nach aus dem Bauch heraus.
Viele werden sich jetzt sicher auch Fragen, warum der 4. Band vor dem 3. Band erscheint! Hat einen einfachen Grund: ich wollte in Band 3 noch die Artikel von mir mit aufnehmen, der in der letzten Ausgabe der Zeitung erschienen, weil sie thematisch so schön passten.
Noch eine abschließende Erläuterung. Bis Sommer 2005 hatte ich kein Internet. Daher bestand bei mit überhaupt nicht der Bedarf daran, meine Artikel auf meinem PC, den ich damals seit 1999 hatte, abzuspeichern, um sie per E-Mail zu versenden. Zudem waren damals die in die Rechner eingebauten Festplatten von der Speicherkapazität her noch extrem klein. Sie lag bei 4,5 GB, bzw. 4,8 GB. Heute gelten 500 GB bereits als klein. Deshalb wurde auf den Rechnern nur das Notwendigste gespeichert und alles andere wieder gelöscht.
Und nun, auf geht’s! Lassen Sie uns in meinen alten Texten stöbern.
Rolf Gänsrich am 21. + 25.5. + 19.6.2024
*
Helmholtz – November 2011 – am 7.10.2011
Mit dem 1. September 1939 begann der vom Hitler-Regime angezettelte II.Weltkrieg. Ab dem 12.August 1940 wurden erstmals durch Bomber der Deutschen Wehrmacht die britischen Inseln direkt angegriffen.
Dieser so beginnenden „Luftschlacht um England“ war gewissermaßen eine Testphase der „Legion Condor“ voraus gegangen. Die „Legion Condor“ war eine verdeckt, das heißt ohne deutsche Uniformen oder Hoheitszeichen, operierende Einheit der deutschen Wehrmacht im Spanischen Bürgerkrieg.
Sie wurde 1936 unter strengster Geheimhaltung ins Leben gerufen, griff in alle bedeutenden Schlachten ein und war wichtig für den Sieg der Putschisten unter General Franco über Spaniens demokratisch gewählte Regierung. Ihre Existenz wurde bis 1939 geleugnet.
Die Legion Condor errichtete die erste Luftbrücke, führte den ersten massiven Luftkrieg der Geschichte gegen die Zivilbevölkerung eines europäischen Landes und verübte die ersten Verbrechen der Wehrmacht. Bekannt wurde die Legion Condor insbesondere durch die völkerrechtswidrige Bombardierung und Zerstörung Guernicas 1937, das so zu einem weltweiten Symbol für die Gräuel des Krieges wurde. In England waren die ersten Ziele der deutschen Luftwaffe im Krieg ab 1939 natürlich Flughäfen, militärische Objekte, Hafenanlagen und schließlich Industriegebiete.
Sie sollten England so weit schwächen, dass es entweder freiwillig aufgab oder eine deutsche Invasion, eine Anlandung auf den britischen Inseln möglich machte. Durch die deutsche Wehrmacht wurden dann aber tatsächlich nur einige britische Inseln im Ärmelkanal, wie z.B. Jersey okkupiert.
Großbritannien wehrte sich ziemlich schnell. Bereits am 5.September 1939 hatte die britische „Royal Air Force“ (RAF) Wilhelmshaven angegriffen.
Berlin wurde durch die RAF vom 25.August 1940 bis zum 30.März 1945 bombardiert, da hieß aber der Chef der Deutschen Luftwaffe, Herrmann Göhring, schon lange in der Berliner Bevölkerung nur noch Meier, hatte doch der, wie er auch hieß, „Goldfasan“ oder „Lametta-Heini“, bei Kriegsbeginn vollmundig erklärt, er wolle Meier heißen, sollte jemals ein alliiertes Flugzeug Berlin erreichen.
Mit dem Eintritt der USA in den Krieg, nach dem Angriff der Japaner auf den US-Stützpunkt Pearl Harbor in Oahu auf Hawaii am 7.Dezember 1941, teilten sich Briten und Amerikaner die Luftangriffe auf Deutschland. Tags über griff die damalige US-Army-Air-Force (USAAF) die Industriegebiete und Verkehrsandern an, Nachts terrorisierte die RAF die Zivilbevölkerung.
In Berlin wurden vom ersten Kriegstage an Bordsteinkanten mit Leuchtfarbe gestrichen, denn eine Straßenbeleuchtung gab es Nachts im Krieg nicht mehr. Auch wurde Nachts Verdunklung angeordnet. Die Menschen mussten Fensterläden schließen und Rollos herunter lassen. Autos, Straßen- und S-Bahnen fuhren mit Tarnscheinwerfern, die nur noch einen kleinen Lichtschlitz nach vorn warfen, Grundwehrdienstleistende der NVA werden diese noch aus eigenem Erleben kennen.
Aber auch in den Bussen und Bahnen selbst war „Verdunklung“ angesagt, die Fahrgastkabinen hatten an den Scheiben selbst Rollos und wurden innen nur schummerig beleuchtet. Die S-Bahnen zum Beispiel hörte man eher in die, gleichfalls unbeleuchteten Bahnhöfe, einfahren, bevor man sie sah. Da in dieser permanenten Dunkelheit und bei Gedränge auch oft die Zugtüren kaum von Wagenzwischenräumen zu unterscheiden waren, schweißte man recht bald und nach einigen Unfällen, bei denen Menschen von Bahnsteigkanten auf Gleise und Stromschienen gefallen waren, Metallbügel in Brusthöhe an die Waggonenden.
Das Leben unter diesen permanenten Luftangriffen muss zermürbend für die Zivilbevölkerung gewesen sein. Ständig auf gepackten Koffern sitzen, oder im Luftschutzraum Stunden lang, Tage lang herum sitzen, warten und hoffen, dass man den nächsten Luftangriff auch wieder übersteht. Ein Soldat hat es da besser, denn er kann bei einem Angriff entweder zurück schießen und sich selbst verteidigen, oder sich selbst eingraben, oder weg laufen oder sich selbst die Kugel geben. All diese Möglichkeiten hat ein Zivilist nicht.
Mein Vater, in der Pappelallee 62 aufgewachsen und bei Kriegsende gerade erst vier Jahre alt (und leider schon am 29. Januar 2010 verstorben) erzählte mir immer, wie schlimm gerade die letzten Kriegstage waren. Ständig raus aus dem warmen Bett, rein in den kalten, muffigen Keller des Hauses, warten. Dann war auch plötzlich mal seine Mutter weg, weil sie von irgendwoher was zu essen organisierte und die dann wohl bei einem dieser „Ausflüge“ nur um Haaresbreite einem Scharfschützen entging … .
Und dann die letzten Tage, wo sie dann gar nicht mehr aus den Kellern heraus kamen.
Das war dann auch schon eine Zeit, in der viele Leute die Fenster in ihren Wohnungen mit Holz und Pappe vernagelt hatten. Durch die Druckwellen bei den Luftangriffen waren die meisten Fensterscheiben in der Stadt zersprungen. Glas war Mangelware und viele, die dann neue Glasscheiben hätten bekommen können, vernagelten trotzdem lieber ihre Fenster, denn beim nächsten Luftangriff splitterten die Scheiben ohnehin wieder. Hinzu kam die dann noch erhöhte Verletzungsgefahr durch eben jene Glassplitter.
In den letzten Kriegstagen gab es schließlich keinen eindeutigen Frontverlauf in der Stadt mehr. Saßen um zwölf Uhr im Keller des Vorderhauses die Russen und im Dachgeschoss des Seitenflügels noch die Wehrmacht, konnte das eine Stunde später bereits wieder umgekehrt sein.
Hinzu kam, dass die meisten Keller eines Häuserblocks untereinander verbunden waren. Die Häuser trennenden Wände waren überall bereits zu Kriegsbeginn nur lose zu gemauert und sollten als Fluchtweg, für die in diesem Schutzraum Sitzenden dienen, sollte deren Haus von Bomben getroffen sein. Zum Kriegsende hin waren die meisten dieser Mauerdurchbrüche von der Bevölkerung längst begehbar gemacht.
Mein Vater erzählte mir davon, wie er noch so einiges von diesen letzten Kampfhandlungen mit bekam und wie ständig Soldaten in anderen Uniformen durch die Keller flitzten. Um den Zeitpunkt der eigentlichen Kapitulation Berlins am 2.Mai 1945 herum, brach noch eine Gruppe von SS- und Wehrmachtssoldaten aus dem Berliner Kessel in Richtung Norden, genau durch diese Keller in der Pappelallee, aus.
Von den Kampfhandlungen in Berlin zeugen die bis heute sichtbaren Einschusslöcher in den Fassaden der wenigen noch nicht sanierten Häuser, davon auch einige in der Pappelallee und vom dortigen Friedhofspark aus erkennbar.
Auf Humann- und Helmholtzplatz waren im Krieg Löschteiche angelegt worden. In diesen verscharrte man nach den Kämpfen eiligst Soldaten beider Armeen. Ich habe nicht heraus bekommen, ob diese jemals wirklich exhumiert wurden, aber anzunehmen ist es.
Unser Bild hier zeigt den Helmholtzplatz vermutlich im Frühjahr 1946. Wir können es leider nicht direkt datieren. Die gröbsten Kriegsschäden scheinen bereits beseitigt, jedoch sieht man überall noch diese mit Holz und Pappe vernagelten Fenster. Der Platz ist weitest gehend abgeholzt.
Nach der Katastrophe „Krieg“ kam es 1945/46 zum „Hungerwinter“. Die Männer waren meist noch in Gefangenschaft, die Äcker waren im Frühjahr 1945, aus verständlichen Gründen, nicht oder kaum bestellt worden, Brennmaterialien gab es, wegen der fehlenden BergMÄNNER, auch kaum, dazu kamen die fast komplette Zerstörung der Infrastruktur und der Verkehrswege in Deutschland, Gerangel der Alliierten um Kompetenzen untereinander, zugige, weil meist kaputte Wohnungen und eine besonders harte Kältewelle. Viele, die den Krieg überlebt hatten, erfroren in diesem Winter.
In seiner Not, den Menschen irgendwie helfen zu wollen, gab der Berliner Magistrat deshalb die Fällung von Straßenbäumen frei und verteilte die Bäume, auch in Parks und auf Plätzen, an die Hausgemeinschaften, …. also sie wies diesen dann bestimmte Bäume zur Fällung zu.
Was zum Beispiel an Bäumen im Tiergarten den Endkampf um Berlin überlebt hatte, wurde dann dort in diesem Winter abgeholzt.
Deshalb ist der Helmholtzplatz auf diesem Foto auch so kahl. Ein nächster Schritt des Berliner Magistrats, um dem Hunger herr zu werden, war dann, dass alle Plätze beackert werden durften. Und so sehen wir auf diesem Bild hier offenbar ganze Hausgemeinschaften auf dem Helmholtzplatz bei der Gartenarbeit im Frühjahr 1946. Es ging dabei vor allem um den Anbau von Kartoffeln und um Kohl- oder Steckrüben.
Und dann sind mir auch noch die Geschichten meines Vaters und meiner 1982 verstorbenen Großmutter mütterlicherseits in Erinnerung, die mir davon berichteten, wie man nach dem Krieg überall, wo man es konnte, Nahrung herstellte. Kaninchen und vor allem Hühner wurden (nicht Art gerecht) in kleinen Verschlägen auf Balkonen oder sogar in Küchen gehalten. Und in Blumenkästen und als Zimmerpflanzen gediehen vor allem Tabak und Rüben.
*
am 20.11.2009Weihnachten zwischen Colloseum und Westpaket
Im Zuge der ganzen Fernsehbilder, die man rund um den 20. Jahrestag des Mauerfalles sah, hab ich mich gefragt, wie denn wohl die Kontakte zwischen Ost- und Westberlin während der Mauer aussahen.
Den Genuss, sich innerhalb Deutschlands frei bewegen zu können, hatte man schon seit Beginn des II.Weltkrieges eigentlich nicht mehr. Wobei es in den ersten Kriegsjahren, als die Deutsche Wehrmacht vom einen zum anderen Sieg taumelte, Privatpersonen noch durchaus möglich war, zu reisen. Aber spätestens, als die 6.Armee vor Stalingrad eingeschlossen wurde (Ende 1942) hieß es: „Räder rollen für den Sieg“ und Privatreisen waren nicht mehr möglich. Mit dem Beginn der Besatzungszeit in Deutschland nach dem Krieg konnten sich die Bürger nur problemlos (abgesehen von der zerstörten oder demontierten Verkehrsinfrastuktur) innerhalb der eigenen Besatzungszone bewegen. Nach Gründung von DDR und BRD 1949 wurden die Grenzen zwischen beiden deutschen Staaten (die sogenannten „Interzonengrenzen“) schon 1952 komplett verriegelt und lediglich West-Berlin war für die DDR-Bürger erreichbar.
Am 13.August 61 war mit dem Mauerbau auch da Schluss. Wir sehen noch die Bilder weinender Mütter, an Fenstersimsen hängende Großeltern usw. in der Bernauer Straße. Die persönlichen Kontakte rissen unvermittelt ab. Wusste man da nicht mehr, wie es der Verwandtschaft, den Freunden im anderen Teil der Stadt erging, hab ich mich gefragt? Auch das innerstädtische Telefonnetz war 1952 getrennt worden. Aber in Ostberlin hatte ohnehin damals kaum eine Privatperson einen Telefonanschluss. Einzig innerhalb des internen Netzes der Deutschen Reichsbahn konnte man von Ost nach West, nur dienstlich, telefonieren, da die DDR-Reichsbahn auch die Strecken (einschließlich S-Bahnnetz) in Westberlin betrieb. Irgendwie ab 1972 gab es dann einen Handvermittelten Dienst, ab wohl 1974 auch einige Selbstwählleitungen zwischen den beiden Stadthälften, mit der Vorwahl von Ost- nach Westberlin: 849, wie es mein Telefonbuch von 1989 besagt. Übrigens das DDR-Telefonnetz war noch 1990 auf dem technischen Stand der frühen 30er Jahre.
Ein Kuriosum für die heutige Zeit: die Rohrpost in (Ost-) Berlin wurde am 1. März 1949 wieder aufgenommen und erst 1977 eingestellt. Die Beförderungsgebühr betrug 20 Pfennige je Sendung.
Also, wie waren da die Kontakte? Es gab wenigstens Briefe? Im Internet ist da nicht viel zu erfahren. Also musste ich Freunde und Bekannte fragen, die zur Zeit des Mauerbaus schon so weit erwachsen waren, dass sie das ganze Drama bewusst miterlebten. Und nun also, ja! Briefe konnten geschrieben werden.
Die Post wurde weiter befördert. Wobei man sicher sein konnte, dass nationale wie internationale Geheimdienste garantiert das eine oder andere mitlasen. Es dauerte auch. Zehn bis vierzehn Tage für die Laufzeit waren da normal. Und dann gab es zu Weihnachten das legendäre „Westpaket“ von der Oma, dem Onkel oder den Freunden von „drüben“.
Der Inhalt der Westpakete, die mit der Aufschrift „Geschenksendung, keine Handelsware“ gekennzeichnet sein und ein Inhaltsverzeichnis enthalten musste, ähnelte sich oft. Verschickt wurden neben überwiegend gebrauchter Kleidung vor allem Süßigkeiten, Orangen, Kaffee, Zigaretten und Obstkonserven wie Dosenananas. Die Paketkontrollen in der DDR waren sehr scharf, so dass es passieren konnte, wenn die Inhaltsangaben ungenau oder falsch waren, dass solche Pakete mit ihrem gesamten Inhalt beschlagnahmt und eingezogen wurden. Zurückgeschickt wurden sie nie!
Dennoch enthielten Pakete, deren Versand die westdeutschen Absender steuermindernd geltend machen konnten, pro Jahr etwa 1000 Tonnen Kaffee und fünf Millionen meist gebrauchte Kleidungsstücke.
Ich erinnere mich, dass diese Westpakete, wenn man sie öffnete, immer besonders rochen, ... so etwas süßlich nach Orange, Tabak und Zuckerwaren. ... Für mich der Inbegriff des Weihnachtsgeruchs!
Am 20. März 1976 wurde das Abkommen über Post- und Fernmeldewesen zwischen der DDR und der BRD unterzeichnet. Ab dem 1. Juli 1976 galten im Internationaler Postverkehr mit der BRD und Berlin (West) neue Bestimmungen. Päckchen waren bis zum Höchstgewicht von 2 kg zugelassen. Im Postverkehr mit der BRD und mit Berlin (West) war die Abtretung von Ersatzansprüchen ausgeschlossen.
„Die Westler“ konnten einen erst Jahre nach dem Mauerbau im Ostteil besuchen. Dafür gab es ein spezielles „Passierscheinabkommen“. Unterhändler unterzeichneten am 17. Dezember 1963 das erste Passierscheinabkommen. Ost-Berliner Verwandte durften erstmals zwischen dem 19. Dezember 1963 und dem 5. Januar 1964 besucht werden, etwa 700.000 West-Berliner machten Gebrauch davon.
Zu dieser Zeit gab es noch keine gegenseitige Anerkennung staatlicher Einrichtungen. Daher stand man vor dem Problem, mit welchem Personal man die einzurichtenden Passierscheinstellen in West-Berlin besetzen sollte. Polizeiangehörige und vergleichbares Personal aus der DDR waren durch den Westen nicht erwünscht.
Als Lösung dieses Problems wurden scheinbare Mitarbeiter der Deutschen Post eingesetzt. Es handelte sich um gegenüber dem Westen als Postler legendierte, also mit Postuniformen und Ausweisen versehene, Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Mit dieser Lösung konnten beide Seiten das Gesicht wahren.
Der Westen verhinderte amtliche Behördenvertreter aus dem Osten, der Osten konnte Staatsbedienstete zur Passierscheinerteilung einsetzen.
Soweit ich erfahren habe, konnten ab 1964 erstmals Rentner (der gleichbedeutende Begriff „Rentier“ ist heute nicht mehr gebräuchlich) aus der DDR in den „Westen“ reisen.
Bis 1966 folgten vier weitere Passierscheinabkommen mit der DDR:
Das 2. Passierscheinabkommen am 24. September 1964 (ab November 1964 erstmals mit Mindestumtausch von Devisen), das 3. Passierscheinabkommen am 25. November 1965 und das 4. Passierscheinabkommen am 7. März 1966 für Ostern und Pfingsten. Zwischen dem 7. und 20. April 1966 sowie zwischen dem 23. Mai und 5. Juni 1966 durften West-Berliner Verwandte in Ost-Berlin besuchen, das 5. Passierscheinabkommen am 6. Oktober 1966 für Weihnachten/Neujahr.
Danach blieb nur noch die Passierscheinstelle für dringende Familienangelegenheiten, also Härtefälle, erhalten. Von diesen Beschränkungen ausgenommen waren Geschäftsreisen, Reisen zur Leipziger Messe sowie Reisen auf Einladung amtlicher Stellen der DDR.
Das Viermächte-Abkommen über Berlin von 1971 und der Verkehrsvertrag vom 17. Oktober 1972 ersetzten später die bisherige Regelung des Personenverkehrs.
Nunmehr war es den Bewohnern von West-Berlin wieder regelmäßig möglich, nicht nur Verwandte, sondern auch Bekannte im Ostteil der Stadt und auch in der gesamten DDR nach Erteilung eines „Berechtigungsscheins zum Empfang eines Visums“ zu besuchen.
Als die Regelungen ab 1971 in Kraft traten, machten uns die Lehrer in der Schule ideologisch scharf und sie berichteten von den bösen Westlern, die Verbrechern gleich, Gift in die Süßwaren täten, die sie uns mitbringen würden und ähnliche Schauermärchen, die wir, als Grundschüler, damals glaubten.
Um an Devisen zu gelangen, wurde gleichfalls mit diesen Besuchsabkommen ein Zwangumtausch von der DDR erhoben. Anfangs waren es 10 DM, eine Zeit lang nur 6,50 DM, ab den 80er Jahren 25 DM die pro Person und pro Besuchstag in der DDR von den Westberlinern bei der Einreise nach Ostberlin zum Kurs von 1 : 1 in DDR-Mark umgetauscht werden mussten. Eine ganz schöne Stange Geld für eine Arbeiterfamilie aus dem Wedding, die ihre Verwandten am Prenzlauer Berg besuchen wollten! Hatten die das Geld dann nicht ausgegeben, durften sie es bei der Ausreise aus Ostberlin jedoch nicht wieder zurücktauschen!
„Die Westler“ besuchten uns 2 – 3 mal im Jahr meist am Samstag- oder Sonntagnachmittag, also zu einer Zeit, in der die Geschäfte schon geschlossen und selbst die Schönhauser Allee fast Menschenleer war. Und so entsinne ich mich noch mit Entzücken an die Goldene Hochzeit meiner Eltern, an der uns „die Westler“ nun ausnahmsweise einmal mitten in der Woche besuchten und die über die nun sehr belebte Schönhauser Allee staunten.
Schon damals sehr beliebt war das Kino Colosseum. Ein Teil des Gebäudes wurde 1894 als Wagenhalle der Berliner Straßenbahn benutzt. Anfangs wurden hier ebenfalls zunächst die Pferde, nach der Umstellung auf elektrischen Betrieb nur noch Busse untergebracht. Am 12. September 1924 eröffnete das erste Filmtheater an diesem Ort. Es hatte 1000 Plätze für Besucher, welche hier neben Stummfilmaufführungen auch Varietéveranstaltungen mit Orchesterbegleitung erleben konnten.