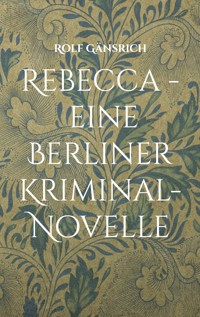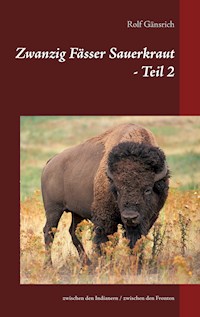Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es war in der NVA streng verboten, als einfacher Soldat ein Tagebuch zu führen, denn "der Feind" hätte es ja in die Hände bekommen können und dann ... tja, dann ... Ich hab es dennoch getan, zumindest ein Erstes geführt, ein zweites begonnen, wobei mir das bei einer gezielten Schrank-kontrolle durch den Stasi-Offizier unserer Einheit abgenommen wurde und ich mich dann nicht mehr getraut habe, ein Neues zu beginnen. In einem kleinen A6-Vokabelheft, pro Tag nur eine Zeile und das in kryptischer Kurzschrift, fand ich dieses Tagebuch 2005 wieder. Plötzlich kamen sehr intensive, sehr genaue Erinnerungen in mir zum Vorschein, die ich 2004 als Serie für eine meiner Radiosendungen bei alex-berlin und rockradio.de aufschrieb und hier nun erstmals veröfffentliche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort am 3.Februar 2019
Endlich ist mein erstes von insgesamt vier bislang schon fertigen Büchern über BoD auf dem Weg („Wie bewerbe ich mich richtig – ein Ratgeber für den Berufsalltag“) und ich kann mich an die Veröffenlichung des nächsten Buches machen. Ich habe mittlerweile so viel Zeugs geschrieben: Kurzgeschichten, die Stadthistorie für unsere Lokalzeitung, Texte für meine Radiosendung, Gedichte und diesmal eben auch etwas Längeres. Aus vielem, vor allem aus den kurzen Texten, muss ich noch in sich stimmige Bücher schmieden.
Angefangen hat alles einmal in der Kindheit. Wir hatten in unserer Familie bis ich sieben Jahre alt war keinen Fernseher. Das war Anfang der 60er Jahre und in meinen Augen noch nicht so lange her. Und so bin ich damals mit Radio, mit Hörspielen sowie mit Geschichten, die mir meine Eltern vorgelesen hatten, groß geworden. Das hat meine Phantasie derart beflügelt, dass ich schon ab der ersten Klasse, kaum der Buchstaben kennend fähig, meine ersten kurzen Texte zu schreiben begann. Mit zunehmendem Alter wurden diese länger.
Meine Mutter tippte diese Texte auf meine Bitte hin dann auch mal auf ihre Schreibmaschine ab. Sie arbeitete als Sekretärin in Heimarbeit – meine Facharbeiterabschlussarbeit beispielsweise diktierte ich ihr fast aus dem Stehgreif in die Maschine. Allerdings kürzte sie eigenmächtig meine Texte ohne mein Wissen. In der DDR gehörte es sich – das wußte man als Schreiber –, dass man in die Texte ein gehöriges Quantum an „staatstragender Ideologie und Politik“ mit einweben musste. Ich wunderte mich immer, dass meine Texte promt abgelehnt wurden, und zwar mit den Worten „noch nicht reif genug“, „zu wenig Klassenstandpunkt enthalten“ oder „Text ist fernab des sozialistischen Menschen“.
Erst wenige Wochen vor ihrem Tod im Jahr 2008 gestand mir meine Mutter, dass sie bei meinen Textabschriften ausgerechnet die politischen Inhalte weggekürzt hatte, die ich extra ihretwegen hineinweben wollte.
Schade! Vielleicht wäre ich ja bereits in der DDR ein bekannter Schriftsteller geworden. Allerdings verlor ich durch diese vielen Absagen derart den Mut, dass ich – abgesehen von Briefen aus der JVA – das Schreiben über zwanzig Jahre so gut wie bleiben ließ.
Ende 1995 liefen mir nette Menschen über den Weg, die monatlich die kleine Stadtteilzeitung „Prenzlberger Ansichten“ veröffentlichten und die mich aufforderten, für sie zu schreiben. Mein erster Text, im April 1996 dort erschienen, war schlichtweg WOW… ich kann es! Mittlerweile ist die Auflage der Zeitung von dreitausend auf rund siebzehntausend gestiegen. Ich schreibe nach wie vor pro Monat ein, zwei Texte über Stadtgeschichte, die auf tausendfünfhundert, bzw. dreitausend Zeichen begrenzt sind.
Das hier vorliegende NVA-Tagebuch existiert wirklich. Es fiel mir Weihnachten 2004 in die Hände und ich dachte, weil ich alle Geschehnisse darin nur in je einer Zeile pro Tag anreiße, eine gute Idee, es abzuschreiben, bevor ich die dahinter stehenden Zusammenhänge vollends vergesse.
Dieses erste Heftchen war nach einem halben Jahr voll und ich nahm es mit nach Hause. Ein zweites Büchlein wurde leider bei einer gezielten Schrankkontrolle konfisziert. Ein drittes Büchlein traute ich mich dann nicht mehr anzufangen. So basiert also dieser hier vorliegende Text aus zusammengereimten Erinnerungen. Beim Schreiben staunte ich nicht schlecht, wie viel Erinnerungen da noch zum Vorschein kamen.
Und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen musste dieser Text dann auch fertig werden. Genau zwei Tage nach seiner Fertigstellung kam ich am 14. Februar 2005 mit einer Lungenembolie in die Notaufnahme des DRK-Klinikums Berlin-Westend. Bis zu dieser Lungenembolie war ich bei einem täglichen Zigarettenkonsum von etwa vierzig Stück am Tag beziehungsweise einem Päckchen Tabak selbstgedrehter Zigaretten angekommen. Am Tag der Lungenembolie habe ich schließlich mit dem Rauchen aufgehört. Das Rauchen ist aber hier im Buch ein oft wichtiges Thema.
Ziemlich genau fünfundzwanzig Jahre nach meiner Einberufung zur NVA las ich diesen Text erneut – und zwar häppchenweise, immer recht genau fünfundzwanzig Jahre nach den damaligen Ereignissen in meiner Radio-Sendung „pommes rot weiß“ beim Internetsender Rockradio.de.
Mein Leben in der NVA, der Nationalen Volksarmee der DDR.
*
Ende des Vorworts und Beginn des Tagebuchs
Im Mai ´85 wurde ich zum Grundwehrdienst der NVA eingezogen. Am 1. März 2006 wäre die NVA 50 Jahre alt geworden, wenn es sie noch gegeben hätte.
Grundlage für dieses Buch liefert mir jenes Tagebuch, das ich bei der NVA heimlich geführt habe, sowie die Briefe, die ich an meine Eltern und an meine damalige Freundin geschickt hatte und die mir diese irgendwann einmal zurück gaben.
Vorweg eines: angenehm war die NVA nicht! Achtzehn Monate oder fünfhundertachtundvierzig Tage lang fragte ich mich, warum ich diese Zeit dort war? Was hatte ich verbrochen? Was hatte ich angestellt, dass man mich 548 Tage lang einsperren musste, um mich der Willkür, der Schikane von Vorgesetzten und der anderen Soldaten auszusetzen!
Andererseits zehre ich von dieser Zeit noch heute! Wo sonst in Mitteleuropa als in einer Armee reizt man die Grenzen des eigenen Daseins so total aus? 68 Stunden nicht essen und nicht trinken. Oder 74 Stunden ohne Unterbrechung wach sein ... bis zum Sekundenschlaf. Oder zwei Wochen lang sich nicht waschen können, bis die Haut rotbraun ist und juckt. Oder das Gefühl, wenn scharfe Geschosse über den eigenen Kopf hinwegorgeln. Oder das Erleben eines Geschosseinschlages in unmittelbarer Nähe. Oder das sinnlose Stunden vergammeln, das Umzingeltsein von einer Horde Wildschweine, die traurigsten Weihnachten, der Alkoholschmuggel... und... so... weiter.
Erst heute sage ich: ich bin stolz, in der NVA gedient haben zu dürfen. ... Die NVA ... die im besten Sinne preußischste Armee der Welt, die jemals auf deutschem Boden gestanden hat.
*
Die NVA wurde am 1. März 1956 aus Einheiten der sogenannten kasernierten Volkspolizei gegründet. Von Anfang an hatte die NVA Probleme mit ihrer eigenen Identität und mit ihrer eigenen Geschichte, die irgendwo in Deutschland verwurzelt sein sollte.
Die Uniform der NVA war jener der Wehrmacht zum verwechseln ähnlich, jedoch wurde dieser Uniformschnitt damit begründet, dass Soldaten diesen Schnitt schon in den preußischen Befreiungskriegen getragen hätten. Offiziere trugen zu ihrer Paradeuniform kleine Säbelchen ... auch so ein Relikt. Die Schirmmützen, die es zur Ausgangsuniform gab, sollten zwar, im Gegensatz zur Wehrmacht, keinen Sattel, sondern wie bei der Sowjetarmee, einen glatten Teller haben, aber natürlich zwirbelten wir, schon weil es verboten war, diese Schirmmütze zu einem Wehrmachtssattel um.
Der NVA-Stahlhelm war ebenfalls keine Erfindung der NVA, sondern ein Originalprodukt der deutschen Wehrmacht, das noch in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges entworfen wurde.
Zur ersten Parade der NVA am 1. Mai ´56 sollte die NVA im russischen Gleichschritt mit 16 Schritt (wie ich glaube: pro zehn Sekunden) marschieren. Dies klappte bei den Vorbereitungen allerdings nicht und so stellte es die sowjetische Militäradministration der NVA frei, wonach sie marschierte. Und schließlich, oh Wunder, nach preussischer Militärmusik, mit preussischen nur 12 Schritt pro zehn Sekunden, klappte es.
Und seien wir doch mal ehrlich: der alte, preussische Stechschritt bei Paraden oder bei der Wachablösung sah doch weit besser aus, als das Geschlunze der Bundeswehr!
Im Jahr 1962 wurde in der DDR die Wehrpflicht eingeführt. Mein Vater wurde im November 1962, quasi als zweite Wehrpflichtschicht, mitten in der Kubakrise eingezogen und diente dann bis Ende April 1964 als Funker und Kraftfahrer bei Neubrandenburg in Fünfeichen.
*
Die DDR-Grenztruppen wurden aus der NVA heraus gegründet. Nach dem Viermächteabkommen, wonach Berlin eine von deutschen Soldaten entmilitarisierte Zone war, hätte demnach nie ein Ost-Berliner zur NVA eingezogen werden dürfen. Zu den Grenztruppen schon, aber nicht zur regulären NVA.
Ich will ’ne Entschädigung! Ich hätte nie zur NVA gedurft!
Wir Berliner NVA-Soldaten merkten das daran, dass wir zu bestimmten Anlässen nicht nach Hause durften, damit man unsere Uniform in der Öffentlichkeit nicht sah, denn wir mussten in Uniform fahren und hätten bei den reinen Wochenendurlauben einmal pro Halbjahr dann auch außerhalb unserer Wohnungen Uniform tragen müssen. Nur bei längerem Urlaub brauchte man das nicht. Aber das hat natürlich niemand gemacht.
Oder ein anderes Beispiel: ich war mal drei Wochen lang in der Grenztruppenkaserne in Wilhelmshagen untergebracht, das kurz vor der Berliner Stadtgrenze hinter Erkner liegt. Der Verteidigungsminister des befreundeten Staates Vietnam machte einmal einen Truppenbesuch in dieser Kaserne. Während dieser Zeit bekamen wir NVA-Soldaten den ausdrücklichen Befehl, unsere Unterkunftsräume nicht zu verlassen, damit dieser befreundete Verteidigungsminister unsere NVA-Uniform nicht sah... wie gesagt: Verstoß gegen den Viermächtestatus Berlins.
Urlaub gab es 18 Tage für 18 Monate Grundwehrdienst. Die Urlaubstage wurden pro Halbjahr aufgeteilt. Es gab je einen K.U. (d.h. Kurzurlaub) von Freitag Dienstschluss bis Montag Dienstbeginn sowie einen V.K.U. (d.h. Verlängerter Kurzurlaub) von Freitag Dienstschluss bis zum nächsten Freitag Dienstbeginn. Gab es dazwischen einen gesetzlichen Feiertag wie zum Beispiel den 1. Mai oder den 7. Oktober, dann hatte man automatisch einen Urlaubstag mehr. Leider hatte die NVA auch eine ständige Gefechtsbereitschaft von 85 %, als befände man sich im tiefsten Krieg, und nur zu Weihnachten gab es davon Ausnahmen. Diese hohe Gefechtsbereitschaft und den zustehenden Urlaub der Soldaten zu gewährleisten, war planerisch immer ein Drahtseilakt.
Man war also zweimal pro Halbjahr zu Hause.
Ausgänge gab es. Punkt. Da die meisten Soldaten weit weg wohnten und oft stundenlange Fahrtwege in Kauf nehmen mussten, war der Ausgangsbereich meist auf die umliegenden, ein, zwei Dörfer beschränkt. Ausgang gab es meist von Dienstschluss 17.00 bis 24.00 Uhr, gelegentlich gab es auch – wenn auch sehr selten – Ausgang bis morgens um 6.00 Uhr. Nur etwa alle zwei bis drei Wochen hatte es für einen Soldaten überhaupt Sinn, einen Ausgang zu beantragen, meist wurde nur ein Ausgang pro Monat gewährt, öfter gab es ihn kaum, ... Vorgesetzten-Schikane inbegriffen!
„Sie sind ja nackt, Mann! Machen sie gefälligst den obersten Knopf an ihrem Hemd zu!“
*
Bezahlt wurde der Dienst in der NVA auch. Als Wehrsold gab es erst 150 Mark. Wenn man nach einem Jahr fast automatisch vom Soldaten zum Gefreiten befördert wurde, gab es 180 Mark Sold. Was bezahlte man davon? Von diesen 150 bzw. 180 Mark musste die freiwillig abonnierte Tageszeitung und die eher unfreiwillig abonnierte Armeezeitung bezahlt werden, sowie die Mitgliedsbeiträge für FDJ, DSF und Partei. Zigaretten kosteten pro Packung (Inhalt je 20 Stück, Tagesverbrauch im allgemeinen eine Schachtel, bei Diensten und bei Übungen auch durchaus zwei Schachteln am Tag) Karo (ohne Filter) 1,60 M, Juwel alt (mit Filter) 2,50 M, Cabinett 3,20 M (ich rauchte bis zur Wende die "Juwel alt" und stieg dann auf Camel und Pall Mall um – es gab auch eine "Juwel 72", quasi die Neue, die aber aus fürchterlich schlecht geschnittenem bulgarischem Tabak gemacht war) – das machte bei 2,50 M pro Tag etwa 75 Mark im Monat und etwa viermal im Monat war man auch mit Kaffee kaufen auf der Bude dran. Eine Tüte Mocca-Fix mit 125 g (ein Viertelpfund) Inhalt reichte auf der Bude nur einen Tag lang ... macht nochmal rund 36 M pro Monat.
Mit den Zeitungen war es so, natürlich lag es im eigenen Interesse jedes Soldaten, das eigene, heimische Regionalblatt zu abonnieren. Ich freute mich immer auf meine leicht lesbare „BZ am Abend“ (Ja, Ost-Berlin hatte noch eine Abendzeitung, die etwa ab 14 Uhr überwiegend per Straßenverkäufer an den S-Bahnhöfen oder über die Kaufhallen [Supermärkte] in den Verkauf kam. Gegen 13.30 Uhr erfolgte die Auslieferung. Am Morgen des nächsten Tages bekam man das Blättle auch in der restlichen DDR).
Bei den Armeeblättern hatte man, soweit ich noch weiß, zwei Varianten zur Auswahl. Entweder man nahm die wöchentliche Zeitung oder man nahm das monatlich erscheindende Hochglanzmagazin mit den erotischen... tja... Pinup-Fotografien namens „Armeerundschau“. Beide kamen jedenfalls vom Armee-Verlag in der Storkower Straße im Prenzlauer Berg... also für mich von zu Hause, quasi auch mit einem Schuß Heimaterde.
Vom Rest des Wehrsoldes wurden überwiegend Zigaretten und Kaffee gekauft. Karo ohne Filter (stark wie Rothändle ohne Filter, allerdings war in der Karo unparfümierter, scharzer Tabak und ihr Rauch so ätzend, dass er sogar Mücken vertrieb und wir sie deshalb gerne heimlich und verbotenerweise rauchten, wenn wir Nachts Objektwache standen, denn eine glimmende Zigarette sieht man Nachts noch auf einen Kilometer Entfernung), zwanzig Zigaretten für 1,60 Mark, oder „Juwel-alt“, zwanzig Filter-Zigaretten für 2,50 Mark oder „Cabinett“ für 3,20 Mark oder „Club“ für 4 Mark oder „Orient“ - zehn Zigaretten oval mit Mundstück ohne Filter für 2,60 Mark, Mocca-Fix (wie die meisten Kaffeesorten in der DDR 125 Gramm) für 8,75 Mark. War noch Geld übrig, gab es auf unserer Bude puren Luxus in Form von Bäckerbrot, das derjenige zu holen hatte, der im Ausgang war. Aber auch der Ausgang kostete Kohle für Alkohol. Dann brauchte man Schreibzeug und Briefmarken oder man kaufte sich ein paar neue Kragenbinden für die Uniform, man brauchte seine Zahncreme und sein Rasierzeug und sein Deo, usw.
Den Satz:
„Liebe Eltern, wollt ihr mich retten,
schickt mir Geld und Zigaretten!“
habe ich mehr als einmal geschrieben.
Fresspakete von Verwandtschaft oder Freundin waren üblich!
Die Steglitzer Verwandtschaft schickte in der Zeit an meine Eltern regelmäßig Dauerkonserven mit Obst (Ananas in Dosen und Pfirsiche), Theramed-Zahncreme und meinen geliebten löslichen Kaffee. Muttern packte die Sachen dann um und leitete sie an mich weiter. Hin und wieder erreichte mich auf diesem Weg auch eine Packung Camel-Filters, die eigentlich immer für Vaddern gedacht waren. Tja, man kann sagen, dass ich quasi „vom Feind“ mitversorgt wurde.
Ja...äh... das Feindbild der NVA war der Westdeutsche und der West-Berliner und natürlich die Soldaten der NATO, insbesondere die der Bundeswehr und der USA!
Übrigens: während normalerweise alle Fressalien in Kasernenbuden geteilt wurden, gab es bei uns die Abmachung, dass Westkonserven, Westschokolade, Westkaffee nicht geteilt werden mussten – dafür gabs das auch zu selten. Aber fast jeder hatte irgendwas... „vom Feind“.
Weil der Vater eines Kameraden bei uns auf der Bude bei Schollene Fischer war, habe ich z.B. in meiner NVA-Zeit mehr geräucherten Aal gegessen als jemals zuvor oder danach.
Man konnte im Besucherraum des Objektes auch Besuch empfangen, ganz ähnlich wie im Knast. Einige Male kamen in der Zeit meine Eltern, zweimal mein Bruder, einmal meine Freundin.
Belobigt wurde in der NVA auch!
Die höchste Belobigung war eine Fotografie von sich selbst vor der Truppenfahne! Hurra-hurra-hurra!
Dieses Bild wurde dann an die Eltern, an die Freundin und an das heimische Arbeitskollektiv gesandt. Das Arbeitskollektiv hatte dieses Bild dann auf Wandzeitungen aufzuhängen.
Eine Stufe darunter wurde mit einem Tag Sonderurlaub belobigt. Ich bekam in anderthalb Jahren insgesamt vier Tage Sonderurlaub und, auch eine Form der Belobigung, mehrere Ausgänge bis 6.00 Uhr.
Dann gab es jede Menge Orden und Ehrenzeichen, wenn man auf seinem Fachgebiet entsprechende Prüfungen bestand, wie beispielsweise die „Quali-Spange“. Etwa bei der zweiten Stufe als Vermesser gab es die Schützenschnur, wenn man beim scharf Schießen eine gewisse Punktzahl erreichte und so weiter.
Es gab natürlich auch Strafen. Eine Stunde lang in brütender Sonne stillstehen war noch das Geringste. Als Gefreiter konnte man zum Soldaten degradiert werden. Man konnte tagelang oder auch, so wie ich, nur zum Ausnüchtern für eine Nacht in den Knast kommen. Oder der Sonderurlaub wurde gestrichen. Oder man bekam, so wie ich, wochenlang Ausgangssperre aus dem Objekt. Oder man bekam, so wie ich, eine Arbeitsverrichtung außer der Reihe, d.h. in der Freizeit aufgebrummt. Es war ein Drahtseilakt zwischen: ich erfülle meine Pflicht, ich erfülle meine Pflicht über oder ich schlunze. Wo Licht ist, ist auch Schatten.
Wie ich dazu kam, erkläre ich noch.
Der normale Soldat ist meistens feige und nur selten mutig. Er heischt nicht nach Belobigungen, ist meistens faul, versucht, mit dem Strom zu schwimmen und irgendwie durchzukommen. Dabei bekommt er mal Lob und mal Ärger. Man war anderthalb Jahre eingesperrt, man hatte anderthalb Jahre kein Privatleben!
*
Mich beim Vorgesetzten für eine Zigarette oder für den Gang zum Klo ab- und auch wieder zurück zu melden, hab ich in der NVA gelernt.
Anweisungen und Befehle... wenn man sie als sinnvoll betrachtet, oder wenn sie Spaß machen, erfüllt man sie gut, wenn sie einem sinnlos, irrsinnig oder bescheuert vorkommen und wenn sie keinen Spaß machen, erfüllt man sie den Buchstaben nach oder kreativ nach Art der Schildbürger!
*
Ich bin Jahrgang ´61 und in Hohenschönhausen geboren. Im März ´79, meinem 18. Lebensjahr, musste ich zur allgemeinen Musterung. Dabei stellte man fest, was die BfA ja jahrelang bestritten hatte: dass mein Kreuz arg angschlagen ist. Ich wurde für die Rückwärtigen Dienste gemustert und erst einmal für Jahre zurückgestellt.
Als ich am 1. März 1983 mit zweiundzwanzig Jahren bei meinen Eltern in Hohenschönhausen aus- und in meine Bude im Prenzlauer Berg einzog, musste ich mich auch auf dem Wehrkreiskommando Diesterwegstraße Ecke Danziger Straße (damals Dimitroffstraße) ummelden. Aber der 1. März war „Tag der NVA“ und somit NVA-interner Feiertag. Man ließ mich nicht mich ummelden, ja man wimmelte mich auf dem Wehrkreiskommando regelrecht ab. Ich solle in ein paar Tagen wiederkommen. „Sie wissen doch, was heute für ein Tag ist.“
Auf der Meldestelle der Polizei funktionierte die Ummeldung reibungslos.
In der stillen Hoffnung, dass man mich vielleicht vergessen würde, meldete ich mich natürlich nicht nochmal auf dem Wehrkreiskommando. Ihr hattet eure Chance!
Freiwillig komme ich nicht zu euch.
Man vergaß mich aber nicht. Am 15. Februar ´85, mit fast 24 Jahren und einem schon halb gelebten Leben, bekam ich per Einschreiben den Termin für meine „Einberufungsmusterung“ für den 12. März ´85. Am Tag nach diesem Einschreiben kam ich betrunken zur Arbeit. Ich hatte mir mit Muttern am Abend eine „Keule“ (Flasche starken Alkohols, vermutlich Weinbrandverschnitt) „eingefädelt“.
Während der Einberufungsmusterung – sie fand in der Schivelbeiner Straße 43 statt – wurde mir gesagt, dass ich im Mai wegkomme.
In den Wochen danach hatte ich viel zu tun.
Offiziell lebte ich in meiner Wohnung zur Untermiete. Jedoch lebte der Hauptmieter mittlerweile offiziell bei seiner Freundin. Innerhalb von zwei Wochen bekam ich die Wohnung vom Amt zugesprochen und das Amt übernahm für die NVA-Zeit die Miete meiner Wohnung.
Sämtliche Daueraufträge von meinem Gehaltskonto – ich hatte damals schon eines und sie waren eine Seltenheit in der DDR – mussten gestoppt werden. Die Abbuchung vom Tele-Lotto wurde genauso gestoppt wie die S-Bahn-Monatskarte für eine Station Ostring für 2,70 Mark pro Monat, das Zeitungsabo sowie die Lebensversicherung wurde auf Eis gelegt, Energiekosten für die Wohnung wurden bis zu meiner Wiederkehr gestundet .....
Im Radio... äh... vom Radio schnitt ich, per Tonband, nochmals alles mit, was es an Titeln gab. Ich schnitt einfach ALLES mit.
Dann vervollständigte ich meine privaten Telefon- und Adresslisten. Von meiner Radio-Sendung, ich erstellte damals wöchentlich eine Sendung mit 90 min auf Tonband, produzierte ich in sechs Wochen zweiundzwanzig 90-min-Sendungen vor!
Diese Tonbandsendungen hatte ich 1978 begonnen. Die von mir aufgenommen Bänder – ein Mix aus Musik, Kurzgeschichten und Witzen – wurden im Freundeskreis herumgereicht. In aller Regel brauchte es etwa vier Wochen, bis ich ein Band wieder zurück bekam und neu überspielen konnte.
Weil ich sämtliche Bänder immer wieder überspielte, ist davon so gut wie nichts mehr erhalten. Um 1990 herum wurden aus den echten Tonbändern dann Tonbandkassetten, die ich noch bis etwa 1996 herstellte. Seit 1995 sende ich wöchentlich live beim heutigen „alex – offener kanal berlin“.
Die Blumen meiner Wohnung verteilte ich auf die gesamte Verwandtschaft, der Gummibaum wanderte ins dunkle Bad und dort in die Wanne. Diesen Gummibaum hatte meine Mutter 1958 von ihrem ersten Lehrgeld gekauft. Der Baum lebt bei mir im Wohnzimmer noch immer.
Ich musste organisieren, dass gelegentlich nach der Wohnung und regelmässig nach meinem Briefkasten geschaut wird.
Für den Dienst in der NVA musste ich je zweimal Wasch- und Rasierzeug organisieren, Handtücher, Waschlappen, Schlafanzüge, Schreibzeug, Papier, Kugelschreiber, Bücher zum Lesen, ein Kartenspiel …
In meiner Wohnung lagerte ich 100 Schachteln Zigaretten („alte Juwel“), sechs Flaschen Alkohol (Goldbrand – der billigste Weinbrandverschnitt), zwei große Kartons Papiertaschentücher und mehrere Dauerkonserven für den Fall ein, dass ich doch mal unverhofft nach Hause käme. Ich hatte während meiner NVA-Zeit auch immer meine Wohnungsschlüssel am Mann... es hätte ja sein können... Selbst meinen Personalausweis musste ich kurz vor der Einberufung auf der Meldestelle der Polizei hinterlegen.
Es kam mir so vor, als würde ich für die nächsten anderthalb Jahre nicht existieren.
Ich eliminierte stückchenweise mein ziviles Leben. Ich legte mein Leben auf Eis und war anderthalb Jahre lang jemand anderes. Zumindest fühlte ich mich so.
Nachdem ich am 2. April ´85 mitbekam, dass mir nur noch zwei reguläre Urlaubstage in meinem Job zustünden, schob ich auf Arbeit die „scheiß-egal“-Nummer. Ich machte auf Arbeit nur noch das Allernotwendigste, kam zu spät zur Arbeit oder besoffen. Am 13. April machte ich komplett blau und ging erst gar nicht hin.
Am 29. und 30. April gab mir dann mein Chef von sich aus frei... mit mir wäre sowieso im Job nichts mehr anzufangen gewesen.
Mit den Kumpels feierte ich am 27./28. April Abschied. Von der Familie am 29. April. Mit meiner damaligen Geliebten, Marina, feierte ich am 30. April. Wobei der Abschied mit den Kumpels noch so lief, dass uns im Laufe des Abends der Alkohol ausging und wir im Trabbi eines Kumpels besoffen und mit quitschenden Reifen in den Kurven zu einem Späti fuhren, um Nachschub zu holen.
Am 30. April, vor meinem Treffen mit Marinchen, bekam ich in der Schallplattenabteilung eines Warenhauses sogar noch zwei Lizenz-LP’s, Michael Jacksons „Thriller“ und eine „Best of“ von Johnny Cash zu kaufen. Am 1. Mai war ich nüchtern und schlich nochmals allein durch meine Wohnung und hörte Musik.
*
Der erste Tag bei der NVA, Donnerstag der 2. Mai 1985, war der schlimmste... und längste.
Gestellungsort: Klietz, zwischen Stendal, Rathenow und Havelberg gelegen!
Gestellungszeit: 12 Uhr!
Fast genau dort, wo am 8. Mai 1945 als letzte Wehrmachtstruppe im Zweiten Weltkrieg die „Armee Wenck“ kapituliert hatte.
Mein Vater fuhr mich mit seinem Wartburg hin. Letzte Aufnahme zu Hause um 8.30 Uhr: Die RIAS-Nachrichten und anschließend das Lied „ein Tag wie ein Freund“ von Truck Stop. ... Ha ha! Wie passend! Um 8.40 Uhr saß ich mit flauem Magen im Auto.
Um 11.40 Uhr kamen wir vor dem Objekt auf einem Parkplatz an. Mein Vater versuchte mich zu beruhigen: „Sieht doch gar nicht so schlimm aus!“... Wir waren nicht einer Meinung. Es sah schlimm aus: die Gebäude, die Sturmbahn, die Wachposten...
Vor dem Tor zum Objekt schlenderte eine Person „mit Lametta“ herum. Wie sich bald herausstellte mein Stabschef Major Willmann.
Nunja. Auch ein Hinauszögern des Abschiedes konnte nicht ewig dauern. Irgendwann musste ich ja sowieso da rein.
Also noch eine Zigarette mit Papa, dann die Reisetasche schnappen und den Einberufungsbescheid.... zielstrebig schlenderte ich gebeugten Hauptes auf den Major zu und zeigte ihm den Bescheid und fragte: „Ähm ... bin ich hier richtig?“ - ein Nein erhoffend, aber nicht wirklich erwartend.
„Ja, na, dann kommen’se mal rein...nach da hinten, in den Kinosaal!“
Als es zwölf wurde, Mittags, High-noon, waren wir etwa 60 oder 70 junge Männer in zivil, mit recht verängstigten Gesichtern. Sehr viele betrunken.
Die Anwesenheit jedes einzelnen wurde festgestellt, ehe es eine Rede vom Major gab und es zur ersten Einkleidung kam. Jeder von uns erhielt einen Trainingsanzug, Turnschuhe und Unterwäsche.
Vor dem Kinosaal wurden wir dann unseren Einheiten zugeordnet. Ich wurde zum „Stabsführungszug“ eingeteilt, ohne jedoch den blassesten Schimmer davon zu haben, was das überhaupt sei.
Im ersten Gebäude auf dem Komplex wurden wir und unsere Reisetaschen gefilzt und wir mussten uns umziehen. Mein Pech war, dass meine Mutter es nur gut mit mir gemeint hatte und mir, unbemerkt von meinem Vater und mir, zwei Tafeln Westschokolade in die Reisetasche geschmuggelt haben musste, als Vaddern mich vor meiner Tür abgeholt hatte.
Schon war ich dran: „Sie schickt wohl der Feind?“ Die Schokolade wurde konfisziert, ich sah sie nie wieder, und ich hatte meinen ersten Anranzer weg. Schönes Ding!
Dann ging es weiter. Zum ersten Mal im ach so ungewohnten Gleichschritt. Ziel war ein Mannschaftszelt für etwa 50 Leute. Krasser hätte der Unterschied zwischen Zivilleben und Armee nicht sein können! Psychischer Absturz ohne Ende! Drei Betten übereinander, also nicht Doppelstock-, sondern Trippelstock-Betten. Einsziebzig lang, d.h. zwölf Zentimeter zu kurz für mich, und fünfzig breit. Gestampfter, kalter, glibberiger Lehmboden mit Grasresten. Drei Mann, ein Schrank. Die gesamte Beleuchtung im Zelt bestand aus zwei Hundert-Watt-Glühbirnen. Eine Steckdose. Ein Kanonenöfchen. Ein Tisch. Keine Hocker oder Stühle. Das nächste Bett eine Armlänge weit weg.
Dass wir die Grundausbildung im Zelt verbrachten, lag daran, weil in unseren eigentlichen Quartieren für drei Wochen einige Offiziere hausten, die an einer großen Übung der NVA auf dem Truppenübungsplatz Klietz teilnahmen. Dies erfuhren wir erst einige Tage später.
Man kam nicht zum Nachdenken.
Alle 50 Leute rein ins Zelt. Bettensuche nach Einheit. Bettenbau... blau-karierte Bettwäsche... hier Kante, da Karos... aber ein bischen schnell!
Schrank einräumen... wie gesagt, drei Mann, ein Schrank... also etwas abweichend von der Norm, aber alles sieht hinterher gleich aus. Das eigene Eßbesteck greifen und sofort wieder draußen antreten, stillgestanden und dann: „Iiim Laufschritt maaarsch!“ Mittagessen fassen.
Rein in die Kantine, anstellen und klatsch: man hat irgendwas Klebriges auf dem Teller.
Wenn der Unteroffizier aufgegessen hat, steht der auf und brüllt: „Alles auf!“. Spätestens am zweiten Tag schlingt man das Fressen in sich hinein, scheißegal, was es ist... man hat ja Kohldampf.
In dieser Zeit bin ich zum „Suppenkasper“ geworden. Mehl-, Milch- und Nudelsuppen waren meist nur noch lauwarm, wenn man sie auf dem Teller hatte. Sowas konnte man leichter und schneller weglöffeln. Griesbrei oder Milchreis waren auch sehr beliebt.
Dass die Unteroffiziere, oft achtzehnjährige Burschen, sich einen regelrechten Spaß daraus machten, möglichst schnell „Alles auf“ zu sagen, dürfte einigermaßen klar sein.