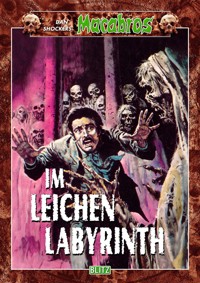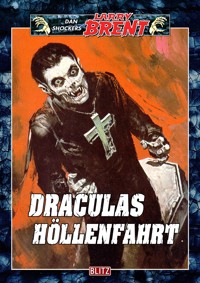Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Larry Brent Classic
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Larry, Morna und Iwan gastieren in Lima, um einem Maskenfest beizuwohnen. Noch ahnen sie nicht, was in ihrer unmittelbaren Nähe heranreift. Doch dann wird ein englischer Forscher vermisst. Kurz darauf überschlagen sich die Ereignisse. Bonus: Dan Shockers Schreckensherberge (Teil 2)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 78
Dan Shocker
DIE TODESBRUT IN DEN ANDEN
Erscheinungstermine von „Die Todesbrut in den Anden “
© 2014 by BLITZ-Verlag
Redaktion: Jörg Kaegelmann
Fachberatung: Robert Linder
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati
Illustration: www.ralph-kretschmann.de
Titelbildgestaltung: Mark Freier
Satz: Winfried Brand
All rights reserved
www.BLITZ-Verlag.de
ISBN 978-3-95719-878-5
Der Wind blies so stark, dass sein Heulen und Pfeifen zwischen den mächtigen Felsblöcken geisterhaft klang und Donovan Ashley aufweckte. Der Engländer, dessen Vorfahren noch echte Lords waren, jedoch verarmten und ihre Ländereien ebenso eingebüßt hatten wie ihre Titel, hob den Kopf und lauschte in die Nacht. Der Wind zerrte wie wütend an seinem Zelt. Auf dem Hochplateau, wo sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, stand noch ein zweites Zelt. Darin schliefen die drei Träger, Indios aus dem Andenhochland, denen diese abenteuerliche Landschaft vertraut war. Und sie kannten noch etwas, das Ashley brennend interessierte. Auf den Märkten unten in den Städten, wo sie ihre handgefertigten Stoffe und Kunst verkauften, wurde über ein Ungeheuer gesprochen. Bisher waren dem geheimnisvollen Wesen, das in der zerklüfteten Bergwelt der Anden leben sollte, schon mehrere Menschen zum Opfer gefallen. Man hatte zumindest nie wieder etwas von ihnen gehört.
Von seinen Vorfahren hatte Donovan Ashley den Geist eines echten Abenteurers geerbt. Ashleys Ahnen waren Reisende und Entdecker gewesen, und wenn Ashley es einrichten konnte, war auch er gerne unterwegs. Und eines Tages hatte er in Peru von den seltsamen Vorfällen in den Bergen gehört. Die Geschichten waren so aufregend gewesen, dass Ashley drei mutige Einheimische anheuerte, um den Weg in die Berge zu wagen. Seine Begleiter sollten ihn so weit wie möglich begleiten, den Rest des Weges wollte er allein zurücklegen. Morgen Mittag würde es soweit sein. Zelte, Proviant und Geräte, die für den Aufstieg gebraucht wurden, sollten im Lager verbleiben. Die Zelte waren als Rückzugsort im Notfall gedacht.
In das Heulen des Windes mischte sich plötzlich ein Geräusch, das nicht vom Sturm stammen konnte. Ashley war sofort hellwach, beugte sich vor, zog die Zeltplane am Eingang zurück und starrte in die stürmische Nacht hinaus. Da war es wieder, dieses Geräusch, ein lang gezogener Klagelaut mit dumpfem Zischen. Ashley schälte sich aus seinem Schlafsack, warf eine Wolldecke um seine Schultern und lief nach draußen. Das Zelt, in dem seine Begleiter schliefen, flatterte vor ihm im Wind. Der Eingang war unverschlossen. Ashley stolperte näher und erstarrte. Das Zelt war leer!
Die drei Helfer, die ihm bei Tagesanbruch auf der letzten Wegstrecke hätten folgen sollen, waren spurlos verschwunden. Sie hatten ihn im Stich gelassen. Die Schlafsäcke lagen offen, die Wolldecken fehlten. Ashley holte missmutig eine Stablampe aus seinem Zelt und ließ den hellen Lichtfinger über den Felsboden wandern. Kampfspuren konnte er nicht entdecken. Vielleicht hatte die Angst vor dem Monster sie vertrieben. Womöglich hatte es mit den Geräuschen zu tun, die er gehört hatte.
„Hallo!“, brüllte Ashley in das Sturmbrausen des Windes. Niemand antwortete ihm, stattdessen vernahm er wieder dieses eigentümliche Zischen. Neugierig ging er über das Plateau hinweg und folgte den Lauten. Vorsicht war hier in dreitausend Metern Höhe geboten, denn das Gestein war rissig, voller Spalten und uneben genug, um zu verunglücken. Wenn er sich in dieser gottverlassenen Gegend ein Bein brach, konnte es kritisch für ihn werden. Er war jetzt auf sich allein gestellt und konnte kaum Hilfe erwarten.
Plötzlich bemerkte Ashley im Lichtkegel seiner Lampe etwas Merkwürdiges. Unter einem verwitterten Felsblock drang schwarzer Dampf hervor, wurde in Abständen mit großem Druck aus dem Gestein gepresst. Der Atem eines Ungeheuers!, schoss es ihm durch den Kopf. Sollte an dem Gewäsch der Indianer doch etwas dran sein? Die unzugänglichen Stellen in den Bergen spielten schon immer eine große Rolle in den Mythen der Eingeborenen, deren Vorfahren Inkas und Mayas waren. Die alten Götter hausten noch an versteckten Orten, beseelten die alten Tempel und Mauern, die zum Teil vergessen waren, aber von denen immer wieder durch Zufall Reste entdeckt wurden. In dieser Region war der Boden mit Menschenblut gedüngt. Vor Jahrhunderten hatte man tausende Menschen in die Tempelstätten der Blutpriester und ihrer Götzen getrieben und sie in deren Namen bestialisch ermordet. Wenn Steine reden könnten …
Ashley näherte sich vorsichtig dem zischenden Dampf. Er hatte keine Erklärung für dieses Phänomen. Waren das die Vorzeichen eines ausbrechenden Vulkans? Wenn Lava ein Ventil brauchte, fand sie einen Weg. Aus dem Loch unterhalb des Felsens drangen lang gezogene Klagelaute, die sich anhörten wie gequälte Stimmen im Höllenfeuer. Er wagte sich noch einen Schritt näher heran, ging in die Hocke und merkte im gleichen Augenblick, dass der verwitterte Felsboden unter seinen Füßen nachgab. Bevor er einen klaren Gedanken fassen konnte, kippte Ashley nach hinten. Instinktiv verlagerte er sein Gewicht und versuchte, sich herumzuwerfen, doch es war bereits zu spät. Er rutschte wie auf einer Rampe in die Tiefe, durch den schwarzen Dampf, der zischend in sein Gesicht spritzte. Er spürte jeden Tropfen, der ätzend seine Haut traf. Es brannte wie Feuer und fraß sich durch seine Kleidung. Ashley schrie, als der Schmerz seine Haut erreichte. Sein Brüllen hallte schaurig durch die kalte Nacht und kam verzerrt von den nahen Bergen als Echo zurück. Ashley verlor das Bewusstsein.
Ashley erwachte, glaubte, dass er in seinem Zelt lag, eingezwängt in seinen dickgefütterten Schlafsack. Er versuchte sich zu bewegen, doch ohne Erfolg. Steif wie ein Brett lag er da und spürte das panische Rasen seines Herzens. Was war passiert? Er konnte seinen Körper kaum noch spüren, alles fühlte sich taub an. Es war, als hätte ein Nervengift seine Muskeln gelähmt. Er zwang sich zur Ruhe. Seine Erinnerung reichte zurück bis zu dem Moment, als er in das dunkle Felsloch gestürzt war. Er glaubte nicht an dieses Monster, das in der Einsamkeit Wanderer überfiel und zu sich in sein dunkles Reich hinabzog.
Um ihn herum war alles finster, seine Augen gewöhnten sich nur langsam an die Dunkelheit. Er befand sich in einer Höhle. Das stimmte auch mit seiner letzten Wahrnehmung überein. Beim Sturz in die Tiefe musste er sich verletzt haben, dennoch hatte er keine Schmerzen. Er versuchte erneut, sich herumzuwerfen. Nichts. Er lag steif da und beobachtete seine Fußspitzen. Sie bewegten sich nicht. Obwohl er keine Lichtquelle ausmachen konnte, nahm er die dunklen Umrisse von Mauern wahr, purer Fels. Er selbst lag auf blankem Stein, wie in einer großen Gruft, erfüllt von einer bedrückenden Totenstille. Nichts war mehr von dem ohrenbetäubenden Zischen zu hören, das ihn zu dem gefährlichen Ort gelockt hatte. Er wollte rufen. Wer immer ihn hier festhielt, sollte ruhig wissen, dass er bei Bewusstsein war. Doch seine Stimme versagte ihm den Dienst, scheinbar war er nicht nur von Kopf bis Fuß gelähmt. Seine Panik verstärkte sich. Wer war da? Das Lichtflackern entstand sicher nicht von selbst. Außerdem lag er sorgfältig ausgestreckt auf einem Steinsockel. Da war er sicher nicht von selbst hingelangt. Jemand musste ihn gefunden und darauf gelegt haben.
Der ersten Angst folgte Hoffnung. Ich bin nicht allein!
Er hörte Schritte, zuerst leise, dann lauter. Sie näherten sich. Wer immer ihn gerettet hatte, kam, um nach ihm zu sehen. Endlich! Zwar konnte er sich nicht vorstellen, dass ein Mensch in dieser Einöde leben konnte, eine finstere Höhle zu seiner Behausung gemacht hatte, doch das war im Augenblick nebensächlich. Um ein Monster würde es sich jedenfalls nicht handeln. Das waren die Schritte eines Menschen, der festes Schuhwerk trug. Keine Sandalen oder Lumpen, mit denen sich die Indios in den Anden die Füße umwickelten, um sie zu schützen.
Ashley versuchte abermals erfolglos, seinen Kopf in Richtung der sich nähernden Schritte zu wenden. Ein Schatten näherte sich, dann beugte sich ein Gesicht über ihn. Das Gesicht eines Weißen! Was hatte der in dieser rätselhaften Höhle zu suchen? Der Mann besaß ein ovales Gesicht und schütteres Haar, das an seinem Kopf klebte. Einzelheiten der Mimik, die Form des Mundes und die Farbe der Augen konnte Ashley bei den schummrigen Lichtverhältnissen kaum erkennen. Der Mann war nicht allein. Eine zweite Person befand sich bei ihm. Sie stand einen halben Schritt weiter im Schatten, sodass Ashley ihre Umrisse mehr erahnen als sehen konnte. Der Schmalköpfige näherte sich Ashleys Gesicht. Ashley sah die Hand direkt über seinem Auge.
„Nein, da ist leider nichts mehr zu machen“, vernahm er die Stimme des Mannes, der einen hellen Arztkittel trug. „Er ist tot!“
Nein!, brüllte es in Ashley. Nein! Ich lebe! Diese Worte hallten in ihm wieder, doch kein Ton kam über seine Lippen. Die Hand legte sich so über sein Gesicht, dass der abgespreizte Daumen und der Mittelfinger die Augenlider berührten und nach unten drückten. Der Mann wollte ihm die Augen schließen, wie bei einem Toten. Aber seine Lider blieben nicht unten.
Der Unbekannte gab auf. „Na schön“, murmelte er beiläufig. „Dann eben nicht. Was nicht geht, sollte man nicht erzwingen. Ist ja auch egal, ob er mit offenen oder geschlossenen Augen in den Sarg gelegt wird.“
Hört mich an! Ashleys Gedanken tobten vor wilder Panik. Untersteht euch, mich in einen Sarg zu legen. Ich bin nicht tot! Ich atme, mein Herz schlägt, ich denke! Untersucht mich, dann werdet ihr schon merken, dass ich nicht tot bin!
„Sind Sie sicher, Doktor Spanther?“, meldete sich die Stimme aus dem Hintergrund.
Donovan Ashley schöpfte wieder Hoffnung. Wenigstens einer, der sich vom einfachen Schein nicht täuschen ließ.
„Zweifeln Sie an meinem ärztlichen Können, Antonio?“, fuhr der andere ihn an.
Und ob!, hämmerten Ashleys Gedanken. Zu gern hätte er das, was ihm durch den Kopf ging, laut hinausgeschrien. Ich bin nicht tot! Ich kann mich nur nicht rühren, bin hilflos wie ein Baby. Wenn einer von euch Arzt ist, muss er das doch feststellen!
„Bitte. Der Mann ist steif wie ein Brett, eiskalt und atmet nicht mehr, sein Herz steht still, seine Pupillen reagieren nicht“, setzte Dr. Spanther routiniert nach.
Woher weißt du das alles, verdammt noch mal? Du hast mich doch gar nicht untersucht!
„Hier, Antonio, mein Stethoskop und die Taschenlampe. Ich war vorhin schon mal hier, ehe Sie in die Station kamen. Da konnte ich mich bereits vom Tod dieses Mannes überzeugen. Schade, ich hätte gern gewusst, wer er ist und wie er in diese abgelegene Gegend kommt.“
Wer seid ihr, verdammt noch mal?, fragte sich Ashley lautlos.
Die zweite Gestalt schob sich aus dem Hintergrund nach vorn. Ein Mann, kompakter als Dr. Spanther, mit einem Kopf wie eine große Kartoffel. Eine Taschenlampe wurde angeknipst.
„Die Pupille zieht sich nicht zusammen“, konstatierte Antonio, und legte zwei Finger auf den Puls. „Nichts zu fühlen …“ Er öffnete Ashleys Hemd, legte das Stethoskop an und lauschte. „Nein, da ist wirklich nichts mehr zu hören.“
„Wie gesagt, Antonio. Jemand, der seit drei Tagen hier liegt, kann nicht mehr leben.“
Seit drei Tagen?, echote es in Ashley. Bin ich schon so lange hier? Was ist in dieser Zeit passiert? Mit einem Mal zweifelte er, ob er das alles wirklich erlebte und nicht träumte. Hilflos bemühte er sich aufzuwachen, doch alles um ihn herum blieb gleich.
„Soll ich alles vorbereiten, Doktor?“
„Ja, wir beerdigen ihn in einer Stunde.“
Larry Brent alias X-RAY-3, zurzeit geheimer Leiter der PSA und damit X-RAY-1, traf am Mittag aus Rio de Janeiro kommend in der peruanischen Hauptstadt Lima ein. Dort freute er sich auf seine attraktive Kollegin Morna Ulbrandson alias X-GIRL-C. Sie hatten sich in dem Dachgarten-Bistro des Hotels Cuzco verabredet. Kellner in goldblauen Uniformen servierten eiskalte Erfrischungen, als Larry mit Morna eine erste Lagebesprechung abhielt. Mal wieder hatten verschwundene Personen und bizarre Gerüchte über ein Ungeheuer die PSA in diese Gegend geführt. Larry konnte aber noch von einer anderen Besonderheit berichten. „Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes treffen sich die Nachkommen der Ureinwohner zu einem großen Maskenfest“, erklärte er Morna. „Indios aus Bolivien, Ecuador, Kolumbien und Brasilien veranstalten hier in Lima ein Ritual, bei dem die alten Bräuche der verschiedenen Indio-Gruppen gezeigt werden. Fachleute, die sich mit Völkerkunde und der geschichtlichen Entwicklung der Rassen befassen, sind der Meinung, dass bei dieser Gelegenheit einiges zu sehen sein wird, wovon man bisher keine Ahnung hatte. Gerade der Götter- und Geisterglaube in seinen unterschiedlichsten Formen kann einen tiefen Einblick in die Kultur eines längst vergangenen Volkes gewähren, beispielsweise in das der Inkas. Bis heute liegt bei diesem Volk immer noch vieles im Dunkeln.“
„Man vermutet, dass die Inkas die Ureinwohner von Atlantis gewesen sind“, ergänzte Morna, die sich selbstverständlich ebenfalls auf diesen Einsatz vorbereitet hatte. „Aber kann man das mit den mysteriösen Vermisstenfällen in Verbindung bringen?“
Larry zuckte die Schultern. „Alles kann sein. Zuviel Wissen und Überlieferungen gingen durch die spanischen Eroberer verloren. Für die war damals nur Gold wichtig. Und so ging das Wissen eines Volkes unter, das uns noch bis heute in vielerlei Erscheinungsformen begegnet. Magie, Okkultismus und Totenbeschwörung. In den Tänzen und Riten kann man immer noch einiges entdecken.“
Morna musterte Larry amüsiert. „Kaffeebraune, halbnackte Körper, die sich im Takt heißer Rhythmen wiegen, hm?“
Larry grinste. „Carneval in Südamerika unterliegt eigenen Gesetzen.“ Er nahm Mornas Hand und hauchte einen Kuss auf ihre Haut. „Bei dir werde ich allerdings kaum dazu kommen, Ausschau nach kaffeebraunen Leibern zu halten. Ich vermute, dass ich mit dir genug zu tun haben werde. Wegen des Maskenfestes und der zahlreichen Gäste in der Stadt war es leider nicht mehr möglich, zwei Einzelzimmer zu buchen. Ich musste ein Doppelzimmer bestellen.“
Nun musste auch die Schwedin grinsen. „Natürlich.“
„Wir sind ein Ehepaar auf Hochzeitsreise. Señora und Señor Brent.“
Morna lächelte verführerisch. „Und du hast dich hoffentlich umfassend auf deine Rolle als Ehemann vorbereitet.“
„Ich werde mein Bestes tun, Doña Morna.“
„Und wo schläft unser Iwan? Wo hast du ihn bei der Raumknappheit in Lima untergebracht?“
„Das war tatsächlich ein kleines Problem, Liebling. In der Stadt ist wie gesagt kein freies Zimmer mehr zu bekommen. Die Direktion hat sich freundlicherweise bereit erklärt, ein Notbett auf den Balkon zu stellen. Bei diesen Temperaturen ist das machbar.“
„Ich möchte nicht wissen, was die Direktion sich bei diesem Arrangement denkt.“
Larry zog eine todernste Miene. „Iwan ist unser Pater, der uns getraut hat und aus rein persönlichem Interesse mit nach Lima kommt. Sein Orden hat ihm die Erlaubnis erteilt, damit er hier gekleidet wie jeder normale Besucher und nicht in seiner Mönchskutte die heidnischen und okkulten Bräuche studieren und später im Kloster darüber berichten kann.“
Morna sah ihn mit ihren nixengrünen Augen an. „Ich muss doch immer wieder deine fast unglaubliche Phantasie bewundern.“
Noch eine Stunde zu leben! Dieser Gedanke erfüllte Donovan Ashley mit Grauen. Für diesen Dr. Spanther und seinen Assistenten Antonio war er tot. Seine Gedanken drehten sich im Kreis. Ärzte! Das konnte nur bedeuten, dass man ihn in den Bergen gefunden und in ein Krankenhaus eingeliefert hatte. Er konnte sich zwar an nichts mehr erinnern, aber so musste es gewesen sein. Sie hatten versucht, sein Leben zu erhalten. Aber dann musste etwas passiert sein, das die Männer glauben ließ, er sei tot. Doch mit modernen Geräten war das doch leicht zu widerlegen. Ein EEG würde sofort beweisen, dass sein Gehirn funktionierte, dass lediglich die Aktivität seiner anderen Organe, Herz und Lunge, so weit abgesunken war, dass man sie nicht mehr registrieren konnte. Doch das Hospital, in das man ihn gebracht hatte, schien nicht über die Möglichkeit zu verfügen, eine Hirnstrommessung vorzunehmen. Das, was er anfangs für eine Höhle gehalten hatte, war in Wirklichkeit der Leichenkeller des Krankenhauses.
Soweit konnte er sich alles logisch erklären. Und doch gab es einen Punkt, der seine Theorie auf den Kopf stellte. Selbst in einem primitiven Krankenhaus gab es Bahren, auf die die Leichen gebettet wurden. Er aber lag eindeutig auf einem ausgehöhlten Steinsockel. Wie passte das zusammen? Er stieß einen innerlichen Seufzer aus. Das Grauen floss förmlich durch seine Adern. Die totale Hilflosigkeit wirkte sich verheerend auf sein Gemüt aus.
Und dann näherten sich Schritte. Die Stunde war schon um? Sie kamen, um ihn zu holen! Alles in Ashley sträubte sich. Er schrie innerlich auf, als dieser Antonio eine Bahre auf Rollen neben seine Liegestatt manövrierte, um ihn hinüber zu heben. Er knickte tatsächlich nicht ein, auch jetzt veränderten Arme und Beine ihre Lage nicht. Sein Körper blieb steif. Die Totenstarre war tatsächlich schon eingetreten! Ich bin nur scheintot! Ich sehe und höre alles. Bitte! Ihr dürft mich nicht in ein Grab legen! Ich lebe! ICH BIN NICHT TOT! Seine Gedanken kreischten durch sein Gehirn, doch kein Wort drang nach außen. Ashley tobte in seinem starren Körper, aber niemand bemerkte es. Dr. Spanthers Assistent rollte Ashley mit der Bahre aus dem kahlen Verlies. Er sah die dunkle Felsendecke über sich, registrierte die Nischen und Gänge in dem kargen Gewölbe. So sieht doch keine Leichenhalle aus!
Der Weg führte durch einen Stollen, der gerade so hoch war, dass der Mann, der die Bahre schob, nicht mit dem Kopf an die Decke stieß. Neonröhren flackerten an der Decke und wechselten die Helligkeit, was darauf schließen ließ, dass die Stromversorgung nicht immer in gleicher Stärke erfolgte. Der Stollen mündete in eine ausgedehnte Halle. Links und rechts befanden sich Nischen im Fels, die mit Gittern versehen waren. Die Bahre wurde dicht an der Wand vorbeigerollt. Ashley bemerkte, dass die Gitter nach oben geschoben waren. Er konnte in die Ställe hineinsehen. Ratten, Hunde, Katzen. In den größeren Nischen befanden sich Ziegen und Schweine auf dem Boden. Alle Tiere lagen in Reih und Glied. Versuchstiere?, durchschoss es Ashley. Ein schauriger Gedanke fraß sich in ihm fest, absurd, und doch ließ er ihn nicht mehr los. Das sind keine normalen Ärzte! Das sind Verbrecher, die verbotene Experimente durchführten. Er war ihnen gewissermaßen frei Haus geliefert worden. Seine Umgebung hatte sich nie verändert. Er befand sich nach wie vor in den Bergen, der schwarze Dampf war ein Abfallprodukt einer geheimen Forschungsstätte, von der die Indios ferngehalten wurden, indem man ihnen das Märchen von einem Monster erzählte.
Die Bahre wurde am Ende der Felsenhalle abgestellt. Jetzt konnte Ashley diesen Antonio besser erkennen. Der Mann wirkte füllig. Das Haar war tiefschwarz, die Haut gebräunt. Vom Typ her konnte er Spanier sein. Er trug einen nicht mehr blütenweißen Kittel, darunter einen zerknautschten Anzug. All dies konnte Ashley sehen, ohne dass sich seine Augäpfel dabei bewegten, denn die waren starr wie sein restlicher Körper.
Warum blieb der Mann stehen? Ja!, rief Donovan Ashley stumm, Schau mich nur genau an! Hier im Licht, das ist gut so. Ihr dürft mich nicht begraben. Nehmt euch Zeit! BITTE!
Dochsein innerer Monolog blieb ohne Echo. Dass Antonio stehengeblieben war, hatte einen anderen Grund. Der Spanier öffnete einen Torflügel und ein Schwall kühler Luft strömte in die Felsenhöhle. Tageslicht drang herein. Der Himmel war grau. Ashley wurde über einen steinigen Pfad auf einen terrassenförmigen Vorsprung geschoben, wie die Indios ihn zum Anbau von Getreide und Gemüse benutzten. Aber das war kein Gemüseacker. Das war ein Friedhof! Mehrere flache Hügel waren deutlich zu erkennen. Es gab jedoch weder Grabsteine noch einfache Holzkreuze. Nicht weit vom Höhlenausgang befand sich eine frische Grube. In ihr befand sich eine primitiv genagelte Holzkiste, in die Ashley von Antonio hinein gehoben wurde. Der Deckel der Kiste stand an der Seite. Die Grube war über einen Meter tief.
„Leb wohl“, sagte Antonio zu dem Mann in der Holzkiste und atmete tief durch. „Wir hätten dir gern geholfen, aber leider war nichts mehr zu machen.“
Dieser Albtraum wurde unerträglich. Ashley schwitzte Blut und Wasser. Alles in ihm sträubte sich. Er wollte sich aufbäumen, blieb jedoch weiter bewegungslos liegen. Gerade schob Antonio den Deckel auf die Kiste. Es wurde dunkel, und nur durch die Ritzen zwischen Totenkiste und Deckel schimmerte noch schwaches Tageslicht. Kein Geräusch entging dem Mann, der in seinem eigenen Körper gefangen war. Er war mit seiner Angst allein, hörte das Knirschen, als sein Totengräber nach oben kletterte und ein paar Brocken der trockenen Erde gegen die Seitenwände der Kiste kullerten. Sekunden später prasselte weiterer Lehm auf den Deckel. Ashley wollte vor Verzweiflung und Todesangst zerspringen.
Die Erde häufte sich und bedeckte den Deckel. Das Tageslicht verschwand, die Dunkelheit wurde vollkommen. Donovan Ashley wurde bei lebendigem Leib begraben. Außer der absoluten Schwärze umgab ihn wenig später auch totale Stille. Grabesstille. Sein Hirn tobte und sein innerliches Schreien biss sich in seinem Kopf fest. Es trieb ihn in den Wahnsinn.
Antonio ging in die Felsenhalle zurück und schloss hinter sich die schweren Torflügel. Sie bestanden aus Metall und besaßen die graubraune Farbe des Felsgesteins. Riegel und Sicherheitsschloss wurden vorgelegt. Die Tür hatte nur innen eine Klinke und ließ sich auch nur von dieser Seite öffnen. Von außen war die Tür wie eine einfache Felswand gestaltet. Lediglich bei genauem Hinsehen ließ sich ihr künstlicher Ursprung erkennen. Antonio gab der Bahre einen Stoß, holte sie wieder ein und stellte sie in eine Wandnische. Im Vorübergehen warf er einen Blick in die offenen Käfige, in denen die reglosen Tiere lagen. Er zog ein steifes Kaninchen heraus und starrte ihm in die Augen. Dabei kraulte er seinen Nacken. „Na, Kleiner?“, fragte er lächelnd. „Merkst du was? Dein Körper fühlt sich kalt an, ich weiß aber, dass du nicht tot bist. Du hörst meine Stimme und merkst, dass ich dich kraule. Eigentlich müsstest du jetzt vor Angst zusammenzucken und davonrennen. Du warst in der letzten Versuchsreihe unser Prachtexemplar, und ich habe mit Spanther gewettet, dass du der erste bist, der wieder herumrennen kann. Wir wollten dich wieder aufpäppeln. Vorausgesetzt, du weißt noch, was Salat und Möhren sind und hast nicht vergessen, wie man sie frisst.“ Er klopfte dem Hasen einige Male auf den Kopf, schüttelte ihn und legte das stocksteife Tier dann wie einen Gegenstand in die Felsnische zurück.
Antonio durchquerte die Höhle und kam zu der Stelle, an der sich das steinerne Bett befand. Unweit von dieser Stelle entfernt gab es einen Durchgang, der in den Felsen führte. Dahinter lag eine primitive Treppe, uralt und aus klobigen Quadern. Sie waren lose aufeinander gefügt und stabil. An der Ecke, an der die Treppe nach oben führte, befand sich ein Lichtschalter. Antonio wollte gerade danach greifen, um die Neonröhren auszuknipsen, als er im Halbdunkel neben dem Steinbett eine dunkle Gestalt bemerkte.
Der Nachmittag verging wie im Flug. Im Laufe der Stunden waren immer neue Gäste im Hotel angekommen, der Dachgarten füllte sich. Die Kellner hatten alle Hände voll zu tun, Drinks, Eis und Snacks für die bunt zusammengewürfelten Besucher herbeizuschleppen. Die Sonne schien angenehm moderat vom Himmel über der Stadt. Hier, direkt an der felsigen Küste, war das Wetter noch schön. Im Landesinneren, wo die Berge fast bis zum Himmel reichten, wirkte er fast schwarz. Riesige Wolkenfelder brauten sich im Osten der Anden zusammen.
In einem der Taxis, die aus Richtung Flughafen kamen, saß Iwan Kunaritschew. Larry und Morna beobachteten seine Ankunft.
„Wenn man ihn nicht hört oder riecht“, meinte Larry, „erkennt man ihn trotzdem schon von Weitem an seiner fuchsroten Mähne.“