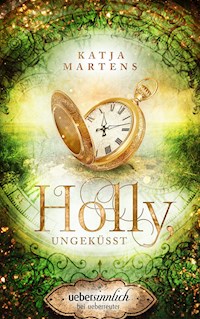1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lassiter
- Sprache: Deutsch
"Heiliger Rauch!" Alarmiert starrte Clay Shetler auf den Kadaver. Ein Maultierhirsch trieb im Weasel Creek an ihm vorüber. Während der Bach an heißen Sommertagen kaum mehr als ein Rinnsal war, führte er jetzt mit ausgehendem Winter reichlich Wasser. Die Fluten schossen durch den Canyon, und sie waren stark genug, um ein so kräftiges Tier mitzureißen.
Unwillkürlich hielt Clay nach höher gelegenen Felsvorsprüngen Ausschau, auf die er sich notfalls retten konnte, sollte das Wasser weiter steigen. Angesichts der mit Eis und Schnee bedeckten Felsen erschien ihm eine Kletterpartie jedoch wenig aussichtsreich. Clay packte seine Hawken Rifle fester und stapfte weiter. Je schneller er den Canyon hinter sich brachte und wieder in seiner Hütte am warmen Feuer saß, umso besser.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Ranger und das Biest
Vorschau
Impressum
Der Ranger und das Biest
von Katja Martens
»Heiliger Rauch!« Alarmiert starrte Clay Shetler auf den Kadaver. Ein Maultierhirsch trieb im Weasel Creek an ihm vorüber. Während der Bach an heißen Sommertagen kaum mehr als ein Rinnsal war, führte er jetzt mit ausgehendem Winter reichlich Wasser. Die Fluten schossen durch den Canyon, und sie waren stark genug, um ein so kräftiges Tier mitzureißen.
Unwillkürlich hielt Clay nach höher gelegenen Felsvorsprüngen Ausschau, auf die er sich notfalls retten konnte, sollte das Wasser weiter steigen. Angesichts der mit Eis und Schnee bedeckten Felsen erschien ihm eine Kletterpartie jedoch wenig aussichtsreich. Clay packte seine Hawken Rifle fester und stapfte weiter. Je schneller er den Canyon hinter sich brachte und wieder in seiner Hütte am warmen Feuer saß, umso besser.
Er war seit den frühen Morgenstunden auf Kontrollgang durch den Kiefernwald südlich des Mount Mary bis zum Labyrinth der Schwefel- und Schlammquellen der Crater Hills. Vorbei an Kratern, aus denen mit gewaltigen Dampfstößen der Schlamm fünf Yards hoch spritzte. Ein Spektakel, das ihm jedes Mal den Atem raubte.
Als würde der Teufel selbst hier sein Süppchen kochen.
Am Elephant Back Mountain, seiner nächsten Station, hatten die Winterstürme mächtige Bergkiefern umstürzen lassen. Die Stämme lagen kreuz und quer, sodass er sich mühselig einen Weg daran vorbei suchen musste. Im Sattel gab es an diesen Hängen kein Durchkommen. Das war auch der Grund, weshalb Clay auf sein Pferd verzichtete, wenn er in diesem Teil des Nationalparks nach dem Rechten sah.
Nun, nicht der ganze Grund.
Er liebte es, die Gegend zu Fuß zu erkunden und die Natur mit allen Sinnen in sich aufzusaugen. Aufgewachsen in einem Elendsviertel im Osten, umgeben vom Unrat und Gestank einer großen Stadt, hätte er sich nie und nimmer träumen lassen, einmal an einem solchen Ort zu leben.
Hier draußen bot ihm jeder Schritt einen freien Blick auf immer neue Wunder – auf dichte Wälder, Geysire und Wasserfälle, die sich in üppigen Kaskaden in gewaltige Sandsteinbecken ergossen. All das schien jedoch nur die Einfassung jener kostbaren Perle zu sein, die sich im Herzen des Nationalparks verbarg: der Yellowstone Lake. Ein ultramarinblau gefärbtes Juwel inmitten der unberührten Natur.
Morgens war die Oberfläche des Sees für gewöhnlich noch ruhig, aber ab dem Mittag rollten die Wellen und erhoben sich in eine Höhe von bis zu einem Yard. Das Gewässer war mit unzähligen smaragdgrünen Inseln gesprenkelt, die von Scharen von weißen Schwänen und Pelikanen bevölkert wurden.
Der See erinnerte Clay in seiner Form immer an eine nach Süden gewandte Hand mit gespreizten Fingern. Längs seiner Ufer entsprangen zahlreiche heiße Quellen, die pfeifend und fauchend den Dampf emporbliesen. Vom Ufer aus führte ein Canyon in westliche Richtung – dorthin, wo die Hütte des Wildhüters stand.
Mit weit ausgreifenden Schritten folgte Clay nun dem Pfad am Ufer des Baches. Sein Atem kam stoßweise und seine malträtierten Rippen protestierten mit einem wütenden Ziehen gegen die Anstrengung, aber er behielt sein hohes Tempo bei. Schließlich musste er aus dem Canyon heraus sein, wenn das Wasser weiter stieg!
Seine Blessuren verdankte er dem Zusammenstoß mit einem Wapiti.
Einem ausgesprochen ungehaltenen Wapiti.
Oben am Mount Mary war er auf eine Fallgrube gestoßen. Er war sich recht sicher, dass sie nicht von den Lakota ausgehoben worden war, die der Hunger von Zeit zu Zeit zum Jagen in die Wälder des Yellowstone trieb. Das war nicht ihre Art. Nein, diese Falle war von weißen Wilderern gestellt und mit angespitzten Pflöcken gespickt worden. Ein junger Wapiti war in die Grube gestürzt. Schmächtig genug, um nicht aufgespießt zu werden, aber zu klein, um aus eigener Kraft nach oben zu gelangen. Auf zittrigen Beinen stand er auf dem Grund der Falle und rief nach seiner Mutter, die oben wartete und ihm nicht helfen konnte.
Clay hatte sich des Jungtiers angenommen. Das hatte ihm einen kräftigen Stoß von der Mutter eingebracht, die ihm nichts Gutes zutraute und ihr Junges verteidigen wollte. Der Stoß hätte ihn um ein Haar selbst in die Grube katapultiert. Seine rechte Seite würde morgen vermutlich grün und blau sein.
Er hatte ein Seil um einen Baum gebunden und war nach unten geklettert. Es war ihm gelungen, den Wapiti nach oben zu hieven. Kaum hatte das Junge wieder festen Boden unter den Hufen, war es mit seiner Mutter auf und davon gelaufen.
Clay hatte die Grube fluchend zugeschaufelt. In seinem Park duldete er keine Fallen, in denen Tiere womöglich tagelang litten, bevor sie verendeten. Wenn er die Strolche erwischte, die solche Gruben aushoben, konnten sie sich auf eine Predigt gefasst machen, von der ihnen noch Tage später die Ohren klingelten.
Neben ihm raste der Bach durch den Canyon. Zwischen den Steinwänden hallte das gurgelnde Tosen des Wassers vielfach wider. Schmelzwasser tropfte von den Zweigen der dürren Birken, die sich weiter oben an die kahlen Felsen klammerten. Die untergehende Sonne wärmte die Luft genug auf, dass es überall taute, aber in der Nacht würde es wieder Frost geben. Das spürte er in allen Knochen.
Clay stapfte weiter und atmete auf, als vor ihm die breiten Vorsprünge im Felsen auftauchten, die eine natürliche Treppe nach oben bildeten. Der Untergrund war rutschig, aber er kletterte vorsichtig weiter und gelangte wohlbehalten oben an.
Mit langen Schritten durchmaß er den Wald, bis er seine Hütte vor sich sah.
Die Blockhütte duckte sich unter ausladende Fichten. Sie war gerade groß genug für einen Mann und sein Pferd, das auf einer kleinen Koppel stand und bei schlechtem Wetter im angrenzenden Stall untergebracht werden konnte. Flecken von Schnee lagen noch auf dem Dach. Aus dem Schornstein ringelte sich kein Rauch mehr, aber unter dem Vordach lagerte genügend trockenes Holz, um ihn über den restlichen Winter zu bringen.
Sein Brauner kam an den Zaun der Koppel getrabt und reckte freundlich zur Begrüßung den Kopf herüber. »Hey, mein Großer.« Clay strich ihm über die Stirn und steckte ihm ein Pfefferminzbonbon zu, das sein Pferd mahlend zerkaute.
Clay streute ihm frisches Futter hin. Dann lenkte er seine Schritte ins Haus.
Er legte seine Hawken Rifle ab und schob den Rucksack mit seiner Ausrüstung unter die Pritsche. Noch in Jacke und Stiefeln kniete er sich vor den Kamin und schürte die spärliche Glut, bis ein munteres Feuer prasselte und das Innere der Hütte mit behaglicher Wärme erfüllte.
Jetzt erst zog er seine Pelzjacke aus und nahm den Hut ab.
Draußen neigte sich der Winter – und mit ihm seine Vorräte. Er würde bald in die Stadt gehen und sich frische Lebensmittel beschaffen müssen, wenn er nicht nur von Trockenfleisch und den spärlichen Überresten der Nüsse leben wollte, die ihm geblieben waren. Nun, mit etwas Glück würde er bei seinem Besuch auch Nelly treffen. Die Tochter des Gemischtwarenhändlers hatte es ihm angetan. Sie schenkte ihm immer ein Lächeln, wenn er in den Laden ihres Vaters kam. Clay hatte mehr als einmal Waren gekauft, die er eigentlich nicht brauchte, nur um Nelly zu sehen. Wie die Packung mit getrockneten Kräutern zum Beispiel, aus denen man Tee kochen konnte. Clay verabscheute Tee und trank nie etwas anderes als Kaffee oder Whisky. Der Tee verstaubte auf seinem Regal, aber der Kauf hatte ihm eine weitere Viertelstunde mit Nelly beschert und war sein Geld absolut wert gewesen.
Nelly stellte ihm bei jedem Besuch viele Fragen zu dem Park und die Wildtiere, und er beantwortete sie ihr gern. Mit ihr konnte er unbefangen reden. Ganz anders als mit den meisten Ladys aus der Stadt, die ihm das Gefühl gaben, ein ungeschickter Tölpel zu sein. Ja, Nelly war... anders.
Er war fest entschlossen, sie zum Tanzen auszuführen, wenn er das nächste Mal in der Stadt war.
Und ihrem Vater würde er beweisen, dass er ein Mann von Ehre war. Jemand, auf den Verlass war und dem man eine Frau wie Nelly anvertrauen konnte. Nicht wie sein Vorgänger, der vor einiger Zeit spurlos verschwunden war. John Running war vor ihm der Wildhüter im Yellowstone Nationalpark gewesen. Doch noch vor dem ersten Schnee war er fort gewesen. Manche glaubten, ein Unglück hätte ihn ereilt. Andere waren der Ansicht, er hätte die Einsamkeit hier draußen nicht ertragen und sich aus dem Staub gemacht. Clay hatte keine Ahnung, was aus seinem Vorgänger geworden war, aber er war entschlossen, seinen Posten zu halten.
Komme, was wolle.
Während er seinen Eintopf vom Vortag über dem Feuer warm machte, blätterte er in dem Notizbuch, das auf dem grob gezimmerten Holztisch lag. Mit einem Bleistiftstummel hatte er ein Gedicht für Nelly hineingekritzelt. Das wollte er ihr schenken, wenn sie sich das nächste Mal sahen. Es war jedoch noch nicht fertig.
Meine Nelly, dein Haar ist so braun wie das Fell eines Grizzlys, und deine drallen Hüften gehen mir nicht mehr aus dem Sinn...
Clay stockte und blickte grübelnd auf die Zeilen nieder. Irgendwie klang das nicht wie bei diesem Dichter, von dem Nelly ihm vorgeschwärmt hatte. Shakespeare, oder wie der hieß. Doch das störte ihn nicht. Sie sollte sich ja schließlich nicht in den Barden mit dem Bart verlieben, sondern in ihn.
Also weiter! Enthusiastisch packte er den Bleistift fester und beugte sich wieder über das Papier. Bevor er jedoch von Nellys üppigen Brüsten schwärmen konnte, wehte von draußen unvermittelt das Wiehern seines Braunen herein... und brach so jäh ab, als hätte er es sich nur eingebildet.
Alarmiert fuhr Clay hoch. Die plötzliche Stille dröhnte ihm in den Ohren. Und ein unliebsamer Schauer rieselte ihm die Wirbelsäule hinunter.
Irgendetwas stimmte da nicht!
Er warf den Stummel hin, schnappte sich sein Gewehr und trat hinaus in die kalte Abendluft. Ein seltsam metallischer Geruch empfing ihn.
Er blickte sich um... und sah sein Pferd auf der Koppel niedergesteckt. Die Kehle des Braunen war zerfetzt. Eine Blutlache färbte den Schnee rings um ihn tiefrot.
Der Schock fuhr dem Wildhüter kalt wie Eiswasser durch die Adern. »Was um alles in der Welt...« Aus dem Augenwinkel bemerkte er plötzlich eine Bewegung, kaum mehr als ein Schatten... Er riss die Hawken Rifle hoch, aber bevor er zielen konnte, brach das Verhängnis bereits über ihn herein.
Etwas traf ihn mit ungeheurer Wucht und riss ihn von den Beinen. Ein unerträglicher Schmerz explodierte an seinem Hals – und löschte jeden klaren Gedanken aus. Ein blutroter Schleier legte sich vor seine Augen. Er hörte ein gequältes Röhren wie von einem waidwunden Tier, ohne zu realisieren, dass es aus seiner eigenen Kehle kam.
Er fiel – und schien immer weiter zu fallen. In eine bodenlose Schwärze, die ihn schließlich verschlang wie der weit geöffnete Rachen eines Ungeheuers.
✰
»Sie sind ein verdammter Glückspilz, Mister!« Tim Miller schoss einen finsteren Blick auf Ward Thompson ab, bevor er die Spielkarten in seiner Hand zusammenfaltete und mit einem frustrierten Schnauben auf den Tisch warf. Der Haufen Münzen vor ihm war in der letzten halben Stunde beträchtlich geschrumpft. Inzwischen lagen nicht einmal mehr eine Handvoll Geldstücke vor ihm. Er schnaubte wütend.
»Nehmen Sie es nicht so schwer, Miller«, brummte der Rotbart, der neben ihm saß. Ein Ire namens Ian Dunbar, der tagsüber dem Undertaker zur Hand ging und sich abends gern im Saloon vergnügte. Er schob sein Zigarillo von einem Mundwinkel in den anderen. »Gegen Wards Glück kommt keiner an.«
»Ist das so?« Der Jungspund starrte Ward prüfend an.
Der sparte sich eine Erwiderung. Er war zum Spielen hergekommen, nicht für tiefschürfende Unterhaltungen. Schweigend nahm er einen Schluck Whisky. So ruhig, als würde ihn der Ranchhelfer nicht gerade mit Blicken durchbohren.
»So viel ›Glück‹ hat kein Mensch«, fuhr der nun in anklagendem Ton fort.
»Was wollen Sie damit sagen?« Der Ire furchte die Stirn.
»Ich will sagen, dass ich nicht glaube, dass Glück etwas damit zu tun hat, dass dieser Gentleman dauernd gewinnt.« Tim Miller sprang auf und lehnte sich über den Tisch zu Ward. »Sie erlauben doch?« Ohne auf eine Antwort zu warten, tastete er Wards Ärmel einen nach dem anderen ab.
Schlagartig wurde es still im Saloon. Die Gespräche an den Nachbartischen verstummten und selbst der Mann am Piano hörte auf, das Instrument zu malträtieren. Der Vorwurf des Falschspiels waberte wie ein schlechter Geruch durch das Lokal.
»Was haben wir denn da?« Tim Miller zog ein quadratisches Stück Stoff aus Wards Ärmel ans Licht. Es war ein Taschentuch. Auf dem zerschlissenen Baumwollstoff zeichneten sich tiefrote Flecken ab. »Was zum Teufel...« Nach einem Moment schien dem Ranchhelfer zu dämmern, was er da in seiner Hand hielt, denn er ließ das Tuch so hastig fallen, als hätte er sich daran verbrannt. Das Taschentuch segelte zu Boden.
In der Zwischenzeit hatte niemand auf Ward geachtet, der in aller Ruhe seinen Army-Colt gezogen hatte und ihn nun über den Tisch auf sein Gegenüber richtete. Mit rauer Stimme warnte er: »Nimm deine Hände von mir, wenn dir etwas an deinen Eiern liegt, Bürschchen.«
Das metallische Klicken des Hahns ließ sein Gegenüber erstarren.
Langsam richtete sich Tim Miller auf. In seinem bartlosen Gesicht kämpften verschiedene Regungen miteinander. Wut. Enttäuschung. Frustration. Seine Hände ballten sich zu Fäusten – bis ihm der Ire begütigend ein Glas Whisky hinschob.
»Lassen Sie es gut sein«, mahnte der. »Trinken Sie was und dann spielen wir weiter.«
»Mit Halunken spiele ich nicht.« Unwillig wischte der Ranchhelfer das Glas zur Seite, wirbelte herum und marschierte aus dem Saloon.
Sekundenlang herrschte noch Stille. Dann setzten die Gespräche wieder ein und auch der Mann am Piano hieb wieder in die Tasten.
»Man sollte nichts verkommen lassen.« Der Ire zuckte mit den Schultern, setzte das Glas an die Lippen und kippte den Whisky hinunter.
Ward schaufelte seine gewonnenen Münzen mit einem Arm aus der Tischmitte zu sich heran. Tim Miller hatte so Unrecht nicht. Tatsächlich folgte Ward das Glück seit einiger Zeit wie ein treues Hündchen. Welches Risiko er beim Pokern auch einging, meist war er am Ende der Gewinner, der einen Haufen Geld einstrich. Er war den größten Teil seines Lebens ein armer Schlucker gewesen. Jetzt jedoch hatte er mehr Geld, als er in der Zeit, die ihm noch blieb, ausgeben konnte.
Ironie des Schicksals, nannte man das wohl.
An diesem Abend saßen Dunbar und ein Fremder mit ihm am Tisch, der noch weniger sprach als Ward selbst.
Nun, wo Miller fort war, näherte sich Sam Reid. Man sah den Barbier nie anders als gut gekleidet – in dunkler Hose, Hemd und einer Weste, aus deren Tasche eine goldene Uhrenkette blitzte.
»Gestatten Sie, dass ich mich zu Ihnen geselle, Gentlemen?« Er blickte in die Runde und wartete eine einladende Geste ab, ehe er sich auf Millers Platz niederließ und zufrieden die Enden seines Schnurrbarts nach oben zwirbelte. »Schön. Schön. Dann wollen wir doch mal sehen, ob ich nicht etwas von dem Geld gewinnen kann, dass der Grünschnabel an Sie verloren hat, Thompson.«
»Sie können es gern versuchen.« Ward neigte den Kopf.
»Was machst du eigentlich hier, Sam? Solltest du jetzt nicht daheim beim Abendessen sein?«, fragte der Ire. »Mir ist, als hättest du unserem guten Reverend neulich versprochen, die Finger vom Glücksspiel zu lassen.«
»Der Geist ist willig, aber das Fleisch... Nun, du weißt schon. Ich werde am Sonntag zur Beichte gehen, dann wird mir sicherlich vergeben.«
»Der Herr vergibt«, pflichtete der Ire bei, »aber bei deiner Frau bin ich mir da nicht so sicher.«
Seine Bemerkung ließ den Barbier kurz zusammenzucken, aber dann streckte er die Hände nach den Spielkarten aus. Er schob sie zu einem Stapel zusammen und begann zu mischen und die Karten zu verteilen.
Auf Wards Schoß räkelte sich derweil das bezaubernde Girl, das vor einer Weile an seinen Tisch geschlendert und immer näher gerückt war. Er bezweifelte nicht, dass der Stapel Münzen vor ihm etwas mit ihrer Aufmerksamkeit zu tun hatte, aber das störte ihn nicht weiter. Warum sollte sie nicht etwas von seinem Glück abhaben? Er hatte sie kurzerhand auf seinen Schoß gezogen, wo sie nun ihre sinnlichen Rundungen an ihn schmiegte, dass ihm die Konzentration auf die Karten nicht so leichtfiel wie sonst. Ihr süßer, blumiger Duft stieg ihm in die Nase. Madam Rosalia achtete bei ihren Mädchen auf Sauberkeit, da ließ sie sich nichts nachreden.
Die Schöne auf seinem Schoß trug kaum mehr als einen Hauch von nichts, und so ertappte Ward den Iren, wie er ihre keck aufgerichteten Brustwarzen musterte und dabei seine Spielkarten senkte, dass Ward einen Blick darauf erhaschen konnte.
Er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
Offenbar war er an diesem Abend nicht der Einzige, bei dem es mit der Konzentration nicht allzu weit her war.
Sie spielten eine Weile und der Haufen Münzen vor ihm wuchs und wuchs.
Da legte sich mit einem Mal eine schwere Hand auf seine Schulter.
»Ward? Du bist nicht leicht zu finden, weißt du das?«
Er blickte sich um und schaute in das bärtige Gesicht des Mannes, der unbemerkt hinter ihn getreten war. Von Kopf bis Fuß ein Gentleman. Er war in einen dunklen Anzug gekleidet, dessen tadelloser Sitz den teuren Schneider verriet. Ein ordentlich gestutzter weißer Bart zierte sein Gesicht. Seine grauen Augen blickten hinter einer runden Drahtgestellbrille so aufmerksam in die Welt, das ihnen wohl kein Detail entging. Mr. Harold Crampton. Verwalter des Yellowstone Nationalparks und einer von Ward Thompsons ältesten Freunden.
»Harold. Welcher Wind hat dich in meine Stadt geweht?«