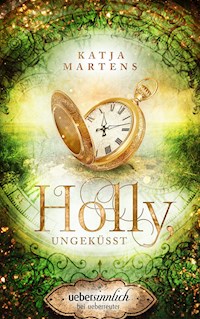1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Kommt mit erhobenen Händen raus, ihr Kanaillen!" Ray Ortega blickte am Lauf seines Henry-Gewehrs entlang, während er in der Deckung eines großen Holzfasses kniete. Er spähte zu der Mühle hinüber, in der sich die Banditen verschanzt hatten. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Das laute Klirren von Glas gellte durch die staubige Luft. Das Fenster neben der Eingangstür barst und ein Gewehrlauf stach durch die Öffnung. Krachend spuckte ein Spencer-Gewehr Feuer und heißes Blei aus. Das Geschoss schrammte an dem Fass vorbei und zackte in den krummen Stamm der Kiefer hinter Ortegas linker Schulter, ohne Schaden anzurichten. Von der Mühle wehte ein frustrierter Fluch herüber, dem augenblicklich zwei weitere Schüsse aus dem Unterhebelrepetierer folgten. Offenbar waren die Kerle in der Mühle entschlossen, ihre Haut so teuer wie möglich zu verkaufen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Eine verdammt schlechte Idee
Vorschau
Impressum
Eine verdammt schlechte Idee
von Katja Martens
»Kommt mit erhobenen Händen raus, ihr Kanaillen!« Ray Ortega blickte am Lauf seines Henry-Gewehrs entlang, während er in der Deckung eines großen Holzfasses kniete. Er spähte zu der Mühle hinüber, in der sich die Banditen verschanzt hatten.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Das laute Klirren von Glas gellte durch die staubige Luft. Das Fenster neben der Eingangstür barst und ein Gewehrlauf stach durch die Öffnung. Krachend spuckte ein Spencer-Gewehr Feuer und heißes Blei aus. Das Geschoss schrammte an dem Fass vorbei und zackte in den krummen Stamm der Kiefer hinter Ortegas linker Schulter, ohne Schaden anzurichten.
Von der Mühle wehte ein frustrierter Fluch herüber, dem augenblicklich zwei weitere Schüsse aus dem Unterhebelrepetierer folgten. Offenbar waren die Kerle in der Mühle entschlossen, ihre Haut so teuer wie möglich zu verkaufen!
»Wir werden sie ausräuchern müssen.« Lassiter hatte hinter der Ecke der Scheune Stellung bezogen. Er hielt seinen 38er Remington in der Faust und wechselte einen schnellen Blick mit seinem Begleiter. »Die Kerle kommen nicht raus. Die stellen sich taub.«
»Oh, die werden schon hören, wenn meine Missy ihnen was flüstert.« Ortega strich liebevoll über den achteckigen Lauf seines Gewehrs. Es war eine verbesserte Version des früheren Volcanic Repeating Gewehrs und verschoss sechzehn Randfeuerpatronen hintereinander. Im Bürgerkrieg war diese Waffe nie offiziell in den Dienst aufgenommen worden, aber sie war so beliebt gewesen, dass viele Soldaten sie aus eigenen Mitteln gekauft und ihr ihr Leben anvertraut hatten. In den richtigen Händen konnte ein Henry Gewehr achtundzwanzig Schuss pro Minute abgeben und war ein verlässlicher Verbündeter. Lassiter war sich recht sicher, dass sich sein alter Freund eher von seinem warmen Bett als von seiner Missy trennen würde.
Ortega kaute auf einem Zündholz herum. »Hört zu!«, brüllte er. »Einem Feuergefecht werdet ihr nicht standhalten. Das hier ist eure letzte Chance. Also kommt raus!«
Aus der Mühle erklang dreckiges Gelächter.
»Kommt ihr doch rein und holt uns.«
»Das werden wir. Worauf du deinen mageren Hintern verwetten kannst.« Ortega packte sein Gewehr fester und knirschte mit den Zähnen.
Sie waren der Spur der Banditen beinahe drei Monate lang gefolgt. Was nicht weiter schwer gewesen war, denn die Horde war von einem Überfall zum nächsten gezogen und hatte dabei eine breite Fährte aus Blut und Tod hinterlassen.
In Las Cruces hatten sie die Gesuchten endlich eingeholt. Die Horde hatte die örtliche Bank überfallen und war auf der Flucht. Mindestens einer von ihnen hatte sich eine Kugel eingefangen und war verletzt. Lassiter und Ortega blieben ihnen auf den Fersen, aber die Banditen hatten ihre Flucht gut geplant und eine Sprengladung an einer Brücke hinter sich hochgehen lassen, sodass ihre Verfolger gezwungen waren, einen Umweg zu nehmen.
Nun jedoch saßen die Kerle in der Falle.
Sie hatten sich in der abgelegenen Mühle verschanzt.
Die Mühlenflügel knarzten im Wind, während Lassiter ihre Möglichkeiten überdachte.
»Sie haben die Familie als Geiseln genommen. Wir könnten warten, bis sie schlafen, und dann versuchen, sie zu überwältigen.«
»Bis dahin sind die Geiseln längst tot.« Ortega schüttelte den Kopf. »Álvarez und seiner Bande ist nichts heilig.«
»Und wenn wir auf Verstärkung warten? Der Town-Marshal wird mit einem Aufgebot schon auf dem Weg sein.«
»Dann sterben die Geiseln trotzdem. Ich würde gern ein Blutbad vermeiden.«
»Dann müssen wir reingehen und die Kerle ausschalten, bevor sie der Familie etwas antun können.«
»Genauso sehe ich das auch.«
»Am besten teilen wir uns auf«, schlug Lassiter vor. »Du hältst die Kerle hier beschäftigt. Ich gehe hinten rum und suche einen Weg hinein.«
»Sie werden dich erwarten.«
»Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.«
»Womöglich doch.« Ortega spuckte sein Zündholz in den Staub. »Lenk sie ab. Dann klettere ich über die Dächer der Scheune und der Mühle auf das Wohnhaus und dringe von oben ein. Damit werden sie nicht unbedingt rechnen.«
Lassiter zog eine Braue hoch. Das war ein gewagter Plan, aber er konnte funktionieren. Zumindest, wenn es ihm gelang, das Feuer eine Weile auf sich zu ziehen.
»Okay.« Er nickte bedächtig. »Ich gebe dir fünf Minuten, dann komme ich nach.«
»Drei reichen.« Ortega grinste ihn an. Dann wandte er sich ab und huschte geduckt zu der Scheune hinüber. Lassiter wusste, dass dahinter ein Frachtwagen stand. Über den konnte sein Begleiter die Dachkante erreichen und sich auf das Dach der Scheune schwingen. Wenn er sich katzengleich fortbewegte, könnte er so auf das Dach des Wohnhauses gelangen und sich ungesehen einen Weg hinein bahnen.
Lassiter schickte einen Hagel aus heißem Blei auf das Mühlenhaus.
Drinnen ließen sich die Banditen nicht lumpen und beantworteten seine Grüße sogleich mit Salven, denen Schwaden von Pulverdampf folgten.
So weit, so gut.
Lassiter duckte sich ab, um nachzuladen.
Hinter der Scheune war er in einer guten Position. Ortega war derjenige, um den er sich Sorgen machte. Während er selbst noch recht neu war in der Brigade sieben, war Ortega ein erfahrener Agent, der schon viele schier unmögliche Aufträge zu einem guten Ende geführt hatte. Der alte Haudegen galt als unverwüstlich. Diesmal jedoch war sein Verstand vernebelt vom Wunsch nach Vergeltung und das mochte ihn alle Vorsicht fahren lassen.
Die Bande von Álvarez hatte auch die Bank in Ortegas Heimatstadt überfallen. Dabei war ihnen Ortegas Frau Mary ahnungslos in den Weg geraten und vom Anführer des Haufens erschossen worden. Seitdem machte Ortega Jagd auf sie. Unterstützt von Lassiter, der von Washington als Verstärkung geschickt worden war.
Für Ortega war die Sache nun persönlich.
Das führte dazu, dass er sich mehr auf seine Waffe als auf seine Vorsicht verließ.
Lassiter schwor sich, dafür zu sorgen, dass sein Partner das hier lebend überstand.
Im Haus wurde mit einem Mal wütendes Gebrüll laut.
Das bedeutete hoffentlich, dass Ortega erfolgreich eingedrungen war und sich ans Werk gemacht hatte.
Jetzt galt es.
Lassiter muss sich darauf verlassen, dass sein Partner die Kerle genügend beschäftigen würde, damit er selbst zum Haus gelangen konnte.
Er spannte den Hahn seines Remingtons, dann schnellte er mit langen Schritten aus seiner Deckung und feuerte auf den Schützen am Fenster.
Kugeln flogen wie wütende Hornissen um ihn herum, verfehlten ihn jedoch.
Da hatte er die Tür auch schon erreicht und trat sie auf. Ein schneller Blick hinein verriet, dass der Flur verlassen war und die Küche schräg gegenüber lag. Eine Frau stand neben dem Herd schützend vor drei Kindern; das Kinn hoch erhoben, verrieten nur ihre geweiteten Augen, wie viel Angst sie hatte. Ihre Hände waren an das Ofenrohr gefesselt. Sie trug ein schlichtes Kleid aus blassblauem Musselin und eine Haube auf ihrem dunklen Haar.
Hinter ihr drängten sich die Kinder ängstlich aneinander.
In einer Ecke krümmte sich ein Mann auf dem Boden. Keiner der Banditen, soweit Lassiter das mit einem schnellen Blick erfassen konnte. Der Müller vermutlich. Sein Gesicht war blau und grün verfärbt und geschwollen. Auch er war gefesselt.
Auf dem grob gezimmerten Küchentisch lag einer der Banditen. Blut quoll unter den Lumpen hervor, die er sich auf den Bauch presste. Mehrere blutige Lappen lagen neben dem Tisch verstreut. Der Mann war so bleich, als wollte er mit den weiß gestrichenen Wänden der Küche verschmelzen.
Ein weiterer Revolverschwinger stand am Fenster und behielt die Umgebung im Auge. Seine Hände waren blutverschmiert. Offenbar hatte er die ›Behandlung‹ unterbrochen, um die Verfolger loszuwerden.
Ein dritter schwenkte den Lauf eines Army-Colts herum und nahm Lassiter ins Visier. Es war ein bärtiger Dürrländer, der mehr Narben als Haare auf dem Kopf zu haben schien. Er war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet und seine grauen Augen blickten so kalt, als wäre überhaupt kein Leben mehr in ihnen. Álvarez.
Von oben drang das Krachen des Henry Gewehrs.
»Zwei hab ich erwischt!«, rief Ortega, während es hörbar polterte und er offenbar alle Hände voll zu tun hatte mit einem weiteren Gegner.
Sechs Banditen. Zwei ausgeschaltet. Am dritten arbeitete Ortega.
Blieben drei für Lassiter: Álvarez, der ›Doc‹ am Fenster und der Verletzte auf dem Tisch.
Wie auf ein stummes Kommando hin griffen seine Widersacher zu ihren Waffen und eröffneten das Feuer!
Lassiter duckte sich hinter der Tür ab und lud in aller Eile nach.
»Auf den Boden!«, rief er. »Wenn ihr leben wollt, dann gebt ihr jetzt auf!«
»Das hättest du wohl gern, was?« Álvarez stieß ein raues Lachen aus.
Im selben Augenblick stürzte ein Mann die Treppe herunter.
Es war einer der Banditen.
Damit hielt sich nur noch Ortega oben auf.
Lassiter nahm seinen Hut ab und hielt ihn mit der freien Hand in die Höhe, während er in die Knie ging. Dann schnellte er vor. Sein Hut zog das Feuer auf sich und wurde sogleich von Kugeln durchsiebt. In der Hocke zischten die Bleistücke über ihn hinweg. Er jagte eine Kugel nach der anderen aus dem Lauf.
Ein Bleistück fetzte dem ›Doc‹ in den Oberschenkel und riss ihn von den Beinen. Brüllend wälzte er sich auf dem Bretterboden.
Ein weiteres Bleistück fetzte dem Verletzten das rechte Ohr vom Schädel. Er ließ die Waffe fallen und fasste sich heulend an den Kopf.
Álvarez hechtete gedankenschnell zur Seite und entging Lassiters Kugel. Dann sprang er auf die Füße, packte eines der Kinder und zerrte es zu sich heran. Er presste dem Jungen den Lauf seiner Waffe gegen die Schläfe. »Wirf dein Schießeisen weg, Langer, oder ich jage dem Kleinen 'ne Kugeln durch seinen kleinen Schädel.«
Die Frau schrie auf.
Lassiter erhaschte eine Bewegung weiter oben. Ortega stand oben an der Treppe und warf einen bedeutungsvollen Blick zur Seite. In der nächsten Sekunde spuckte sein Henry Gewehr Feuer und Blei. Das Geschoss zackte in die Petroleumlampe an der Küchendecke und ließ sie auf den Anführer der Banditen herabstürzen.
Flüssiges Petroleum rann dem Dürrländer über die Stirn und in die Augen. Er röhrte auf. Für einen Augenblick war seine Aufmerksamkeit abgelenkt. Das genügte. Lassiter schmetterte ihm mit der Handkante die Waffe aus der Faust. Dann entriss er dem Kerl den Jungen. Der Kleine flüchtete sich hinter die Röcke seiner Mutter.
Lassiter zog die Lederriemen hervor, mit denen er Gefangene zu fesseln pflegte, und machte sich daran, die drei Banditen sicher zu verschnüren. Die Augen von Álvarez waren rot und tränten und sein Blick flackerte, als hätte er Mühe, seine Umgebung deutlich zu erkennen. Die beiden anderen Outlaws jammerten und fluchten abwechselnd, aber da half nun alles nichts. Sie endeten ebenso verschnürt wie ihr Anführer.
Lassiter wandte sich an die Frau und schnitt ihre Fesseln durch.
»Ist bei Ihnen alles in Ordnung, Mrs. Miller?«
Sie nickte zittrig, rieb sich kurz die Handgelenke und schlang dann ihre Arme um ihre Kinder.
Ortega war derweil heruntergekommen und kümmerte sich nun um den Müller. Er schnitt seine Fesseln durch und untersuchte ihn behutsam.
»Die Kerle haben ihn ziemlich schlimm zugerichtet«, stellte er fest. »Aber ich würde sagen, er wird schon wieder.«
»Gut zu hören.« Lassiter schnappte sich einen der Lappen und wickelte ihn um die Wunde am Oberschenkel des ›Docs‹, ehe ihnen der Kerl hier an Ort und Stelle verblutete. Anschließend verband er den anderen Halunken. »Der Richter wird sich eurer annehmen«, erklärte er. »Bis dahin werden wir euch am Leben halten.«
Beide schienen nicht allzu glücklich über diese Aussicht zu sein.
Während sich der Müller und seine Frau in die Arme fielen, trat Ortega neben Lassiter und reichte ihm wortlos ein sauberes Tuch.
Jetzt erst bemerkte der große Mann die brennende Wunde an seiner Schläfe. Offenbar hatte ihn einer der Glassplitter der geborstenen Lampe getroffen.
Er wischte sich das Blut ab. Dann ließ er das Tuch sinken und sah seinen Partner an.
»Es ist vorbei, Ray«, sagte er rau. »Wir haben die Kerle.«
»Dann hat meine Mary endlich ihren Frieden.« Ortega nickte bedächtig. »Und ich kann mich zur Ruhe setzen.«
»Hast du das wirklich vor? Nach all den Jahren im Job?«
»Ich habe es Mary versprochen. Ihre Mörder musste ich noch zur Rechenschaft ziehen, aber jetzt werde ich mein Leben nicht länger aufs Spiel setzen. Unsere Tochter hat nur noch mich. Ich muss für sie da sein.«
»Ich verstehe.« Lassiter sah seinen Freund eine kleine Weile schweigend an. Die Brigade Sieben würde ohne ihn nicht mehr dieselbe Organisation sein, aber er verstand ihn wirklich. Ein Mann musste im Leben Prioritäten setzen und seinem Gewissen folgen. Nichts anderes hätte er von Ortega erwartet. »Und was hast du nun vor?«
»Oh, ich schätze, ich werde mir irgendwo eine Farm zulegen und ein ruhiges Leben führen.« Ein breites Lächeln kerbte das bärtige Gesicht des anderen Mannes. »Ich werde Mais und Pecannüsse anbauen und mich von Ärger fernhalten.«
»Hört sich nach einem guten Plan an.«
Das tat es wirklich.
Doch das Leben hielt sich nicht immer an Pläne ...
✰
12 Jahre später
»Hey, meine Finger stehen nicht mit auf der Speisekarte.« Liz Stokes streute den Hühnern Futter aus einem flachen Korb hin: Körner und grüne Blätter. Die muntere Schar stürzte sich hungrig darauf und pickte nach allem, was in Reichweite war – selbst nach dem Rock und den Händen der jungen Farmerin.
Im Koben nebenan verspeisten die beiden Schweine schmatzend ihre Abendmahlzeit. Die Sonne stand schon tief über den Hängen des Juniper Valleys. Während die Schatten länger wurden, kühlte sich die Luft merklich ab. Früher wäre um diese Zeit der Dunst vom Fluss herangekrochen, doch der Juniper River führte schon lange kein Wasser mehr. War nur noch ein Rinnsal und oft genug nicht einmal mehr das.
Liz stemmte die Hand auf die Hüfte und schaute zufrieden zu, wie es den Tieren schmeckte. Auf den Hängen rings um die Farm wuchsen Wacholder und ölweidenblättriger Nachtschatten. Letzterer bereitete den Farmern nicht wenig Arbeit, weil er giftig für ihr Vieh war und ausgemerzt werden musste. Erst im vergangenen Frühling hatten die Wheelers ein paar Meilen südlich zwei Schweine verloren, die davon gefressen hatten.
Die Stokes-Farm schmiegte sich an das schmale Flussbett wie ein Biberjunges an den Bauch seiner Mutter. Liz bewirtschaftete das Land allein mit ihrem Bruder Chase, seitdem ihre Eltern zwei Winter zuvor dem Fieber erlegen waren.
Liz brachte den Korb zurück in die Scheune. Als sie wieder ins Freie trat, näherte sich ein Einspänner ihrem Zuhause. Sie legte eine Hand an ihre Stirn, um ihre Augen zu beschatten, und erkannte die Lenkerin. Es war Hannah Blank, die mit ihrer Familie ein Stück den Fluss hinunter wohnte. Zwei Jungen im Alter von fünf und sechs Jahren saßen hinter ihr.
»Hallo Hannah.« Liz trat an ihre Besucher heran. »Joseph, Toby, ich glaube, ihr seid schon wieder gewachsen, seit ich euch das letzte Mal gesehen habe. War das nicht erst letzte Woche? Wenn ihr so weitermacht, seid ihr bald größer als euer Vater. Wollt ihr mit reinkommen? Ich habe einen Apfelkuchen gebacken. Er müsste genug abgekühlt haben, dass wir ihn anschneiden können.«
Sie hatte freudige Rufe und leuchtende Augen erwartet.
Stattdessen senkten die beiden Kinder die Köpfe.
Liz stutzte. »Ist alles in Ordnung?« Sie wandte sich wieder an Hannah. Jetzt erst bemerkte sie, wie blass die andere Frau war und wie sie die Hände in den Baumwollstoff ihrer Röcke krallte, als müsste sie irgendeinen Halt suchen. Da dämmerte es ihr.
»Noch immer keine Spur von deinem Mann?«
»Nicht die geringste.« Ihre Besucherin schüttelte den Kopf, dass ihr blonder Zopf von einer Schulter auf die andere schwang. »Er ist gestern Abend noch einmal losgeritten, um mir etwas von der Ingwerlimonade zu besorgen, die mir so gut gegen die Übelkeit hilft. Doch er ist nicht zurückgekommen.«
»Hast du den Marshal informiert?«
»Natürlich. Und ich bin die ganze Strecke abgefahren, die Oliver genommen hat. Vergeblich. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Allerdings ...« Hannah stockte. »Sein Pferd stand heute Morgen vor dem Stall.«
»Es ist allein zurückgekehrt?« Liz schwante nichts Gutes. »Der Marshal muss ein Aufgebot zusammenstellen und Männer losschicken, die nach deinem Mann suchen.«
»Das tun sie schon, aber bis jetzt ... Nichts.« Hannah strich sich über die Stirn, als müsste sie einen unliebsamen Gedanken vertreiben. »Ich wollte deinen Bruder bitten, sich der Suche anzuschließen. Chase war bei der Army, oder? Ein Fährtensucher?«
»Ja, das stimmt. Er reitet gerade den Zaun ab und repariert ihn, wo es nötig ist, aber er sollte bald wieder da sein. Kommt doch rein und stärkt euch erst einmal.«
»Das ist sehr freundlich von dir.« Hannah nahm ihre Kinder bei der Hand und folgte Liz ins Haus. Wenig später saßen sie bei dampfendem Kaffee und Apfelkuchen beisammen. Hannah stocherte jedoch nur in ihrem Kuchen herum. Sie war blass und so schmal, dass man ihr noch nicht ansah, dass ihr drittes Kind unterwegs war.
»Ich habe solche Angst, dass Oliver etwas zugestoßen ist«, sagte sie leise. »Was soll ich bloß ohne ihn machen? Die Farm ... sie ist alles, was wir haben, aber allein kann ich sie unmöglich halten.«
»Wir finden ihn, Hannah. Ganz bestimmt.«
»Wenn es ihm bloß gutgeht. Ich wünschte, ich hätte ihn nicht noch einmal losgeschickt ...« Tränen glitzerten in den Augen der Besucherin.
Da polterten mit einem Mal Schritte auf der Veranda und wenig später trat ein groß gewachsener Mann mit sonnengebräunter Haut ein. Chase Stokes war achtundzwanzig Jahre alt und damit drei Jahre älter als Liz. Man sah ihm an, dass er zupacken konnte. Seine Hände waren schwielig und seine Schultern breit und kräftig. Staub bedeckte sein Hemd, die Weste und seine braunen Hosen.
»Mrs. Blank.« Er nickte der Besucherin zu und nahm seinen Hut ab.
»Chase?« Liz starrte auf die dunkelroten, fast bräunlichen Flecken, die seine Arme bedeckten. »Ist das etwa Blut?«
»Hab zwei verendete Ziegen gefunden. In der Nähe der Brücke. Ich hab sie mir genauer angeschaut. Sie sind verdurstet. Wie schon die Ziegen letzte Woche.«
Liz schnürte sich die Kehle zu. »Dieses Tal war einmal grün und voller Leben«, sagte sie leise. »Jetzt schleicht sich immer öfter der Tod an.«
»Weil das Wasser fehlt.« Ihr Bruder presste die Kiefer so fest aufeinander, dass sie es knirschen hören konnte. »Ich werde mich waschen gehen. Dann schaue ich nach dem Brunnen. Mir gefällt nicht, wie sich das Wasser verfärbt. Als würde er langsam versiegen.«