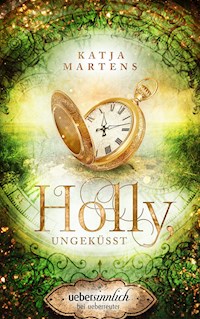1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"McAllister war tot. Mausetot." Bekräftigend hieb Vince auf den Spieltisch. Rings um ihn erhob sich Gemurmel. Ein Raunen zunächst, schwollen die zweifelnden Stimmen an wie das Wasser des Cypress Creek nach heftigen Regenfällen.
Diese Einfallspinsel. Sie glaubten ihm nicht. Dabei hatte er den Toten mit eigenen Augen gesehen: aschgraue Haut, schwarzblaue Lippen ... nein, am Ableben des Marshals gab es nichts zu rütteln. Bis auf die Tatsache, dass sein Leichnam spurlos verschwunden war. Aber wie war das möglich? Ein Toter spazierte doch nicht einfach so davon! Der Tod des Marshals war ein Rätsel.
Und es sollte nicht bei diesem einen bleiben. Bald darauf verschwanden weitere Menschen aus der Stadt. Darunter die bildschöne Tochter des Marshals. Old Pattonsburg war auf dem besten Weg, sich in eine Geisterstadt zu verwandeln...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Tod blufft nicht
Vorschau
Impressum
Der Tod blufft nicht
von Katja Martens
Die Wölfe hatten ganze Arbeit geleistet.
Blutige Hautfetzen lagen im Schnee verstreut und färbten das Weiß tiefrot. Eine Spur des Grauens. Sie führte zu einer Kiefer, die sich – gebeugt von den Jahren und den harschen Winterstürmen Colorados – über einen Kadaver neigte. Die Überreste eines Pferdes. Obwohl es eisig kalt war, hatte es seit Tagen nicht mehr geschneit, und so lag der zerfetzte Körper offen da.
Zögerlich näherte sich der Reverend dem toten Tier und vermied jeden allzu genauen Blick auf die bleichen Knochenfragmente. Der metallische Geruch von Blut und Verderben stieg ihm in die Nase, und er bekreuzigte sich unwillkürlich.
Ein Stück weiter lag ein umgestürzter Einspänner. Weit und breit war kein Mensch zu sehen, doch eine weitere Blutspur führte tiefer in den Wald hinein...
Unwillkürlich schob Joseph Mercer eine Hand unter seinen mit Pelz gefütterten Umhang und fasste nach dem goldenen Kreuz, das an einer schweren Kette um seinen Hals hing.
Er murmelte ein Gebet, bevor er sich weiter umsah.
Dabei fiel sein Blick auf das gebrochene Rad der kleinen Kutsche. Das Fuhrwerk musste über ein Hindernis gerumpelt sein, das unter dem Schnee unsichtbar gewesen war. Das Rad war gebrochen und die Fahrt hatte ein jähes Ende gefunden. Gut möglich, dass das Pferd dabei zu Schaden gekommen war. Eine leichte Beute für die Wölfe, die sich hier in den Bergen herumtrieben. Sie schienen fort zu sein. Nichts als der Wind fauchte durch die Wipfel über der unheimlichen Szenerie und neigte die Bäume, bis sie sich ächzend unter seiner Macht bogen.
Suchend musterte der Reverend die Umgebung, konnte jedoch keinen toten Wolf nicht ausmachen. Wie es schien, hatte, wer auch immer den Einspänner gelenkt hatte, keine Gelegenheit mehr gefunden, einen Schuss abzugeben.
Aber wo war derjenige abgeblieben?
Ein Blick unter die Plane des Gefährts offenbarte mehrere Gepäckstücke – Teppichstofftaschen und eine Kiste –, aber keine Menschenseele.
Eine weitere eisige Böe fauchte ihm entgegen. Joseph Mercer kniff die Augen zusammen und blickte sich um. Obwohl es noch nicht spät sein konnte, wurde es bereits dunkel. In weniger als einer Stunde würde das Tageslicht fort sein und die Temperatur noch weiter fallen. Dann wollte er eigentlich bereits daheim am Kamin sitzen und einen ruhigen Abend mit heißem Tee und erbaulicher Lektüre verbringen.
»Hallo?« Seine Stimme verlor sich in der Stille. Vergebens wartete er auf eine Antwort. Ein eisiger Wind fegte von Norden heran. Die Kälte schnitt in die Wangen des Geistlichen und ließ seine Finger taub werden. Rings um ihn schien die endlose Landschaft aus verschneiten Hängen, Bergkiefern und Felsklüften in der eisigen Luft erstarrt zu sein. Der Schnee knirschte unter seinen schweren Stiefeln, als er sich einen Weg in die verschneite Wildnis bahnte.
Der Reverend folgte den Fußspuren tiefer in den Wald hinein. Bei jedem Schritt sank er bis zu den Knien ein und musste sich mühsam weiterkämpfen. Bald drang ihm trotz der beißenden Kälte der Schweiß aus allen Poren. Sein Atem bildete kleine Wölkchen in der eisigen Luft. In der Ferne waren die gedämpften Geräusche des Turkey Creek zu hören, der unter einer dünnen Eisschicht vor sich hin murmelte.
Immer dunkler wurde es. Die Silhouetten der mächtigen Bäume drängten sich dicht zusammen, wirkten bedrohlich in der zunehmenden Finsternis.
Plötzlich zeichnete sich vor ihm etwas Dunkles im Schnee ab... Halb hinter verschneitem Gestrüpp verborgen lag ein Mensch!
»Hallo? Können Sie mich hören?« Der Reverend beschleunigte seine Schritte, verwünschte den Schnee, der ihn aufhielt und das Vorankommen erschwerte.
Als er näher kam, erkannte er, dass vor ihm ein Mann lag. Er hatte schwarze Haare und einen gepflegten schwarzen Kinnbart. Seine Haut war blass, der Schnee rings um ihn blutrot verfärbt. Seine Kleidung hing ihm in Fetzen vom Körper, und sein rechtes Bein wies tiefe Bisswunden auf und verriet, dass die Wölfe auch ihm zugesetzt hatten. Er hielt einen Knüppel umklammert. Damit schien er sich die Beutegreifer vom Leib gehalten zu haben, denn wider Erwarten war er nicht tot.
Noch nicht jedenfalls.
Sein Brustkorb hob und senkte sich unter flachen, aber deutlich wahrnehmbaren Atemzügen. Seine Augen waren geschlossen. Es war unklar, ob er den Reverend überhaupt wahrnahm.
Argwöhnisch spähte Joseph Mercer umher, darauf gefasst, dass jeden Moment ein Wolf aus dem Unterholz auf ihn zuspringen, würde. Er umklammerte sein Kreuz und tastete nach der Bibel, die er stets bei sich trug.
Doch alles blieb still.
Da stieß der Verletzte ein gurgelndes Stöhnen aus.
»Bleiben Sie ganz ruhig«, mahnte der Reverend. Mit langen Schritten brachte er die kurze Distanz zu dem Fremden hinter sich und kniete sich hin. »Hören Sie mich? Ich bin hier. Ich werde Ihnen helfen. Sie müssen nur leise sein. Es ist besser, wir locken die Wölfe nicht hierher zurück.«
»W-was ist mit meinem Pferd?« Der Fremde blinzelte aus halb geöffneten Augen zu ihm hoch.
»Da ist nichts mehr zu machen. Tut mir leid.« Warmes Mitgefühl strömte durch Joseph Mercer, als er die Verzweiflung in den Augen des anderen Mannes sah. »Ich muss mir Ihre Verletzungen ansehen. Ist das in Ordnung für Sie?« Er wartete das Einverständnis des Fremden ab, ehe er seine Handschuhe auszog und sich über das zerfetzte Bein beugte. Ihm entging der entsetzte Blick des anderen Mannes nicht, mit dem dieser seine Hände betrachtete. Die waren mit Brandnarben übersät und verzerrt, als würde man sie im falschen Abstand durch ein Vergrößerungsglas betrachten. Joseph hatte sich an den Anblick gewöhnt. Für Fremde mochte er beunruhigend sein. Er hielt sich jedoch nicht mit Erklärungen auf, sondern tastete behutsam das Bein des Verletzten ab. Es war notdürftig mit einem Fetzen verbunden, aber der Stoff war blutgetränkt und hielt den Strom kaum noch auf.
Joseph Mercer murmelte ein Gebet, während er seinen Schal abband und um die Wunde wickelte. Das würde die Blutung eine Weile stoppen, aber der Verletzte musste so schnell wie möglich ins Warme, sonst würde er elend erfrieren.
Und er brauchte einen Arzt!
Der Reverend hob den Kopf. Ringsum war der Wald in eisiger Stille versunken, als würde er den Atem anhalten, während er auf den Frühling wartete. Der Wind wurde immer stärker und ließ den Schnee in wirbelnden Spiralen aufsteigen.
»Die Wölfe werden wiederkommen«, murmelte er. »Wenn es so weit ist, sollten wir nicht mehr hier sein.«
»W-w-wiederkommen?« Die Zähne des Verletzten schlugen hörbar aufeinander vor Kälte.
»Ihr Pferd.« Joseph Mercer deutete mit dem Kinn in die Richtung. »Es ist noch etwas davon übrig. Ein Vorrat für die Biester. Das wissen sie. Sie werden wiederkommen, um ihn sich zu holen. Die Natur verschwendet nichts.«
»Dann bin ich verloren. Ich k-konnte sie mir mit Ach und Krach vom Leibe halten, aber nochmal schaffe ich das nicht.«
»Niemand ist verloren. Der Herr kümmert sich um die Seinen. Ängstigen Sie sich nicht. Ich werde Ihnen helfen. Wie ist Ihr Name?«
»Ich... weiß es nicht«, kam es zögerlich zurück.
Eine Augenbraue des Reverends wanderte in Richtung Haaransatz nach oben.
»Ich w-weiß es wirklich nicht«, beteuerte der Unbekannte. Dabei tastete er mit der Hand nach seiner Schläfe. Jetzt erst fiel Joseph Mercer die bläuliche Schwellung auf, die sich dort abzeichnete. Der Fremde schien bei dem Kutschenunglück irgendwo mit dem Kopf aufgeschlagen zu sein. Offenbar war dabei so einiges in seinem Schädel durcheinandergeraten. Von solchen Fällen hatte er schon gelesen.
»Keine Sorge«, begütigte er. »Das fällt Ihnen schon alles wieder ein. Sie sind jetzt in Sicherheit. Ich bin Reverend Joseph Mercer.«
»Mercer?« Ein mattes Lächeln zupfte an den Mundwinkeln des Verletzten. »Dann lässt mir der Herr seine Gnade wohl doch noch zuteilwerden, was?«
»Darauf können Sie sich verlassen.« Er rieb sich das bärtige Kinn, während er darüber nachdachte, wie er den Verletzten am besten von hier fortbringen konnte. Er war zu Fuß unterwegs. Der Weg, den er einmal in der Woche nahm, war nicht für Fuhrwerke geeignet. »Ich werde eine Trage bauen müssen. Dann bringe ich Sie nach Old Pattonsburg.«
»Haben Sie dort Ihre Kirche?«
»Das habe ich.« Stolz schwang in seiner Stimme mit, auch wenn Kirche ein recht enthusiastischer Ausdruck für die Hütte war, durch deren Ritzen der Wind pfiff und deren Dach im Wind laut genug klapperte, um seine Predigten zu übertönen. Eines Tages, davon war er überzeugt, würde es eine anständige Kirche in Old Pattonsburg geben. Mit einem Turm, einer Glocke, genügend Platz für eine große Gemeinde und einem richtigen Altar, der aus mehr als einem wackeligen Tisch bestand, der aus alten Brettern zusammengezimmert war.
Joseph Mercer richtete sich auf, um Äste und Zweige zu sammeln, die er zu einer Trage zusammenflechten konnte, um den Fremden in die Stadt zu transportieren. Kurz flackerte der Gedanke durch seinen Kopf, dass es leichter wäre, zurückzulaufen und Hilfe zu holen, aber bis er wieder hier war, wäre der Fremde vermutlich erfroren.
Also beeilte er sich und mühte sich mit stacheligem Geäst ab. Nicht zum ersten Mal verwünschte er seine kleine, drahtige Gestalt, in der nicht genügend Kraft für Arbeiten wie diese steckte. Bald kam sein Atem kurz und stoßweise und seine Arme zitterten, als hätte er versucht, den Saddle Mountain von seinem Platz zu schieben.
Inzwischen war es dunkel geworden, aber die Wolkendecke riss auf und ließ genügend Mondlicht durch, um die Umgebung erkennen zu lassen.
Der Reverend sandte ein leises Dankgebet in den Himmel, während er eine provisorische Trage baute und den Fremden darauf wuchtete. Er musste ihn ziehen und zerren, weil der andere Mann vom Blutverlust zu schwach war, um ihm helfen zu können. Stattdessen hielt er die Augen geschlossen, während er etwas vor sich hin murmelte, das nicht zu verstehen war.
Joseph Mercer hielt inne und legte prüfend eine Hand an die Wange des Unbekannten. Dann zog er scharf den Atem ein.
Die Kälte war aus dem Körper des Fremden gewichen.
Er glühte beinahe!
Das Fieber hatte ihn überfallen. Das war kein gutes Zeichen. Ganz und gar nicht.
»Halten Sie durch«, beschwor der Reverend ihn. »Ich werde Ihnen Hilfe besorgen, hören Sie mich? Sie müssen nur durchhalten!«
Der Fremde stöhnte vernehmlich.
»Ich weiß, Sie haben Schmerzen und würden am liebsten einschlafen, aber Sie müssen wach bleiben. Das ist wichtig. Sonst wachen Sie womöglich nicht mehr auf.« Joseph Mercer rüttelte den anderen Mann sacht an der Schulter.
Der wimmerte leise. Dann murmelte er: »Die Beute... muss die Beute verstecken... die verdammten Sternträger sind mir auf den Fersen!«
»Was reden Sie denn da?« Unwillkürlich bekreuzigte sich der Reverend. »Was um alles in der Welt haben Sie getan?«
✰
Drei Monate später
Dieser Mann ist ein verfluchter Geist!
Lassiter knirschte mit den Zähnen.
So etwas war ihm in all den Jahren nicht passiert, die er nun schon für die Brigade Sieben ritt: Der Outlaw, den er aufspüren und hinter Gitter bringen sollte, entwischte ihm immer wieder. Es war, als würde er versuchen, Rauch mit bloßen Händen zu fangen. Dabei war sein Auftrag simpel: Arturo Perez das Handwerk zu legen.
Doch das war leichter gesagt als getan.
Der Outlaw wurde in etlichen Territorien gesucht, war den Sternträgern jedoch immer wieder entwischt. Im vergangenen Winter hatte er einen Geldtransport überfallen, der auf dem Weg nach Durango gewesen war. Das Geld gehörte der Army und war für den Bau eines Forts bestimmt, das den Süden Colorados vor weiteren blutigen Übergriffen der Ute-Indianer schützen sollte.
Einhunderttausend Dollar.
Doch das Geld hatte sein Ziel nie erreicht.
Stattdessen war es dem Banditen gelungen, die Kisten mit einer List an sich zu bringen, ohne dass auch nur ein einziger Schuss gefallen war. Erst Stunden später war ihr Fehlen aufgefallen, aber da war Perez schon über alle Berge gewesen.
Sowohl die Army als auch die örtlichen Gesetzeshüter hatten versucht, Perez aufzuspüren und ihm das Geld wieder abzunehmen.
Niemandem war es gelungen.
In Washington hatte man beschlossen, dass es nun genug war, und Lassiter auf die Spur des Outlaws gesetzt. Er schien mehrmals nah dran zu sein, aber jedes Mal war Perez schon wieder untergetaucht.
Seit einigen Wochen gab es überhaupt kein Lebenszeichen mehr von ihm.
Es war, als hätte sich die Erde aufgetan und ihn verschluckt.
Vor rund zehn Jahren war es Lassiter schon einmal gelungen, Arturo Perez zu schnappen. Damals war der Outlaw noch mit einer Schar Banditen geritten und hatte Ranches und Kutschen überfallen. Doch bevor er einem Richter vorgeführt werden konnte, war ihm die Flucht gelungen. Danach hatte er sich allein mit kleineren Überfällen durchgeschlagen und war immer wieder durch die Maschen des Gesetzes geschlüpft. Bis zu jenem Überfall auf den Geldtransport der Army.
Der war ein Brocken, der für ihn zu groß zum Schlucken sein würde, wenn es nach dem Willen der Verantwortlichen in Washington ging.
Doch bis jetzt war Lassiter noch nicht wieder nahe genug an ihn herangekommen, um ihn zu schnappen.
Was die Suche erschwerte, war der Umstand, dass es kein Bild von ihm gab. Zumindest keines, auf dem er zu erkennen gewesen wäre. Es gab wohl ein paar Zeichnungen auf alten Steckbriefen von ihm, aber die waren nur bessere Skizzen. Außerdem hatten die vergangenen Jahre Perez verändert. Nein, die Bilder ähnelten ihm ungefähr so gut, wie ein alter Knochen einem Tanzgirl in Rubys Saloon ähnelte.
Und so war Lassiter mal wieder einer falschen Spur gefolgt.
Die hatte ihn nach Harpers Creek geführt, einer verschlafenen Kleinstadt westlich des Needle Rock. Ein fahrender Händler wollte Perez wiedererkannt haben, aber wie sich zeigte, war der Mann, den er tatsächlich meinte, der örtliche Totengräber, dem seit dem Krieg ein Fuß fehlte und der die Stadt seit Jahren nicht verlassen hatte.
Mal wieder stand Lassiter mit leeren Händen da und er fragte sich, ob es nicht besser wäre, die Suche aufzugeben, statt Woche um Woche mit Fehlschlägen zu vertun. Doch Aufgeben war für ihn noch nie eine Option gewesen, und er würde jetzt nicht damit anfangen. Früher oder später würde er den Outlaw aufspüren und das Geld für den Bau des Forts sichern. Falls davon noch etwas übrig war und Perez nicht alles verschleudert hatte.
Waren die vergangenen Wochen noch kühl und wechselhaft gewesen, zeigte sich das Wetter endlich von einer wärmeren Seite. Der Schnee zog sich in die höheren Regionen zurück und hier im Tal blühte und grünte es, als hätte die Natur nur darauf gewartet, sich wieder in voller Pracht zu zeigen.
Lassiter hatte seinen Braunen im örtlichen Mietstall untergestellt und im einzigen Hotel von Harpers Creek übernachtet. Nun schlenderte er die Mainstreet hinunter. Sein Ziel war das kleine Frühstückslokal, das ihm im Hotel empfohlen worden war. Er wollte sich noch stärken, bevor er die Stadt verließ und seine Suche nach Arturo Perez fortsetzte.
Er passierte einen Eisenwarenladen und sah plötzlich eine junge Frau vor sich. Ohne sich Gedanken über ihr blaues Kleid zu machen, saß sie auf den Holzstufen, die zu einem Futtermittelgeschäft hinaufführten. Sie hielt ein Brett auf ihrem Schoß, auf das ein Blatt Papier geklemmt war, und zeichnete mit einem Bleistift.
Lassiter folgte ihrem Blick zu einem kleinen Jungen, der nicht älter als sieben oder acht Jahre sein konnte und sich die Nase am Fenster eines flachen Gebäudes plattdrückte. Die Glocke über der Eingangstür verriet, dass es sich um die örtliche Schule handelte. Was mochte der Knirps so fasziniert beobachten?
Die Unbekannte war so in ihre Arbeit vertieft, dass sie nichts um sich herum wahrzunehmen schien. Konzentriert richtete sie den Blick auf ihre Zeichnung und zog zwischen ihren Strichen die volle Unterlippe zwischen ihre Zähne. Ihre Wimpern lagen wie dichte dunkle Fächer auf ihren leicht geröteten Wangen. Sie trug ihre rotblonden Haare am Hinterkopf zu einer Hochsteckfrisur aufgetürmt, aber einige Locken hatten sich daraus gelöst und ringelten sich nun um ihr hübsches Gesicht. Es zuckte ihm in den Fingern, sie zurückzustreichen und herauszufinden, ob sie sich so seidig anfühlten, wie sie aussahen.
Ihr Kleid war hochgeschlossen, aber der Stoff schmiegte sich um ihre reizvollen weiblichen Rundungen und betonte ihre Sanduhrfigur. Als sie sich nun vorbeugte, um einen anderen Stift aus ihrer Tasche zu nehmen, wippte und wogte ihr Busen, dass der Stoff ihn kaum zu bändigen vermochte. Oh, diese Lady war so bezaubernd, dass er sich fragte, warum sie niemand malte.
Sie beugte sich tiefer über ihre Zeichnung und lenkte damit seinen Blick auf ihr Bild. Überrascht bemerkte er, wie lebensecht sie nicht nur den Jungen, sondern auch einige Passanten festgehalten hatte... und ihm kam eine Idee.
»Verzeihen Sie, Ma´am«, sprach er sie an und zog seinen Hut vom Kopf.
»Ma´am?« Sie blickte zu ihm hoch und wirkte kurz verblüfft. Dann glättete sich ihre gekräuselte Stirn und ein Lächeln huschte über Gesicht. »Ich bin Miranda.«
»Lassiter«, stellte er sich vor. »Ich würde Sie gern um einen Gefallen bitten, Miranda.«
»Natürlich. Sie können mich besuchen kommen.« Ihr Lächeln vertiefte sich. »So früh am Tag arbeite ich allerdings nicht.« Sie neigte den Kopf und schaute kurz zu dem Gebäude auf der anderen Seite der Mainstreet hinüber. Der Eingang wurde von roten Lampen flankiert und die Vorhänge an den Fenstern waren fest zugezogen.
Lassiter schüttelte den Kopf. »Das war es nicht, worum ich Sie bitten wollte.«
»Wie schade.« Ihre Stimme war warm und melodisch und sandte Wärme durch seinen Körper, bis in seine Fingerspitzen hinein. Sie senkte halb die Lider, während sie fragte: »Worum wollten Sie mich dann bitten?«
»Mir ist aufgefallen, wie wunderbar Sie zeichnen.«
»Oh, das ist nur ein Zeitvertreib.«
»Sie sind wirklich gut. Sie könnten für die Zeitung arbeiten.«
»Das habe ich versucht, aber Mr. Huckle hat kaum einen Blick auf meine Bilder geworfen. Er meinte, ich hätte das Zeichentalent eines betrunkenen Waschbären.«