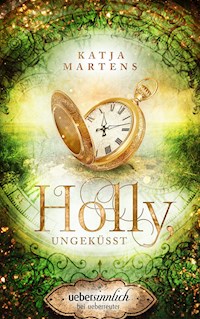1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lassiter
- Sprache: Deutsch
Besinnliche Weihnachten? Nicht in Cedaredge. Früher einmal war die Siedlung tief in den Bergen von Colorado ein beschaulicher Ort zum Leben. Die Quinn-Mine spülte den Arbeitern reichlich Geld in die Taschen. Es gab eine Schule, eine anständige medizinische Versorgung und ein gutes Auskommen für jedermann.
Aus und vorbei. Seitdem der Minenbesitzer dahinsiecht, geht es mit der Stadt bergab. Revolverschwinger haben sich eingenistet und halten die Arbeiter klein. Wer sich auflehnt, ist bald entweder tot oder wünscht sich, er wäre es. Sie schonen niemanden, weder Mensch noch Tier.
Bis eine junge Schlittenführerin den Mut findet, gegen die Bande aufzustehen. Doch die Kerle sind in der Übermacht, und hätte Lassiter nicht eingegriffen, wäre auch Belles Leben keinen müden Cent mehr wert gewesen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Jingle-Belle
Vorschau
Impressum
Jingle-Belle
von Katja Martens
Seit Wochen hatte Lassiter keinen Saloon mehr von innen gesehen. Er war den Spuren der Horde quer durch Colorado gefolgt, hatte unter freiem Himmel genächtigt und wusste kaum noch, wie sich ein Bad anfühlte. Oder die warme, weiche Haut einer hübschen Lady. Heiliger Rauch, für eine anständige Mahlzeit hätte er seinen Sattel verkauft. Die Banditen freilich, die waren ihm bis jetzt immer ein paar Pferdelängen voraus gewesen. Seine Suche nach ihnen glich dem Versuch, Nebel mit bloßen Händen zu fangen. In Little Creek hoffte er, endlich einen Hinweis auf die Kerle zu finden. Doch stattdessen stieß er auf eine Mauer aus Schweigen und Angst ...
»Lassen Sie die Finger davon, solange Sie es noch können, Mister.« Der Oldtimer, der neben ihm an der Bar saß, senkte die Stimme. »Es sind Geister, die Sie jagen!«
»Geister.« Lassiter war sich nicht sicher, ob er richtig verstanden hatte.
»Ganz recht.« Sein Gegenüber schien sich gerade einen Whisky genehmigen zu wollen, hielt sein Glas nun jedoch selbstvergessen in der Hand. In seinen Augen glitzerte Furcht, als er sich nach allen Seiten umsah. »Schon viele haben versucht, sie zu schnappen, und das ist ihnen nicht gut bekommen.«
»Das macht die Kerle noch lange nicht zu Geistern.«
»Das vielleicht nicht, aber man erzählt sich, dass ihre Pferde die Erde erbeben lassen. Unter ihren Hufen stieben feurige Funken auf, als würden sie geradewegs aus der Hölle kommen. Und die Reiter haben keine Gesichter. Nein, unter ihren Hüten verbergen sich knochige Totenfratzen. Sie können es mir glauben, Mister: Diese Schar ist nicht von dieser Welt!«
»Für Geister hinterlassen die Kerle aber reichlich Tote.«
»Davon rede ich doch. Niemand überlebt eine Begegnung mit ihnen. Sie sollten Ihre Suche vergessen, solange Sie noch Ihre heilen Knochen und Ihren Verstand beisammen haben!« Damit knallte der Dürrländer sein Glas auf den Tresen, warf eine Münze daneben und stürmte aus dem Saloon, als wäre die Horde nun hinter ihm her.
Seine Furcht blieb zurück wie ein schlechter Geruch.
Verblüfft starrte Lassiter auf das Glas, das der andere Mann nicht einmal angerührt hatte. Knochenfratzen? Feuer schlagende Pferdehufe? Was waren das für Geschichten? So etwas fand sich vielleicht in den Schauerromanen, die man für ein paar Cents im Generalstore nebenan erstehen konnte, aber nicht im echten Leben.
Oder?
»Nichts als Aberglaube, wenn Sie mich fragen.« Der Salooner stellt ihm ungefragt ein Glas hin und schenkte ein. »Das Leben hier draußen ist oft nicht leicht. Das Schicksal schlägt unverhofft zu und reißt Lücken in die Familien. Bei guten Menschen, die das nicht verdienen. Da fragt man sich vergebens nach dem Wieso. Also schieben die Leute es auf übernatürliche Kräfte. So ist der Mensch nun mal. Er sucht für alles eine Erklärung.« Der kleine, drahtige Mann zuckte mit den Achseln.
Lassiter ließ sein Glas stehen, denn er war mehr an Antworten interessiert als am Alkohol. »Glauben Sie, an den Geschichten über die Horde ist etwas dran?«
»Sie bringen Tod und Verderben. So viel steht fest. Aber ich glaube nicht, dass die Hölle sie ausgespuckt hat. Nein, Mister, das sind Menschen aus Fleisch und Blut.«
»Und die Knochenfratzen? Wie erklären Sie die?«
»Das kann ich nicht. Hab' die Kerle noch nicht gesehen und bin auch nicht scharf drauf. Wenn Sie mich fragen, gaukelt die Panik ihren Opfern etwas vor.«
»Womöglich. Haben Sie eine Idee, woher die Banditen kommen?«
»Von überall und nirgends.« Der Salooner rieb sich bedächtig den Bart. »Sie tauchen auf, richten Unheil an und sind mit dem nächsten Wimpernschlag wieder verschwunden. Niemand kennt ihren Unterschlupf. Niemand.«
Das stimmte leider. Nach allem, was Lassiter wusste, trieben die Banditen ihr Unwesen in den Bergen. Sie überfielen Kutschen und Transporte. Blitzschnell schlugen sie zu und ließen niemanden am Leben. Weder Männer noch Frauen oder Kinder. Offiziell gingen mehr als ein Dutzend Überfälle auf ihr Konto, aber es war gut möglich, dass es weitaus mehr waren, von denen nur noch niemand erfahren hatte.
Bislang gab es keinen Hinweis auf ihren Unterschlupf oder ihre Identität. Scharen von Sternträgern waren hinter ihnen her, tappten jedoch weiterhin im Dunkeln. Aus diesem Grund hatte die Brigade Sieben Lassiter geschickt, um die Horde aufzuspüren und ihrem Treiben ein Ende zu setzen.
Es sollte endlich wieder Ruhe im Territorium einkehren.
Doch der große Mann hatte die Berge bislang vergeblich durchkämmt. Die Banditen waren einfach nicht zu fassen.
Sein ramponiertes Äußeres verriet, dass mehrere Wochen in der Wildnis hinter ihm lagen. Sein Lederanzug sah reichlich mitgenommen aus. Außerdem hätten ihm eine Rasur und ein Bad nicht geschadet. Doch das musste hinter seiner Suche nach Antworten zurückstehen. Zuerst einmal wollte er herausfinden, ob irgendjemand in Little Creek etwas über die Horde wusste.
»Der alte Jeremiah hat sie angeblich gesehen«, entsann sich der Salooner. »Ich weiß nicht, ob wirklich etwas dran ist, aber es würde einiges erklären.«
»Wo finde ich diesen Mann?«
»Jeremiah Nickleberry? Er wohnt in einer Hütte unten am Fluss. Laufen Sie einfach an der Wassermühle vorbei. Von dort sind es noch etwa hundert Yards. Können Sie gar nicht verfehlen. Ich sage es Ihnen aber gleich: Sie werden nicht viel von ihm erfahren. Seitdem Jeremiah die Horde gesehen hat, hängen bei ihm nicht mehr alle Kerzen am Kronleuchter, wenn Sie verstehen.« Der Wirt machte eine kreisende Bewegung mit einem Finger neben seiner Schläfe. »Der arme Kerl geht allmählich vor die Hunde.«
»Ich werde ihn trotzdem aufsuchen.« Lassiter leerte sein Glas und legte eine Münze auf den Tresen.
Unvermittelt bat eine raue Stimme: »Darf ich mich anschließen?«
Sie gehörte einem Mann, der ein sauberes Hemd, dunkle Hosen und eine schwarze Weste trug. Aus seiner Tasche ragte eine Uhrenkette. Sein graumelierter Bart war ordentlich gestutzt und er schaute hinter einer runden Brille in die Welt. Sein Blick war prüfend, aber durchaus nicht unfreundlich.
»Ich bin Joseph Quinn«, stellte er sich vor. »Ich wollte nicht lauschen, aber ich kam nicht umhin, Ihrer Unterhaltung zu folgen.« Er schaute flüchtig auf seinen geleerten Suppenteller, ehe er den Blick wieder auf Lassiter richtete. »Der bedauernswerte Mr. Nickleberry scheint mir einen Schock erlitten zu haben, von dem er sich noch nicht erholt hat. Ich kenne einen Arzt, der ihm vielleicht helfen kann. Er hat auch meiner Tochter geholfen. Das arme Mädchen hat nach dem Tod meiner Frau monatelang kein Wort gesprochen, aber der Arzt wusste Rat. Womöglich kann er auch etwas für Mr. Nickleberry tun.«
»Sind Sie hier aus der Gegend, Mr. Quinn?«
»Nein, ich bin nur geschäftlich hier. Ich betreibe eine Mine oben in Cedaredge. Dort beschäftige ich auch einen Arzt, der sich um meine Arbeiter kümmert. Wenn sich Mr. Nickleberry entschließt, ihn aufzusuchen, könnte er ihm vielleicht Linderung verschaffen. Mich dauert sein Zustand, deshalb würde ich es ihm gern anbieten.«
Es waren weniger die Worte des anderen Mannes, als vielmehr die Wärme in seiner Stimme, die Lassiter davon überzeugte, dass er es ehrlich meinte. Joseph Quinn wollte helfen, und dagegen ließ sich nun wirklich nichts sagen. Aus diesem Grund hatte er nichts dagegen einzuwenden, von dem Miner begleitet zu werden.
Sie verließen den Saloon gemeinsam, wandten sich dem Fluss und der Mühle zu und stießen wenig später auf eine Hütte, die diesen Namen kaum mehr verdiente. Aus groben Brettern war sie zusammengezimmert, und so windschief, dass der nächste Sturm ihr sicherlich den Garaus machen würde. Teile des Dachs fehlten bereits. Wie es aussah, waren sie nicht die ersten Besucher, die Mr. Nickleberry an diesem Tag aufsuchten. Von drinnen drang bereits eine harsche Stimme.
»... hab' allmählich genug davon, meinem Geld hinterherzulaufen. Du hast inzwischen genug Schulden bei mir angehäuft, um einen Krieg zu finanzieren.«
Undeutliches Murmeln beantwortete die Vorwürfe.
»... es reicht! Du verschwindest von hier! Hast du mich verstanden? Und das, was von deinem Krempel noch brauchbar ist, werde ich als Entschädigung behalten!«
Drinnen polterte etwas.
Dann war ein gedämpfter Wehlaut zu vernehmen.
Lassiter runzelte die Stirn und brachte die letzten Yards mit zwei, drei langen Schritten hinter sich. Er sprang die beiden Stufen mit einem Satz hinauf und stieß die Tür der Hütte auf, ohne sich die Zeit zum Anklopfen zu nehmen. Drinnen beugte sich ein Mann soeben über einen zweiten, der auf dem Boden lag und abwehrend die Arme hochriss. Er zitterte am ganzen Körper. Sein Angreifer hatte die Rechte zur Faust geballt und drohte sie jeden Augenblick auf ihn niederfahren zu lassen.
Lassiter packte sein Handgelenk und warnte: »Das würde ich bleiben lassen!«
»Was mischen Sie sich hier ein?« Der Fremde fuhr zu ihm herum und starrte ihn grimmig an. Spucke flog von seinen fleischigen Lippen, als er schnaubte: »Ich war lange genug geduldig. Der Mistkerl hat in meinem Laden auf Pump eingekauft, aber nun ist es genug. Ich will mein Geld, und wenn er nicht zahlen kann, ist das nicht mein Problem.«
»Glauben Sie etwa, ihm fallen die Münzen aus dem Hintern, wenn Sie auf ihn einprügeln?«
»Ganz sicher nicht, aber eine Lektion wird es ihm sein. Ich bin im Recht, das müssen Sie doch einsehen!«
Lassiter hielt das Handgelenk des anderen Mannes weiterhin fest, während er den Blick durch die Hütte schweifen ließ. Zu behaupten, dass die Einrichtung armselig war, wäre geprahlt gewesen. Staub lag auf den wenigen Möbelstücken. Dem Tisch fehlte ein Bein, das mit aufgestapeltem Moos und Erde ersetzt worden war. Darauf lag ein Kanten von etwas, das einmal Brot gewesen sein mochte, jetzt jedoch grünlich vermodert war. Dass es auf einem Teller lag, ließ befürchten, dass der Besitzer der Hütte es noch essen wollte.
Die Wände der Hütte waren mit grässlichen Fratzen bemalt. Knochige Schädel... Skelettierte Pferde, unter deren Hufen Flammen aufstoben... Unter die Zeichnungen waren Worte gekritzelt, die keinen Sinn zu ergeben schienen.
»Armer Teufel«, murmelte Joseph Quinn, als er die Hütte betrat. In der Tat schien der Mann, der hier lebte, von inneren Dämonen verfolgt zu werden.
»Lassen Sie es gut sein«, mahnte Lassiter und ließ den Ladenbesitzer los.
Der stieß einen wütenden Laut aus, ließ seinen Arm jedoch sinken, ohne noch einen Schlag zu führen.
»Wie viel schuldet Ihnen Mr. Nickleberry, Sir?« Joseph Quinn zog eine schwarze Ledermappe aus der Innentasche seiner Weste und beglich den Betrag, den ihm der Owner nannte, ohne mit der Wimper zu zucken.
Grollend zog sich der Ladenbesitzer aus der Hütte zurück.
Krachend schlug die Tür hinter ihm zu.
Lassiter streckte dem Mann am Boden die Hand hin und half ihm beim Aufstehen.
Jeremiah Nickleberry schlurfte zum Fenster, ließ sich auf einen Hocker sinken und starrte hinaus, während er undeutlich vor sich hin brabbelte.
Lassiter stellte ihm einige Fragen, bekam jedoch nur undeutliches Murmeln zurück.
Nach einer Weile gab er es auf.
Joseph Quinn zog seinen Hut vom Kopf und fuhr sich mit der Hand über die Stirn. »Ich bezweifle, dass er imstande ist, Ihnen verwertbare Antworten zu geben.«
»Nein, das stimmt wohl.«
»Ich werde ihn mit nach Cedaredge nehmen und meinen Arzt bitten, für ihn zu tun, was menschenmöglich ist. Vielleicht... in ein paar Wochen oder Monaten... geht es ihm gut genug, dass Sie mit ihm reden können.«
»So viel Zeit habe ich leider nicht. Die Banditen haben lange genug Tod und Verderben gebracht. Ich werde mich anderswo nach ihnen umhören müssen.«
Der Miner zog die Stirn in Falten. »Reiten Sie für das Gesetz?«
»So was ähnliches.«
»Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg.«
»Den wünsche ich Ihnen auch, Mr. Quinn.« Lassiter reichte dem Miner die Hand. »Es ist aller Ehren wert, dass Sie Mr. Nickleberry helfen wollen.«
»Ich tue nur, was nötig ist. Und ich hoffe, Sie können diesen Banditen das Handwerk legen. Es würde mich interessieren, wie die Sache ausgeht. Vielleicht begegnen wir uns einmal wieder. Es heißt doch, man sieht sich immer zweimal im Leben, nicht wahr?«
»So heißt es«, stimmte Lassiter ihm zu.
Tatsächlich sollten sie sich wenige Monate später wiedertreffen. Doch die Umstände, unter denen das geschah, hätten sie sich beide nicht träumen lassen...
✰
»Still! Hast du das gehört?« Timmy hob den Kopf und lauschte.
Der Wind flüsterte in den verschneiten Wipfeln der Kiefern. Doch das war nicht das einzige Geräusch, das die winterliche Stille durchbrach. Nein, von fern wehte das Stampfen von Hufen heran. »Hörst du!« Er zupfte am Ärmel seines Bruders. »Pferde!«
Tobias wirkte vollkommen unbeeindruckt. »Das wird die Postkutsche sein.«
»Ist das nicht zu früh für den alten Selwyn und seine Fuhre?«
»Schon möglich. Vielleicht hat er seinen Tieren die Peitsche gegeben, um vor dem Sturm daheim zu sein. Komm schon. Lass uns hier fertigwerden und heimgehen, ehe uns hier draußen die Zehen abfrieren.«
»Ich glaube, das sind sie schon.« Timmy versuchte, in seinen Stiefeln mit den Zehen zu wackeln, aber er hatte kein Gefühl mehr in den Füßen. Die Stiefel waren von seinem Vater und viel zu groß für ihn. Er hatte seine Füße mit Stofffetzen umwickelt. Trotzdem schlackerte er beim Gehen in den Stiefeln herum.
Seinen Schal höher über Mund und Nase ziehend, wandte er sich um und bückte sich nach einem Ast, der sich zum Verfeuern eignen würde.
Plötzlich traf ihn etwas zwischen den Schulterblättern.
»Hey!« Der Schrecken fuhr ihm in alle Glieder. Er wirbelte herum und starrte in das grinsende Gesicht seines Bruders.
»Erwischt!« Tobias formte bereits einen weiteren Schneeball.
»Na warte!« Timmy raffte rasch eine Handvoll Schnee zusammen, presste ihn zwischen seinen Händen, holte aus und warf.
Sein Bruder duckte sich blitzschnell.
Der Schneeball schoss an seinem rechten Ohr vorbei und traf klatschend auf den wuchtigen Stamm einer Kiefer. Eine Krähe flog krächzend aus dem Wipfel auf und flatterte davon.
»Genug jetzt«, mahnte Tobias, als sich Timmy nach einem weiteren Schneeball bückte. Er ließ sein Geschoss fallen. »Wir sollten wirklich weitermachen. Pa wird uns etwas erzählen, wenn wir zu spät heimkommen.«
Das stimmte. Trotzdem wurmte es Timmy, dass sich sein Bruder gern älter und reifer gab, obwohl er nur eine Viertelstunde älter war als er selbst. Doch er hatte gelernt, dass sich manche Dinge eben nicht ändern ließen, und so machte er sich nun eilends daran, genügend Feuerholz zu sammeln, um ihren Schlitten zu beladen.
Wolken zogen über ihren Köpfen von Westen heran. Die Luft war bitterkalt und barg das Versprechen auf weitere, starke Schneefälle. Es wurde zusehends dunkel. Tatsächlich war es höchste Zeit für sie, heimzukehren.
Timmy zog den Schlitten hinter sich her, als sie tiefer in den Wald stapften.
Da war es wieder, das ferne Stampfen von Pferdehufen. Ein Schauer rieselte ihm den Rücken hinunter, und der hatte nichts mit der Kälte zu tun.
»Was ist?« Sein Bruder sah ihn von der Seite an.
»Was ist, wenn die Pferde zu den unheimlichen Reitern gehören, die die Berge heimsuchen?«
»Du meinst die wilde Horde?«
»Es heißt, sie wären keine Menschen. Ihre Gesichter seien knochige Totenfratzen. Aber so etwas gibt es nicht.« Timmy schluckte, bevor er zaghaft fragte. »Oder?«
»Wer weiß.« Sein Bruder zog den Kopf zwischen die Schultern und blickte sich um, bevor er die Stimme senkte und raunte: »Ich glaube, ich höre sie kommen!«
»Was?« Timmy machte vor Schreck einen Satz nach hinten und stieß mit der Wade gegen den Schlitten.
»Oh, du solltest dein Gesicht sehen!« Sein Bruder lachte und richtete sich wieder zu voller Größe auf. »Das war nur 'n Witz. Ehrlich. Mach dir keine Gedanken um diese Horde. Das ist nur eine Spukgeschichte, wie sie der alte Clarence erzählt, wenn er zu viel von seinem Selbstgebrannten intus hat. Weiter nichts.«
»Bist du sicher?«
»Sicher bin ich sicher.«
»Und wenn es sie nun doch gibt?«
»Dann würde Marshal Davis ihnen schon heimleuchten.« Tobias blieb stehen und bückte sich nach ein paar Ästen, die er ebenfalls auf den Schlitten lud. »Schätze, wir haben genug gesammelt. Lass uns heimgehen.«
»Warte!«
»Was ist denn noch?«
»Wir haben noch keinen Christklotz gefunden.«
»Brauchen wir auch nicht.«
»Aber sicher brauchen wir einen.«
»Pa würde uns das Ding eher an den Kopf werfen, als es anzuzünden.«
»Würde er nicht.« Timmy schob die Unterlippe vor, als ihm sein Bruder einen bedeutungsvollen Blick zuwarf. »Na schön, würde er vielleicht doch, aber darauf sollten wir es ankommen lassen.«
»Kleiner...« Sein Bruder stieß hörbar den Atem aus. Der stieg in weißen Schwaden vor seinem von der Kälte geröteten Gesicht auf. »Das ist 'ne blöde Idee.«
»Ist es nicht.«
»Wofür soll das überhaupt gut sein?«
»Es ist eben Brauch, einen geweihten Holzklotz an Heiligabend in den Kamin zu legen. Ma hat unseren Pa immer nach einem Weihnachtsscheit in den Wald geschickt, selbst wenn es geschneit und gestürmt hat und er eigentlich nicht gehen wollte. Weißt du nicht mehr?«
»Freilich weiß ich das noch. Ich weiß auch noch, wie er immer geschimpft hat, aber dann hat er Ma umarmt und geküsst und sie haben richtig froh ausgesehen.« Tobias schaute über Timmys Kopf hinweg und schien ihn eine Weile gar nicht zu sehen. Seine Augen schimmerten mit einem Mal verräterisch.
Auch Timmys Augen brannten plötzlich. Er wischte sich mit einer Hand darüber. »Es bringt Glück, wenn der Weihnachtsscheit während der Raunächte brennt. Die Asche streut man auf die Felder und füttert die Tiere damit. Und einen Rest bewahrt man über das Jahr auf. Wir könnten eine kleine Kiste bauen und welche für unseren Pa hineintun. Er könnte 'n bisschen Glück gebrauchen, meinst du nicht?«
»Da ist schon was dran.«
»Also machen wir es?«
»Ich weiß nicht. Pa wird das nicht gefallen. Seitdem Ma nicht mehr da ist, mag er gar nichts von Weihnachten hören.«
Das wusste Timmy nur zu gut. Düster war es daheim. An Weihnachten gab es bei ihnen keine Geschenke, keine Lieder und auch kein festliches Essen. Nein, während der Feiertage saß ihr Vater sturzbetrunken in seinem Sessel und durfte nicht gestört werden. Während andere Familien zusammen fröhlich waren, hockten Timmy und Tobias in ihrer Kammer und wagten nicht, ein lautes Geräusch zu machen. »Bitte, lass es uns versuchen. Schlimmer kann es kaum noch werden, oder?«
Dagegen konnte sein Bruder nichts einwenden.
»Na schön. Meinetwegen.« Tobias schaute sich um und streckte den Arm aus. »Nehmen wir den da drüben.«
»Der geht aber nicht.«
»Warum denn nicht?«
»Weil der Christscheit aus Eichen- oder Eschenholz sein muss.«
»Herrje.« Sein Bruder brummte etwas, das sich wie: »Das auch noch!«, anhörte. Dann setzte er sich in Bewegung und stapfte weiter.
Timmy folgte ihm, den Schlitten hinter sich her ziehend.
Plötzlich sprang vor ihnen ein Tier mit glattem braunem Fell zwischen den verschneiten Büschen hervor und fletschte seine Zähne. Im ersten Moment glaubte Timmy, einen Wolf vor sich zu haben, aber dann erkannte er seinen Irrtum. Ein Hund war es, aber was für einer! Kräftige, kurze Beine stemmte er in den Schnee. Sein Schädel war rund und gedrungen und seine Zähne sahen aus, als könnte er einen Christscheit mühelos mittendurch beißen.
Wenn der sie anfiel... Timmy ließ vor lauter Schreck die Leine des Schlittens los. Sein Herz machte einen schmerzhaften Satz in seiner Brust.
Bevor er etwas sagen oder tun konnte, brach ein Reiter zwischen den Bäumen hervor. Ganz in Schwarz war er gekleidet – vom Hut über den Staubmantel bis zu seinen Stiefeln. Er hielt ein Gewehr im Anschlag und lenkte sein Reittier anscheinend mit seinen Oberschenkeln. Sein Finger am Abzug krümmte sich. Ein Schuss zerriss die winterliche Stille und jagte einen Vogelschwarm kreischend gen Himmel. Das Geschoss fetzte Späne von dem Stamm einer verschneiten Kiefer, die keine Armlänge von Timmy entfernt stand.
Der Hund wirbelte herum und stürmte mit langen Sätzen davon.