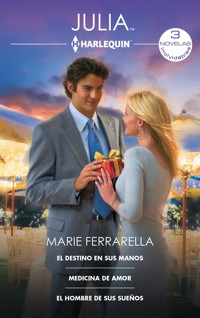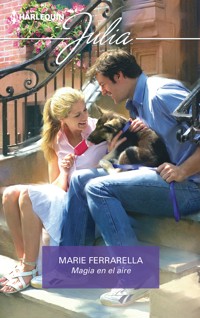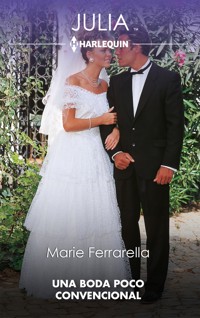2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Kritisch mustert Lisa den neuen Helfer. Die junge Lehrerin arbeitet freiwillig in einer sozialen Einrichtung, und man hat ihr Ian Malone unterstellt, der hier seine Sozialstunden ableisten muss. Ihr Urteil fällt rasch: ein attraktiver reicher Faulpelz ohne Verantwortungsgefühl. Abneigung auf den ersten Blick. Erst beim zweiten Blick sieht sie, wie respektvoll und einfühlsam er mit den Ärmsten der Armen umgeht - und ist rettungslos verloren. Beim dritten Blick ist es schon Liebe. Doch gerade als sie glaubt, Ian wirklich zu kennen, erlebt Lisa eine weitere Überraschung …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Ähnliche
Marie Ferrarella
Liebe auf den dritten Blick
IMPRESSUM
BIANCA erscheint im CORA Verlag GmbH & Co. KG, 20350 Hamburg, Axel-Springer-Platz 1
© 2007 by Marie Rydzynski-Ferrarella Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V., Amsterdam
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe BIANCABand 1664 2009 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg Übersetzung: Ines Schubert
Fotos: Polka Dot / Jupiter Images
Veröffentlicht im ePub Format im 12/2010 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-86295-343-1
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Führung in Lesezirkeln nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte übernimmt der Verlag keine Haftung. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
1. KAPITEL
Als Ian Malone erkannte, dass die Finsternis um ihn herum von seinen geschlossenen Augen herrührte, bemühte er sich, sie zu öffnen.
Die Welt war unscharf und verschwommen, wurde aber mit jeder Minute klarer. Es war wirklich Nacht, und statt der dumpfen Bewusstlosigkeit, in die er bis eben noch abgetaucht war, umgab ihn jetzt vertraute, natürliche Dunkelheit – und frische Nachtluft.
Er lebte noch. Verdammt.
Allmählich nahm seine Umgebung Form an, und bruchstückweise kam auch die Erinnerung wieder. Seine Hände umklammerten nicht mehr das Lenkrad. Ja, er befand sich überhaupt nicht mehr in seinem Wagen.
Von irgendwo drang das entnervende, ewige Zirpen der Grillen an sein Ohr, Grillen auf Brautschau, auf der Suche nach einer Familie.
Viel Glück, Freunde, dachte er sarkastisch.
Als er versuchte, den Kopf zu heben, entfuhr ihm ein Stöhnen, und er ließ sich wieder nach hinten sinken.
Jetzt wurde ihm auch bewusst, dass er nicht allein war. Jemand stand über ihn gebeugt und atmete schwer, ja, röchelte geradezu. Wie Darth Vader, der Unhold aus „Star Wars“, persönlich. Oder war der Sensenmann gekommen, um ihn endlich mitzunehmen?
„Ich bin nicht tot, oder?“, brachte er mühsam hervor, wobei die Anstrengung ihm das nächste Stöhnen entlockte.
Die Gestalt beugte sich noch etwas näher zu ihm herab, und Ian blickte in ein müdes, ungehaltenes Gesicht, aus dem ihn zwei Augen vorwurfsvoll anfunkelten. Darunter erkannte er eine Uniform. Natürlich, die Polizei. Früher oder später erschien an einem Unfalloder Unglücksort immer die Polizei.
Und manchmal kommt sie zu spät, dachte Ian. Wie damals.
Der Uniformierte schüttelte unwirsch den Kopf. „Nein, Sie sind nicht tot“, bemerkte er. „Vielleicht klappt’s ja beim nächsten Mal.“
Ian wollte lachen, aber es wurde nur ein schwaches Keuchen daraus.
Der Polizist hatte sich aufgerichtet, beide Hände in die Seiten gestützt und musterte das Autowrack an dem Baum. Dann nahm er seine Kappe ab und kratzte sich nachdenklich die Halbglatze.
Ians Porsche hatte sich wie zu einem ewigen Walzer um einen Korallenbaum geschlungen.
„Man sollte meinen, jemand, der sich so einen schicken Wagen leisten kann, hätte mehr Grips im Kopf, als nach einer Flasche Johnnie Walker durch die Gegend zu rasen“, äußerte der Beamte unwirsch.
Nein, kein Whisky, dachte Ian. Whisky war das Lieblingsrauschmittel seines Großvaters gewesen. Er selbst zog andere vor.
„Es war Wodka“, verbesserte er heiser. „Und nicht genug, um mich in diese Lage zu bringen.“
Vermutlich lag es an den Medikamenten. Vielleicht war er ein wenig achtlos gewesen und hatte ein paar Beruhigungspillen zu viel geschluckt, heutzutage gab es ja Pillen gegen alles. Nur nicht gegen das Schuldgefühl, das ihn an Tagen wie heute bei jedem Atemzug begleitete.
Weil er noch atmete und sie nicht mehr. Bruce. Donna. Brenda.
Mit einer gewaltigen Kraftanstrengung stützte Ian sich auf die Ellbogen und hievte sich in dem nassen Gras in eine halb sitzende Position.
Vor seinen Augen tanzten Sterne in allen Farben, die sich im nächsten Moment mit plötzlicher Finsternis abwechselten. Er hätte nicht sagen können, was lästiger war, das ganze bunte Flimmern oder die Schwärze, von beidem jedenfalls wurde ihm scheußlich schwindlig.
Mit zittrigen Fingern tastete er nach seiner Stirn und fühlte etwas Dickes, Klebriges. Als er sich die Hand vor die Augen hielt, sah er das Blut.
Blut.
Brenda, nicht sterben! Bitte, nicht sterben! Lass mich nicht zurück. Bitte!
Quälend hallte die schrille, panische Kinderstimme – seine eigene – in seinem Schädel wider, und mit ungeheurer Willensanstrengung knipste er die Stimme einfach aus.
Ian hob den Blick ein wenig und musterte wieder den Beamten. Das dunkelblaue Hemd des Mannes spannte sich über dem umfangreichen Bauch, und Ian stellte fest, dass der dritte Knopf von oben kurz vor dem Abspringen war.
Als auch die weitere Umgebung in sein Blickfeld rückte, kam die Erinnerung an den Abend wieder. Er war durch die verlassenen Straßen hinter dem Universitäts-Campus gefahren. Die menschenleere Route hatte er absichtlich genommen, denn trotz seiner Verzweifung und dem betäubenden Cocktail in seinen Adern war er klar genug gewesen, dass er niemand anders in Gefahr bringen wollte.
Irgendwann hatte es ihn einfach überkommen, er hatte das Lenkrad herumgerissen, die Straße verlassen, und dann war der Baum aus dem Nichts auf ihn zugeschossen.
Jetzt spürte er allmählich, wie die Feuchtigkeit aus dem nassen Gras in seine Kleider kroch. Wie spät mochte es sein? Drei? Vier?
„Haben Sie mich rausgezogen?“, fragte er den Beamten mühsam.
Der Mann schüttelte den Kopf. „Sie waren schon draußen. Vielleicht sind Sie allein rausgekrabbelt.“ Mit einem schwachen Grinsen fügte er noch hinzu: „Sieht so aus, als wollte doch etwas in Ihnen weiterleben.“
„Nicht, dass ich wüsste“, murmelte Ian.
Er stemmte die Hände ins Gras und versuchte, sich ganz aufzurichten, wogegen sein Körper jedoch sofort protestierte.
„Wieso bleiben Sie nicht liegen?“, sagte der Beamte. Es war mehr Befehl als Vorschlag. „Ich habe einen weiteren Wagen angefordert.“
Da seine Muskeln und Knochen sich anfühlten wie Wackelpudding, blieb Ian brav liegen, wo er war, und kommentierte nur mit einem zynischen Lächeln: „Verstärkung? Ich werde mich der Verhaftung nicht widersetzen.“ Selbst wenn er wollte, hätte er das gar nicht gekonnt.
„Für einen Betrunkenen klingen Sie ganz schön klar“, äußerte der Beamte.
„Übungssache“, gab Ian zurück.
In Wahrheit hatte er viel mehr Pillen als Alkohol im Blut, und vielleicht war er in diesem Zustand wirklich ein bisschen gefährlich. Normalerweise gelang es ihm, die Erinnerungen zu verdrängen und irgendwie weiterzumachen. Aber heute hatte der Schmerz die Oberhand gewonnen, und er wollte ihn nur noch loswerden.
Nicht weit entfernt stand eine Straßenlaterne, und jetzt konnte er das Gesicht des Polizisten in allen Einzelheiten studieren.
„Denken Sie, Sie sind unsterblich?“, spottete der Beamte.
„Ich hoffe nicht“, entgegnete Ian ruhig und merkte zufrieden, dass er den Mann allmählich aus der Fassung brachte.
„Hören Sie mal mit dem verdammten Grinsen auf“, befahl der Beamte prompt. „Wir haben unsere Vorschriften.“
Ian gab den Versuch, auf die Beine zu kommen, endgültig auf. Er musste warten, bis sein Körper ihm wieder gehorchte und sein Kopf aufhörte, mit ihm Karussell zu fahren.
Er brachte noch ein kurzes Lachen zustande. „Nichts gegen Ihre Vorschriften …“
Dann verschluckte ihn wieder ein schwarzer Abgrund.
„Was zum Teufel hast du dir bloß dabei gedacht?“, fragte Marcus Wyman, Ians Anwalt und Freund. Man hörte ihm die Sorge und den Ärger an.
Die Frage schwebte in dem kahlen Raum der Polizeiwache, in dem die Anwälte mit ihren Klienten unter vier Augen sprechen durften, während draußen ein Wachmann stand und die Minuten zählte.
Ian lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und schaukelte lässig auf den beiden hinteren Stuhlbeinen. Er saß am anderen Ende des rechteckigen Tisches, wandte seinem Anwalt halb den Rücken zu und starrte aus dem Fenster.
Es war heller Nachmittag, und von der letzten Nacht war ihm nur ein großes Pfaster auf der Platzwunde an der Stirn und ein dumpfes, fernes Dröhnen im Kopf geblieben. Ziemlich unglaublich eigentlich, wenn man es genau bedachte.
„Ich habe versucht, nicht zu denken“, bemerkte er endlich ausdruckslos.
Marcus war ein kleiner, stämmiger Mann mit der Angewohnheit, sich beim Nachdenken ständig die Brust zu reiben. Jetzt wanderte er mechanisch in dem kleinen Raum auf und ab, während sich seine Gedanken, wie üblich, Schritt für Schritt zu einem logischen Ganzen fügten.
Mit seinen zweiunddreißig Jahren hatte Marcus nur ein Jahr mehr auf dem Buckel als Ian, wirkte aber mit seinen schon leicht angegrauten Schläfen und dem immer etwas nachdenklichen Gesichtsausdruck um einiges älter.
Die beiden Männer kannten sich seit fast zwanzig Jahren, und Marcus betrachtete sich gern als Ians einzigen echten Freund, auch wenn man in jeder längeren Reportage lesen konnte, dass Ian Malone – alias B.D. Brendan, Bestsellerautor von fünfzehn Science-Fiction-Romanen – über Heerscharen von Freunden verfügte.
Ians dunkle, gut aussehende Erscheinung, sein Ruf als Draufgänger und sein rasiermesserscharfer Verstand und Witz faszinierten die Menschen, besonders Frauen. Wo immer er auftauchte, zog Ian Malone die Mengen magisch an, doch tief in seinem Herzen war er sehr einsam.
Marcus wusste, dass Ian sich insgeheim für etwas bestrafte, woran er völlig unschuldig gewesen war und das sein ganzes Leben aus der Bahn geworfen hatte. Zwanzig Jahre zuvor waren Ians Eltern und seine Schwester bei einem Erdbeben ums Leben gekommen. Der zehnjährige Ian hatte mit ihnen in einem verschütteten Wagen gesessen und als Einziger überlebt. Das Trauma war er niemals losgeworden, genau wie die quälende Frage, warum seine Familie tot war und er lebte.
Bei allem Mitgefühl und Verständnis hätte Marcus den um einiges höher gewachsenen Ian manchmal jedoch gern bei den Schultern gepackt und wachgerüttelt. Heute war es einmal wieder so weit.
Um fünf heute Morgen hatte ihn ein Anruf aus dem städtischen Gefängnis unsanft aus dem schönsten Schlummer geholt. Und seitdem hatte Marcus sich ins Zeug gelegt und versucht zu retten, was zu retten war.
„Ich musste einige Strippen ziehen, aber ich glaube, wir haben geschafft, dass es nicht in die Presse kommt“, erklärte er und starrte dabei erbittert auf Ians Hinterkopf.
In seiner Sorge um Ian hatte er es heute Morgen so eilig gehabt, aus dem Haus zu kommen, dass er seine Frau angeblafft hatte und ohne Frühstück losgezogen war. Beides hob seine Stimmung auch nicht gerade.
Bei Trunkenheit am Steuer kannten die Gerichte keine Gnade, deshalb drohte Ian sogar eine Gefängnisstrafe. Wenn jedoch alles nach Plan ging, konnten sie möglicherweise mit ein paar Wochen gemeinnütziger Arbeit davonkommen.
„Ian, hörst du mir überhaupt zu?“
Ian rührte sich nicht, sondern sah nur weiter abwesend aus dem Fenster. „Weißt du, was gestern für ein Tag war?“, fragte er irgendwann plötzlich.
Seufzend fuhr Marcus sich durch das glatte, kurze Haar. „Der Tag, an dem du deinen Porsche zu Schrott gefahren hast?“, antwortete er versuchsweise.
„Nein“, entgegnete Ian. „Der einundzwanzigste Jahrestag.“
Marcus erstarrte. „Das habe ich vergessen“, gestand er.
Ian atmete tief aus, und die kleine, warme Atemwolke beschlug die Fensterscheibe. „Ich nicht“, bemerkte er leise.
Mit ein paar Schritten war Marcus bei seinem Freund und legte ihm die Hand auf die Schulter. Wenn er daran gedacht hätte, hätte er versucht, den Tag mit Ian zu verbringen, denn er wusste, wozu Ian in seinen dunklen Momenten fähig war.
Marcus Wyman war ein gütiger, mitfühlender Mann und echter Freund. Manchmal hatte er etwas von einem Teddybären an sich, und außer Ians Großeltern war er der Einzige, der die traurige Familiengeschichte kannte.
„Ian“, begann Marcus sanft. „Irgendwann musst du mal loslassen. Einundzwanzig Jahre sind eine lange Zeit.“
Ian zuckte mit der Schulter, und Marcus musste seine Hand fallen lassen.
Marcus unterdrückte einen Seufzer. „Hör zu, es war, Gott sei Dank, das erste Mal …“ Er wollte gar nicht wissen, ob es schon ähnliche Gelegenheiten gegeben hatte, bei denen man seinen Freund nur nicht erwischt hatte. Was er nicht wusste, konnte ihm zumindest nicht den Schlaf rauben.
Ian wich Marcus’ Blick aus. Der vergangene Abend bedeutete einen Riss in seiner sorgsamen Fassade, und das beunruhigte ihn. Noch nie war er in jenem Zustand Auto gefahren. Wenn das Bedürfnis, die Welt zu vergessen, ihn überwältigte, hatte er den Schmerz sonst immer in den eigenen vier Wänden betäubt, allein und weit weg von neugierigen Blicken.
Marcus bemerkte: „Man kann an so etwas arbeiten, glaube ich.“ Er wollte einen Klinikaufenthalt oder einen Psychiater vorschlagen, aber er wusste, dass er Ian mit solchen Vorschlägen nicht erreichte. Weil Ian nicht eingestehen konnte, welche Schwäche sich unter seinem glänzenden Panzer verbarg.
„Wir haben eine vernünftige Richterin erwischt, Sally Houghton, eher der mütterliche Typ“, sagte der Anwalt deshalb nur. „Also bring dich in Ordnung, zeig Zerknirschung und denk daran, ihr dein berühmtes TausendWattLächeln zu schenken.“
Mit einem klick schloss er seinen Aktenkoffer und äußerte: „Dein Schutzengel scheint ja immer noch ganz schön auf Draht zu sein.“
Zu Marcus’ Erleichterung wandte Ian sich jetzt endlich vom Fenster ab, sah ihn an und ließ den Hauch eines Lächelns erkennen. Es war dieses Lächeln, das auf fünfzig Schritt jeden Stein erweichen und auf zehn Schritte die Herzen hartgesottener Richterinnen zum Schmelzen bringen konnte. Seine Chancen stehen gut, dachte Marcus. Denn Ian hatte einen magischen Charme, wenn er nicht gerade mit den Geistern seiner Vergangenheit kämpfte.
Vielleicht ist die ganze Sache sogar zu etwas nütze, überlegte Marcus noch, als er sich von Ian verabschiedet hatte und dem Wärter ein Zeichen gab, ihn hinauszulassen. Vielleicht begann Ian ja jetzt endlich zu leben.
2. KAPITEL
Manchmal fragte sich Lisa Kittridge, warum sie nun schon seit anderthalb Jahren Woche für Woche ihre Nachmittage im Obdachlosenheim ‚Providence Shelter‘ verbrachte, ohne dass jemand sie dazu gezwungen hätte.
Denn es war ja nicht so, dass sie nicht wusste, wohin mit ihrer Zeit. Im Gegenteil, ihre Tage waren minutiös durchgeplant, um den Alltag mit einunddreißig quirligen Drittklässlern, ihrem fünfjährigen Sohn und ihrer bei ihnen lebenden Mutter unter einen Hut zu bringen.
Um ihre Mutter musste sie sich dabei nicht besonders kümmern – im Gegenteil. Susan Kittridge war eine sehr unabhängige Frau und ihr zu Hause eine große Hilfe. Nur ganz selten einmal kam es vor, dass Susan in die Vergangenheit abtauchte und für eine Weile mit der ganzen Welt haderte.
Dann war Lisa gefragt, um ihre Mutter aufzumuntern und mit dem unverwüstlichen Optimismus anzustecken, den sie selbst offenbar von Natur aus mitbekommen hatte.
Ihr Lebensmut hatte ihr auch durch ihre eigenen schweren Zeiten geholfen. Und jetzt versuchte sie, ihn mit den Leuten hier im Obdachlosenheim zu teilen und auf diese Weise ein bisschen von ihrem eigenen Glück zurückzugeben. Außerdem hinderte die Arbeit sie daran, zu viel zu grübeln. Jede Beschäftigung hielt die Gedanken an Matt fern.
Von außen betrachtet, wirkte die Arbeit im Heim nicht besonders schwierig. Vor allem Durchhaltevermögen und unerschöpfiche Energie schienen gefragt.
Aber dahinter lag so viel mehr. Hin und wieder ging Lisa das Leid, dem sie hier begegnete, so nah, dass sie es nur schwer aushielt. Manchmal verfolgten sie die Gesichter der Kinder bis in ihre Träume, und dann hätte sie am liebsten einfach die Flucht ergriffen.
Trotzdem kam sie immer wieder zurück.
Ursprünglich hatte sie in dem Heim zu helfen begonnen, weil sie diesen Menschen etwas geben wollte. Stattdessen hatte sie selbst etwas von ihnen bekommen. Sie war demütiger und dankbarer in ihrem Leben geworden. Und noch mehr dazu entschlossen, anderen zu helfen.
Gerade hatte sie mit einem Stapel frischer Wäsche einen der Schlafsäle betreten, da sah sie mitten in dem leeren Saal ein neues Gesicht. Auf einem der Feldbetten saß ein vielleicht fünfjähriges Mädchen und blickte ihr furchtsam entgegen.
Die Kleine hatte die dünnen Arme um den schmächtigen Körper geschlungen und ließ pausenlos die spindeldürren Beine baumeln.
Als Lisa nähertrat, las sie Misstrauen und Angst in den großen, grauen Augen des Kindes, und vor Mitgefühl zog sich ihr das Herz zusammen.
Das Mädchen war etwa so alt wie ihr eigener Sohn Casey, und Lisa dachte an all die kleinen Mädchen und Jungen, die wegen einer grausamen Laune des Schicksals in den Wänden eines Obdachlosenheims landeten. Es sollte kein Kind diesen Ausdruck in den Augen haben müssen!
Vorsichtig setzte sie den Wäschestapel ab und lächelte dem Mädchen zu. „Hi, wie heißt du denn?“, fragte sie freundlich.