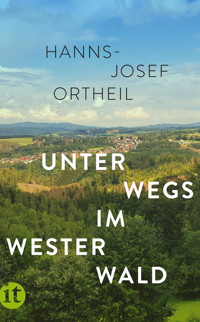9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hanns-Josef Ortheil erzählt Geschichten aus dem Leben seiner beiden Kinder Lo und Lu – von Anfang an bis zu ihren ersten Jahren in der Schule. Als Schriftsteller-Vater, der zu Hause arbeitet, ist er ein guter Beobachter und Mitspieler bei den kleinen Geschichten und Begebenheiten, in denen die Kinder die Hauptrolle spielen. Ehe er sich anfangs darüber Gedanken machen kann, wie das Alltagsleben in der größer gewordenen Familie organisiert werden soll, haben schon die Kinder die Regie im Haus übernommen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Wie sieht der Alltag eines Schriftsteller und Vaters aus, wenn »La Mamma« tagsüber in den Verlag verschwindet und Papa die beiden Kinder versorgen muss? Natürlich ist Hanns-Josef Ortheil auf gar keinen Fall »Hausmann«, sondern lediglich ein Schriftsteller, der zu Hause arbeitet und sich um die Kinder kümmert. Von den Herausforderungen des Lebens zwischen Wickelkommode und Schreibtisch erzählt Ortheil in seinen überaus vergnüglichen und selbstironischen Skizzen und Beobachtungen: Was tun, wenn man von der höchst attraktiven Verkäuferin offensichtlich ausschließlich als »Vater« wahrgenommen wird? Wie macht man der Schulärztin klar, dass die Tochter das klügste und begabteste Kind des Jahrgangs ist? Und wann kommt der Schriftsteller wieder einmal zum Arbeiten?
Von der Geburt des Sohnes Lukas bis über die ersten Schultage der Tochter Lotta hat Hanns-Josef Ortheil seine Erfahrungen aufgeschrieben. Staunend und voller Liebe begleitet er ihren Weg und entdeckt die Welt noch einmal aus der Sicht seiner Kinder. Ein wunderbares, sehr persönliches Buch über das Glück, Vater zu sein.
Autor
Hanns-Josef Ortheil wurde 1951 in Köln geboren, er lebt in Stuttgart. Er gehört zu den bedeutenden deutschen Autoren der Gegenwart, sein Werk ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Brandenburger Literaturpreis und dem Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck. Er lehrt als Professor für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim.
Hanns-Josef Ortheil
Lo und Lu
Roman eines Vaters
btb
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Genehmigte Ausgabe März 2003 by btb Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Copyright © 2001 by Luchterhand Literaturverlag, München
Umschlaggestaltung: Design Team München
Umschlagbild: Corbis/Pietro Novelli
SR Herstellung: Augustin Wiesbeck
ISBN 978-3-641-10865-6V002
www.btb-verlag.de
Das erste Mal
Heute bin ich zum ersten Mal mit Lu allein, denn am frühen Morgen kämmt La Mamma ihr schönes langes Haar, wählt die weiße Bluse und den weiten, knapp über dem Boden schwingenden Rock, legt die kleine Halskette an, greift nach ihrer schwarzen Aktentasche und verschwindet mit Lo, unserer Tochter, die gerade mal zwei Jahre alt ist. Lo wird den Vormittag bei einer Freundin verbringen, La Mamma aber wird ihr frisch gestrichenes und neu eingerichtetes Verlagsbüro mit dem blauen Fußboden beziehen und wieder mit der täglichen Verlagsarbeit beginnen. La Mamma ist Verlegerin und will es bleiben, auch wenn es neben Lo inzwischen auch Lu gibt, einen Sohn, der jetzt zwei Monate alt ist.
Lu liegt oben, im Kinderzimmer unseres Hauses, das wir nur das Gartenhaus nennen, weil es kein eigenes Haus ist, sondern ein Haus inmitten eines Gartens. Wenn man »Garten« sagt, stellt man sich darunter etwas Gebändigtes, Überschaubares vor, etwas mit schmalen Pfaden und Wegen, Rabatten und kleinen, nierenförmigen Teichen. So eine Art Garten ist unser Garten jedoch nicht, es ist vielmehr ein großes, überhaupt nicht zu bändigendes Stück Land, ein ehemaliger Weinberg, ein weites Gelände mit Obstbäumen und Wiesen, ein halber Bergrücken, hoch über der Stadt ... − aber was schreibe ich und was denke ich nach über Gärten?
Lu liegt oben, in seiner Wiege, die aus einem großen braunen Korb auf Rädern besteht, er liegt unter einem weißen Zelthimmel, von dessen Spitze ein Mobile zu ihm herab baumelt, er liegt in diesem Paradiesbett und schläft. Ich könnte die schmale Treppe zu ihm hinaufgehen, aber ich lasse das lieber, das Geräusch der knarrenden Holzstufen könnte ihn wecken.
Was aber mache ich? Ich könnte mich an meinen Schreibtisch setzen, um ein wenig zu arbeiten, aber auch das lasse ich lieber, weil ich für die Arbeit die Illusion brauche, zeitlich unbegrenzt arbeiten zu können, und weil allein der Gedanke daran, daß ich bei Lus ersten Regungen mit der Arbeit aufhören muß, das Arbeiten unmöglich macht.
Vielleicht gelingt es mir, etwas zu lesen, eine schwierige Lektüre darf es allerdings auch nicht sein, weil ich mich an diesem Morgen, an dem ich etwas aufgeregt und angespannt bin, nicht gut werde konzentrieren können. Eine leichte Lektüre also, vielleicht die Zeitung, das müßte gehen, aber als ich die Zeitung aufschlage, bemerke ich sofort, daß ich noch nie am frühen Morgen die Zeitung gelesen habe, sondern meist erst nach dem Essen am Mittag.
Die Stunde nach dem Essen am Mittag erschien mir immer als die ideale Stunde für meine Zeitungslektüre, denn am frühen Morgen möchte ich mir den Kopf nicht vollstopfen mit all den Meldungen und Kommentaren und den unterschiedlichen Themen, die sich am Mittag schon etwas gesetzt und beruhigt haben und bis zum Abend dann beinahe dramatisch altern.
Vielleicht sollte ich etwas aufräumen, in der Küche gäbe es reichlich Anlaß dazu, aber ein so frühmorgendliches Aufräumen, Wischen und Putzen würde mich sofort in die Rolle eines Hausmannes drängen. »Hausmann« ist ein schreckliches Wort, ich werde mich hüten, auch nur in die Nähe eines Hausmannsdaseins zu geraten, denn natürlich bin ich kein Hausmann, der kocht, putzt, wäscht, sondern ein Schriftsteller, der durch seine Arbeit ans Haus gebunden ist, aber nicht für das Haus, ausschließlich, als Hausmann, lebt.
Nun gut, ich sollte mich nicht zu sehr ereifern, ich werde mir einen zweiten Tee kochen, mich an den Eßtisch setzen und hinaus in den Garten schauen, der kein Garten ist, sondern ein Stück weiter Natur. Ich werde aus dem Fenster schauen, einfach so, lange habe ich nicht mehr ruhig und grundlos aus dem Fenster geschaut, weil es immerzu etwas zu tun, zu arbeiten, zu richten gibt, als bestünde das Leben aus lauter Aufräum- und Richtarbeiten, ein endloser Schwanz kleiner Erledigungen, die einen vom Wesentlichen nur abhalten.
Was aber wäre das Wesentliche, zum Beispiel? Ich werde mir einen zweiten Tee kochen und darüber nachdenken, was das Wesentliche ist. Ein ruhiges, langes Schauen in den Garten könnte zum Beispiel schon etwas Wesentliches sein, ein Sich-Abwenden vom Zufall der Tage, ein Sich-Hinwenden zum Dauerhaften und Unwandelbaren, nun ja, vielleicht sehe ich das etwas zu streng, ich muß noch genauer darüber nachdenken ...
Lu scheint wirklich gut und tief zu schlafen. Seit er am Morgen getrunken hat, schläft er nun bereits zwei Stunden, er kann also nicht mitbekommen haben, daß La Mamma nicht mehr im Haus ist, nein, ausgeschlossen, die Frage ist nur, ob er es bemerken wird, wenn er aufwacht. Was mache ich dann? Was mache ich, wenn er nach niemand anderem verlangt als nach La Mamma, wenn er an ihrem schönen, langen Haar ziehen und sich an ihre Brust flüchten will, während er nur das kurze, kratzende Vaterhaar zu fassen bekommt und eine frontale, spröde und unzugängliche Männerbrust, an der es nichts zu entdecken gibt?
Jetzt höre ich ihn, die Wiege bewegt sich, ein leises Seufzen, oder irre ich mich? Auf Zehenspitzen gehe ich die wahrhaftig leicht knarrenden Treppenstufen hinauf, da liegt er und schläft, er schläft also immer noch, anscheinend hat er sich nur im Schlaf bewegt, das kommt schon einmal vor, auch Erwachsene bewegen sich ja im Schlaf, Schlafforscher haben sogar herausgefunden, daß wir uns ununterbrochen im Schlaf bewegen.
Kein Grund zur Beunruhigung also, Lu schläft noch immer tief, vielleicht aber schläft er bereits etwas zu lang, obwohl es ja ein gutes Zeichen sein soll, wenn kleine Kinder ungestört schlafen. Lus Schlaf ergibt übrigens ein sehr schönes Bild, viel schöner als die Natur draußen vor unserem Eßtischfenster, vielleicht hat das Bild von Lus Schlafen ja etwas vom Wesentlichen, beinahe kommt mir das jetzt so vor.
Ich werde nicht mehr hinuntergehen, ich werde mich hierhin, in die Nähe seiner Wiege, setzen, um dieses Bild zu betrachten, Lus kleinen, etwas nach hinten gereckten Kopf, das feine Lächeln um seinen Mund, den inneren Frieden, der ein Bild der Beruhigung und Entspannung hinterläßt und der doch in vielem an den Frieden des gelassenen Alters erinnert, wie ja überhaupt dieses Gesicht auch Züge des Alters und einer vorweggenommenen Weisheit hat, das ist seltsam, man bekommt die Augen ja gar nicht fort von diesem Gesicht und den kleinen Trauben von Luftbläschen, die wie ein feiner Schaum zwischen den Lippen nisten.
So dauerhaft anstarren kann ich Lu aber auch nicht, nein, ich kann ihm nicht stundenlang beim Schlafen zuschauen, das gehört sich doch nicht, wer will schon beim Schlafen beobachtet werden, ich jedenfalls nicht. Ab und zu aber werde ich einen begeisterten Blick in sein Bett werfen, ja, das schon, einen solchen Blick erlaube ich mir, so daß es vielleicht am besten ist, wenn ich eine Weile in mich selbst hineinblicke und über das Wesentliche nachdenke, zwischendurch aber zu ihm hinüberschaue, so ein hin und her wandernder Blick könnte das Richtige sein, eine Art Blickwechsel, oder wie soll ich das nennen?
Es ist gar nicht so leicht, in Gegenwart eines tief schlafenden Kindes eine angemessene Position einzunehmen, auch darüber muß ich einmal nachdenken und mich fragen, welche Positionen überhaupt in Frage kämen, um notfalls gleich die richtige Wahl treffen zu können. Kleine Kinder stellen einen schon durch ihre bloße Gegenwart vor die seltsamsten Fragen, auf die man sonst niemals kommen würde. Plötzlich beginnt man, sich eine Frage nach der anderen zu stellen, während man zuvor doch auch gut ohne diese Fragen auskommen konnte. Und jetzt? Nur noch Fragen, von denen alles abhängt, die Zukunft, ein Menschenleben ...
Jetzt wacht Lu auf, es ist soweit, diesmal täusche ich mich nicht. Er wendet den Kopf mehrmals nach links und nach rechts, streckt sich, ein wenig zitternd, öffnet langsam die Augen, greift mit den Händen ins Leere und schluckt den Speichel herunter, während die Bläschen auf seinen Lippen sich auflösen. Ich sollte ihm Zeit lassen, zu sich zu kommen, und mich nicht sofort zeigen, ich könnte ihn sonst leicht erschrecken, zumal er ja vielleicht den Anblick von La Mamma erwartet, die aber jetzt in ihrem neuen Verlagsbüro sitzt und nichts von den Fragen ahnt, die sich mir stellen.
Die nächste Frage: Wie soll ich jetzt in Erscheinung treten, einfach aufstehen und mich über Lus Bett beugen, oder mich zunächst entfernen, um dann aus der Ferne näher zu kommen? Das plötzliche Aufstehen erscheint mir nicht richtig, Lu könnte den Eindruck bekommen, ich hätte die ganze Zeit neben seinem Bett auf sein Aufwachen gewartet, und damit vielleicht die Erwartung verbinden, daß ich von nun an immer neben seinem Bett auf sein Aufwachen warten werde. Vermuten könnte er auch, ich beobachtete ihn heimlich, obwohl ich nicht glaube, daß er bereits zu solchen Vermutungen und sich daran anschließenden Schlußfolgerungen fähig ist, aber was weiß ich schon, wozu er überhaupt in der Lage ist, vielleicht denkt es unaufhörlich in seinem Kopf, darüber sollte ich etwas wissen, allerdings lassen sich solche Fragen nicht durch bloßes Nachdenken beantworten, sie verlangen geradezu schreiend nach exaktem Wissen.
Warum denke ich aber gerade jetzt an exaktes Wissen, während doch die viel näherliegende Frage zu beantworten ist, wie ich mich Lu nähern soll. Ich könnte die knarrenden Treppenstufen auf allen vieren wieder hinunterkriechen und dann mit markantem, deutlichem Auftreten wieder hinaufgehen, das wäre eine Möglichkeit, obwohl es eine lächerliche Vorstellung abgäbe, auf allen vieren, geduckt, eine Treppe hinabzukriechen und sie auf beiden Füßen, hoch erhoben, wieder hinaufzugehen, ein heimlicher Beobachter könnte vermuten, ich spielte die Epochen der Evolution durch, vom Hüpfschritt zum aufrechten Gang.
Was also nun? Wie gebannt sitze ich auf meinem Stuhl neben der Wiege, und irgendwie muß ich es schaffen, mich unauffällig zu erheben und mich ihm in angemessener Langsamkeit zu nähern. Am besten, ich stehe einfach auf und gehe hinüber ins Nebenzimmer, das wird ihn aufhorchen lassen, und dann mache ich im Nebenzimmer kehrt und komme zurück und beuge mich über sein Bett und begrüße ihn, hallo Lu, nein, nicht hallo, guten Morgen, mein Lu, nein, so auch nicht, ich habe ihm ja schon guten Morgen gewünscht, mein Gott, irgendwas wird mir schon einfallen.
Jetzt, ja, jetzt schreit er. Er schreit verhalten, es ist eine Art Ankündigungsschreien, ein Ausprobieren eines kräftigeren Schreiens, wie die Vorübung eines Sängers kurz vor dem großen Auftritt. Ich mag nicht, wenn er schreit, wenn mich etwas unsicher und nervös macht, ist es Lus Schreien. Lo hat in ihren ersten Monaten sehr selten geschrien, und meist konnte man den Grund ihres Schreiens leicht herausfinden. Lu aber schreit anders, unerwartet, zu den seltsamsten Zeiten und wenn kein Mensch darauf kommt, was der Grund sein könnte.
Also los, was sitze ich da und höre mir an, wie Lu schreit? Aufgestanden, ein paar Schritte durch den Raum gemacht, die Tür zum Nebenzimmer geöffnet und theatralisch geschlossen und sich über die Wiege gebeugt! Er erkennt mich, natürlich erkennt er mich, womit hatte ich denn gerechnet? Das Schreien hört auf, und anscheinend verlangt er auch nicht nach La Mamma, sondern nimmt vorlieb mit mir.
Er hat lange genug in seiner Wiege gelegen, ich nehme ihn jetzt einmal heraus, komm, kleines Früchtchen, komm auf die linke Schulter und laß dich tragen! Lu liebt es, so getragen zu werden, es heißt, alle Kinder seien in das Getragenwerden vernarrt. Lo zum Beispiel übertrieb die Sache so sehr, daß sie nur noch getragen werden wollte, am Ende ließ sie sich nicht einmal mehr in den Kinderwagen legen. Durch ganz Rom habe ich sie auf dem Rücken und auf meinen Schultern getragen, mitten im heißen Juli und im noch heißeren August, und ich habe geschwitzt, wie ich noch nie geschwitzt habe in meinem Leben. Manchmal blieben sogar Passanten stehen und schauten uns an, als gäbe es einen Anlaß zu Mitleid. Manche Passanten haben mich zu einem Glas Wasser eingeladen, und die mitleidigsten Wirte haben mir gleich ein großes Bier dazu spendiert, aber halt, ich bin jetzt nicht in Rom und bin nicht mit Lo unterwegs, es geht vielmehr um Lu, und Lu ist ganz anders als Lo, ich sollte erst gar nicht damit anfangen, beide Kinder miteinander zu vergleichen.
Ich gehe also mit Lu auf der linken Schulter durchs Haus, er liegt da wie ein weiches, warmes Bündel, das sich an das Schulterplateau anschmiegt, manchmal drückt er seinen Kopf auch gegen meinen, und dann rieche ich diesen betörenden Kinderhautduft, eine Mischung aus, ja aus was eigentlich? Es ist schwer, diesen Duft genau zu beschreiben, dominant ist jedenfalls etwas beinahe Geruchsneutrales und Warmes, so etwas wie eine Art Eigengeruch der Haut, zu dem sich die schwache Süße des Speichels gesellt, sehr genau ist das nicht, aber näher läßt es sich auch nicht sagen.
Ich kann nicht stumm mit ihm durch das Haus gehen, das geht nicht. Ich könnte uns mit Musik unterhalten, mit Mozart vielleicht oder mit Bach, nein, doch eher mit Mozart, aber warum habe ich jetzt etwas gegen Bach, natürlich habe ich nichts gegen Bach, er eignet sich nur nicht so sehr wie Mozart für das Ohr eines Kleinkindes, das ..., ja was? Wie komme ich jetzt darauf, daß Bachs Musik nichts für Lu ist, wie komme ich auf so ein entschiedenes und doch durch nichts gerechtfertigtes Urteil? In diesem Urteil scheint sich eine instinktive Einschätzung von Bachs Musik zu verbergen, von der ich, seltsam, bisher nicht einmal ahnte, daß ich sie hatte.
Also keine Musik, besser keine Musik, bis ich mir darüber klargeworden bin, welches die richtige sein könnte, Mozart oder vielleicht Beethoven, nein, Beethoven ganz gewiß nicht, Beethoven ist nichts für Lu, auch nicht »Freude, schöner Götterfunken«, nein, auf keinen Fall, »Freude, schöner Götterfunken« kommt in der neunten Symphonie viel zu orchestral und gewaltig daher, ein viel zu großer Aufwand wird damit getrieben, wenn es ein schlichtes Lied wäre, dann könnte es passen, aber nicht dieser brüllende Chor, der aus dem schlichten Lied eine derart aufgedonnerte Sache macht, im Grunde ist »Freude, schöner Götterfunken« etwas für Cello solo, etwas Leises, Schlichtes, das unter die Haut geht. Bachs Suiten für Cello solo gehen übrigens unbedingt unter die Haut, die wären also wohl auch etwas für Lu, oder etwa nicht?
Aus, Schluß, ich werde mich jetzt nicht mit solchen Erwägungen abgeben, ich trage Lu durch das Haus und erzähle ihm etwas. Ich könnte ihm die Küche zeigen und die Gegenstände, die sich in der Küche befinden, das ist ein guter Gedanke, mein Gott, es kommt mir so vor, als wäre das heute der erste gute Gedanke. Es ist merkwürdig, daß ich in Lus Gegenwart derart viel nachdenke, mir fällt das oft auf, und ich weiß nicht, woher das kommt. Verlasse ich zum Beispiel das Haus, hört das Nachdenken scheinbar auf, es rumort noch eine Weile in meinem Kopf, dann wird es schwächer und erlischt.
Doch es braucht nur eine kurze Erinnerung, schon ist das Nachdenken wieder da. Mit einem abwesenden Gesicht laufe ich herum, wie ein Schlafwandler, ich werde Lus Bild einfach nicht los und noch viel weniger die Gedanken, die um dieses Bild unaufhörlich kreisen. Als Lo geboren wurde, begann diese Schlafwandelei, und bis heute hat sie nicht aufgehört, als wäre ich in meinem Kopf nicht mehr allein.
Andere Menschen, zum Beispiel Freunde, ja selbst die ältesten Freunde, ahnen von diesem merkwürdigen Zustand nichts. Man trifft und unterhält sich weiter mit ihnen, aber man ist manchmal nicht mehr ganz bei der Sache. Man spricht nicht davon, natürlich nicht, wie sollte man dieses Nachdenken auch erklären, manche Freunde, besonders die kinderlosen, reagieren sowieso schon gereizt, wenn man zuviel von Kindern spricht. Die Kinderthemen sollten das Gespräch unter Erwachsenen nicht dominieren, ich weiß, aber im Augenblick haben die Erwachsenenthemen nichts Anziehendes für mich, und ich muß mich anstrengen, unverhofft nicht wieder auf Kinderthemen zu kommen.
Der Schneebesen, der Kochlöffel, das gefällt Lu, ich hatte es mir ja gedacht! Ich werde ihm zeigen, was man mit einem Schneebesen und einem Kochlöffel alles anstellen kann, wie spät ist es eigentlich? Am Mittag kommt La Mamma kurz vorbei, sie soll einen guten Eindruck von uns bekommen. Einen glänzenden Eindruck würden wir hinterlassen, wenn wir in der Küche aufräumen würden. Irgendwer muß schließlich einmal aufräumen, und ich sollte das nicht ausschließlich La Mamma überlassen, schließlich ist Aufräumen auch für sie keine reine Freude.
Wenn ich aufräume, muß ich Lu allerdings kurz zurück in die Wiege legen, das gefällt ihm gar nicht, er beginnt gleich wieder zu schreien. Also gut, ich werde ihn weiter auf dem Rücken durchs Haus tragen, Gegenstände, die ich ihm zeigen könnte, gibt es im Haus zum Glück ja genug.
Am Mittag kommt dann La Mamma, sie bringt Lo mit. Lu und ich − wir verschweigen, daß ich nichts anderes getan habe, als ihn zwei Stunden lang durchs Haus zu tragen, sogar im Keller sind wir gewesen und haben mit leeren Flaschen gespielt, die wunderbar klirren, wenn man sie gegeneinander schlägt, und die singen können, wenn man sie etwas mit Wasser füllt und dann mit dem Finger ihre schmale Öffnung umkreist.
Wie war’s, fragt La Mamma.
Sehr schön und ganz einfach, sage ich.
Und dann setzen wir uns hin, essen zu Mittag und hören dazu eine Cello-Suite von Bach.
Die Erfindung des Films
Ich will eine Videokamera kaufen, und da ich keine Erfahrung mit Videokameras habe, lasse ich mich von einem Freund etwas beraten. La Mamma, die in solchen Dingen viel gründlicher ist als ich, schlägt vor, daß ich mehrere Fachgeschäfte aufsuche, die Preise und Angebote vergleiche, einen Videokamera-Test der »Stiftung Warentest« hinzuziehe und mich so auf den Kauf vorbereite.
Ich habe mich noch nie auf einen Kauf vorbereitet. Wenn ich etwas kaufen will, muß sich alles von selbst ergeben: Ein Fachgeschäft betreten, den gewünschten Gegenstand auf den ersten Blick als den einzig richtigen erkennen, ihn bezahlen, verschwinden. Einkäufe solcher Art haben etwas von stürmischen und leidenschaftlichen Liebesaktionen, ich entreiße den Gegenstand der Tristesse seiner Warenumgebung und lasse ihn von nun an nicht mehr los.
Das Fachgeschäft, das ich betrete, sieht vertrauenerweckend aus, nur der Verkäufer ist etwas zu jung. Ich mag keine allzu jungen Verkäufer, sie geben sich oft so kühl und überlegen, solche Anwandlungen können den Liebesansturm von vornherein dämpfen. Aber ich sollte nicht voreingenommen sein, auch jungen Verkäufern sollte man zutrauen, sich auf Ahnungslose einstellen zu können.
Zu ahnungslos wiederum sollte ich mich auch nicht geben, solche Bescheidenheit könnte ein Gefühl maßloser Überlegenheit in ihm entstehen lassen, das unser Verhandlungsgespräch nur belasten würde. Klar und entschieden sollte ich meine Wünsche anmelden und meine persönlichen Kaufmotive ins Spiel bringen. Ich will eine Videokamera kaufen, weil ich all die schönen Momente, die ich mit Lo und Lu verbringe, festhalten will. Eine Videokamera könnte genau das Richtige sein, vermute ich einmal, obwohl ich nicht einmal ahne, wie mit einer Videokamera gedrehte Filme ausschauen könnten. Meine Freunde haben keine Videokameras, sie finden sie häßlich, spießig und abstoßend. Jemand mit Videokamera neben dir auf dem Bergmassiv des Monte Frattino, das bringt dich um den ganzen Panoramablick, meint etwa Peter.
Er hat ja recht, bis vor kurzem dachte ich auch nicht einmal im Traum daran, eine Videokamera zu kaufen. Seit Lo und Lu auf der Welt sind, sind jedoch gewisse Überzeugungen ins Wanken geraten. Manchmal vermute ich sogar, daß meine Überlegungen regelrecht auf den Kopf gestellt werden.
Ich werde darüber nachdenken, jetzt ist nicht die Zeit dazu, der junge Verkäufer lächelt und erwartet, daß ich etwas sage. Ich möchte eine Videokamera kaufen, sage ich ruhig.
Sie meinen einen Camcorder, sagt der Verkäufer.
Einen Videocorder, sage ich.
Dann meinen Sie einen Recorder, sagt der Verkäufer.
Nein, sage ich, meine ich nicht. Ich meine eine Videokamera, und so nenne ich sie auch.
Wie Sie meinen, sagt der Verkäufer. An was haben Sie gedacht, an einen 8-mm-Camcorder oder an etwas Anspruchsvolleres?
An etwas Anspruchsvolleres, sage ich, nur zu anspruchsvoll sollte es auch nicht sein.
Wofür brauchen Sie es denn, fragt der Verkäufer.
Ich möchte meine beiden kleinen Kinder damit filmen, sage ich.
Aha, sagt der Verkäufer, dafür reicht ein 8-mm-Camcorder. Nein, sage ich, etwas anspruchsvoller sollte es schon sein.
Dann empfehle ich einen Hi8-Camcorder, der hat ein HiFi-Stereo-Tonsystem, sagt der Verkäufer.
Das ist etwas zu anspruchsvoll, sage ich. Was habe ich davon, wenn ich meine beiden kleinen Kinder in HiFi-Stereo erlebe?
Viel, sagt der Verkäufer und lächelt. Etwas Besseres kann der Markt zur Zeit nicht bieten.
Dann lassen Sie einmal sehen, sage ich.
Er hat, denke ich, bestimmt keine Kinder und interessiert sich nicht einmal für sie. Für ihn bin ich nichts weiter als ein unbeholfener Amateur, der seine tapsigen Finger ausgerechnet an das heilige Gehäuse eines Hi8-Camcorders legen möchte. Dieses Modell hier kann ich empfehlen, sagt er, mit Instant-Zoom-Taste und motorgetriebenem Zoom-Objektiv.
Wo ist die Augenmuschel, frage ich, und er schaut rasch und kurz zu mir auf.
Hier, sagt er, sie ist bewußt unauffällig plaziert, man zieht sie heraus.
Das Unauffällige gefällt mir, sage ich.
Mir auch, sagt er und lächelt wieder.
Ich nehme sie, würde ich jetzt am liebsten sagen, ich nehme diese Kamera, sie hat eine so unauffällig und schön plazierte Augenmuschel, aber so einfach geht es natürlich nicht. Der Verkäufer will sehen, daß ich mich bemühe, der Kauf ist noch nicht in eine dramatische Phase getreten, und dazu gehört, daß ich den Zweifler spiele, den unberechenbaren Käufer und Abwäger, eine Rolle, die mir durch und durch zuwider ist.
Die Farbe des Handgurts gefällt mir nicht, sage ich.
Sie ist neutral, sagt er, schwarz und dadurch neutral.
Der Handgurt ist widerwärtig, sage ich, ohne Handgurt sähe es viel besser aus.
Sie können den Handgurt abmontieren, sagt der Verkäufer, aber ich rate Ihnen nicht dazu.
Warum nicht, frage ich.
Erst ein straff gespannter Handgurt vereinigt die Hand mit dem Gerät, ohne Handgurt bleibt die Verbindung sehr lose, Sie spüren das Gerät dann nicht derart sinnlich, sagt er.
Jetzt schaue ich zu ihm auf, solche Gedanken hätte ich ihm nicht zugetraut, selbst zu so etwas Lächerlichem wie einem Handgurt fällt ihm etwas Verblüffendes ein.
Dann ist der Handgurt gewissermaßen die erotische Komponente der ganzen Sache, sage ich.
Er ist das Erotischste überhaupt, sagt der junge Verkäufer. Aber warum gestaltet man ihn dann derart neutral, frage ich. Er müßte als leuchtendes Zeichen zur Geltung kommen, grellrot.
Schon ein schwaches Aquamarinblau würde es bringen, sagt der junge Verkäufer.
Wir sollten an die Hersteller schreiben, sage ich.
Habe ich längst getan, sagt der junge Verkäufer.
Und, frage ich.
Vergessen Sie es, sagt er und lächelt.
Ich bin mit ihm einig, denke ich, wie einig man für Sekunden selbst mit einem derart jungen Verkäufer sein kann. Er ist klug, gebildet, er hat ein hohes sensuelles Empfinden, ich nehme diese Kamera, was braucht es noch weitere dramatische Phasen?
Wollen Sie nicht einmal durchschauen, fragt der junge Verkäufer.
Richtig, sage ich, durchschauen wäre nicht schlecht.
Sie sehen die Welt jetzt in Schwarz-Weiß, sagt der junge Verkäufer, erschrecken Sie nicht.
Ich liebe schwarz-weiß, sage ich, noch heute fotografiere ich lieber schwarz-weiß als in Farbe.
Farbige Bilder sind Fotos, sagt der junge Verkäufer, Schwarz-Weiß-Bilder sind Fotografien.
Wir gehen gemeinsam nach draußen und bleiben vor dem Geschäft in der belebten Fußgängerzone stehen. Ich lasse meine gestreckte Hand in den anschmiegsamen und empfänglichen Handgurt gleiten, ziehe die unauffällige Augenmuschel heraus und drücke auf die gut sichtbare Aufnahme- und Start-Taste. Das Bild ist enttäuschend. Ein matter Schwarz-Weiß-Film, ohne Kontraste, wie Szenen eines unprofilierten Pubertätstraums.
Es ist enttäuschend, nicht wahr, fragt der junge Verkäufer. Nun ja, sage ich.
Geben Sie nichts drauf, sagt der Verkäufer, wenn Sie’s in Farbe sehen, sind Sie begeistert.
Sind Sie da sicher, frage ich.
Absolut, sagt der junge Verkäufer, und wir gehen wieder hinein.
Ich nehme sie, sage ich.
Ich könnte ihnen noch andere Modelle zeigen, sagt der Verkäufer.
Nein, sage ich, ich nehme die hier, genau die.
Das freut mich, sagt der Verkäufer, ich verwende sie übrigens auch, genau die.
Und was filmen Sie, frage ich.
Meine Kinder, sagt der Verkäufer, ich habe alles dokumentiert, von der Geburt bis jetzt, lückenlos.
Gratuliere, sage ich und versuche, bewundernd zu lächeln.
Zu Hause ziehe ich mich in mein Arbeitszimmer zurück, niemand soll meine erste Kontaktaufnahme mit dem neuen Gerät miterleben. Ich packe die Kamera aus und lege sie vor mich hin auf den Tisch. Dann gehe ich die umfangreiche Gebrauchsanweisung durch, das heißt, ich fange an, sie versuchsweise zu lesen, obwohl ich genau weiß, daß ich sie nie ganz durchlesen werde.
Als es mir reicht, schiebe ich eine Filmkassette ein und lasse meine rechte Hand in den Handgurt gleiten. Ich werde mit ihr hinausgehen, in die frische Luft, um die ersten Probeaufnahmen zu machen, wir wollen versuchen, uns aneinander zu gewöhnen, die Gebrauchsanweisung kann mir gestohlen bleiben.
Vorsichtshalber verstecke ich sie unter meinem Mantel, es gelingt mir noch nicht, mich offen mit ihr zu zeigen. Wir gehen zusammen den schmalen Pfad hinauf zur Höhe, ich schaue hinab ins Tal, ein Zug fährt gerade vorbei: das wäre eine gute Gelegenheit, die ersten Aufnahmen zu machen. Wenn ich mich recht erinnere, waren die ersten Filmaufnahmen ebenfalls Aufnahmen von einem fahrenden Zug, die Lokomotive soll frontal auf die Betrachter zugerast sein, so daß unter den ersten Zuschauern Panik ausbrach, war es nicht so?
Leider kommen gerade ein paar Spaziergänger vorbei, so daß ich die Kamera nicht hervorholen kann, schließlich kann ich mich nicht in diese freie Natur stellen, um sie mit einer Kamera zu fixieren. Aber warum nicht, warum stelle ich mich so an? Im Grunde werde ich hier konfrontiert damit, wie aufdringlich und zupackend der fotografische Blick ist. Ein wenig fühle ich mich zurückversetzt in die Rolle der ersten Filmpioniere, die erschrocken waren, als sie ihre eigenen Bilder anschauten.
Außerdem bin ich nicht richtig gekleidet. Dieser schwere Mantel eignet sich nicht für meine neue Passion, er ist zu steif und macht nicht gut mit, und wenn ich ihn heimlich öffne, um die Kamera herauszuzerren, komme ich mir vor wie ein Exhibitionist. Ich sollte eine leichte Windjacke tragen, etwas Sportliches, Wendiges, und ich sollte die Kamera offen in der Hand halten, als wäre ich mit ihr verwachsen. Schließlich sollte ich mich auch schneller oder jugendlicher bewegen, gute Kameramänner sind springlebendig und haben etwas Ruheloses und Bildsüchtiges, ich spüre schon etwas in dieser Richtung.
Obwohl es recht kühl ist, ziehe ich meinen Mantel aus und lege ihn auf die nächste Bank. Ich beginne jetzt mit den Aufnahmen, »Klappe« ruft etwas in mir, »Waldeinsamkeit, Klappe eins, die erste«, und dann sage ich es wirklich und laut: »Waldeinsamkeit, Klappe eins, die erste«.
Ich filme den schmalen Fußweg, der sich durch den Wald schlängelt, ich richte den Blick hinauf in die Baumwipfel und führe ihn in einem eleganten Schwenk wieder zu Boden, ich mustere die Grasbüschel zu beiden Seiten, als hätte ich noch nie Grasbüschel gesehen, und ich merke, wie ich die Luft anhalte, zwei, drei Minuten, bis ich diesen ersten Anlauf hinter mir habe.
Erst als ich das Gefühl habe, daß es nun wirklich genug ist, und endlich die Stop-Taste gedrückt habe, atme ich aus, wie nach einer schweren, auch körperlich schweren Anstrengung. Und, seltsam, es ist anstrengend, alles in einem zieht sich zusammen, liegt auf der Lauer, konzentriert sich, ich kannte so etwas noch nicht, beim Fotografieren ist die Konzentrationsphase viel kürzer und fällt mit der Zeit nicht mehr auf.
Ich streife dann noch eine Weile herum und filme weiter den mir völlig unbeweglich erscheinenden Wald und − als Bewegungskontrast − die ziehenden Wolken, und ich muß sagen, es ist ein Vergnügen. Man betrachtet die Umgebung viel aufmerksamer als sonst, man mustert sie wie eine Kollektion optischer Angebote, und ohne daß man es merkt, stellt sich eine gewisse Aufregung ein, mit klopfendem Herzen springt man durch diese Kulissen, wie ein Jäger, der herjagt hinter den scheuen Waldtieren ...
Nach meiner Rückkehr ins Haus gelingt es mir, die Kamera offen und frei vor mir herzutragen, wir haben einander inzwischen gefunden und gehören zusammen, nur will man uns im Haus gleich wieder trennen. La Mamma zum Beispiel beharrt darauf, sie werde sich nur unter gewissen Bedingungen filmen lassen, keineswegs aber längere Zeit ununterbrochen, auch wolle sie die Sache nicht nur mir überlassen, sondern ein Wort mitreden, wenn es um die Auswahl der Drehorte im Haus gehe.
Es ist klar, La Mamma sieht sich als Darstellerin oder vielleicht sogar als Schauspielerin oder am Ende gar als große Aktrice, unsere Ansichten vom Film gehen, wie es scheint, so weit auseinander, daß ich mich gedrängt fühle, mit einigen Brocken Filmtheorie aufzuwarten.
Ich erkläre ihr also, daß Film so etwas sei wie die Errettung der äußeren Wirklichkeit und es deshalb darauf ankomme, die Kamera ganz zu vergessen, das Kameraauge sollte mit der Zeit etwas Alltägliches werden, nur dann gelinge es, das Leben unverstellt einzufangen, dokumentarisch, als Aufzeichnung des Ephemeren und Zufälligen, so in etwa formuliere ich mein theoretisches Credo, das übrigens von den Theorien einiger bedeutender Vorläufer angeregt wurde, ich breite das hier nicht weiter aus, so etwas würde zu weit gehen.
La Mammas Bedürfnisse richten sich denn auch gar nicht so sehr auf das theoretische Rüstzeug, La Mamma sieht die Sache sehr pragmatisch und trocken, und ihre Entgegnung, ich könne reden, solange ich wolle, sie habe es einfach nicht gern, wenn man mit der Kamera hinter ihr her sei und sie auf Schritt und Tritt wie eine Beute verfolge, enttäuscht mich, so daß ich zunächst einmal schweige, desillusioniert.
Neue Medien trafen bei ihrer ersten Erprobung immer auf starke Widerstände, sage ich mir weiter, ich hätte mit so etwas rechnen müssen, den Kindern jedenfalls wird mein Filmen gefallen, Kinder halten viel weniger am Hergebrachten fest, weil sie noch keine Vorurteile haben und die neuen Medien eher als Spielzeug betrachten.
Als ich dann aber im Kinderzimmer erscheine, die Kamera gleich vor dem Auge und mit der Linken vor mir her fuchtelnd wie ein Blinder, der Hindernisse ertasten und ihnen ausweichen möchte, beginnt Lu sofort zu schreien, als habe ein böses Phantom den Raum betreten.
Nur Lo sitzt stumm da und betrachtet mich mit offenem Mund wie einen Fremden. Sie regt sich nicht, sie hat die Augen weit geöffnet, anscheinend erlebt sie einen Moment der Überwältigung, von dem sie noch nicht weiß, wie sie ihn einschätzen soll. Dreißig, vierzig Sekunden lang filme ich Los verzückte Erstarrung, dann taucht La Mamma auf und bereitet dem schönen Moment ein vorzeitiges Ende.
In der Nacht aber, als alle schlafen, schließe ich meine Kamera mit einem Verbindungskabel an den Fernseher an. Und plötzlich ist alles da, wie Gottes Schöpfung am siebenten Tag, nur daß es gewaltig rauscht in meinem Wald und das Keuchen meines Atems so laut zu hören ist, als arbeitete ich mit einer Axt. Ein zittriger, hektischer Blick rast durch die Baumwipfel und stolpert hinab ins Grün, die Grasbüschel blicken überdimensional trotzig und drohend zurück, und in regelmäßigen Abständen schreit im Orkan des Windes eine Stimme in Seenot: »Waldeinsamkeit, Klappe eins, die erste, die zweite ...« Die ganze gefilmte Welt, kommt es mir vor, ist aus dem Häuschen, alles bewegt sich, gibt Laut, schwankt und rülpst, ich habe anscheinend immer wieder vergessen, die Stop-Taste zu drücken, so daß lauter Bilder erscheinen, die meine Filmtheorie feixend verhöhnen, der pure Zufall bricht sich Bahn, tanzende Himmelssplitter und dann wieder der nackte Waldboden, und weiter alles so, als hätte ich vorgehabt, einen Experimentalfilm zu drehen.
Dann aber, Schnitt, neue Sequenz, ist La Mamma zu sehen, in einem unbeobachteten Moment, in dem ich einige ihrer fast schwerelosen und schwebenden Schritte in der Küche von hinten erwischt habe, und dann sehe ich Lo ..., es ist wirklich Lo, so plastisch und nah, als wäre sie durch die Kamera neu erschaffen worden, ein schwacher Lichtschimmer liegt auf ihrem Gesicht wie Spuren des goldenen Lichts auf den Mädchengesichtern Vermeers, mein Gott, flüstere ich, das ist unfaßbar, diese Filmbilder übertreffen an Genauigkeit und Schärfe den eigenen Blick, und so lasse ich sie einfrieren zu einem Standbild, ›Die junge Lo, in Betrachtung eines Phantoms, unbekannter Meister des späten 20.Jahrhunderts‹, von dem ich gleich weiß, daß ich es suchen, aber niemals wiederfinden werde, nachts, in meinen Träumen.
Rosebud
Schnee, den ganzen Morgen fällt Schnee. Lo steht vor dem Fenster, schaut hinaus und trampelt mit den Füßen auf der Stelle, als wollte sie zu diesem unablässigen Schneefall den Takt treten und immer mehr Weiß hervorlocken aus den grauen Himmelslandstrichen. Dann den Pullover, die Mütze, den Schal, nichts wie raus, rausraus, treibt sie mich an, und ihre Backen sind so weit und gierig gebläht, als wollte sie lauter Schneekristalle zum zweiten Frühstück verzehren.
Ich ziehe mich also auch gleich warm an und gehe mit ihr hinaus, gelassen wie jemand, dem Schnee nichts ganz Fremdes mehr ist. Ich vermute, daß Lo jetzt gleich anfangen wird, den Schnee einzufangen oder einen Schneemann zu bauen, und ich überlege, wie ich mich davor drücken könnte, ihr dabei zu helfen. Dieses Bauen von Schneemännern ist mir aus der Kindheit noch gut in Erinnerung, es war eine lange, sich stundenlang hinziehende, anstrengende Arbeit, an deren Ende man durchnäßt und verschwitzt ein mollig-drolliges, aber meist auch etwas autistisches Wesen betrachtete, das nach der Fertigstellung gleich sentimental zu tropfen begann, ja so war es.
Gerade rechtzeitig fällt mir ein, daß ein alter Schlitten irgendwo in einem Keller auf uns wartet, vor einigen Wochen ist er mir dort begegnet, ich muß ihn finden, das könnte die Rettung sein. Schlittenfahren ist etwas ganz anderes als Schneemänner bauen, mit Schlittenfahren verbinden sich nur die besten Erinnerungen, obwohl ich, wenn ich mich ganz genau zu erinnern versuche, nur eine steile Wiese sehe und eine rasante Abfahrt, nach der ich den steilen Hang wieder hinaufstapfen mußte. Immer beim Hinaufziehen des Schlittens hatte ich das Mißverhältnis zwischen der kurzen Fahrtlust und dem sich unendlich dehnenden Schleppfrust gespürt, das Ziehen und Schleppen hatte etwas von einer Bestrafung gehabt, als sollte einem mit strenger Hand deutlich gemacht werden, daß auch ein leichtes Vergnügen immer auf harter Arbeit beruhe.
Als ich den alten Schlitten gefunden habe, kommt er mir sehr fremd vor, »Davos« steht in schon etwas verwitterter Schrift auf einer der schmalen Leisten, der sonst dicke Lack ist dort gesprungen, irgendwer hat an diesen Buchstaben gekratzt. Ich habe keine Ahnung, wem der Schlitten früher gehörte, ich glaube, wir fanden ihn beim Einzug ins Gartenhaus neben anderen verlassenen Spielsachen unten im Keller, gut, daß wir ihn aufbewahrt haben, er gefällt mir in seiner sachlichen Holzehrlichkeit, keine Farbe, kein Schnickschnack, aber auch nicht die verzagte Blässe von frischem Holz, also kein fades Ikea-Gesicht.
Gut also, der Schlitten hat etwas Freundliches, und mir fällt auch gleich ein, wo er zum Einsatz kommen könnte, wir müssen nur einige hundert Meter weiter den Hang hinaufsteigen bis zum früheren Aussichtsturm auf der Höhe, von dort könnte dann eine temporeiche Hahnenkammabfahrt mit wenigen gut auszufahrenden kleineren Kurven steil hinab ins Tal führen.
Fahren, fahren ..., ruft Lo neben mir, während ich den Schlitten den Berg hinaufziehe, sie benutzt jetzt oft diese einfachen Infinitive als Befehle, ich meine das jetzt rein sachlich, als bloße Feststellung also, ich höre aufmerksam hin, wenn meine Tochter mit mir spricht, außerdem sollte man bei einem derartig anstrengenden Schlittenschleppen etwas zu denken haben.
Oben angekommen, wenden wir den Schlitten und versuchen, hintereinander auf ihm Platz zu nehmen, es ist etwas eng, aber es klappt. Für einen Moment kommt es mir beinahe so vor, als wüßte ich gar nicht, wie Schlitten fahren geht, aber ich habe keine Zeit, solche dummen Überlegungen zu pflegen, es geht einfach los.
Fahren, losfahren ..., ruft Lo, und schon fahren wir, beschleunigen, nehmen Fahrt auf, legen zu, donnern und rasen zu Tal, ich hatte ganz vergessen, wie schnell sich ein Schlitten bewegt, wie ein Gesteinsbrocken, der zu Tal kracht, das hatte ich völlig vergessen und auch, was Geschwindigkeit ist, dieser Kitzel des kühlen Luftstroms am Hinterkopf und das Klatschen der Backpfeifen des Fahrtwinds, vielleicht fahren wir sogar etwas zu schnell, ich sollte die Herrschaft über das Gefährt nicht verlieren, aber was soll das heißen, wir fahren nicht in einer Kutsche aus alten Tagen, sondern rasen ohne unser Zutun zu Tal.
Ich höre Lo schreien, ein wenig Angst ist in diesem Schrei, aber auch sehr viel Glück, es ist eine Befreiung vom langsamen Trott, und plötzlich höre ich auch mich schreien, ja, es ist so, ich schreie, ein wenig Angst ist in meinem Schrei, aber auch sehr viel Glück, seit Jahrzehnten, kommt es mir vor, habe ich mich nicht mehr so schnell und so lustvoll bewegt, wo war diese Lust bloß all die Jahre, wo hatte sie sich versteckt?
Als wir unten sind, lachen wir, wir lachen und schütteln uns aus, als hätten wir zwei Komikern beim Schlittenfahren zugeschaut, uns kommen sogar vor Lachen die Tränen, was für ein seltsames Befreiungslachen, das führt uns langsam zurück in die Welt.
Noch mal, schreit Lo, ja, natürlich noch mal, das werden wir wiederholen, wenn nur das Hinaufschleppen nicht wäre. Lo kümmert sich nicht weiter darum, sie ist schon voraus, ohne Schlitten kommt man mühelos den Hang hinauf, während ich den alten Gesellen an einer ebenso alten Kordel hinaufziehe, sie ist speckig und schneidet leicht in die Finger. Schon als Kind hat mich so eine Kordel geärgert, es war immer die gleiche, denn auch wenn ich sie ausgetauscht hatte, war die neue gleich wieder alt und speckig und schnitt leicht in die Finger. Heutzutage wird man solche Kordeln bestimmt nicht mehr verwenden, aber was verwendet man denn, ich glaube, Schlitten sind auch aus der Mode, erst recht aber Kordeln, früher waren es Geschenkpaketkordeln, die Kordeln der bescheidenen 50er Jahre, und wir bewahrten sie in einem Küchenfach auf, dort lagen sie wie kleine Tiere, die man einsperren muß, widerspenstig und nicht aufgewickelt, man zog sie wie eklige Würmer heraus.
An genau so einer alten Kordel also habe ich früher meinen Schlitten einen Hang hinaufgezogen, das ist seltsam, und plötzlich ist auch der alte Hang wieder gegenwärtig, er war nicht so steil wie dieser hier, eher ein Abhang, eine Art Böschung, ich trudelte inmitten eines Rudels von Freunden auf meinem Schlitten ins Tal, und dann stapften wir langsam wieder hinauf, und mein Freund Rainer fragte, was heißt »Davos«, auf Deinem Schlitten steht ja »Davos«, auf meinem steht »Bergisches Land«. Und ich schaute auf meinen Schlitten, ich wußte nicht, was »Davos« meinte, »Bergisches Land« wäre mir lieber gewesen, und abends habe ich dann heimlich das fremde »Davos« fortzukratzen versucht, aber es gelang nicht, der Lack splitterte und setzte sich unter den Nägeln fest.
Lo ist schon wieder oben am Turm angekommen, sie winkt, nochmal, bitte nochmal, ich winke zurück, aber insgeheim winke ich jemand anderem, und als ich mich beim Hinaufgehen umdrehe und sehe, wie »Davos« mir ohne allzu sichtbare Spuren des Alters brav folgt, muß ich schlucken. Und plötzlich macht es mir nichts mehr aus, einen Schlitten diesen steilen Hang hinaufzuziehen, ich ziehe schließlich »Davos«, das ist etwas anderes.
Mein lieber »Davos« ..., ich sollte es ihm so leicht machen wie möglich, vielleicht sollte ich ihn den Berg hinauf tragen oder die Kufen mit Schmirgelpapier glänzend reiben, oder übertreibe ich jetzt?
In einem Film von Orson Welles kreist eine ganze Lebensgeschichte um einen Schlitten, ja, so war es, es war die Geschichte eines amerikanischen Mediengiganten, dessen letztes Wort »Rosebud« gewesen war, ein dunkles, geheimes Vermächtnis, auf dessen Spur sich die Reporter gemacht hatten, denen es aber trotz aller Nachforschungen nicht gelungen war, das Rätsel zu lösen. Erst in der Schlußeinstellung des Films war zu sehen gewesen, daß »Rosebud« der Name des Kinderschlittens war, auf dem der später vereinsamte Mann seine glücklichsten Tage verbracht hatte, der Name einer sentimentalen Erinnerung also, des letzten Blicks zurück auf die verlorenen Tage der Kindheit.
Wie rührselig war mir dieser Filmschluß früher erschienen, als ich noch nichts wußte von den Eigenheiten der Lebensalter. Obwohl: »Davos« ist ganz und gar nicht mein »Rosebud«, denn vereinsamt bin ich weiß Gott nicht, sondern reise mit Lo, meiner springlebendigen Tochter, nur kurz in meine Kindheit zurück, um hier, in der Gegenwart, anzukommen. Und weil »Davos« lebt, will er auch nicht den Hang hinaufgetragen oder mit Schmirgelpapier bearbeitet werden, er will nichts anderes als zu Tal donnern!
Nochmal, nochmal, schreit Lo, als ich oben angekommen bin, und trampelt mit beiden Füßen auf der Stelle, und auch ich schreie, nochmal, los, mein Lieber, und dann donnern wir wieder zu Tal, als wollten wir es Orson Welles beweisen ...
Die alltägliche Arbeit
Lu wacht gegen halb sieben am Morgen auf, so daß auch Lo gegen halb Sieben aufwacht. Seit sie beide so früh aufwachen, wache ich gegen sechs auf, was mir eine halbe Stunde Vorsprung verschafft. Ich habe lange nachgedacht, wie ich die halbe Stunde wohl nutzen könnte, aber mit einer halben Stunde läßt sich nicht viel anfangen, es sei denn, ich verzichtete darauf, gegen halb sieben gleich bei Lo und Lu hineinzuschauen und ihnen einen guten Morgen zu wünschen.
Ich weiß nicht, ob ihnen viel an meinen Morgenwünschen gelegen ist, ich könnte das alles auch einfach lassen und sie etwas später begrüßen, aber noch zieht es mich gegen halb sieben hinein in ihr Zimmer, wo ich dann hängen bleibe. Meist nehme ich mir vor, nur kurz einen guten Morgen zu wünschen, doch immer wieder verwickelt mich einer der beiden in ein Spiel oder treibt seine Albernheiten mit mir, so daß ich schon bald völlig eingewickelt bin und erst aus der Sache herauskomme, wenn wir in der nächsten Tagesphase angelangt sind.
Erst seit Lo und Lu auf der Welt sind, weiß ich, was Tagesphasen sind, Lo und Lu haben diese Phasen, ohne es zu ahnen, für La Mamma und mich entworfen, und nun kommt alles darauf an, sich diese Phasen zu eigen zu machen. Meist geht es nicht anders, und man unterwirft sich ihnen freiwillig. Wenn man sich aber stark fühlt und mutig, versucht man, seine eigenen Tagesphasen mit den Lo und Lu-Phasen geschickt zu koppeln, und nur wenn man einmal wieder verrückt ist und überreizt und eigensinnig und trotzig und einem alles zuviel wird, beharrt man auf seinen eigenen Phasen, was sofort schiefgeht, sofort, jedes Mal.
Ich könnte also zum Beispiel meine erste Tagesphase mit dem Aufstehen gegen sechs Uhr beginnen und mich sofort an den Schreibtisch setzen, wie ich das jahrelang getan habe. Gegen sechs Uhr am Schreibtisch kam mein Arbeiten rascher als zu jeder anderen Tageszeit in Gang, oft schaffte ich es, bis neun oder zehn Uhr zu schreiben, und wenn ich dann frühstückte, hatte ich das meiste vom Tag schon getan und konnte frühstücken wie ein spät aufgestandener und ausgeschlafener Herrscher über den Tag, für den die früh aufgestandenen Minister schon alle Arbeit getan hatten.
Meine erste Tagesphase dauerte im idealen Fall also drei bis vier Stunden am Morgen, so lange kann sie aber nicht dauern, seit Lo und Lu gegen halb sieben aufwachen. La Mamma verläßt das Haus gegen acht, ich hätte also wohl Zeit für eine frühe Arbeitsphase von sechs bis sagen wir halb acht, das bringt aber nichts, in anderthalb Stunden komme ich gerade erst mal in Schwung und müßte dann genau auf dem Leistungshöhepunkt aufhören, abbrechen und alles hinschmeißen. Ich habe es einmal versucht, aber das Ganze erinnerte mich an den Vorgang des Coitus interruptus, von dem ich als Schüler mit roten Ohren zum ersten Mal in den Kinsey-Reports las. Bisher bin ich ihm aus dem Weg gegangen, und das soll auch so bleiben, denn er hinterläßt, wenn ich mich richtig an die tiefen Sorgenfalten auf der Stirn von Mister Kinsey erinnere, schwere und nie mehr zu korrigierende Schäden.
Ich arbeite also nicht von sechs bis halb acht, ich wünsche Lo und Lu einen guten Morgen, und wenn noch etwas Zeit übrig ist, bis La Mamma das Haus verläßt, beantworte ich Briefe oder schneide irgendwo einen Artikel aus, den ich unbedingt aufheben will. Das alles aber ist natürlich keine richtige Arbeit, es ist eher ein Fummeln und Schnippeln, und jedes Mal, wenn ich daran sitze, denke ich, das könnte auch irgendein anderer tun.
Hat La Mamma dann aber wirklich das Haus verlassen, will vor allem Lo beschäftigt sein, und so steigen wir ein in die Tagesphase des Anspielens. Das Anspielen ist so etwas wie ein Anwärmen, wir holen also ein Spiel und einen Baukasten nach dem anderen hervor und fangen an, einen Zoo mit vielen Tieren oder einen Flughafen mit kleinen Gepäckwagen zu bauen. Nach einer Weile ist Lo so in das Bauen und Spielen vertieft, daß sie allein weiter baut. Ich muß nur den besten Moment finden und mich dann langsam davonstehlen, ganz vorsichtig und unauffällig, als wehte mich ein Wind wie ein Stück Papier um die nächstbeste Ecke.
Die nächstbeste Ecke ist ein ruhiger Platz, wo ich etwas zu lesen versuche, ich schlage ein Buch auf und lege los, manchmal lese ich zwanzig Minuten am Stück, an gewissen Tagen sogar dreißig bis vierzig.
Ich lese, doch meine beiden Ohren sind ganz woanders, sie lauschen nach Lo und dem ruhigen Murmeln, das ihr Bauen begleitet, und ich lausche hinein in die Stille, die Lus Wiege umgibt. Lu schläft, Lo und ich wissen, daß er etwa eine Stunde lang schläft, dann will auch er beschäftigt werden, und das meint, er möchte in den Wagen gesetzt werden und eine Morgentour machen.
Wenn wir gegen halb zehn zu dieser Morgentour aufbrechen, habe ich etwas gefummelt, etwas geschnippelt und einige Seiten gelesen, das ist nicht eben viel, beweist mir aber, daß ich mir den Willen zur Arbeit erhalten habe. Die Morgenfahrt ist ein Ritual, sie besteht aus lauter Stationen und kleinen Abenteuern, viele Ideen habe ich für diese Fahrt entwickelt, ich komme später noch einmal genauer darauf zurück, weil die Morgenfahrt so etwas ist wie ein Kunstwerk oder eine Performance, für die man ja bekanntlich ein eigenes ästhetisches Programm haben muß.
Gegen zwölf Uhr sind wir wieder zu Hause, ich bin nun, wie man so sagt, seit sechs Stunden auf den Beinen, und wer glaubt, daß man sich beim Bauen, Spielen und Fahren entspannen kann, kennt Bauen, Spielen und Fahren nicht richtig. Lo und ich bereiten nach unserer Rückkehr das Mittagessen vor, während Lu uns aus seiner leicht schräg gestellten, praktischen Liege dabei zuschaut.
Wie freuen wir uns, wenn gegen eins La Mamma erscheint! Lo tritt auf der Stelle, und Lus kleiner Körper vibriert in seiner Liege so heftig, als durchzuckten ihn Liebesschauer. Für einen wie mich, der den ganzen Morgen zur Stelle war, kommt es nun darauf an, diskret zur Seite zu gehen und den kleinen Film, der da zwischen La Mamma und ihren Kindern abläuft, nicht durch harte Schnitte zu unterbrechen.
Wenn La Mamma aber nach dem gemeinsamen Essen wieder verschwunden ist, sind Lo und Lu wahrhaftig müde. Ich schließe also die Fensterläden des Kinderzimmers und lege sie, selbst eine gewisse Entspannung genießend, zu Bett. Etwa anderthalb Stunden werden sie schlafen, so in etwa, es ist klar, daß man sich nicht darauf verlassen kann.
Ach, bin auch ich müde, so müde, ich verstehe, warum man den Schlaf in alten Zeiten als etwas Süßes bezeichnet hat, Schlafen kann wirklich etwas Verführerisches haben und eine Art Verlockung sein, ein Sich-gehen-Lassen, Sich-Strecken, Sich-Aufgeben, schon der Gedanke daran, wie die Traumbilder langsam aus den letzten Tagesresten entstehen, verschafft so etwas wie ein Wonne-Gefühl, »Wonne« ist genau das richtige Wort, obwohl ja längst nicht mehr gebräuchlich, doch das macht nichts, ich bleibe bei »Wonne«, es erinnert ja auch ein wenig an »Wanne«, der Schlaf als »Wonnenwanne«, ich hoffe, ich werde verstanden.
Andererseits stehen mir jetzt anderthalb, im besten Fall sogar zwei Stunden zur Verfügung, um zu arbeiten, die einzigen Stunden des Tages, von der Nacht rede ich später. Ein Buch lesen, das geht allerdings nicht, ich würde schon nach den ersten Zeilen einschlafen, das weiß ich, und das Fummeln und Schnippeln habe ich im Grunde auch satt, ich sage das jetzt einmal so hart. Ich sehne mich ja auch nicht danach, mir die Zeit zu vertreiben und irgend etwas zu tun, ich will vielmehr arbeiten, konzentriert arbeiten.
Und so setze ich mich an den Schreibtisch und versuche zu schreiben. Todmüde, blockiert von einem Körper, der etwas ganz anderes will als mein Verstand, sitze ich auf einem Drehstuhl und drehe. Am liebsten würde ich den Kopf auf die Tischplatte legen und die Arme zu Boden hängen lassen, ich würde mich auch nicht scheuen, mich einfach auf den harten Boden zu legen, denn ich fühle mich wie der Wolf aus dem Märchen, dem man den Magen mit lauter Wackersteinen gepflastert hat. Diese Schwere, diese Last, es ist fast nicht zu ertragen!
Mit beiden Händen klammere ich mich an die Tischplatte, um nicht auf ihr zusammen zu sinken. Ich drücke das Kreuz durch und recke den Kopf in die Höhe, halte durch, sagt etwas in mir, du weißt doch, nach einer Weile wird es meist besser, du mußt durchhalten, es wird schon gehen. Konzentriert arbeiten allerdings kann ich in diesem Zustand nicht, ich sitze am Schreibtisch und bereite mich durch suggestives inneres Sprechen nur darauf vor, ich zeige, daß ich für die Arbeit bereit bin und daß ich versuche, die Bedingungen dafür so ideal wie möglich zu gestalten. Ohne zu wanken, ohne einzuknicken, sitze ich vor dem Schreibtisch und starre ins Nichts, das ist schon allerhand, es hat etwas Asiatisches, ich glaube, die alten ZEN-Meister haben auf ganz ähnliche Weise Schwächezustände bekämpft.
Mir liegt allerdings wenig daran, es mit ZEN-Meistern aufzunehmen, ich will nur arbeiten, aber das ist einfach nicht möglich, die Konzentration geht ja schon für den Kampf gegen die Müdigkeit drauf. In diesem Zustand regt sich rein gar nichts in mir, ich bin eine Art Medium, passiv und schwach, und wenn es mir dann schließlich doch gelingt, einen Bleistift zu halten, so reicht es gerade dafür, aufzuschreiben, daß ich hier zur Mittagszeit sitze und das aufschreibe, was ich eben so aufschreibe.
Anderthalb bis zwei Stunden habe ich also Zeit, mich einer Art Schreibarbeit zu widmen, ich führe Tagebuch, das ist so etwas wie die Schwundstufe von Arbeit, aber immerhin, ich schreibe, ich bäume mich auf und lasse nicht zu, daß mein Körper im Meer des Schlafes willenlos dumpf einfach versinkt.
Gegen drei wachen Lo und Lu auf, gut gestärkt, kräftig und schon bald wieder sehr munter, man sieht ihnen an, wie sehr sie sich darauf freuen, etwas mit mir zu unternehmen. Der Nachmittag ist etwas für längere Ausflüge, weit hinaus in die angrenzenden Wälder, hinab in die Stadt, oft sind Kinderspielplätze das Ziel. Aber auch im Haus verbringen wir einige Zeit, kriechen von Zimmer zu Zimmer, bauen kleine Verstecke und Zelte, zeichnen, malen, kleben, mit der Zeit habe ich das alles schließlich als meine Arbeit verstanden, ich muß lernen, Arbeit neu zu definieren, habe ich mir gesagt und hätte vor Müdigkeit schon beim bloßen Denken des Wortes »definieren« beinahe gestottert.
Wenn Lo und Lu einem Tag für Tag so nahe sind, hört man schließlich auf, Worte wie »definieren« überhaupt noch zu benutzen. Alles angestrengte und überzogene Reden bekommt vielmehr mit der Zeit etwas Lächerliches, so daß einem etwa die Auftritte von Politikern im Fernsehen schon bald wie Komik-Sendungen vorkommen, bei Auftritten von Künstlern ist es übrigens nicht anders.
La Mamma erscheint dann gegen sechs Uhr am Abend, und meist ist der Wunsch, dann einmal für einige Momente allein zu sein, wie ein heftiger, animalischer Trieb, von dem ich früher gar nicht wußte, daß ich ihn hatte. Es reicht schon, ein paar Schritte allein durch den Garten zu gehen und sich irgendwo hin, auf eine Bank oder einen Holzstumpf, zu setzen. Die Abendluft streicht einem wie die fürsorglich-dankende Hand einer höheren Macht durch das Haar, ich vermute, daß Marathonläufer nach ihren Glanzleistungen ähnliche Erlebnisse haben, erst jetzt spürt man, daß es einem gelungen ist, zwölf Stunden lang die eigenen Nerven so zu beherrschen, daß es trotz vieler Störungen nicht zu explosiven Entgleisungen kam.
Alles fällt von dir ab, jetzt darfst du dich für eine halbe, dreiviertel Stunde entspannen, La Mamma hat mir geraten, es mit einem Waldlauf zu versuchen, aber ich mußte zugeben, zu solchen Selbstüberwindungen noch nicht fähig zu sein. Ein disziplinierter, nicht zu schneller, aber auch nicht zu langsamer Waldlauf, sagte La Mamma, könne mich rasch wieder aufbauen und den müden Kreislauf präparieren für die Abend- und Nachtstunden, die für meine eigentliche Arbeit reserviert sind.
La Mammas Vorschlag leuchtet mir ein, aber als ich ihn meiner müden Seele einzutrichtern versuche, beginne ich bei »disziplinieren« und »präparieren« vor Erschöpfung wieder zu stottern. Besser also ich überfordere mich vorläufig nicht, sondern setze mich einfach hin und lese die Zeitungen, so vergehen die kritischen Minuten bis zum Abendessen beinahe von allein.
Gegen acht Uhr gehen Lo und Lu dann zu Bett, bis sie wirklich schlafen, ist es halb neun. Jetzt nahen die Stunden der Nachtarbeit. Soll wirklich etwas entstehen, dann brauche ich von ihnen drei, besser noch vier. Und so sitze ich wieder an meinem Schreibtisch, und mein Zustand ist beinahe der wie am Mittag, nur etwas schlimmer, und ich denke wieder an die alten ZEN-Meister, denen es genügte, still dazusitzen, in Meditationen versunken.
Meditationen allerdings helfen mir leider nicht weiter. Um mir Mut zu machen, lese ich im Tagebuch nach, was ich am Mittag geschrieben habe, und dann schreibe ich wieder etwas ins Tagebuch und denke, in gewissen biographischen Phasen sollte sich alles Arbeiten tagebuchartig verdichten. Ich sollte ausschließlich Tagebuch führen, denke ich weiter, ein detailliertes, ausschweifendes Tagebuch, und ich sollte das Fummeln und Schnippeln gleich damit verbinden und die ausgeschnittenen Zeitungsartikel, Bilder und Fotos mit hineinkleben, damit in diese Aufzeichnungsmaschine etwas Welt hineinkommt und nicht nur die Rede vom Windelnwechseln, Flaschenerwärmen und Früchtebreikneten ist, regelmäßigen Anforderungen eines Tages, die ich hier übersprungen habe, aus Diskretion.
Lo und Lu, denke ich weiter, könnten mir bei diesem Tagebuch helfen, ich werde Lo das Fotografieren beibringen und ihre Fotos mit einkleben und dazu einige ihrer Zeichnungen und Bilder, so könnte das Tagebuch ein Gesamtkunstwerk werden, mit Querverweisen auf meine Videofilme, über gesonderte Tonaufzeichnungen sollte ich mir noch Gedanken machen ...
Als es mir gelang, all das in einer einzigen Nacht, ohne einmal ins Stottern zu geraten, hintereinander wie eine Kette strenger logischer Schlüsse zu denken, wußte ich, daß ich mich von der eigentlichen Arbeit endgültig verabschiedet hatte.
Ich kann nicht mehr schreiben, murmelte ich vor mich hin, wenn es mir schlecht ging. Ich habe ein neues, anderes Schreiben entdeckt, redete ich mir ein, mit leicht triumphierendem Grundton, als mir die prallen, bunten, dicht bemalten und beschriebenen Tagebuchseiten zu gefallen begannen.
Irgendwann wird dieses Tagebuch platzen, sagte ich mir noch zum Schluß, es wird die Fiktionen und Geschichten, die es verdrängt hat und an deren Stelle es beinahe ohne mein Zutun getreten ist, nicht mehr zurückhalten können. Es wird wie ein Sprengsatz detonieren, jawohl, mein Notieren wird detonieren ..., aber da hörte ich längst, daß ich redete wie die Künstler im Fernsehen, und als ich reflexartig auch sofort zu lachen begann, wußte ich, daß es aus war, »aus« mit dem früheren »Arbeiten«, endgültig aus.
Kleine Ästhetik des Fahrens im Kreis
Gegen halb zehn brechen wir zu unserer Morgentour auf, Lu im Kinderwagen, Lo mit kurzen, schnellen Schritten weit voraus, so daß ich mir gleich überlege, ob ich hinter ihr her rufen sollte: Langsam, nicht zu schnell! Ich rufe dann aber doch nicht hinter ihr her, zu Beginn unserer Fahrt sollte ich mit Ermahnungen sparsam sein, sonst erscheinen sie später leicht abgenutzt und wirken nicht mehr.
Ich lasse Lo also den Höhenweg vorauseilen und schiebe den Wagen hinter ihr her. Es ist nicht leicht, Lo und Lu gleichzeitig im Auge zu behalten, vorerst konzentriere ich mich einmal auf Lu, der mit weit geöffneten Augen im Wagen liegt und die über uns ziehenden Wolken studiert. Manchmal wandern seine Blicke auch zu mir herab und mustern mein angespanntes Gesicht, dann verziehe ich es sofort zu einem Lächeln und fange an, ein wenig zu reden, meistens redet mein heiterer Tonfall mir die gute Laune gleich mit ein.
Nach einigen hundert Metern fällt mir oft auf, wie fest ich den Kinderwagen doch halte. Es ist gar nicht nötig, den Kinderwagen so fest zu halten, man könnte ihn dann und wann auch einige Meter frei fahren oder sogar sausen lassen, man könnte ihm einen Stoß oder Schubs geben, aber ich halte ihn fest, ja es ist beinahe so, als wären meine Finger mit ihm verwachsen und als gingen mein Spaziergänger-Körper und der Kinderwagen während der Morgenfahrt eine geheime Verbindung ein und bildeten einen neuen Gesamt-Körper.
Im innersten Kern dieses neu gebildeten Körpers aber schlummern versteckte Energien und mir selbst unerklärliche Kräfte, manchmal vermute ich sogar, diese Kräfte sind so aggressiv, daß ich, wenn sie sich wirklich zeigen und hervortreten wollten, keinerlei Gewalt über sie hätte.
Von außen und oberflächlich betrachtet, ergibt unser Gehen, Lächeln und Reden wahrscheinlich ein etwas blödes, aber doch friedliches Bild. Dahinter aber tobt jetzt, zu Beginn unseres Morgenweges, etwas von Abwehr und Widerstand, ich bin bereit, es mit jedem Feind aufzunehmen, selbst wenn er die Stärke eines, sagen wir, Grizzlys hätte. Wenn wir das Haus verlassen, scheinen der Kinderwagen und ich instinktiv die Gefahr des Fremden zu spüren, wir wappnen uns und bilden eine schützende Außenhaut um Lu, dessen nichtsahnendes Lächeln zu dem, was mir durch den Kopf geht, nicht passen will. In Wahrheit sind natürlich gar keine Grizzlys und auch sonst keine Feinde in Sicht, nicht mal einer, dem wir vorübergehend diese Rolle übertragen könnten. Im geheimen aber sind wir bereit, und wenn uns tatsächlich ein Feind entgegenträte, würden wir ihn, ich drücke mich jetzt brutal, aber ehrlich aus, sofort zermalmen.
Das Zermalmen habe ich während der ersten hundert Meter des Morgengangs im Hinterkopf, ich gehe übrigens auch zum Zermalmen gespannt, allerdings kommt uns nur die kurzsichtige Malerin entgegen, die sich gleich über den Kinderwagen beugen und Lus Entwicklung kommentieren wird.