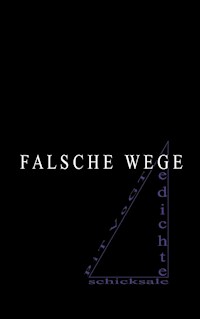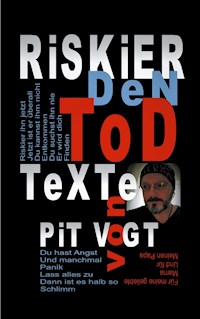Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Schiff voller Erlebnisse und Zauberei? Möglicherweise! Es ist wohl ein Schiff, ein Buch voller Gefühle, Lebensschicksale und unfassbarer Begebenheiten. Es sind Stories, die man sich vielleicht nicht immer so recht zu erklären vermag. Kleine Geschichten, die am Ende doch der Fantasie des Lesers freie Bahn lassen. Auch dieser zweite Teil mit dem Titel "Loveboat" vereint die unterschiedlichsten Schicksale und Lebenswendungen. Und es bleibt eben ein Schiff, das auf hoher See dem Sturm und den geheimnisvollen, düsteren Tiefen des Ozeans zu trotzen vermag. Egal, ob es nun Geister sind, die uns helfen oder ganz normale Menschen, die einfach für uns da sind. Am Ende bleibt dieses "Loveboat" mit seinen gefühlvollen und nicht immer durchschaubaren Geschichten das Schiff der unerklärlichen Träume unseres abenteuerlichen Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Flaschenpost
Irrlichter
Ein kleines Lied
Der Geistersee
Der Krug
Tornado
Rons Engel
Schwester Annemarie
Blitzschlag
Flugunterricht
Karussell
Die Tarnkappe
Das Haus auf der Insel
Das Engelsbuch
Spätsommer
Ausgebremst
Der Große Preis
Der Ring der Mutter
Der kleine Fuchs
Tetra-Virus
Die Begegnung
Großmutters Bild
Der Untermieter
Flaschenpost
Jenny liebte es, ihren Urlaub am Meer zu verbringen. Immer, wenn es ihr möglich war, fuhr sie dorthin. Und wenn die kühle Seeluft um ihre Ohren blies, fühlte sie sich so richtig wohl. Auch im Sommer des Jahres 2002 war das wieder so. Bereits drei Tage genoss sie schon ihren Urlaub und das Wetter war herrlich. Die Sonne schien und sie konnte jeden Tag am Strand liegen. An einem besonders heißen Tag musste sie sich oft im Wasser abkühlen, damit sie es in der Sonne aushalten konnte. Sie schwamm weit hinaus und tauchte ab und zu mit ihrem Kopf in das kühle Wasser. Plötzlich stieß sie an einen harten Gegenstand. Erschrocken schaute sie sich um und entdeckte vor sich eine kleine Flasche, die munter auf den Wogen tanzte. Natürlich wunderte sie sich über dieses seltsame Fundstück, doch sie ergriff es und schwamm zum Strand zurück. Sie hatte keine Zweifel, dass es sich um eine Flaschenpost handelte. In ihrer kleinen Strandburg betrachtete sie sich die Flasche etwas genauer. In ihrem Inneren entdeckte sie einen eingerollten Zettel, war das ein Brief? Mit einem Stein zerschlug sie die Flasche und nahm den Zettel an sich. Bisher hielt sie das Ganze für einen großen Spaß, doch als sie den Zettel las, verging ihr das Lachen. Der Zettel war in englischer Sprache verfasst. Darauf stand: „Ich bin Toni Miller. Ein Schiff ist in Seenot, die „Corona-Star“! An Bord sind etwa 150 Passagiere. Sie wurden im dichten Nebel von irgendetwas gerammt. Wenn Sie diese Nachricht lesen, kommen sie und rettet Sie die Leute. Vielleicht haben sie noch eine Chance. Danke, T.M.!“ Nervös faltete Jenny den Zettel zusammen und sammelte die Scherben der Flasche auf, um sie in eine alte Einkauftüte zu werfen. Sollte sie diese Flaschenpost ernst nehmen? Doch an wen sollte sie sich wenden? Vielleicht wusste die örtliche Polizei Rat. Sie packte ihre Sachen zusammen und lief los. Bei der Polizei legte sie den Zettel vor und die begannen nach anfänglichen Bedenken mit den Ermittlungen. Jenny war nicht sehr wohl bei dem Gedanken, dass vielleicht zur gleichen Zeit so viele Menschen in Not sein könnten. Das Schiff, die „Corona-Star“ gab es tatsächlich und sie war bereits auf dem Weg. Doch es gab weder eine Katastrophe, noch waren Menschen in Not. Es konnte nichts unternommen werden. Dennoch ließ Jenny diese Nachricht keine Ruhe. Sie hatte das untrügliche Gefühl, dass dem Schiff nichts Gutes bevorstand. Von ihrer Mutter hatte sie diese Gabe für Vorahnungen geerbt. Und schon oft wurden sie dadurch vor Schlimmerem bewahrt. Sie musste unbedingt Kontakt zum Kapitän des Schiffes aufnehmen. Von der Polizei erfuhr sie, wie sie mit dem Schiff in Kontakt treten konnte. Sie rief beim Kapitän an und der zeigte sich sehr verständig. Jenny meinte, dass sein Schiff möglicherweise mit etwas Unbekanntem kollidieren könnte. Und da sich die „Corona-Star“ bereits vor einer dichten Nebelwand befand, ließ er das Schiff vorsichtshalber evakuieren. Kaum hatte er die Passagiere zu drei in der Nähe befindlichen Fischkuttern bringen lassen, geschah das Unglück. Aus der Luft ertönte ein ohrenbetäubendes Pfeifen, dann schlug mit lautem Knall etwas Großes auf das Schiff. Es stellte sich heraus, dass ein Meteorit aus dem All auf das Schiff gestürzt war. Er zerstörte einige Kabinen und riss außerdem ein riesiges Loch in den Rumpf. Im dichten Nebel sank das Schiff innerhalb weniger Stunden. Hätte der Kapitän nicht rechtzeitig die Menschen auf dem Schiff evakuieren lassen, wären viele ums Leben gekommen. Jenny konnte es einfach nicht fassen. Die Katastrophe fand tatsächlich statt! Doch das aller seltsamste war, dass die Flaschenpost von keinem der Geretteten abgeschickt wurde. Weder unter den Passagieren noch in der Mannschaft des Schiffes gab es einen Toni Miller. Vielleicht hatte jemand unter einem falschen Namen die Flaschenpost verfasst? Als sie den Zettel noch einmal genauer betrachtete, bemerkte sie, dass es sich um ein abgerissenes Stück eines Kalenders handelte. Darauf stand ein Name, vielleicht der des Schiffes, Jenny las: „Andrea Doria“. Auch das Datum konnte man noch erkennen. Es war der 25. Juli, der Tag, an welchem die Andrea Doria damals mit einem anderen Schiff kollidierte. Bei Jennys weiteren Recherchen kam außerdem ans Licht, dass sich an Bord der „Andrea Doria“ auch ein Passagier namens Toni Miller befand.
Irrlichter
Mein Job als Kundenberater in einer großen Bank stresste mich schon sehr. Von Tag zu Tag verlangte mein Chef mehr Abschlüsse von mir. Und obwohl ich schon sehr gut war, wollte er immer noch mehr. Ich überlegte schon, wie ich die Kunden am besten über den Tisch ziehen könnte, dachte tatsächlich bereits an krumme Geschäfte. Dennoch plagten mich endlose Skrupel und ein schlechtes Gewissen. Irgendwann würden all diese üblen Dinge ans Tageslicht kommen und dann? Ich wagte nicht, weiter darüber nachzudenken, lenkte mich mit körperlicher Ertüchtigung ab. Wenn es die Zeit erlaubte, fuhr ich aufs Land hinaus. Ich hatte ein ganz bestimmtes Ziel, ein großes Waldgebiet, welches sich an einen merkwürdig geformten Hügel schmiegte. Dort fühlte ich mich wohl und sicher. Stundenlang ging ich dort spazieren und dachte über mich und meinen Job nach. So manche Idee kam mir in dieser verlassenen Gegend. Auch an einem Sonntag, an welchem das Wetter Purzelbäume zu schlagen schien. Mal war es sonnig und warm, dann wieder regnete es und es war kalt und stürmisch. Dennoch zog es mich magisch dorthin. Es war so gegen Drei, als ich auf die kleine Wiese einbog, die als Parkplatz diente. Außer mir schien sich an diesem Tag keiner dorthin verirrt zu haben. Ich schnappte mir meinen Schirm und lief los. Einige Wege kannte ich bereits und so gelangte ich immer tiefer in den Wald. Und es dauerte gar nicht lange, da schlug das Wetter um. Dicke Wolken zogen auf und ein heftiger Regenschauer fiel durch die hohen Bäume am Weg. Das dichte Blattwerk konnte nur wenige Tropfen aufhalten. Der Rest verwandelte den Weg in einen regelrechten Sumpf. Dunkel war es geworden und kalt. Irgendwann war es so stockdunkel, dass ich die Hand nicht mehr vor den Augen sah. Und plötzlich hatte ich mich verlaufen. Der Sturm hatte längst tonnenweise Blätter auf die Wege geweht, sodass ich nicht mehr erkennen konnte, wohin ich trat. Bei jedem Schritt sank ich zentimetertief in den Morast. Sollte ich einfach umkehren? Doch wohin? Unterwegs war ich an so vielen Gabelungen vorbeigekommen, da würde ich den richtigen Weg ganz sicher nicht mehr finden. Ich lief einfach weiter geradeaus, in der Hoffnung, das Waldstück bald durchquert zu haben. Doch das stellte sich als Irrglaube heraus. In der Zwischenzeit war es so dunkel geworden, dass ich mich überhaupt nicht mehr zurechtfand. An einem dicken Baum blieb ich stehen. Ich holte mein Handy aus der Jackentasche, doch es hatte natürlich keinen Empfang. Das hätte mir eigentlich klar sein müssen, denn so tief im Wald, na ja. Längst lief ich nur noch auf einer Art Trampelpfad. Den richtigen Weg hatte ich unmerklich verlassen. Plötzlich raschelte es hinter mir. Sofort blieb ich stehen und spitzte meine Ohren! Gleichzeitig duckte ich mich hinter einen dichten Busch. Außerdem war es zu dunkel, genaueres zu erkennen. Dennoch hörte ich deutlich, wie jemand tief ein- und ausatmete. Dieses Geräusch kam immer näher und wurde immer lauter. Mir blieb fast das Herze stehen. Ich rührte mich nicht, hockte wie erstarrt hinter meinem Busch. Als das Atmen genau vor mir zu sein schien, hielt ich meinen Atem an. Ich blinzelte durchs Geäst und sah mit Schaudern eine Gestalt in einem langen schwarzen Umhang. Sie hatte die Kapuze über den Kopf gezogen und atmete laut und schwer. Sollte ich mich zu erkennen geben? Aber was, wenn diese Gestalt nichts Gutes im Schilde führte? Eisern hielt ich die Luft an und musste wohl schon eine bläuliche Gesichtsfärbung angenommen haben. Da bewegte sich die Person weiter voran und verschwand alsbald im Dunkel des Waldes. Unterdessen war der Sturm derart heftig geworden, dass die Bäume knarrend hin und her schwankten. Außerdem rauschte es so laut, dass man glaubte, am Ufer des tobenden Meeres zu stehen. Doch das war nicht das Schlimmste. Viel größer war meine Angst vor dieser rätselhaften furchteinflößenden Gestalt. Wer war das nur? Und warum atmete dieser Jemand so schwer? Ich hielt es hinter meinem Busch einfach nicht mehr aus. Ich musste unbedingt wissen, wohin die Gestalt gegangen war. Vorsichtig und in geduckter Haltung schlich ich mich auf den schmalen Pfad zurück. Sollte ich vielleicht doch besser wieder umkehren? Ich wusste es einfach nicht und entschloss mich, doch weiter zu gehen. Der Regen hatte etwas nachgelassen und so brauchte ich wenigstens den Schirm nicht mehr. Langsam, Schritt für Schritt pirschte ich mich voran. Glücklicherweise war wenigstens der Sturm nicht mehr ganz so heftig. Irgendwann endete der Pfad. Ich musste mich entscheiden, entweder weiter durch das unwegsame Gelände zu stolpern oder doch wieder zum Pfad zurück zu kehren. Meine Neugierde siegte schließlich über die Angst und die Vernunft. Mit einem großen Schritt begann ich meine Pirsch durchs Unterholz. Zunächst sah ich nichts weiter als die dunklen Bäume und das dichte Buschwerk um mich herum. Doch plötzlich leuchteten zwei rote Lichter vor mir auf. Ich erschrak derart, dass ich mich regelrecht fallen ließ. Ich fiel ins weiche feuchte Laub und wusste im ersten Moment gar nicht, wovor ich überhaupt Angst haben sollte. Denn die beiden roten Lichter leuchteten lediglich durch das Buschwerk hindurch, kamen von einem einsam im Wald stehenden, bizarr anmutenden Gebäude. Es hatte keinen Zugang oder einen Pfad, der zu einer Tür führen könnte. Die beiden roten Lichter waren zwei hell erleuchtete Fenster. Aber wieso war es ausgerechnet rotes Licht? Langsam ging ich näher heran. Vermutlich gehörte die seltsame Gestalt von vorhin in dieses Haus? Als ich vor einem der Fenster stand, hörte ich erneut dieses seltsame Atmen. Es war derart nahe, dass ich mich hinter einer Hausecke versteckte. Und da kam sie wieder, die schwarzgekleidete Gestalt. Doch plötzlich fiel mir noch etwas anderes auf. Diese rätselhafte Gestalt lief nicht durch die Wiese, nein, sie schwebte! Vor Angst wäre ich beinahe ohnmächtig geworden. Doch ich durfte unter keinen Umständen einen Laut von mir geben. Die seltsame Erscheinung schwebte ums Haus herum. Ich rannte, so schnell mich meine Füße trugen zum nächstbesten Busch. Dort duckte ich mich wieder und wartete ab. Die Gestalt schwebte auf den Busch zu und ich befürchtete schon das Schlimmste. Doch plötzlich zuckte ein heftiger Blitz vom Himmel auf die Gestalt herab. Im selben Augenblick war sie verschwunden. Hatte sie der Blitz getroffen? Oder lag sie vielleicht irgendwo hinter einem Busch und hatte sich verletzt? Doch ich konnte sie nirgends mehr entdecken. Was ging hier nur vor? Mittlerweile traute ich mich überhaupt nicht mehr aus meinem Versteck. Doch mir blieb mal wieder keine Wahl. Wenn ich wissen wollte, was das alles zu bedeuten hatte, musste ich mich hervorwagen. Wieder schlich ich mich so leise wie ich konnte hinter meinem Busch hervor und näherte mich dem Gebäude. Die roten Lichter waren erloschen und ich nahm an, dass die Gestalt verschwunden sei. Doch ich irrte mich gewaltig. Als ich vor der hölzernen Tür des Hauses stand, hörte ich wieder dieses entsetzliche Atmen. Mir gefror regelrecht das Blut in den Adern. Und ich wusste auch nicht mehr, wohin ich mich retten sollte. Schon erkannte ich die schwarze Gestalt an der Hausecke. Langsam kam sie näher und blieb plötzlich stehen. Unter der Kapuze blitzten zwei rote Lichter hervor und gaben für einen kurzen Moment den Blick auf einen Totenschädel frei. Gleichzeitig zuckten Blitze am Himmel und tauchten die Gestalt und das Haus in ein gespenstisches furchterregendes Licht. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber mir schien in diesem Augenblick alles egal zu sein. Ich brüllte los: „Wer bist Du eigentlich? Der Teufel persönlich? Dann scher Dich weg! Du kriegst mich nicht! Oder willst Du nur die Leute erschrecken!“ Die Gestalt, die vermutlich mit einem solchen Ausbruch meiner Gefühle nicht gerechnet hatte, schwebte zurück zur Hausecke, hinter der sie schnell verschwand. Beim nervösen Kramen in der Jackentasche hielt ich plötzlich eine kleine Taschenlampe in der Hand. Erleichtert stellte ich fest, dass sie funktionierte und hell erstrahlte. Mutig schritt ich zur Hausecke und leuchtete dahinter. Doch die Gestalt war verschwunden. Wieder rief ich laut: „Jetzt hast Du wohl Angst bekommen.“ Doch da war es wieder, das laute Atmen, genau hinter mir. Blitzartig drehte ich mich um und leuchtete mit der Lampe mitten ins Gesicht dieser entsetzlichen Gestalt. Die roten Augen starrten mich an! Der Totenschädel bewegte den Mund und ich spürte den eiskalten Hauch, welcher aus der Gestalt wie ein eisiger Wind trat! Panisch schloss ich meine Augen, wollte wegrennen, doch ich konnte es nicht! Als ich die Augen öffnete, lag ich vor meinem Bett! Erschrocken stellte ich fest, der laute Atem war mein eigener gewesen. Ich hatte einen grässlichen Alptraum, schwitzte und zitterte am ganzen Leibe! Was für ein furchtbarer Traum! Wie kam ich nur auf solch absurde Gedanken? Was hatte sich mein Hirn da Verrücktes ausgedacht? Ich schaute zur Uhr, sie zeigte Viertel nach 1, Mitternacht war also vorbei. Stöhnend erhob ich mich vom Boden und stieg ins Bett zurück. Ich dachte an die schwierigen Termine am nächsten Morgen. Gleich drei Kundengespräche musste ich führen. Und mein Chef verlangte Abschlüsse, viele Abschlüsse. Deswegen musste ich schlafen. Ich schaute zum Fenster, wollte sehen, ob es noch offenstand. Ich erschrak, hinter der vom Wind hin und her bewegten Gardine leuchteten zwei rote Lichter!
Ein kleines Lied
Es war am Weihnachtsabend irgendwo in Hollywood. Der Kirchendiener Jim schlenderte ganz allein und ziemlich einsam durch die breiten Straßen seiner wunderschön geschmückten Stadt und sah die vielen erwartungsvollen Gesichter all der Kinder, die an ihm vorüberliefen. Und er erinnerte sich an seine eigene Kindheit vor sechzig Jahren, da lebte er noch in Detroit, Michigan. Immer schon war die Familie arm und Papa und Mama mussten sehr hart arbeiten, um wenigstens an Weihnachten ein schönes Essen auf den Tisch zu zaubern. Von großen Geschenken konnte er nur träumen, aber nein, er träumte davon nicht. Denn er wollte nicht, dass seine Eltern nur für ihn allein noch mehr arbeiten mussten als sie es ohnehin schon taten. Der allerschönste Moment war dann, wenn die Mama die Kerzen am Weihnachtsbaum entzündet hatte und mit der kleinen Weihnachtsglocke die Bescherung einläutete. Ja, es war dieses Zusammensein, diese Liebe untereinander, die er sich immer bewahrt hatte. Nachdenklich schaute er zu seiner kleinen Kirche, in welcher er seit vielen Jahren stundenweise tätig war. Irgendwie strahlte sie an diesem Heiligen Abend eine alles durchdringende Traurigkeit aus. Längst waren die Gottesdienste vorüber und sicherlich würden sehr viele Kinder sehr viele Geschenke bekommen. Ein leises Lächeln huschte über Jims Gesicht und er wischte sich eine winzige Träne vom Kinn. Es war schade, dass er sich damals mit seinen Eltern verstritten hatte und kaltherzig aus Detroit wegging. Die Familie verlor sich schließlich gänzlich aus den Augen und Jim landete dann in Hollywood, wo er anfangs noch glaubte, sein großes Glück zu finden. Doch alle Träume platzten wie dicke Seifenblasen im Wind und er war am Ende froh, dass er in dieser kleinen Kirche ab und an mithelfen durfte. Viel Geld konnte er sich als Kirchendiener jedoch nicht zusammensparen. Und zu einer Familie hatte er es auch nie gebracht. Aber er konnte die Menschen glücklich machen. Und genau das war es, was ihn selbst ein klein wenig zufrieden sein ließ.