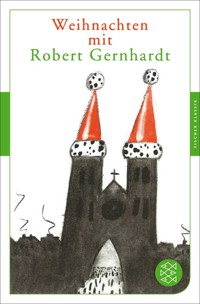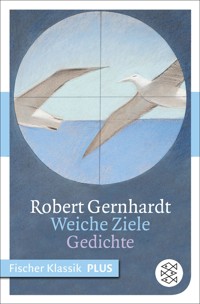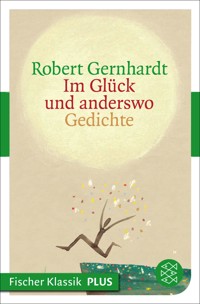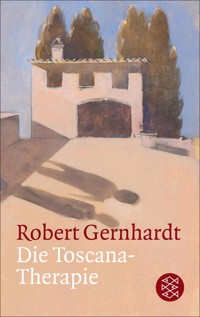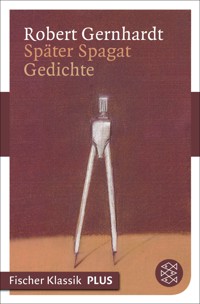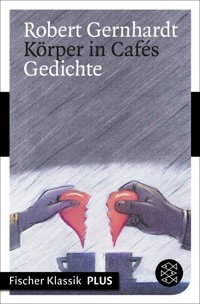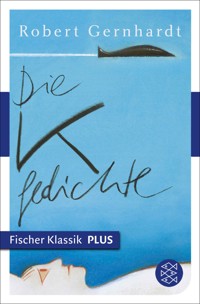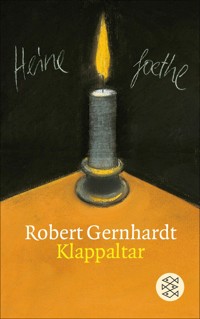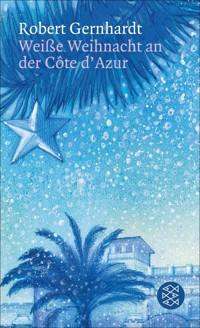8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Ein Sohn und seine missglückte Abrechnung mit der Mutter, zwei Paare, die sich von einer gemeinsamen Reise, das eine Paar nach Kanada, das andere nach Indonesien, viel versprechen… Robert Gernhardt entwirft in diesen Geschichten ein Tableau vom Täuschen und Getäuscht werden, erzählt meisterhaft von Lebenslügen und verpassten Chancen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Robert Gernhardt
Lug und Trug (Fischer Klassik PLUS)
Drei exemplarische Erzählungen
Fischer e-books
Tübingen oderbelegte Seelen
Der Sohn sah hoch, da er den Blick der Mutter auf sich ruhen fühlte. Einen Lidschlag lang schauten die beiden einander an, dann hatte die Mutter ihre Augen bereits wieder auf ihr Strickzeug gesenkt.
»Du willst keinen Kaffee«, sagte sie, aber der Sohn kannte die Mutter gut genug, um ihren Satz als Frage zu begreifen. Er erwog, sie wegen ihrer Ausdrucksweise zur Rede zu stellen, dann aber ging er wieder einmal – zum wievielten Mal? – den Weg des geringsten Widerstandes: »Doch, ich hätte gerne einen Kaffee.«
Er lächelte ihr aufmunternd zu, als sie ihr Strickzeug beiseite legte und etwas steif, wie es schien fast lahmend, über die Terrasse ging. Sie ist alt geworden, dachte er und bedauerte sich: Es würde wieder einmal keine Abrechnung geben. So gut er sich auszukennen glaubte in den Methoden seiner Mutter, dieser nun schon seit Jahren fälligen Abrechnung zu entgehen – und bisher war ihr das stets und zur Gänze gelungen –, so sehr erstaunten ihn ihre unablässig abgewandelten Tricks und ihre scheinbar unerschöpflichen Vermeidungsressourcen. Jetzt wurde sie also auch noch alt. Ganz was Neues! Kaum daß er es gelernt hatte, ihre stets verschlüsselten Botschaften zu verstehen, ihre Aussagesätze in Fragesätze zu überführen und den ihnen zugrundeliegenden Code zu knacken – stets nämlich waren die Aussagen so formuliert, daß sie den Angeredeten in Zugzwang setzten und zur Gegenrede nötigten, während die Redende sicher sein konnte, keinerlei Ablehnung oder gar Verneinung erleiden zu müssen, etwas, das bei einer unverstellten Frage hin und wieder die unausbleibliche Folge gewesen wäre –, kaum also war der Sohn den Finten der Mutter mental gewachsen, kaum glaubte er sich gegen ihre Listen intellektuell gewappnet, da sah er sich schon wieder emotional entwaffnet: Kinder und Alte zu schonen war schließlich eines jener Gebote, auf denen jedwede Kultur, auch die primitivste, gründete. Aber wer hatte ihn eigentlich geschont, als er ein Kind war?
Die Abwesenheit der Mutter nutzte der Sohn, um etwas in Cassell’s German & English Dictionary nachzuschlagen. Das vertraut rote und vertrauenerweckend dicke Nachschlagewerk stammte aus dem Bücherschrank der Mutter und erinnerte, neben weiteren Lehrbüchern und Grammatiken, an jene Helden- und Nachkriegszeit, da sie, die Mutter, die Familie durch Nachhilfestunden in Englisch und Französisch über Wasser gehalten hatte. Der Sohn blickte erst prüfend über die Schulter, dann öffnete er rasch das Lexikon. Hoffentlich taugte es was.
»cumulus – die Haufenwolke«, »cune-ate – keilförmig«, »cunning – listig« – jetzt hätte eigentlich cunt kommen müssen, statt dessen folgte »cup – die Tasse, Schale, der Becher«. Ärgerlich schlug der Sohn das Buch zu. Im sehr viel dünneren Taschen-Langenscheidt hatte er cunt gefunden; wieso eigentlich hatte er den Langenscheidt nicht mitgenommen? Doch sogleich fiel ihm ein, daß der ja Verena gehörte und daß die ihn wahrscheinlich gerade in einen der vielen Pappkartons packte, deren Anblick ihm derart auf die Nerven gegangen war, daß er es schließlich nicht mehr ausgehalten und sich bei der Mutter angemeldet hatte: Er brauche etwas Provinz, Natur und Sammlung – ob er über die Pfingsttage vorbeischauen dürfe.
Die Antwort war geradezu überschwenglich zustimmend ausgefallen: Dann könne er doch auch an der Geburtstagsfeier teilnehmen, zu welcher der Vetter die weitverstreute Verwandtschaft am Pfingstmontag eingeladen habe, selbst die kleine Kirsten aus Schweden werde erwartet. Doch der Sohn war hart geblieben: Keine Familienfeiern, auch dann nicht, wenn ein durchaus geschätzter Vetter fünfzig werde. Er könne zur Zeit nun mal keine Unruhe vertragen, eine schwierige Arbeit benötige seine ganze Kraft. Nein, Verena könne leider nicht mitkommen. Ja, schade.
Der Sohn stand auf und trat aus dem Schatten der Markise. So hatte Pfingsten zu sein: so kühl und verschattet drinnen, so wärmend und heilend draußen, so klar Luft und Sicht, so kontrastreich Licht und Schatten, so gedämpft die Menschenlaute in den Nachbargärten, so herzzerreißend der Gesang der Amseln, jener vielstimmige Chor, der sich ausgerechnet den Garten der Mutter zum Mittelpunkt allen Lockens, Jubilierens und Triumphierens ausgesucht zu haben schien, derart machtvoll erscholl es von der Fernsehantenne des Hauses weit in die grüne Nachbarschaft. Und nun begann auch noch in der Ferne jemand ein Waldhorn zu spielen, indes ein Windstoß vom Tal her durch all das Grün ging, ein wohliges Schaudern, das sich von Baum zu Baum, von Garten zu Garten fortsetzte, bis hin zum Waldrand, an welchem der Unermüdliche die Jagdsignale blies, »Fuchs tot«, »Has tot«, »Hirsch tot«.
Der Sohn kannte ihn bereits vom Vorjahr. Im letzten Juni hatten sie ihn bei einem Spaziergang gesehen, Verena und er, und er erinnerte sich, mit welch mühsam gewahrtem Ernst sie an dem Blasenden vorbeigegangen waren, einem langbärtigen, grüngekleideten, über und über mit Eichenblatt, Sauzahn, Hirschhorn und Gamsbart behängten Mann. Offenbar ein Verwirrter, der in ihnen widerstreitende Gefühle geweckt hatte, Mitleid und Spottlust. Außer Sichtweite hatten sie dann doch losprusten müssen und einander während des kurzen Heimwegs immer neue Jagdsignale zutrompetet, von Hirsch tot und Arsch tot über Gans tot zu Schwanz tot. Schmetternd hatte der Sohn dazu den Beginn von Beethovens Fünfter intoniert; als sie am Haus der Mutter klingelten, tränten seine Augen vor Lachen. Nun fehlte nicht viel, und er hätte wirklich geweint, da kam die Mutter mit dem Kaffee- und Kuchentablett. »Schön, der Garten.« – »Ja, sehr schön.« – »Und eine so klare Sicht.« – »Geradezu unwirklich klar.« Der Sohn räumte eilfertig Papiere und Bücher zusammen, um Platz für die Kaffeetafel zu schaffen. Für einen Augenblick löste sich dabei der Packpapierumschlag vom Taschenbuch, hastig strich ihn der Sohn glatt, unauffällig schob er das schmale Buch unter den gut 1200 Seiten starken Cassell’s. Welch ungleiches Paar, dachte er, während er ein Deckblatt so auf den Manuskriptstapel legte, daß nichts Geschriebenes sichtbar blieb.
Daß er das alles doch liegenlassen solle, beschwor ihn die Mutter, sie wolle seine Arbeit weder behindern noch unterbrechen. Das sei kein Problem, antwortete der Sohn.
»Wahrscheinlich ist es noch zu früh, die Markise einzurollen«, sagte die Mutter, worauf der Sohn wortlos aufstand und zum Hebel griff.
Wieso kann man sich mit dieser Frau eigentlich nicht streiten, dachte er mutlos, da fiel ihm ein, daß er sich eigentlich niemals mit einer Frau so richtig gestritten hatte, schon gar nicht mit Verena. Der hätte er ja um ein Haar noch beim Auszug aus der gemeinsamen Wohnung geholfen, man wollte sich doch als Freunde trennen nach all den Jahren. Man? Wer eigentlich hatte sein Selbstgefühl im Laufe der Zeit derart unterwandert, daß er nicht einmal dazu in der Lage war, von sich selber in der ersten Person zu denken?
»Du mußt jetzt keinen Streuselkuchen essen«, sagte die Mutter und schob den Kuchenteller fast unmerklich näher. »Du hast schon als Kind lieber Salziges gegessen. Leider habe ich heute früh keine Seelen mehr bekommen.«
»Ich will aber Streuselkuchen essen«, erwiderte der Sohn heftig. »Niemand ißt zum Nachmittagskaffee Seelen.«
»Du hast das aber früher getan«, versetzte die Mutter lächelnd.
Der Sohn biß verbittert in den Kuchen. Was eigentlich gab dieser Frau das Recht, ihn, nur weil er früher einmal schwäbisches Kümmelgebäck gemocht hatte, bis an sein Lebensende mit schwäbischem Kümmelgebäck zu traktieren? Zugleich mußte er widerwillig einräumen, daß sie ihm nicht salziges Gebäck, sondern derart verlockenden Kuchen vorgesetzt hatte, daß es ihm schwerfiel, seine Gier zu zügeln. Kuchen und Kaffee – dem Jugendlichen waren diese Genüsse als der Gipfel verderbter Spießigkeit vorgekommen, nun dachte er anders. Jetzt hätte er gerne noch einen Cognac gehabt, um die erprobte Trias bourgeoiser Laster abzurunden, doch nach dem zu verlangen, verbot ihm die gleiche Kindesscham, die es ihm hatte geboten erscheinen lassen, das Taschenbuch, ein Beeline Classic mit dem Titel Horny Girls, für die Dauer seines Besuchs in Packpapier einzuschlagen. Fürsorglich rückte der Sohn am Cassell’s, der all das belastende Papier auf dem Gartenstuhl neben ihm beschwerte; sorgenvoll blickte die Mutter.
»Und du kommst mit deinem Roman gut voran?«
»Ja, ganz gut.«
»Aber versuch auch, dich ein bißchen zu erholen.«
»Du weißt doch, daß ich mich hier immer erhole, auch dann, wenn ich arbeite.«
»Schade, daß Verena nicht mitkommen konnte.«
»Ja, Mutter, sehr schade.«
Der Sohn lächelte bedauernd, fast schmerzlich. Teilnahme malte sich im Gesicht der Mutter, da lachte er auf. Die Mutter blickte fragend, der Sohn log etwas von einem Eichhörnchen, das so komische Sprünge zwischen den Tannen da vollführt habe. Die Mutter blickte sich um, was den Sohn dazu veranlaßte, weiterzulügen: Das Eichhörnchen sei leider bereits Richtung Waldrand verschwunden.
Daß er doch eigentlich nicht gerne lüge, dachte der Sohn, daß er alles in allem in seinem Leben auch nicht allzuhäufig gelogen habe, daß die Belogenen aber so gut wie immer Frauen gewesen seien. Wieso eigentlich? Und wen hatte er mehr belogen: Verena? Oder seine Mutter? Im Moment jedenfalls war wieder die Mutter dran.
»Ein ganz großes, fuchsrotes Eichhörnchen, das sich während der Sprünge von Baum zu Baum auch noch mehrfach um seine eigene Achse gedreht hat.«
»Tiere hast du schon als kleiner Junge geliebt«, erwiderte die Mutter. »Als wir das erste Mal im Zirkus waren, dein Vater, du und ich, da wolltest du hinterher unbedingt ein Zebu sein.«
»Ein Zebu? Du meinst, ein Höckerrind?«
Der Sohn konnte sich nicht an einen solchen Wunsch erinnern; doch traf das nicht für so gut wie all das zu, was sich während seiner ersten Lebensjahre ereignet hatte? Und berechtigte ihn der Umstand, daß seine Mutter völlig frei über seine frühe Biographie verfügen konnte, nicht dazu, den Rest seines Lebens nach eigenem Gutdünken so zu modeln, daß sie keine Handhabe fand, das, was aus ihm hätte werden können, anklagend neben das zu halten, was aus ihm geworden war?
»Nein, kein Höckerrind, ein Zebu. Du warst ganz versessen darauf, ein Zebu zu sein. Aber noch lieber warst du natürlich ein Flügel-Pua.«
»Ein Flügel-Pua?« fragte der Sohn hilfreich, obwohl er die Geschichte schon häufig gehört hatte.
»So nanntest du den Pegasus auf dem Giebel des Posener Stadttheaters. Du hast vor Begeisterung geschrien, wenn du ihn sahst. Und du wolltest unbedingt ebenfalls ein Flügelpferd werden. Ich mußte dir im Badezimmer zwei Waschlappen auf die Schultern legen, das waren die Flügel, du warst das Pua, und zusammen ergab das alles ein Flügel-Pua.«
Du kannst mir viel erzählen, dachte der Sohn und wußte selber nicht so recht, ob er das versöhnlich oder anklagend meinte. Wie um sich für diese Unsicherheit zu bestrafen, nahm er noch ein Stück Kuchen. Oder tat er es, um sichtbar Abbitte für seine schwankenden Gedanken zu leisten? Oder schlicht aus Freßsucht?
Der Sohn, der sich bereits seit längerer Zeit damit abgefunden hatte, daß alledem bodenlose Flachheit eignete – seiner Geschichte, seinen Gefühlen, seinen Motiven –, war zutiefst überzeugt von der Nutzlosigkeit jeglicher Selbstbespiegelung, doch in Gegenwart der Mutter boten selbst scheinbar gesichertste Erkenntnisse keinerlei Schutz. Wie der Bespiegelung entgehen, wenn man einem Spiegel gegenübersaß, ganz gleich, ob der nun verzerrte oder schönte?
Wie von der eigenen Geschichte absehen angesichts ihrer fleischgewordenen Quelle? Die Mutter hatte ihn als Flügel-Pua gesehen, nun sah er sich unwillkürlich auch so, als schmächtigen, lächerlich dekorierten Knaben, der nackt auf dem Bauch lag und danach verlangte, ein anderer zu sein. Der freilich wäre er heute auch gerne gewesen. Aber was war dieser andere eigentlich für einer?
»Du willst keinen Kaffee mehr«, fragte die Mutter, und der Sohn nickte bestätigend. »Nein danke, keinen Kaffee mehr.«
»Dann räum’ ich mal ab, damit du ungestört weiterarbeiten kannst.«
Der Sohn dankte und schaute der Mutter dabei zu, wie sie langsam das Geschirr auf das Tablett stellte. Ihre Hände zitterten leicht, und das leise Klirren, das ihren Gang ins Haus begleitete, trieb ihm erneut Tränen in die Augen.
»Ich bin heute ziemlich nah am Wasser gebaut«, dachte er und hätte sich für diesen Ausdruck ohrfeigen können. Wo kam der nun wieder her? Von ihr hatte er den nicht, in diesem Punkt wenigstens war die Mutter unschuldig. Ob Verena ihn in sein Leben und Denken eingeschleppt hatte? Das sähe ihr eigentlich sehr ähnlich, überlegte er und befahl sich, auf andere Gedanken zu kommen. Er schloß die Augen und hielt den Kopf der Sonne entgegen. Wind, Wärme, Waldhorn, dachte er. Zwanglos alliterierend hängte sich »Verena« an. Seufzend griff der Sohn zum Cassell’s.
»horny – hornig, hörnern, hornartig«.
»Horny Girls« wären demnach »Hornartige Mädchen«, eigentlich gar nicht so schlecht. Laut seinen Exzerpten hatte sich der Langenscheidt zwar weniger etepetete angestellt, war aber ebenfalls nicht ganz auf der Höhe der Zeit: »hornig, schwielig, geil (Mann)«.
Im Buch jedoch gaben ohne Frage geile Mädchen den Ton an: »Jodi und Rosa können nicht genug von dem guten, guten Stoff bekommen. Sie lieben es, wenn Männer sie hart hernehmen, stramme Liebhaber, die sexuell verkommen sind.« Da würde ihnen eine hornartige Beschaffenheit eigentlich ganz gute Dienste leisten, dachte der Sohn und wunderte sich zugleich darüber, wie der Klappentext den Inhalt des Werks referierte.
Soweit er das Buch kannte, und er kannte immerhin bereits elf Kapitel, waren die Männer bisher stets Opfer gewesen, die reichlich unschuldige, wenn auch willige Beute noch jungfräulicher Mädchen, die sehr bestimmte Vorstellungen davon hatten, wozu Männer gut waren und wie weit die Kerls gehen durften. Einstweilen jedenfalls. Denn nun schien die neunzehnjährige Jodi die Vorspielchen leid und drauf und dran zu sein, ihren sechsundvierzigjährigen, verwitweten Vater Wallace zu verführen. »The family that lays together stays together«, hatte Robert Crumb einst gedichtet und dazu eine fröhlich ineinander verschränkte amerikanische Durchschnittsfamilie gezeichnet – der schien diese Jodi nacheifern zu wollen. Daß der Crumb-Vers ein schönes Motto für das Buch wäre, dachte der Sohn, wohl wissend, daß er damit bei Nagel nicht durchkäme. Der hatte ihm bereits in der Probeübersetzung der ersten zehn Seiten jeden Scherz gestrichen, darunter einen, dem er wirklich nachtrauerte: »All characters and events depicted in this book are purely fictitious« – »Alle Personen und Ereignisse, die dieses Buch schildert, sind immer rein ficktief.«
»Jux ist Jux, und Sex ist Sex«, hatte Nagel während der Korrektur gesagt und hinzugefügt: »Ich verlege keine Literatur, ich verlege Pornos. Des Amerikanischen scheinst du ja mächtig zu sein, also halte dich bitte auch an den Wortlaut. Cunt übersetze bitte immer mit ›Fotze‹. ›Möse‹ oder gar ›Muschi‹ verniedlichen den Körperteil, ›Scheide‹ oder ›Vagina‹ bringen ihn auf medizinisches Niveau runter. Unsere Leser wissen gottlob noch, was sie wollen, und genau das sollen sie auch kriegen. Sie wollen ›Fotze‹, ›Schwanz‹ und ›ficken‹, daher werden sie nicht mit ›Bärchen‹, ›Glied‹ oder ›vögeln‹ abgespeist. Gott erhalte ›Fotze‹, ›Schwanz‹ und ›ficken‹, Wörter mit einem wundersamerweise immer noch unverbrauchten Wallungswert, welcher allein dafür sorgt, daß die guten alten Verbalpornos bis auf den heutigen Tag sich haben halten können. Ein aussterbendes Genre, mein Lieber, nur dank ›Fotze‹, ›Schwanz‹ und ›ficken‹ noch nicht ganz vom Erdboden verschwunden! Spätere Zeiten werden dieser Literatur nostalgische Anthologien widmen und demutsvolle Doktorarbeiten! Dann, wenn der durchschnittliche Pornophile, total verkabelt und durch computergesteuerte Elektroden erregt, vor dem Monitor sitzt und sich das synchron ablaufende Video reinzieht, auf welchem die immer näher rückende Frau ihm zuflüstert: ›Und jetzt greif’ ich dir an die Eier … Oh, ich liebe es, dir an die Eier zu greifen, du hast so feste Eier … Wie muß sich da erst dein Schwanz anfühlen, bitte, bitte, laß mich deinen Riesenschwanz fühlen‹ – ein Riesenmarkt, der sich da auftut! Allerdings auch einer, der Rieseninvestitionen erfordert! Da werden wir Billig- und Verbalwichser nicht mehr mithalten können, da wird der Sprachkick nur noch einer von vielen sein: Vor deinen Augen öffnen sich die schimmerndsten Schenkel, erweitert der Spalt sich der feuchtesten Fotze, zugleich stülpt kontrahierend ein warm gleitender Zylinder sich über deinen Schwanz, und während die sekretierende, motorisch betriebene Röhre unendlich einfühlsam sich rauf und runter bewegt und die vollsynchronisierten Eierkribbler deinen Eiern tausend unendlich lustvolle Impulse geben, Feinstreize, von denen eine naturgemäß grobe Frauenhand nur träumen kann – während dies bereits bis zum Zerspringen dich aufgeilt, ertönt zu alledem auch noch die rauchigste aller verworfenen Weiberstimmen oder, falls du es gern jungfräulich hast, als Kontrastprogramm das brüchigste und hingebungsvollste Mädchengepiepse, und all das flüstert, stöhnt und schluchzt stereo in deinem Kopf: ›Halt mich, nimm mich, fick mich!‹ Und das sind nur zwei von x möglichen Programmen! Denn du selber hast es ja in der Hand, ob du manuell oder maschinell befriedigt wirst, ob Mädchen oder Frauen, Knaben oder Männer sich dir hingeben oder dich hernehmen, ob Schwarze oder Weiße, Braune oder Gelbe, ob sie es in deutsch oder englisch oder in sonst einer Sprache des Erdballs tun, ob dezent oder indezent, ob stöhnend vor Erwartung oder fluchend vor Erregung, während du immer lüsterner Knöpfe drückst und Hebel umlegst, um dir immer entschiedener deinen ganz speziellen Cocktail zusammenzumixen – es ist ja alles kompatibel, Arsch und Schwanz oder Schwanz und Mund, Mund und Arsch oder Arsch und Vibrator, Vibrator und Fotze oder Fotze und Mund« – der Sohn hatte dem Obszönitätenschwall des Verlegers scheinbar ungerührt zugehört, manchmal in sich hineingelächelt, wenn er Adorno-Anklänge aus dessen, wie erzählt wurde, äußerst radikaler Studentenzeit herauszuhören glaubte, und häufig verstohlen zu den Nachbartischen hinübergeschaut. Doch obwohl sein Gesprächspartner eine nicht nur derbe, sondern auch laute Sprache führte, war offenbar keiner der Gäste des Cafés auf sie aufmerksam geworden, und nun, da sie zum Abschluß des Treffens Geschäftliches erörterten, drohte ohnehin keine Gefahr mehr.
Ob er ihm den ganzen Schrott bis Mitte Mai, bis zum 15. Mai, genau gesagt, übersetzen könne? Ach nein, das sei ja der Pfingstmontag. Aber am 16. Mai müsse er das Manuskript in Händen haben, hundertprozentig, darauf könne er sich doch verlassen, oder?
Der Sohn hatte Nagel beruhigend zugenickt und den Vorschuß eingesteckt. Er war bereits seit geraumer Zeit ohne feste Anstellung und brauchte das Geld.
»Ich bin froh, daß du wieder schreibst«, sagte die Mutter, während sie ihr Strickzeug aufnahm. »Ich hatte schon immer das Gefühl, daß du dich in dieser Zeitung nicht richtig entfalten konntest.« Die Zeitung war ein Stadtblatt, dem ein neuer Besitzer ein drastisches Sparprogramm verordnet hatte, und der Sohn, zuständig für Film und Fressen, war eines der ersten Opfer gewesen.
»Es gehört bestimmt Mut dazu, eine solch sichere Existenz aufzugeben. Aber du hast schon immer deinen eigenen Kopf gehabt. Worum geht es denn in deinem Roman?«
Der Sohn machte eine vage Handbewegung. Die Handlung müsse sich entfalten, da er niemals nach Plan auf ein feststehendes Ziel hin schreibe, sich vielmehr selber von seinem Text und dessen Entwicklung überraschen lasse.
»Hast du denn schon einen Verlag für dein Buch?«
Es gebe da Interessenten, sagte der Sohn und verwünschte sich dafür, daß er der Mutter jemals etwas von einem Roman erzählt hatte. Was ging es die eigentlich an, woran er gerade schrieb? Nun saß er in selbstverschuldeter Zwickmühle. Einerseits hatte er erst etwa 90 der 180 Seiten übersetzt, während der Pfingsttage würde er unablässig ins Original und hin und wieder auch in den Cassell’s schauen müssen, andererseits galt es, den Schein des Originalautors zu wahren. Was, wenn die Mutter Verdacht schöpfte? Was, wenn sie ihn in Verkennung der Fakten mit Englischproblemen befaßt wähnte, die er für den Fortgang der Romanhandlung zu bewältigen hatte? Was, wenn sie ihm ihre vielfach bewährte, staatlich diplomierte Übersetzungshilfe anbot? Der Sohn fluchte halblaut.
Er hätte sich natürlich nach oben verfügen können, in das Zimmer seiner Jugend, doch war ihm der Gedanke unangenehm, aus klarer Luft und heilender Wärme in jenen beengten Raum zu wechseln; und die Vorstellung, dort, am Schauplatz längst versunkener, selbstvergessener Ausschweifungen, die immer ausschweifendere Geschichte von Jodi und Wallace und Rosa und Paul zu Papier bringen zu müssen, ließ ihn schaudern.
Obgleich der Sohn das Berechnende seiner Vorlage spöttisch durchschaute, und das Berechenbare jedweder Pornographie fast verächtlich belächelte, hatte er beim Übersetzen doch immer wieder die kränkende Erfahrung machen müssen, daß sein Körper sich wenig um die Einsichten seines Kopfes scherte. Aber war das wirklich der Körper, der sich da so selbstherrlich über Kunstverstand, guten Geschmack und besseres Wissen hinwegsetzte? War der nicht lediglich ausführendes Organ des von Wort und Bild gereizten Hirns? Lag da nicht der Kopf mit sich selbst im Widerstreit, indes der Körper und die Schwellkörper willig die unterschiedlichsten Befehle ausführten, mal Blut ins Gemächte pumpten, mal klaglos das eben Gepumpte wieder abführten – uns doch egal, ob es Schwanz oder Hirn versorgt …?
Der Sohn, der nur zu gut wußte, daß auch keine noch so bemühte Reflexion ihn vor einer Erektion bewahren konnte, hatte beschlossen, letzterer dadurch zu begegnen, daß er in seiner Übersetzung die four letter words vorläufig aussparte, jene in der Tat fast stets vierbuchstabigen Reizsignale, die den Text verläßlich durchzogen, da es von Seite eins an stets um das eine gegangen war, also auch um jene Körperteile und Tätigkeiten, die dem einen dienten: cock, ball, cunt, suck, womb, tits, knob, fuck, poke und, last, not least, sein Sorgenkind come. Wie nur sollte er come übersetzen? Der Langenscheidt hatte nicht weitergeholfen, und natürlich fehlte auch in den zweieinhalb Spalten, die der Cassell’s diesem Suchwort widmete, jenes Substantiv, das im Text unfehlbar dann auftauchte, wenn Rosa sich wieder mal Pauls cock angenommen hatte.
Ich hätte zur Sicherheit Nagel fragen sollen, dachte der Sohn, möglicherweise kennt der ein weniger klinisches Wort als Sperma. Doch ob die deutsche Sprache überhaupt mit einem solchen Begriff aufwarten kann?
Mit einem Blick auf die Mutter ordnete der Sohn seine Papiere, dann setzte er die Sonnenbrille auf und griff zum Kugelschreiber. Ein Elsternschrei ließ ihn hochschauen. Gleißend landete der Vogel auf der Fernsehantenne, mit angelegten Flügeln stürzte er in den Nachbargarten, erst kurz vor Erreichen des Erdbodens bremste er seinen Flug. Ein fast demonstrativ lässig ausgeführtes Manöver, das den Sohn an die Turmsprünge seiner Jugendzeit erinnerte, an Negerköpper vom Dreier und vorgebliche Bauchklatscher vom Fünfer, die sich, zur Freude feixender Freunde und angesichts hoffentlich banger Bewunderinnen, im letzten Moment in Arschbomben oder ähnliche Juxfiguren verwandelten.
Daß die Elster zur Arschbombe nicht imstande sei, dachte der Sohn, dafür freilich konnte sie weiterfliegen. Fast neidisch sah er ihr dabei zu, wie sie beschwingt Höhe gewann und mehr gleitend als flügelschlagend das Weite suchte.
Es sei doch wunderschön, fragte die Mutter, und dem Sohn blieb nichts anderes übrig, als bestätigend zu nicken.
Wann er denn zu Abend essen wolle? Er zuckte die Achseln. Ob er einen speziellen Wunsch habe? Er schüttelte den Kopf. Es sei doch recht, wenn sie drinnen äßen? Er nickte abermals. Dann gehe sie schon mal in die Küche. Der Sohn lächelte aufmunternd und sah der Mutter erleichtert nach.
Kaum daß sie fort war, las er die letzten Seiten seiner Übersetzung, und sogleich fiel ihm wieder ein, mit welch unguten Gefühlen er dem Fortgang seiner Arbeit entgegengeblickt hatte. Die hatte er wegen der Sache mit Verena für fast eine Woche unterbrechen müssen, nun erinnerte er sich wieder daran, wie widerwärtig ihm das alles gewesen war, nicht nur die dreist spekulative Art, mit der sich da geile Mädchen nach strammen Schwänzen verzehrten – Rosa nach dem von Paul und Jodi nach dem ihres Vaters –, sondern auch die Tatsache, daß all der Dreck ihn nicht unberührt gelassen hatte. Am peinlichsten aber waren seine Rechtfertigungsversuche ausgefallen, als Verena erfahren hatte, was er da übersetzte. Das seien doch alles unheimlich starke, selbstbestimmte Frauen, die sich frei von Vorurteilen ihre Lust dort suchten, wo es ihnen paßte, hatte er beteuert, und schamrot erinnerte er sich an seinen letzten tölpelhaften Vorschlag, mit Verena zu schlafen, ein Ansinnen, das auf nur zu berechtigte Verwunderung gestoßen war: »Das haben wir doch nun wirklich hinter uns!«
Das und alles andere auch, dachte der Sohn, mit Jan dagegen hat sie das alles noch vor sich, bis auf das eine natürlich, das treiben die ja schon seit einem dreiviertel Jahr. Diese Schweine!
Er befahl sich, nicht mehr daran zu denken, und griff zum Buch, doch die Zeilen verschwammen vor seinen Augen. Nicht daran denken, während er einen Porno übersetzen mußte! Nun lief auch noch die Nase. Rotz und Wasser, dachte er, Schmerz und Trauer. Selbstmitleid und Eigenliebe, widersprach er sich und griff zum Kugelschreiber.
»12. Kapitel«, übersetzte er, »Jodi streckte sich auf der Couch aus, ihren Kopf auf die Schenkel ihres Vaters gebettet. Ihr Gesicht war nun nur noch Zentimeter von seinem entfernt. Wallace hatte sich in seinen Abendanzug geworfen, und Jodi platzte fast vor Neugierde. Trug er nun Unterhosen oder nicht? Wahrscheinlich ja, dachte sie. Alter Racker« – aber bedeutete meany überhaupt dergleichen? Der Cassell’s kannte lediglich mean, ein Wort, zu dem er freilich gleich zwölf Bedeutungen beizusteuern wußte. Adjektive, die der Sohn mit jähem Erkennen allesamt an seine Adresse gerichtet sah: »gering, unbedeutend, gemein, schäbig, geizig, knausrig, filzig, knickrig, niedrig, ärmlich, armselig, erbärmlich«. War meany nach alldem nicht eher ein Geizkragen? So knausrig, daß er sich zwar einen Abendanzug, jedoch keine Unterhosen leistete? Der Sohn rätselte erst, dann stutzte er. Dressing gown – war das überhaupt ein Abendanzug? Hier nun wußte der Cassell’s Rat, unvermittelt sah sich der Vater des Anzugs entledigt und in einen Morgenrock gesteckt, was die Phantasien der Tochter sogleich plausibler machte: »Alles, was ich will, ist, ihn zu fühlen, ihn etwas liebhaben zu können. Sie konnte sich seinen in ihren Händen vorstellen, den schweren zwischen seinen Beinen, wie sie ihn streichelte und herzte.« – Eine Tochter, die den cock ihres Vaters herzt! Die reinste Gartenlaube, Nagel würde sie ihm hohnlachend um die Ohren schlagen! Soll er doch, dachte der Sohn mit fast fröhlichem Abscheu und hätte den Spaß liebend gern dadurch noch weiter getrieben, daß er cock durch jenes Wort ersetzte, mit dem man sein Glied in seinen Kindertagen bezeichnet hatte, durch »Lingelang«. Man? Sie hatte ihn so genannt, weiß der Himmel aus welchen Gründen. Ihn? War er für sie nicht »das« Lingelang gewesen? Hatte sie ihr unverkennbar männliches Kind etwa mit einem sächlichen Geschlecht ausgestattet und aufwachsen lassen?
Im unabweisbaren Gefühl, auf einer heißen Spur zu sein, versuchte der Sohn sich daran zu erinnern, welch andere, teils private, teils öffentliche Kosenamen ihm für den Penis einfielen, und stets waren sie erwartungsgemäß männlichen Geschlechts: der Schniepel, der Pimmel, der Zups, der Schniedelwutz; wenn sie nicht sogar das Maskuline des männlichen Gliedes unverstellt hervorhoben: der Ziesemann, der Pillermann. Wie zweideutig sich daneben das Lingelang ausnahm. In welche Doppelrolle er bereits in frühester Kindheit gedrängt worden war! Wieso eigentlich?
»Sie sah den scharfen Strom seines Pimpersafts vor sich, der aus seinem Lingelang herausspritzte. Sie wollte ihn schmecken, seinen kostbaren Pimpersaft, sie wollte spüren, wie sein Lingelang in ihrem Mund schrumpfte, nur, um es danach wieder anschwellen zu fühlen. Seitdem sie gesehen hatte, wie er nach seiner Rückkehr ins Bad gegangen war, hatte Jodi vom Lingelang ihres Vaters geträumt. Selbst als Rosa heute morgen ihr Kätzchen gegessen hatte« – der Sohn brach ab. Für diesen Scherz hatte ihn Nagel bereits gerügt, als sie die Probeübersetzung durchgegangen waren, sofern er ihn denn überhaupt als Witz begriffen hatte: »Wenn Jodi ›Eat me‹ sagt, dann meint sie ›Leck mich‹. ›Eat my pussy‹ bedeutet demnach ›Leck meine Fotze‹ – klar?« – »Klar«, hatte der Sohn geantwortet. Fick dich doch ins Knie, dachte er nun. Niemand kann mich dazu zwingen, diesen inzestuösen Irrsinn auch noch mit Herzblut zu übersetzen. Niemand kann mir Stilvorschriften machen und Abgabetermine einklagen. Niemand kann von mir verlangen, daß ich diesen Dreck überhaupt in die Sprache Luthers und Goethes übertrage. Niemand.
Da war die Elster wieder. Wunderbar landete sie auf der schön leuchtenden Kiefer.
Daß ja auch niemand das alles von ihm verlangte, dachte der Sohn. Daß er seine Dienste selber angeboten hatte, weil der Mensch ja leben mußte, und daß er eine korrekte Übersetzung zum vereinbarten Termin abgeben würde, da Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit Tugenden waren, die man nicht ungestraft mit Füßen trat. Erledigte er dagegen diesen Auftrag zufriedenstellend, so hatte ihm Nagel weitere Aufgaben in Aussicht gestellt. Noch mehr cocks und cunts, tits und balls! Den Sohn schauderte.
Aus dem Nachbargarten war bereits seit geraumer Zeit Geräusch und Geruch herübergedrungen, da wurde gegrillt und geredet. Nun mahnte eine Frau eindringlich zur Ruhe, worauf die vorwiegend jungen Menschen sich an den Händen faßten und singend bekundeten, wie das Wasser sein zu wollen, da das weiche Wasser den Stein bezwinge. Über schlichten Gitarrenakkorden und wenig moduliertem Jungmännerbrummen erhoben sich die zweiten und dritten Stimmen der Mädchen, ein eingeübter Chor von bezwingender Einfalt und tränentreibender Berechnung. Eine Hecke trennte die Grundstücke, doch die wies Löcher und kahle Stellen auf, so daß der Sohn die Szenerie im großen ganzen überblicken konnte: den Rauch, der vom Grillgerät aufstieg, die Lampions zwischen den Bäumen, die sommerlich gekleideten Jugendlichen im so vorteilhaften Helldunkel von blauem Schatten und rotgoldenem Abendlicht. Ein schwarzhaariges Mädchen stand in der Mitte des sitzenden Menschenkreises und schlug die Gitarre, im Takt wippte sie dabei auf und nieder. Unerwartet deutlich, fast schneidend, hob sich ihre Stimme von denen der anderen ab.
»Berühre meine Brüste, Vati, dachte sie. Nur ein wenig. Du mußt sie nicht anpacken, laß einfach deine Hände auf ihnen ruhen. Fühl, wie die Warzen sich dir entgegenrecken …« Es geht nicht, dachte der Sohn, es geht nicht! Seit wann reckten sich Warzen entgegen? Aber was machten Warzen statt dessen?
Aufblickend nahm er wahr, wie die Gitarrenspielerin ins Licht trat, wie sich sogleich unter der Friedenstaube ihres T-Shirts Verheißungsvolles rundete und wie die späte Sonne auch noch der kleinsten Erhebung zu lockender Deutlichkeit verhalf.
»Piroggen muß man warm essen«, sagte die Mutter, die in der Verandatür stand. »Aber ich kann sie auch später noch einmal aufwärmen. Natürlich schmecken sie dann nicht mehr so gut.«
Der Sohn ordnete hastig seine Papiere und beeilte sich zu versichern, daß er die Piroggen sogleich und frischgebacken verzehren wolle, auch die Kohlsuppe müsse ja heiß gegessen werden. Gebannt sah er bei diesen Worten die Brüste der Sängerin ein letztes Mal aufglühen, bevor ein fast violetter Schatten all das erregende Relief endgültig einebnete.
»Die tollen wie das Wasserschwein«, sagte er und folgte der Mutter ins Wohnzimmer.
»Ja, die Frau Schäble hat sich sehr in der Friedensbewegung engagiert«, erwiderte sie. »Hoffentlich stört dich das nicht bei deiner Arbeit!«
Der Sohn breitete die Arme aus. »Wenn’s der Sicherung des Friedens dient!«
Er blickte auf den Tisch, da hatte alles seine Ordnung. In den vertrauten Steingutschalen der rote Borschtsch, aus welchem ein noch fast festumrissener, jedoch erkennbar ins Formlose drängender Klacks saure Sahne strahlend herausleuchtete. Auf dem glänzenden Teller, dem durch alle Fluchten wundersamerweise geretteten Überbleibsel des einst so vielteiligen Familiensilbers, das mit Hackfleisch und scharfem Fisch gefüllte Gebäck. Die Weinflasche schließlich, natürlich ein Trollinger, neben der ein Korkenzieher lag. Der Sohn schickte sich an, die Flasche zu öffnen, die Mutter verharrte stehend. »Vielleicht trinkst du gar keinen Wein mehr.«
»Aber natürlich trinke ich Wein«, versicherte der Sohn.
»Das war einmal dein Lieblingswein.«
»Das ist immer noch mein Lieblingswein«, sagte er fast beschwörend und goß sich zum Beweis ein randvolles Glas ein. »Zum Wohl, Mutter. Setz dich doch! Alles wird kalt!«
Als der Sohn zum Frühstück herunterkam, erwartete ihn die Mutter mit einer Überraschung. Sie reichte ihm ein Heft und weidete sich an seinem Erstaunen darüber, daß diese Kladde überhaupt noch existierte. Sie habe doch alles von ihm aufgehoben, seine ganzen frühen Aufsätze und Gedichte. Das da habe sie erst kürzlich wiedergelesen, und wieder einmal sei ihr bewußt geworden, wie früh bereits sich seine große Sprachbegabung gezeigt habe. Der Sohn blätterte wortlos in dem Heft, das er, vermutlich als Sechzehnjähriger, mit Versen gefüllt hatte, die er nun, nach anfänglichem Widerwillen, mit respektvoller Rührung, ja gerührtem Respekt las. Alles aus zweiter Hand, gewiß, ein Gemenge aus frühem Brecht, spätem Benn und weniger deutlichen Ingredienzen, aber nicht schlecht gemacht. Frühreif, dachte der Sohn, während er fast reflexhaft Hebungen zählte, Reimwörter prüfte und Versformen kontrollierte. Daß er schon damals Inhalte eher dazu benutzt und gebraucht habe, sich zu bedecken, statt sich zu entblößen, dachte er, und das bereits als Pubertierender, zu einer Zeit also, in welcher der Riß sich endgültig aufgetan hatte, der ihn noch heute spaltete, der Abgrund, welcher, offenbar unüberbrückbar, das Begehren von der Erfüllung schied, das Ich vom Anderen, die Person von der Welt. Damals spätestens war ihm klargeworden, daß er nie ein Flügel-Pua werden würde, statt dessen hatte er jenes Geschöpf gesattelt, welches der Sage nach jeden Riß zu überqueren vermochte, den Pegasus. Daß er das Tier auf Anhieb recht kunstvoll zu reiten verstanden hatte, dachte der Sohn, es aber immer gezügelt, ihm niemals wirklich die Sporen gegeben habe. Daß sich für solch ängstliche Zurückhaltung unschwer eine Ursache finden ließe, überlegte er, wagte er nur einen mitleidlosen Blick auf seine Anfänge ebenso wie auf jene, die versucht hatten, Richtung und Ziel seiner Entwicklung mitzubestimmen. Daß es bei solcher Überprüfung nicht um Schuld gehe, sicherlich aber um Verantwortung, dachte er blätternd, da überraschten ihn vier Zeilen auf einer sonst leeren Seite:
Als ich in tiefen Leiden
verzweifelnd wollt ermatten
da sah ich deinen Schatten
hin über meine Diele gleiten
Er blätterte angeregt um, doch zu seiner Enttäuschung folgten keine weiteren Verse. Schade, dachte er und las die Strophe noch mal, das ist nicht schlecht, wirklich, damals war ich manchmal wirklich gut.
Das Telefon klingelte, für einen Moment fürchtete der Sohn, Verena könnte am Apparat sein. Doch noch bevor er aufstehen konnte, hatte die Mutter bereits »Das ist sicher Wolf!« ausgerufen und abgehoben: »Wolf, bist du es?« Es war Wolf, der jüngere Bruder, der in Genf als Physiker arbeitete und nun anrief, um der Mutter ein frohes Pfingstfest zu wünschen. Die kam ganz erfüllt zum Frühstückstisch zurück. Wolf gehe es gut, er bestelle ihm, dem älteren Bruder, schöne Grüße und beste Wünsche, sie habe auch Wolf von ihm gegrüßt. Der werde heute und morgen glücklicherweise mal ausspannen können, eigentlich sei das ja trotz aller Erfolge, Reisen und des hohen Einkommens kein Leben, das er da in der Schweiz führe, immer nur Arbeit und keine Familie, nicht einmal eine Frau, wieviel besser er es da doch mit Verena habe. Der Sohn nickte halbherzig und gab der Mutter das Heft zurück. Da er wußte, wie stolz sie auf Wolfs Erfolge war, litt er jedesmal mit ihr, wenn sie diese in seiner Gegenwart herunterspielte und im Gegenzug die Verdienste des Älteren herausstrich oder all das gluckenhaft zusammenkratzte, was ihr irgend geeignet schien, ihm ein wenn auch noch so bescheidenes Postament zu errichten, einen Denkmalssockel, auf welchen sie ihn stellen konnte, damit er, so erhöht, der Welt, vor allem aber ihr selber, halbwegs repräsentabel erschien. Früher hatte ihm diese Fürsorge geschmeichelt, ja es hatte sogar eine Zeit gegeben, in welcher er sich von der Mutter vollkommen zu Recht herausgehoben fühlte, wenn auch nicht im Hinblick auf Geleistetes, so doch als Vorschuß für jene Taten und Werke, die er ohne Frage leisten und schaffen würde, sobald ihm nur etwas Zeit für sich selber bliebe. Doch irgendwann waren ihm erste Zweifel gekommen, teils an seiner Befähigung, jemals einen Sockel rechtfertigen zu können, teils an der Lauterkeit der mütterlichen Motive. Wollte die denn wirklich aus ihm einen Goethe machen? Nicht vielmehr aus sich eine Mutter Aja, die fortan im Gefolge des berühmten Sohnes Einzug halten konnte in Biographien, Briefbände und Literaturgeschichten?
»Du willst jetzt sicher arbeiten«, fragte die Mutter, stand aber noch nicht auf, sondern blätterte demonstrativ im Heft. »Du hast früher so schöne Gedichte geschrieben. Schreib doch mal wieder Gedichte!« Der Sohn, der seit dem mehr als zwanzig Jahre zurückliegenden Abitur nicht mehr gedichtet hatte, wies mürrisch darauf hin, daß ihm seine Prosa schon genügend zu schaffen mache. Vor der Arbeit aber wolle er noch rasch ins Bad fahren – ob er das Fahrrad der Mutter nehmen könne?
Er kehrte bald zurück. Er habe ja nur einige Runden schwimmen wollen, sagte er, und schwieg von all dem, was ihm das Schwimmbad seiner Jugend so rasch und gründlich verleidet hatte: die 50-Meter-Bahn, die er einst in einem Durchgang tauchend geschafft hatte, der Sprungturm, von dessen Brettern ihm die tollsten Kapriolen gelungen waren. Noch bedrängender als solch umflorte Vergangenheit freilich war ihm die Gegenwart zu Leibe gerückt in Gestalt all der Familien, die ihm an allen Ecken und Enden des Bades, auf Liegewiesen und Sonnenbänken, unbarmherzig vor Augen geführt hatten, wie vollkommen verbraucht die meisten der Eltern neben ihren Kindern wirkten, so, als gehörten sie eigentlich zwei gänzlich verschiedenen Arten an, hier die Unförmigen, Unschönen, Ungelenken, dort die Geschmeidigen, Glänzenden, Glatten. Für die maliziöse Pointe schließlich sorgte der große Spiegel neben den Umkleidekabinen, in welchen er nach dem kurzen Bad geschaut hatte, getrieben von der wirren Hoffnung, das bißchen Sport müsse seine Erscheinung auch ein bißchen zum Sportlichen hin verändert haben: Daß so gar kein Zweifel daran möglich war, zu welcher Spezies der da gehörte!
Die Mutter empfing ihn geistesabwesend, fast bedrückt. Während sie den Geschirrschrank einräumte, schwieg sie derart beredt, daß der Sohn zähneknirschend in sie drang: »Ist was?«
Nein, nichts. Aber die kleine Kirsten sei doch zu Besuch hier, sie wohne bei Gudrun, und die nun habe angefragt, ob es recht sei, wenn sie nachmittags mal vorbeischauten. Das betreffe aber nicht ihn. Sofern er arbeiten wolle, könne er es selbstverständlich bei einer kurzen Begrüßung belassen, obwohl sich natürlich beide bereits sehr auf ihn freuten, besonders die kleine Kirsten.
»Mal sehen, wie ich vorankomme«, erwiderte der Sohn.
Er kam schlecht voran. Zu beruhigend wärmte die Sonne, zu ausdauernd saß die Mutter auf der Gartenbank. Strickend und in respektvollem Abstand zum Sohn zwar, doch so, daß sie ihn unter Kontrolle hatte. Immer häufiger legte der den Stift beiseite, immer öfter mußte er sich zur Arbeit anhalten. Daß die sich aber auch derart hinzog!
Auch für Jodi freilich liefen die Dinge vorerst nicht in die Richtung, in welche die liebende Tochter sie gerne gelenkt hätte und in die sie sich nach Lage der Dinge unweigerlich entwickeln mußten. Wallace, der liebevolle Vater nämlich, litt nach einem Überseeflug an der Zeitverschiebung, überdies waren die beiden in eine Feriensiedlung in den Rockies gefahren. Ein weiterer Grund für ihn, müde zu sein, und für sie, sich mittels der Dusche zu befriedigen. »›Bald‹, flüsterte sie, ›sehr bald.‹« Doch am nächsten Morgen ging es erst mal durch den sich langsam erwärmenden Wald, ein Spaziergang, den Vater Wallace zu Fotos seiner Tochter nutzte und sie zu immer nichtsnutzigeren Posen, »ihre Brüste nackt, ihre Brustwarzen sich in der kühlen Bergluft versteifend. ›Gefallen dir meine Brüste, Vati?‹ fragte sie ruhig. ›Sie sind wunderschön‹, sagte Wallace.«
Der Sohn spürte, wie sich auch bei ihm etwas versteifte. Er wußte sich durch Kleidung und Tisch einwandfrei geschützt und fühlte sich dennoch durchschaut, wann immer der Blick der Mutter sich von der Handarbeit ab- und ihm zuwandte. »Jodi drückte ihre Brüste zusammen und beugte ihren Kopf so weit hinunter, daß sie mit ihrer langen Zunge die aufgerichteten Warzen lecken konnte. Dann hob sie ihre Augen und schaute ihrem Vater ins Gesicht. Sie hielt ihre Brüste immer noch fest und ließ ihre Daumen über die harten Warzen laufen in einer langsamen, sinnlichen Weise (auf langsam sinnliche Art?). Nimm sie, Vati, dachte sie, drück sie. Saug sie.«
Eine feine Tochter, dachte der Sohn und hätte wohl selber nicht so recht zu sagen vermocht, ob das noch als ironischer Stoßseufzer zu werten war. Er hatte keine Kinder, die Mädchen aber, denen er vor einer Stunde noch im Schwimmbad nachgeschaut hatte, hätten vermutlich allesamt seine Töchter gewesen sein können. Wie hätte er wohl reagiert, wenn eines dieser straffen Wesen mit den Worten »Nimm sie, saug sie« vor ihn hingetreten wäre?