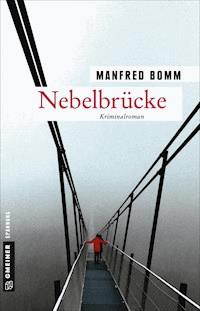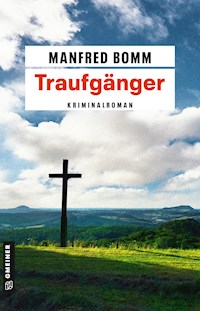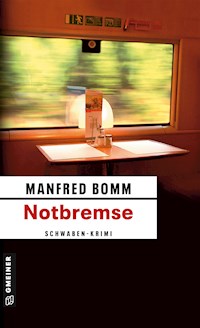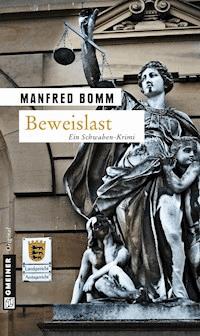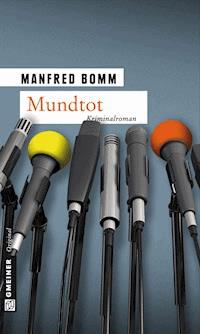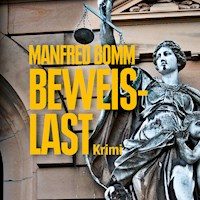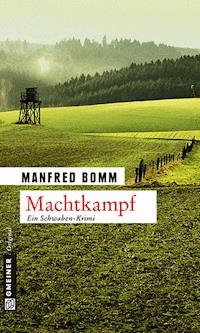
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar August Häberle
- Sprache: Deutsch
Das ländliche Idyll wird jäh zerstört: Der rätselhafte Selbstmord eines Viehhändlers erschüttert ein Dorf auf der Alb. Dass es sich um den besten Freund eines Großgrundbesitzers handelt, der nach den Hofgütern der kleinen Bauern trachtet, erweckt sofort den Argwohn von Kommissar August Häberle. Und als gegen den neuen örtlichen Pfarrer eine schwerwiegende Anschuldigung erhoben wird, tun sich menschliche Abgründe auf …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Manfred Bomm
Machtkampf
Der 14. Fall für August Häberle
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © pip / photocase.com
ISBN 978-3-8392-4324-4
Widmung
Gewidmet allen, die an ihrem Schicksal zu verzweifeln drohen, weil sie auf die Schattenseite des Lebens gedrängt wurden.
Möge ihnen der Glaube an das Gute, Gerechte und Positive wieder die Augen für das Wunderbare und Schöne dieser Welt öffnen.
Lassen wir uns nicht in den Strudel der allgegenwärtigen Horror- und Skandalmeldungen hineinziehen, die im Zeitalter der unübersichtlichen Nachrichtenflut ständig auf uns niederprasseln.
Mögen deshalb auch die Medien ihrer Verantwortung bewusst sein und sorgfältig abwägen können, was zur seriösen Information der Menschen dient und was den Einzelnen, der von einem üblen Verdacht bedroht wird, in tiefstes Unglück stürzt.
Wer trotz allem Schatten, der über seiner Seele liegt, an eine Macht jenseits unserer Vorstellungswelt glaubt, wird schon bald das Morgen in einem neuen Lichte sehen. Denn die Schöpfung lehrt uns: Auf jede finstre Nacht folgt ein neuer heller Tag.
1
»Wenn das an die Öffentlichkeit dringt, kann ich mich gleich begraben lassen.« Die Stimme des Mannes war schwach geworden und wollte nicht so recht zu seinem hünenhaften Erscheinungsbild passen. Er saß zusammengesunken auf dem unbequemen Stuhl, den ihm der Kriminalist angeboten hatte. »Und Sie müssen wirklich dieser unglaubwürdigen Anzeige nachgehen – ohne Rücksicht auf die Folgen, die das für mich haben wird?« Seine Stirn war schweißnass geworden. Er zitterte. »Sind Sie sich der Tragweite dessen bewusst, was dies bedeutet?«
Der Beamte, der vor sich einige Akten ausgebreitet hatte, ließ ein paar Sekunden verstreichen. »Wir müssen«, sagte er schließlich ruhig. Es klang bedauernd und geradezu väterlich. In all den Jahren, seit er für Sexualdelikte zuständig war, hatte Kriminalhauptkommissar Martin Wissmut ein Gespür für den Umgang mit Beschuldigten entwickelt, die plötzlich mit einem schockierenden Sachverhalt konfrontiert wurden. Der Mann, dem die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben stand, war bestimmt kein brutaler Vergewaltiger, keiner, der Frauen auflauerte und sie misshandelte. Es war ein bislang unbescholtener Mann, 63 Jahre alt, Familienvater noch dazu. Und was weitaus schlimmer wog: Er war Pfarrer. Es würde nicht mehr lange dauern, bis in dem kleinen Dorf, das ihm als evangelischem Seelsorger anvertraut war, jeder mit den Fingern auf ihn zeigte.
In der Stille, die sich breitgemacht hatte, war nur sein schwerer Atem zu hören. »Und jetzt?«, fragte er mit belegter Stimme. Sie wussten beide um die Dramatik dieses Augenblicks.
Wissmut sah in wässrige Augen. »Wir machen ein Protokoll und dann wird die Staatsanwaltschaft entscheiden, wie’s weitergeht.«
Der Mann strich sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. »Die Staatsanwaltschaft«, flüsterte er fassungslos. »Und das Kind? Der Bub? Das wird alles einfach so hingenommen?« Er rang nach Worten und hatte Mühe, die Fassung zu bewahren.
»Es wird ein Glaubwürdigkeitsgutachten geben«, erklärte Wissmut. »Und ich geh mal davon aus, dass auch die Mutter noch ausgiebig befragt wird.«
»Die Mutter«, wiederholte der Beschuldigte. »Warum kommt die denn nicht zu mir und redet mit mir? Warum geht sie gleich zur Polizei und erstattet Anzeige?«
Wissmut wollte nicht darauf eingehen. Er rückte seine Brille zurecht und wandte sich seinem Computerbildschirm zu. »Sie sagen also«, konstatierte er emotionslos, »dass Sie keine Erklärung dafür haben, wie es zu diesen Beschuldigungen kommen konnte.«
Sein Gegenüber nestelte am Kragen der Freizeitjacke und schlug die Beine mit den schmutzigen Schuhen übereinander. »So wahr mir Gott helfe – dafür gibt es keine Erklärung.« Er überlegte, während der Kriminalist auf der Tastatur zu tippen begann. »Ich bin fassungslos. Wie kann ein so kleiner, schwächlicher Bub so etwas erfinden? Das ist doch völlig irrational.«
Wissmut drehte sich um. »Sie haben ja gehört, was ich Ihnen vorgelesen habe. Die Mutter schildert es ziemlich detailliert. Nun kommt’s natürlich drauf an, was der Bub beim Kinderpsychologen sagt.«
Der Angeschuldigte schloss die Augen. Er versuchte, sich den kleinen Manuel vorzustellen. Schüchtern, verängstigt, kontaktarm. Kaum in der Lage, sich zu artikulieren. Ein Kind, das bisher wenig Zuneigung erfahren hatte und vermutlich vor dem Fernseher ruhiggestellt wurde. Wie konnte dieser Manuel etwas erfinden, das weit über die Vorstellungswelt so eines Kindes hinausging?
»Sie sagen also«, holte ihn die Stimme des Beamten wieder aus den Gedanken zurück, »dass Ihrer Ansicht nach die Behauptungen von Frau Kowick bezüglich der Vorkommnisse im Religionsunterricht frei erfunden sind.«
Pfarrer Dieter Kugler nickte und kämpfte mit aufkommender Übelkeit. Er spürte, dass er am Beginn eines langen Leidensweges stand. Wenn’s ganz schlimm kam, würde er ihn selbst beenden.
Es war ein warmer, aber gewittriger Herbsttag gewesen. Auf der Hochfläche der östlichen Schwäbischen Alb, irgendwo zwischen Heidenheim und Geislingen an der Steige, hatten die Felder bereits die bräunliche Farbe angenommen, die vom nahenden Herbst kündet. Der Landwirt, der nach einem kurzen Gewitterregen noch in der Abenddämmerung seinen abgeernteten Acker umpflügte, näherte sich mit seinem alten Traktor dem Waldrand. Zu dieser Stunde, wenn Anfang Oktober bereits kurz vor 19 Uhr die Sonne hinterm Horizont verschwand, konnte es vorkommen, dass er hier, weit abseits aller Ortschaften, äsendes Wild aufscheuchte.
Hans Melzinger, der sich trotz seiner 73 Jahre nicht von der kleinen Landwirtschaft trennen konnte, obwohl sie nur noch ein beschwerliches Hobby war, liebte diesen erdigen Duft, der sich beim Aufreißen des harten und steinigen Bodens mit der feuchten Abendluft vermischte. In Kombination mit dem Dieselruß des Traktors erinnerte ihn dies an jenen Geruch, der für ihn seit Kindheitstagen zum Herbst gehörte wie der anheimelnde Qualm eines Kartoffelfeuers.
Als das Waldeck näher rückte, schob sich ein olivgrüner Geländewagen in sein Blickfeld. Das Fahrzeug parkte neben dem Feldweg, der an dieser Stelle in eine Tannenschonung hineinführte. Melzinger kannte den Wagen und sah instinktiv zu dem mächtigen Hochsitz, der nur knapp 50 Meter davon entfernt in eine kräftige Eiche gezimmert war. Vermutlich saß der Eigentümer des Autos in der trutzigen Kanzel, die aus einer Holzkonstruktion samt Fenster bestand und gegen Wind und Wetter schützte. Dort oben, das wusste Melzinger, verbrachte Viehhändler Max Hartmann aus dem Nachbarort Böhmenkirch manchmal ganze Nächte. Und dies wohl nicht immer allein, munkelte man. Die Ausmaße des Hochsitzes, der eher an ein Baumhaus erinnerte, ließen jedenfalls vermuten, dass dies alles nicht nur dem Aufenthalt eines einsamen Jägers diente. Und weil Hartmann ein in Ehren ergrauter Junggeselle war, dazu noch ziemlich wohlhabend und naturverbunden, gab es Anlass für jede Menge Spekulationen.
Mit jeder Reihe, die der Landwirt in sein Feld pflügte, kam er näher an den Hochsitz heran. Obwohl die Dämmerung bereits hereingebrochen war, fiel ihm an der Fensterscheibe ein seltsamer Reflex auf. Bei der nächsten Vorbeifahrt hielt er deshalb an, um genauer hinsehen zu können. Eindeutig: Das Glas war zersprungen, ein Teil offenbar herausgebrochen. Doch so sehr er sich auch anstrengte, er konnte im Dunkel des Hochsitzes niemanden sehen. Melzinger zögerte kurz, trat dann aufs Gaspedal, hob den Pflug hinter sich hydraulisch an und schwenkte von seiner Route entlang der Furchen ab, um direkt auf den Hochsitz zuzusteuern. Nach wenigen Sekunden hatte er den Waldrand erreicht, stellte den Motor ab und lauschte. Doch da war niemand. »Max!«, rief er deshalb, so laut er konnte. »Max, bist du da?«
Keine Antwort. Nur das Zwitschern eines Vogels erfüllte die friedliche Abendstille.
Melzinger stieg von seinem Traktor und ging auf die stabile Holzleiter zu, die steil zu der seitlich angebrachten Tür des Hochsitzes hinaufführte.
Der Landwirt sah über die dicken, naturbelassenen Sprossen hinweg nach oben. Frisches, regennasses Erdreich haftete an den Tritthölzern.
»Max!«, rief er noch einmal, während er gleichzeitig bemerkte, dass die Tür des Hochsitzes einen Spalt weit geöffnet war. Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, bis ihm das Gesehene den Atem raubte. Denn was er dort oben, etwa vier Meter überm Boden, zu erkennen glaubte, schnürte ihm förmlich den Hals zu. Er wich instinktiv zurück. Obwohl das fahle Abendlicht alle Farben matt erscheinen ließ, bestand kaum ein Zweifel: Dort oben war eine rote Flüssigkeit auf die Leiter getropft. Blut?
Die Nachricht verbreitete sich in Rimmelbach und den umliegenden Ortschaften wie ein Lauffeuer. »Er hat sich erschossen – auf seinem Hochsitz«, stellte der alte Wirt des ›Löwen‹ betroffen fest. In den Herbstmonaten, wenn es frühzeitig dunkel wurde, galt der Stammtisch noch immer als beliebter Treffpunkt aller, die in dem 950-Seelen-Dorf etwas zu sagen hatten – oder dies zumindest glaubten. Der Wirt, ein knorriger Älbler, dessen von Wind und Wetter gegerbtes Gesicht tiefe Falten aufwies, war für all seine Gäste nur der ›Schorsch‹ und in der ganzen Gemeinde beliebt. Was draußen zwischen Rimmelbach und Böhmenkirch am frühen Abend geschehen war, hatte er wenig später vom örtlichen Feuerwehrkommandanten erfahren. Einsatzkräfte waren gerufen worden, um die Leiche aus dem Hochsitz zu bergen. Schorsch brachte der Männerrunde ein Tablett mit Hochprozentigem. »Hier«, sagte er, »damit uns das nicht auch noch auf den Magen schlägt. Nehmt euch einen.«
Ein halbes Dutzend fester Männerhände griff nach den Gläsern.
»Und wir alle haben gedacht, er lebe in Saus und Braus«, meinte einer aus der Runde, während er sein Glas mit einem Schluck leerte und es aufs Tablett zurückstellte.
»Du siehst an die Menschen halt nur ran, aber nicht rein«, kommentierte ein anderer. Schorsch, dessen Körperumfang vermuten ließ, dass er gutes Essen und einige abendliche Bierchen nicht verschmähte, lehnte sich an seine Theke und sinnierte: »Der Max hat viel Geld gehabt – das dürfte klar sein. Aber richtig glücklich ist er nie gewesen.«
»Wer weiß, wo der überall seine Geschäfte gemacht hat«, unterbrach ihn der Jüngste aus der Runde, der erst vor Kurzem seinen landwirtschaftlichen Betrieb aufgegeben hatte und nun in Ulm als Kfz-Mechaniker arbeitete. »Viehhändler haben noch nie einen guten Ruf gehabt. Außerdem hat er sich viel im Ausland rumgetrieben. Im Osten.«
Schorsch strich sich durchs schüttere Haar. »Ich glaub, seine Probleme hatten weniger mit seinem Beruf zu tun als vielmehr mit seinem Lebenswandel.« Er zog die Stirn in noch tiefere Falten. »Wer weiß, vielleicht ist er heut Nachmittag gar nicht allein in seiner Liebeslaube gewesen.«
Ein Dritter in der Runde, der stets im blauen Arbeitskittel unterwegs war, brummte: »Aber du sagst doch, er hat sich selbst erschossen?«
»So heißt es bei der Feuerwehr«, erwiderte der Wirt. »Aber was die Kripo rauskriegt, muss man abwarten. Sie drehen gerade noch den Melzinger Hans durch die Mangel.«
»Wie? Den Hans?«, entfuhr es einem wortkargen Mittfünfziger. »Was hat der denn damit zu tun?«
Der Wirt trug die leeren Schnapsgläser wieder zur Theke. »Was soll er damit zu tun haben? Er hat schließlich als Erster die Leiche gesehn. Und vielleicht auch einige Spuren – falls es sie gibt.«
»Spuren?«, echote der Jüngste. »Was denn für Spuren? Mehr als die von Max selbst wird’s ja wohl nicht geben.«
»Mensch, Arnold, jetzt denk doch mal nach«, zeigte sich der Mann im Arbeitskittel gereizt. »Vielleicht hat eine seiner letzten Verehrerinnen Spuren hinterlassen.«
Dieter Kugler war nach der zweistündigen Vernehmung bei der Kriminalpolizei in Geislingen wie in Trance heimgefahren. Nur sein Unterbewusstsein hatte den silberfarbenen Mercedes die Steilstrecke zur Albhochfläche hinaufgesteuert und ihn in der herbstlichen Dunkelheit die paar Kilometer nach Rimmelbach gebracht. Dass hinter Böhmenkirch, kurz vor Rimmelbach, vor ihm ein Leichenwagen in einen Feldweg abgebogen war, registrierte Kugler nur am Rande. Er fühlte sich elend, hatte Kopfschmerzen und einen unruhigen Darm. Beim Erreichen des Ortsschildes, das ihm schon so vertraut geworden war, obwohl er die Pfarrerstelle erst ein knappes Jahr innehatte, pochte sein Herz noch schneller. Vielleicht hatte sich bereits herumgesprochen, wo er war. Womöglich wussten sie alle schon, dass die Staatsanwaltschaft wegen des ›Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen‹ ermittelte – so jedenfalls stand’s im besten Bürokratendeutsch im Protokoll.
Sie würden mit den Fingern auf ihn zeigen, die Kinder von der Straße holen und sie letztlich nicht mehr zum Religionsunterricht schicken. Sehr wahrscheinlich würde der Oberkirchenrat dem Druck der Bevölkerung nachgeben und ihn sogar beurlauben. Wie immer würde es heißen, dass ein Angeschuldigter stets als unschuldig zu gelten habe, solange es kein rechtskräftiges Urteil gebe.
Aber was half dies alles gegen des Volkes Zorn? Gegen Gerüchte und falsches Gerede?
Kugler fuhr so unauffällig wie möglich zum Pfarrhaus, ließ das elektrische Garagentor ferngesteuert nach oben rollen und stellte den Mercedes ab. Mit zitternden Knien stieg er aus, nahm das braune Kuvert mit den Akten und wäre am liebsten in den Boden versunken. Glücklicherweise war es schon dunkel, sodass die neugierigen Blicke, die er aus den nachtschwarzen Fenstern der alten Häuser ringsherum auf sich gerichtet fühlte, weniger schmerzten.
Er ließ das Garagentor nach unten gleiten und stapfte, schwer atmend und auf die Pflastersteine starrend, zur Haustür. Seine Finger zitterten so sehr, dass er Mühe hatte, den Schlüssel ins Schloss zu stecken.
Als die Tür hinter ihm wieder zufiel, fühlte er sich erleichtert. Es war ihm, als habe er die Welt draußen gelassen – als sei er ihr entwichen. Doch so einfach würde dies nicht sein. Denn die Last, die ihn zentnerschwer drückte, war amtlich festgeschrieben – auf ein paar Seiten Papier, die in ein einziges Kuvert passten. Diese Worte würde er nie mehr vergessen und nie mehr richtig loswerden, hämmerte eine innere Stimme. Du bist gebrandmarkt. Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Nichts. Er erschrak, dass es ihm ausgerechnet in dieser Situation schwerfiel, Gott um Hilfe zu bitten. Ausgerechnet ihm, der als Theologe allen Grund hätte, zu beten und an das Gute zu glauben, an die Wahrheit und an den Schöpfer. Und an Gerechtigkeit. Stattdessen drohten die Zweifel ihn jetzt zu übermannen. Mein Gott, was hast du mir angetan?, dachte er plötzlich.
Als er die Schuhe gegen Filzpantoffeln getauscht und seine Jacke an die Garderobe gehängt hatte, war plötzlich Franziska, seine Frau, an seine Seite getreten. Seit am Vormittag dieser Kriminalist angerufen und ihren Mann zu einer Vernehmung gebeten hatte, wusste auch sie, welche Anschuldigungen gegen ihn im Raum standen. Stundenlang waren sie anschließend noch zusammengesessen. Ihr Mann hatte von einer Sekunde auf die andere die Lebensfreude verloren, war zwischen Zorn und tiefer Traurigkeit geschwankt und von einer panischen Angst vor einer Gefängnisstrafe gepackt worden. Sie verzog ihr Gesicht zu einem krampfhaften Lächeln, um die triste Stimmung etwas zu lockern. Kugler strich ihr schweigend übers Haar, sah ihr für einen Moment in die Augen und ging dann ins Wohnzimmer, um sich in einen der Ledersessel fallen zu lassen.
»Soll ich uns einen Kaffee machen?«, hörte er hinter sich Franziskas Stimme.
»Bitte nicht«, erwiderte er und wischte sich Schweiß von der Stirn. »Mein Magen rebelliert. Ein Glas Wasser und eine Aspirin wären mir lieber.«
Wenig später erschien Franziska mit beidem. Sie sah, wie seine Hand zitterte, als er zu der Tablette griff, sie in den Mund nahm und mit Mineralwasser schluckte. Dann versuchte er, so gut es in seinem Zustand ging, das Gespräch mit dem Kriminalisten wiederzugeben. »Die Kowick hat angegeben, ihr sechsjähriger Manuel habe behauptet, ich hätte ihn vor vier Wochen nach der zweiten Religionsstunde auf meinen Schoß gehoben und ihn unter der kurzen Hose an den Schenkeln gestreichelt«, sagte Kugler heiser. Seine Augen waren glasig geworden. Aber jetzt war es wenigstens raus. Jetzt hatte er es in aller Deutlichkeit gesagt. »Das kannst du alles nachlesen. Hier«, er deutete auf das Kuvert, das vor ihnen auf dem Couchtisch lag. Franziska wagte nicht, es anzurühren, so als sei es mit bösen Viren behaftet.
»Und was sagt das Kind bei der Polizei?«, fragte sie.
Kugler zuckte mit den breiten Schultern. »Sie wollen erst noch einen Kinderpsychologen einschalten.«
»Aber der Bub ist doch gerade erst im September eingeschult worden und viel zu schüchtern, um über so etwas zu reden.« Franziska kannte die meisten Kinder im Ort.
»Was soll ich dazu sagen?« Er befüllte sein Glas noch einmal und trank es sofort leer. »Kinder neigen manchmal dazu, Fantasie und Wirklichkeit zu vermischen – vor allem, wenn sie den ganzen Tag über nur vor der Glotze sitzen.«
»Ich bin mir sicher, dass sich dies alles sehr schnell aufklärt«, versuchte Franziska zu trösten. Wieder huschte ein Lächeln über ihr gepflegtes Gesicht, in dem die 57 Jahre kaum Spuren hinterlassen hatten.
Gemeinsam hatten sie viele Höhen und Tiefen überstanden. Und seit Sohn und Tochter außer Haus waren, versuchten sie, sich das Leben geruhsamer zu gestalten. Deshalb hatte sich Dieter Kugler auch voriges Jahr für die vakant gewordene Pfarrstelle in diesem kleinen Dorf beworben. Zwar hätte diese aufgrund der Sparmaßnahmen gar nicht mehr besetzt werden sollen, doch nachdem sich Kugler mit einer 50-Prozent-Stelle zufrieden gegeben hatte, war ihm das Amt anvertraut worden.
Anfänglich allerdings gegen den erbitterten Widerstand eines Großteils des örtlichen Kirchengemeinderats. Obwohl das Gremium nur aus sechs Personen bestand, hatte es hitzige Diskussionen gegeben, denen Kugler nur teilweise selbst beiwohnen konnte. Er sei zu alt, hatte es geheißen, lieber wolle man einen jungen Theologen haben, der auch die Jugend wieder für die Kirche begeistern könne. Außerdem war einem der Gremiumsmitglieder sein Vorstellungsgespräch viel zu konservativ erschienen. Und ein anderer hatte gar herauszuhören geglaubt, er würde einen autoritären Erziehungsstil vertreten und die Kinder im Religionsunterricht eher verängstigen als mit den Botschaften des christlichen Glaubens vertraut machen. Schließlich entschied sich das Gremium mit vier zu zwei Stimmen trotzdem für ihn. Zum Leidwesen des Vorsitzenden, der bis zuletzt versucht hatte, die Abstimmung zu Kuglers Ungunsten zu beeinflussen.
»Das hier stand doch von Anfang an unter keinem guten Stern«, resümierte er nach einigen Sekunden des Schweigens.
»Du hast dafür gekämpft und du solltest weiter dafür kämpfen«, erwiderte Franziska und zündete eine Kerze an. »Du sagst doch selbst immer, dass alles einen Sinn macht und wir mit unserer begrenzten Sichtweise Gottes Pläne nicht ergründen können.« Wieder ein kurzes Lächeln. »Denk doch an deine Stickerei.« Es war der Hinweis auf ein winziges Stück Stoff, das er immer hervorholte, wenn er versinnbildlichen wollte, dass Gott eine andere Betrachtungsweise hatte als der Mensch. Die Stickerei zeigte auf der Vorderseite einen Baum – doch drehte man den Stoff um, sah man nur ein Gewirr von Fäden, das keinen Sinn zu machen schien.
Kugler nickte. Er wusste, worauf Franziska anspielte. »Und jetzt schau ich also gerade auf so eine Rückseite – in der Hoffnung, dass die Vorderseite ein schönes Bild ergibt.«
»Nicht in der Hoffnung«, mahnte Franziska, »sondern in der Gewissheit.«
Er atmete schwer. »Die mögen uns nicht«, sagte er schließlich. »Dabei wollte ich doch gerade hierher, um den Menschen in so einem kleinen Dorf beizustehen.«
Nacheinander kamen ihm viele junge Familien in den Sinn, die von ihren Eltern eine Landwirtschaft geerbt hatten und heutzutage nicht mehr von ihren kläglichen Einnahmen leben konnten. Kugler war hierher gekommen, um ihnen zur Seite zu stehen. Doch nun spürte er eine grenzenlose Enttäuschung und Leere. Das Wenige, was er sich in diesem dreiviertel Jahr mühsam aufgebaut hatte, war heute wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Jetzt würden alle sagen, dass seine Kritiker recht gehabt hätten.
»Keiner von ihnen hat begriffen, worum’s geht«, seufzte er schließlich. »Sie lassen sich alle blenden, verkaufen ihre Ländereien und rennen zum Arbeiten in die Stadt, wo sie der Kapitalismus zu Sklaven macht.«
»Genau dies hört man vielleicht hier nicht so gern.«
»Mag sein, Franziska. Aber ich verstehe meinen Beruf nicht nur so, dass ich sonntags einen braven Gottesdienst abhalte und dabei ein paar alte Leute um mich schare. Das weißt du. Ich habe ein Leben lang versucht, den Menschen die Augen zu öffnen.«
»Und dies mit bemerkenswertem Mut«, warf seine Frau aufmunternd ein.
»Wenn wir als Kirche diesen Mut nicht haben – wer denn dann?« Beinahe wäre er jetzt ins Politisieren geraten, doch als sein Blick das Kuvert streifte, traf ihn die Erinnerung an die Vernehmung wieder wie ein schwerer Hammer.
Franziska überlegte während der entstandenen Pause, ob sie etwas ansprechen sollte, das nicht gerade dazu angetan war, seine Gemütslage zu verbessern. Aber sie konnte ihm die Nachricht nicht verheimlichen. »Da ist noch was anderes«, begann sie vorsichtig. »Der Bürgermeister hat angerufen.«
»Der Bürgermeister?« Kuglers Stimme wurde schwach. Hatte sich alles schon bis zum Rathaus herumgesprochen?
»Nein, nicht wegen dieser Sache«, beruhigte ihn Franziska. »Er wollte dir nur sagen, dass der Max Hartmann tot ist.«
Kugler musste das Gehörte einen Augenblick lang verarbeiten. »Hartmann? Der Viehhändler?«
»Ja.« Sie zögerte. »Es sieht nach einem Selbstmord aus. Erschossen. Mit seiner eigenen Waffe. Auf dem Jägersitz.«
Blitzartig entsann sich Kugler des Leichenwagens, den er bei der Heimfahrt gesehen hatte. »Auf dem großen Jägersitz?«, fragte er zurück. »Am Wald da drüben Richtung Böhmenkirch?«
Franziska nickte. »Genaues weiß man aber noch nicht. Soll wohl irgendwann im Laufe des Nachmittags passiert sein.«
»Schon wieder einer.« Kugler sank in sich zusammen. »Der zweite Selbstmord innerhalb kurzer Zeit.«
Sie wusste, wer noch gemeint war: Harald Marquart, ein 35-jähriger Landwirt. Der Junggeselle hatte sich am Karfreitag in seiner Scheune erhängt. Wie es hieß, war der elterliche Hof hoffnungslos überschuldet gewesen, sodass die Zwangsversteigerung anstand.
Kugler hatte in dieser Verzweiflungstat damals den Beweis gesehen, wie wichtig die seelisch-moralische Unterstützung dieser Generation war, die sich abmühte, das Erbe der Väter zu erhalten, und dabei in eine Schuldenfalle getrieben wurde. Nur die ganz Großen hatten in der Landwirtschaft noch eine Chance. Wem es gelang, möglichst viel Land aufzukaufen, zumindest aber auf lange Zeit hinaus zu pachten, der konnte mit den EU-Vorgaben Schritt halten. Es war halt wie überall im Geschäftsleben: Die Kleinen wurden ausgesaugt, die Großen zockten ab. Und wer sich dem System in den Weg stellte, wurde gnadenlos beseitigt. Bin ich jetzt der Nächste, der nicht ins System passt?, durchzuckte es Kugler.
2
»So ganz gefällt mir die Sache nicht«, stellte der junge Kriminalist Mike Linkohr fest, der an diesem Abend für den Kriminaldauerdienst eingeteilt war. Er saß in der Kriminalaußenstelle des kleinen Städtchens Geislingen an der Steige am Rande der Schwäbischen Alb und blickte auf die Notizen, die ihm die Kollegen nach dem Einsatz am Hochsitz bei Böhmenkirch hinterlassen hatten. Sein Gegenüber – eine überaus hübsche Absolventin der Polizeifachhochschule – stimmte ihm zu. Sie war am frühen Abend selbst vor Ort gewesen, als Kollegen wie immer in solchen Fällen die Umstände überprüfen mussten. »War kein schöner Anblick, sag ich dir, Mike«, berichtete sie. »Er hat sich sein Jagdgewehr unters Kinn gehalten.« Sie deutete es mit einer Handbewegung an.
Linkohr, der trotz seiner erst 34 Jahre schon viel Schreckliches erlebt hatte »Kann ich mir vorstellen. An so was wirst du dich aber gewöhnen.«
Vanessa warf ihre zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haare über die Schulter und runzelte ihre glatte Stirn. »Ich weiß, dass ich mich dran gewöhnen muss. Ich werd es versuchen, aber ob ich’s kann, weiß ich noch nicht.«
»Das ist unser Job, Vanessa. Wir sind genau dort, wo Gutes und Böses dicht beieinanderstehen. Sozusagen an der Schnittstelle.« Als er dies sagte, wurde ihm unangenehm bewusst, dass er zwar schon auf wertvolle Berufserfahrung zurückblicken konnte, dies aber gleichzeitig auch mit dem Älterwerden verbunden war. Es fiel ihm schwer, sich beim Anblick von Vanessa auf die schriftlichen Feststellungen der Kollegen zu konzentrieren. »Zwar ist nach Lage der Dinge davon auszugehen, dass er die Waffe gegen sich selbst gerichtet hat«, fuhr er fort. »Aber zwei Punkte machen mich stutzig.«
»Ich weiß, was du meinst.« Vanessa nickte eifrig, sodass ihr Pferdeschwanz neckisch auf und ab hüpfte.
»Da sind zunächst mal diese Schmutzantragungen, die an der Leiter gefunden wurden. Ganz frische Erde. Klebte wohl an den Schuhen, als da jemand hinaufgestiegen ist. Es hat heute Nachmittag geregnet, sodass dieser Dreck an den Schuhen von irgendjemandem hängen geblieben ist und beim Hochsteigen abgestreift wurde.«
»Aber nicht von denen des Toten«, stellte die junge Polizistin eifrig fest. »Seine sind sauber. Und nicht einmal im Profil der Sohle finden sich frische Erdantragungen.«
»Eben«, lobte Linkohr ihren großen Eifer. »Und oben in der Aussichtskanzel – wenn ich das mal so nennen darf –, da ist der Bretterboden ebenfalls mit frischer feuchter Erde verschmutzt.«
»Daraus ergibt sich also«, konstatierte Vanessa, »der Max Hartmann ist – weil er saubere Schuhe hat – noch vor dem Regen zu seinem Hochsitz hochgeklettert und hat entweder während oder nach dem Regen Besuch gekriegt.«
»Ja – und zwar Besuch von jemandem, der möglicherweise einen Knopf verloren hat.« Linkohr hob eine kleine durchsichtige Plastiktüte hoch, in der sich ein silbern-metallener Gegenstand befand. »Das Ding stammt nicht von Hartmanns Kleidung, könnte natürlich auch schon längere Zeit dort oben gelegen sein.«
Vanessa nahm den Beutel in die Hand, um den Inhalt genauer untersuchen zu können. »Sieht aus, als wär’s von einem Arbeitskittel oder einer Arbeitshose.«
»Also kein seltenes Stück, befürchte ich mal«, entgegnete Linkohr, »wahrscheinlich gibt’s in diesen Albdörfern jede Menge Personen, die so ein Kleidungsstück tragen.«
Vanessa legte das Beweismittel wieder auf Linkohrs Schreibtisch zurück. »Na ja«, schmunzelte sie, »so ein Ding könnte aber genauso gut an einer Damenjeanshose oder an einem Jeansrock dran gewesen sein.«
Linkohr stellte sich für einen kurzen Moment vor, wie Vanessa mit ihrer schlanken, hochgewachsenen Figur in einem sommerlich-kurzen Jeansrock aussehen würde.
»Du meinst«, sammelte er sich wieder, »er könnte dort oben nicht nur vierbeinige Rehlein gejagt haben?«
»Das hast du jetzt gesagt«, konterte Vanessa kess. »Aber es ist tatsächlich so: Ich hab mich mal unter den Feuerwehrleuten umgehört, die die Leiche geborgen haben. Auch wenn sie nicht so richtig mit der Sprache heraus wollten, so hab ich doch einige abenteuerliche Geschichten zu hören bekommen.«
»Kein Wunder natürlich, wenn man sich einen Jägersitz baut, der eigentlich ein richtiges Baumhaus ist.« Linkohr nahm ein Foto aus den Akten. »2.50 Meter lang und 1.90 Meter breit. Und der Fußboden 5.30 Meter vom Erdboden entfernt«, las er vor.
»Platz zum Liegen«, stellte Vanessa lächelnd fest.
»Richtig erkannt, Frau Kollegin. Und er hat es wohl auch genutzt. Denn es gibt zwei zusammenklappbare und gut gepolsterte Liegen. Und außerdem hatte er heute eine Kühltasche dabei, in der sich zwei Gläser und eine Flasche befanden. Prosecco übrigens.«
»Ich sag doch: Er hat Besuch erwartet.«
»Aber zum gemeinsamen Sekttrinken ist es dann wohl nicht gekommen. Die Flasche ist verschlossen, die Gläser sind unbenutzt.«
»In Erwartung eines Liebesabenteuers bringt man sich aber doch nicht um.«
»Exakt, liebe Vanessa.« Er lächelte. »Ich glaube, wir beide könnten uns so was nicht vorstellen.«
»Wir beide?« Vanessa schluckte verwundert.
»Na ja, theoretisch eben«, beeilte er sich leicht verlegen anzufügen. »Also, wenn wir uns beide irgendwo verabreden würden und ich würde auf dich warten – ganz ehrlich, Vanessa, da würde ich mich nicht gleich erschießen, falls du nicht kommen würdest.«
Sie wusste mit dieser Bemerkung nichts anzufangen und verkniff sich ein Lächeln.
Er zögerte. Konnte er es jetzt riskieren, sie zu fragen, ob sie so eine Situation ohne selbstmörderisches Ende einmal ausprobieren sollten? Immerhin war er wieder einmal solo, denn nachdem er mit seiner vorherigen Freundin eine Rundreise durch Mexiko gemacht hatte, war es mit der Begeisterung vorbei gewesen. Nena hatte sich zunehmend als dominante Lederlady entpuppt, was anfangs durchaus spannend gewesen war. Dann allerdings hielt er ihre immer verrückter werdenden Fantasien für ziemlich übertrieben.
Vanessa sah ihn mit großen blauen Augen an und zog eine Schnute, die Linkohr nicht zu deuten wusste. Die junge Frau war erst vor einer Woche von der Polizeidirektion Göppingen zur Kriminalaußenstelle Geislingen abbeordert worden und sie hatten bislang kaum Gelegenheit gefunden, sich ausführlich zu unterhalten. Die Kollegen der Dienststelle trieb ohnehin in diesen Monaten die Sorge um, wie es nach der anstehenden Polizeireform in Baden-Württemberg mit ihnen weitergehen würde. Die kleine Kriminalaußenstelle Geislingen galt bereits als gestrichen.
Linkohr hoffte inständig, sich nach Göppingen retten zu können, um endlich nicht nur bei großen Fällen, sondern auch bei der täglichen Routinearbeit mit seinem Vorbild August Häberle zusammenarbeiten zu können. Aber der sprach immer häufiger vom nahenden Ruhestand.
»Jedenfalls hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet«, wurde Linkohr wieder sachlicher. »Und der Chef meint, wir sollen Häberle verständigen.«
»Den ›großen‹ Häberle?«, fragte Vanessa geradezu ehrfurchtsvoll und hellwach.
»Ja, genau den.«
»Da fällt mir ein«, ereiferte sich die junge Frau, »dieser Hochsitz steht ja ziemlich genau an der Markungsgrenze zwischen Böhmenkirch und Rimmelbach.«
»Stimmt. Aber beides gehört gerade noch zum Kreis Göppingen und damit zu unserem Zuständigkeitsbereich.«
Vanessa trumpfte mit einer Neuigkeit auf: »In diesem Rimmelbach ist momentan auch unser Kollege Martin Wissmut zugange.«
»Der Wissmut? Von der Sitte? Du willst doch nicht behaupten, dass es in diesem kleinen Kaff gerade um ein Sexualdelikt geht?«
»So genau weiß man das noch nicht. Es geht um den Pfarrer.« Vanessa wurde ernster und fügte an: »Eine ziemlich heikle Geschichte, hat Wissmut gesagt.«
Sandra Kowick war eine kräftige Frau Mitte 30 und seit Langem auf dem großen landwirtschaftlichen Anwesen beschäftigt, das man in Rimmelbach den ›Hochsträßhof‹ nannte – in Anlehnung an eine historische Wegeverbindung. Er war erst in den frühen 70er- Jahren komplett neu aufgebaut worden – mit einem im Landhausstil gehaltenen Wohngebäude und einer separaten Scheune für die Lagerung von Heu und Stroh sowie einer großen Stallung für Milchkühe.
Hier, am Ortsrand von Rimmelbach, schmiegte sich das Anwesen an einen sanften Höhenzug, über den sich die Rotoren weiter entfernt gelegener Windkraftanlagen hinwegreckten.
Sandra Kowick hatte jetzt, kurz nach 22 Uhr, noch einmal ihren vorgeschriebenen Gang durch den Kuhstall gemacht und nebenan in die riesige Scheune mit den Erntevorräten des vergangenen Sommers geblickt, als ihr Rauchgeruch in die Nase stieg. Sie musste für einen kurzen Moment daran denken, dass sie oft schon auf die Gefahr einer Selbstentzündung hingewiesen worden war. Feucht eingebrachtes Heu entwickelte nämlich enorme Hitze. Doch der Rauch kam nicht aus der Scheune, sondern wurde vom Wind außen am Gebäude entlanggetrieben. Sie brauchte sich also nicht zu sorgen, zog die Metalltür ins Schloss und ging über den Hof, der von einigen Halogenstrahlern erhellt wurde. Im Schein des elektrischen Lichts waberte feiner Qualm, der vom entfernten Ende der Scheune herrührte.
Sandra wusste, was dies bedeutete. Denn hinter dem Gebäude pflegte ihr Chef Heiko Mompach regelmäßig Unrat zu verbrennen. Dass er dies immer im Schutz der Dunkelheit tat, hatte sie in all den Jahren, seit sie bei ihm beschäftigt war, als Selbstverständlichkeit erachtet. Natürlich steckte Absicht dahinter, denn manches, was er bei Nacht verbrannte, hätte vermutlich teuer als Sondermüll entsorgt werden müssen. Doch zu dieser Uhrzeit war der womöglich schadstoffhaltige Qualm nicht zu sehen. Und das Feuer selbst hielt er so klein wie möglich. Außerdem blieb der flackernde Schein hinter der Scheune und der ansteigenden Böschung verborgen. Aber selbst wenn der Bürgermeister etwas davon erfahren würde, hätte Mompach wohl kaum mit allzu großem Ärger zu rechnen. Er galt als Großbauer, als unangefochtener Patriarch im Ort, war sogar stellvertretender Bürgermeister und stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderats und stand dem Gesangverein und der Ortsgemeinschaft der Backhausbetreiber vor. Nur aus der Feuerwehr war er mit 55 ausgetreten, worauf man ihn zum Ehrenlöschzugführer ernannt hatte. Jetzt, knapp 60, führte er aber auch auf seinem Hofgut ein strenges Regiment, sodass der einzige Sohn es vorgezogen hatte, vorläufig auf die Nachfolge zu verzichten und stattdessen in eine kleine Wohnung im Nachbarort zu ziehen. Sein Geld verdiente er als gestresster Verkaufsfahrer, wie sie heutzutage zu Zehntausenden über die Straßen gehetzt wurden.
Heiko Mompach verlangte von seiner Ehefrau Linda, dass sie sich neben dem Haushalt voll in die Landwirtschaft einbrachte. So wie sie beugte sich auch Sandra seinem Willen, der nicht den geringsten Widerspruch zuließ. Sie allerdings war auf ihn angewiesen. Er hatte es auf geschickte Weise verstanden, sie an sich zu binden.
Denn hätte er ihr nach der Trennung von ihrem Mann keinen Job angeboten und ihr in einem alten windschiefen Bauernhaus keine kostenlose Unterkunft gewährt, wäre sie damals mit ihrem gerade halbjährigen Kind ziemlich hilflos dagestanden und durch alle sozialen Netze gefallen. Andererseits hatte er auch allen Grund gehabt, sie zu unterstützen. Doch daran wollte sie nicht erinnert werden, obwohl sie ihm gegenüber im Grunde ihres Herzens ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit empfand. Und dies trotz der üblen Beschimpfungen, die sie oftmals erdulden musste. Das waren dann jene Momente, in denen in ihr ein unbändiger Hass gegen ihn aufstieg.
Sie näherte sich zögernd dem Gebäudeeck und machte sich durch ein Räuspern bemerkbar. Mompach – das hatte sie oft genug erfahren müssen – war ein Choleriker, bei dem man nie wissen konnte, in welcher Stimmung man ihn antraf. »Entschuldige«, sagte sie, als er sich umdrehte. Hinter ihm stieg aus einem Haufen Glut dichter Qualm auf und raubte ihr fast den Atem.
»Was machst du denn da?«, fuhr er sie an. Seine Silhouette hob sich vom rötlichen Schimmer der Glut ab. Er wirkte nervös.
»Ich hab nur noch meinen Kontrollgang gemacht und Rauch gerochen«, erklärte Sandra vorsichtig, als sei sie bei etwas Verbotenem ertappt worden.
»Gut gemacht«, lobte Mompach unerwartet freundlich und kam ein paar Schritte auf sie zu. »Auf dich kann ich mich halt verlassen. Wie immer.« Er strich ihr beinahe väterlich übers schweißnasse Haar. Sie wich kurz zurück, denn viel zu tief waren die Spuren, die seine regelmäßigen Erniedrigungen in ihrer Seele hinterlassen hatten. Ein Wechselbad der Gefühle stürzte wieder über sie herein. Eigentlich müsste sie ihn hassen. Er nutzte geschickt ihre Notlage aus, konnte jähzornig werden, wenn etwas nicht so lief, wie er es sich vorstellte, und benahm sich in Momenten wie dem jetzigen, wenn sie allein waren, als könne er über sie nach Gutsherrenart verfügen. Manchmal glaubte sie, seine Sklavin zu sein. Längst bezahlte er keine Überstunden mehr – auch nicht, wenn sie an Wochenenden eingespannt wurde. Er hatte nach und nach alle Vergünstigungen gestrichen – stets mit dem Vorwand, der Landwirtschaft gehe es von Jahr zu Jahr schlechter und sie solle froh sein, als alleinerziehende Mutter diesen Job zu haben und ordentlich sozialversichert zu sein. Dass er sie mit ihrem Buben kostenlos in dem alten Bauernhaus wohnen ließ, hielt er ihr regelmäßig als Beweis seiner Großherzigkeit vor. Denn müsste sie auch noch Miete bezahlen, wäre sie trotz ihres meist neunstündigen Arbeitstages nicht in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Oft schon hatte sie sich vorgenommen, allem ein Ende zu bereiten.
Sie wich zurück und erwiderte nur: »Dann hat sich ja alles erledigt. Ich wünsche eine gute Nacht.« Sie wollte gerade gehen, als Mompachs sonore Stimme sie wie ein Peitschenhieb traf: »Sandra, bleib stehen. Warte.«
Sie erstarrte in der Bewegung. Denn da war wieder dieser autoritäre Befehlston, der ihr durch Mark und Bein ging und mit dem er sie dazu erzogen hatte, ihm aufs Wort zu gehorchen.
Auch jetzt wagte sie keinen weiteren Schritt mehr. Sie wartete förmlich darauf, noch eine zusätzliche Arbeit aufgebrummt zu bekommen. Schließlich hatte sie ihn soeben brüskiert, als sie seinen Streicheleinheiten ausgewichen war.
»Wie geht’s denn deinem Manuel?«, fragte Mompach unerwartet sanft.
»Ich muss ihn morgen zur Polizei bringen, falls du das meinst. Ich werde zwischen neun und elf nicht da sein.«
»Wie? Während der Arbeitszeit?«
»Es hat sich nicht anders einrichten lassen«, erwiderte sie kühl und verschwand in der Dunkelheit.
Dieter Kugler hatte eine schreckliche Nacht hinter sich. In den wenigen Augenblicken, in denen er eingeschlafen war, hatten sich all seine Ängste zu Horrorträumen geformt. Sein Herz raste und er schreckte immer wieder mit Schweißausbrüchen auf. Das waren keine normalen Träume, bei denen nach dem Erwachen alles wieder gut wurde. Nein, das Schreckliche haftete an ihm, als sei er in einen Strudel von Dämonen geraten, von denen er sich nicht mehr befreien konnte. Noch heute wollte er einen Rechtsanwalt aufsuchen und – so schwer ihm das auch fallen würde – Kontakt mit dem Oberkirchenrat aufnehmen.
Als er im Bad sein blasses Gesicht sah und deshalb erschrocken die Augen schloss, stellte er sich vor, wie es heute im Religionsunterricht sein würde. Hatte sich bereits alles bis zur Leiterin der Grundschule rumgesprochen? Würde sie ihn des Hauses verweisen? Würden überhaupt noch Kinder zum Religionsunterricht kommen?
Er zuckte zusammen, als sich Franziskas warme Hände auf seine nackten Schultern legten.
»Ich weiß, wie dir zumute ist«, hörte er ihre leise Stimme. Sie drehte sich zu ihm und sah ihm fest in die Augen. »Ich weiß, du hast die ganze Nacht nicht geschlafen. Du solltest dich krankmelden.«
»Krankmelden?« Keine Sekunde hatte er bisher daran gedacht. »Nein, Franziska, das werde ich nicht tun. Das wäre ein glattes Schuldeingeständnis. Schwäche. Nein. Ich hab mir nichts vorzuwerfen. Deshalb werde ich weitermachen wie bisher.«
Sie nickte ihm aufmunternd zu. »Ich steh zu dir, das weißt du. Egal, was kommt.«
Er bückte sich zum Waschbecken und warf sich eine Handvoll kaltes Wasser ins Gesicht. Dann wandte er sich wieder seiner Frau zu. »Wenn’s dumm läuft, wird ganz viel auf uns zukommen.« Er trocknete sich das Gesicht ab. »Selbst wenn es eines fernen Tages zu einem Freispruch vor Gericht kommt, bleibt etwas hängen. Das ist sicher.« Er musste schlagartig an den Wettermoderator Kachelmann denken. »Auch nach einem astreinen Freispruch kannst du deinen Job verlieren, weil irgendjemand sagt, du seist in der Öffentlichkeit nicht mehr tragbar.«
»Aber wieso sollte es zu einer Gerichtsverhandlung kommen?«, versuchte sie, die angespannte Situation zu lockern. »Bisher hast du nur die Anzeige von dieser Kowick, und die wiederum beruft sich auf die Schilderungen ihres kleinen Buben, der erst heute von der Polizei vernommen wird.«
»Und wenn der dabei bleibt und weiterhin diese Geschichte erzählt? Und dann auch noch ein Glaubwürdigkeitsgutachter kommt und sagt, das Kind sei zwar in seiner Entwicklung zurückgeblieben – und daran besteht ja wahrlich kein Zweifel –, aber schon deswegen sei das Kind gar nicht in der Lage, so etwas zu erfinden. Du kennst doch die Gutachter. Die drehen und wenden das. Und die Juristen drehen’s dann auch wieder so hin, wie sie’s brauchen. Denk doch nur an den Fall Mollath. Den armen Kerl haben sie in die Klapse gesteckt, obwohl ihn einige Gutachter nicht mal gesehen haben. Und was glaubst du, was mit einem Pfarrer geschieht, dem man sexuellen Missbrauch vorwirft? Die Gutachter werden natürlich blindlings dem Kind glauben. Das ist ohnehin ein Thema, das in der Öffentlichkeit gerade hochkocht.«
»Jetzt warten wir das erst mal ab.« Sie wusste, dass diese Bemerkung so ziemlich das Schwächste war, was ihr in diesem Moment einfiel. Abwarten war genau das, was ihren Mann zermürbte.
»Du weißt schon, was auf das, was man mir vorwirft, steht?«, sagte er leise und kämmte sein graues Haar. »Die kennen keinen Spaß. Ist dir das klar? Gefängnis. Drei, vier, fünf Jahre und Entlassung aus dem Kirchendienst ohne Pensionsansprüche.«
Er sah über Franziskas Wange eine Träne rinnen. Und auch er konnte sich nicht mehr zurückhalten. Seine Welt war zusammengebrochen. Eine so schöne Welt.
›Die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizeidirektion Göppingen geben bekannt‹ – wenn der Geislinger Lokaljournalist Georg Sander diese Überschrift las, dann wusste er, dass ein größeres Verbrechen geschehen sein musste. Als er an diesem Oktobervormittag in der Redaktion der Geislinger Zeitung seine E-Mails las, schoss ihm beim Überfliegen des Textes der Blutdruck in die Höhe. Von einem ›nicht natürlichen Todesfall‹ war die Rede – und davon, dass ›ein gewisser Verdacht‹ naheliege, dass ›ein Dritter‹ an der Sache beteiligt sein konnte. Was zunächst wie die Selbsttötung eines Jägers ausgesehen habe, sei angesichts der Spurenlage ›nicht mehr ganz eindeutig‹. Sander war es gewohnt, dass Pressemitteilungen nur in dürren Worten verfasst wurden. Allerdings war wenigstens der Tatort oberflächlich genannt: am Waldrand zwischen den Gemeinden Böhmenkirch und Rimmelbach. Und für elf Uhr war sogar eine Pressekonferenz in den Räumen der Geislinger Kriminalpolizei anberaumt. Man suche nämlich dringend Zeugen, hieß es.
Sander, der sich seit nunmehr über 40 Jahren als Journalist beruflich mit den Tiefen der menschlichen Seele auseinandersetzen musste, tippte die Nummer des zuständigen Polizeipressesprechers in Göppingen ins Telefon ein. Doch der Anschluss war belegt – wie immer, wenn Berichte solchen Inhalts verbreitet worden waren. Dann meldeten sich auch überörtliche Medien, vor allem aber ein Heer von freien Journalisten, oder besser gesagt: von solchen, die sich dafür hielten und deren großes Mundwerk meist im umgekehrten Verhältnis zur Zahl ihrer erfolgreich publizierten Geschichten stand. Wenn er darüber nachdachte, wunderte sich Sander jedes Mal, wie man in der Provinz, wo die Zeilenhonorare nicht gerade üppig waren, damit finanziell überleben konnte. Das waren die Momente, in denen ihn der Verdacht beschlich, etwas falsch zu machen. Immerhin war seinem Jahrgang staatlicherseits bereits eine dreimonatige Verlängerung der Arbeitszeit verordnet worden – und dies, obwohl er treu und brav, ohne Unterbrechung, nun schon seit über 43 Jahren in diese ›Betrugsversicherung‹ einzahlte, wie er inzwischen die staatliche Rentenkasse bezeichnete.
Sander wischte solche Gedanken jetzt fort und versuchte noch einmal, den Pressesprecher zu erreichen. Diesmal mit Erfolg. Nach kurzem Gefrotzel, dass endlich wieder einmal ein größerer Fall in der Provinz geschehen sei, wollte Sander den genauen Standort des Hochsitzes geschildert bekommen, um den Tatort fotografieren zu können. Wie immer zierte sich der Pressesprecher, ließ sich dann aber erweichen, »ausnahmsweise einem Lokaljournalisten« die Stelle zu benennen. Sander bedankte sich, rief seinen Fotografen Markus Homsheimer und ließ sich von ihm im blau-weiß beklebten Twingo auf die Albhochfläche chauffieren. Wie immer holte Homsheimer aus dem PS-schwachen Maschinchen alles heraus, was es hergab. Mit quietschenden Reifen bog er im dünnen Herbstnebel, der sich auf der Alb breitgemacht hatte, in den beschriebenen Feldweg ab, wo nach 500 Metern ein rot-weißes Polizeiabsperrband das Weiterfahren untersagte.
Homsheimer parkte den Twingo auf einer Wiese, schnappte sich seine schwere Fototasche, hüpfte über das Absperrband, das Sander bereits hinter sich gebracht hatte, und folgte dem Journalisten. Zwischen den dünnen Nebelschwaden zeichnete sich in etwa 100 Metern Entfernung der Hochsitz ab. Mehrere Einsatzwagen der Polizei parkten entlang des asphaltierten Weges.
Sander war froh, dass sich der Tatort nicht in einer Ortschaft des Alb-Donau-Kreises befand, denn dann wäre die Polizei aus Ulm zuständig gewesen, die sich schon oft gegenüber der Geislinger Presse wenig kooperativ gezeigt hatte. Für einen kurzen Moment musste er daran denken, wie es wohl sein würde, wenn er’s nach der Polizeireform mit einem neu eingerichteten Ulmer Präsidium zu tun hatte.
Als sich Sander und Homsheimer näherten, kam ihnen aus einer Personengruppe ein Uniformierter entgegen. Sander gab sich zu erkennen und fragte, ob Hauptkommissar August Häberle anwesend sei.
»Moment bitte«, sagte der Uniformierte knapp und ging wieder zu der Personengruppe zurück, in der Sander inzwischen die korpulente Figur des Kommissars erspäht hatte, während Homsheimer bereits ein paar Übersichtsfotos schoss.
Mittlerweile hatte der Uniformierte den Kommissar auf die beiden Ankömmlinge aufmerksam gemacht und ihnen mit Handzeichen zu verstehen gegeben, ihm entgegenzukommen.
Sie schüttelten sich zur Begrüßung die Hände. »Kommen Sie mit, da gibt’s was Spannendes zu fotografieren. Einen tollen Luxushochsitz«, kam Häberle sofort grinsend zur Sache. Er führte die Journalisten durch die Schar der Polizeibeamten zu dem Hochsitz. »Das Blut muss auf dem Foto ja nicht unbedingt zu sehen sein«, sagte er und deutete die steile Leiter hinauf. »Da hat’s getropft.«
Sander und Homsheimer hatten Mühe, aus der Distanz die angetrockneten dunkelroten Spuren zu erkennen.
»Genaueres berichten Ihnen bei der Pressekonferenz die ›hohen Herren‹«, fuhr Häberle fort. »Die Theorie vom Selbstmord will nicht so recht in den objektiven Befund vom Tatort passen.«
»Und warum nicht?«, fragte Sander, während Homsheimer jetzt die Leiter mit dem Teleobjektiv aus allernächster Nähe ablichtete.
»Es gibt ein paar Dinge, die noch abgeklärt werden müssen«, entgegnete Häberle ernst.
»Aber er hat sich doch selbst erschossen, heißt es«, blieb Sander hartnäckig.
»So sieht es tatsächlich auf den ersten Blick aus. Aber möglicherweise hatte er Besuch.«
»Besuch? Da oben?«
Häberles breites Gesicht verzog sich jetzt zu einem kräftigen Grinsen. »Es gibt was zu recherchieren, Herr Sander. Nur ein kleiner Tipp von mir: Hören Sie sich doch mal in Rimmelbach drüben um.«
Er genoss Sanders Verwunderung und fügte an: »Ich bin davon überzeugt, da gibt es ganz viele Leute, die ihnen etliches erzählen können.«
Linkohr hatte in seiner Junggesellenbude nur wenige Stunden geschlafen. Gleich nach dem spärlichen Frühstück, das wie immer nur aus einer Tasse Kaffee und zwei Toasts mit Marmelade bestand, war er mit den Kollegen der Spurensicherung im stattlichen Einfamilienhaus des Viehhändlers Max Hartmann verabredet. Als er in dem Neubaugebiet von Böhmenkirch eintraf, wo das villenartige Anwesen am Ende einer Sackgasse stand, waren die Männer in ihren weißen Schutzoveralls bereits bei der Arbeit. Ihre zivilen Kombis mit den neutralen Kennzeichen blockierten die Durchfahrt. In der weitläufigen Garageneinfahrt parkte ein dunkelgrüner Mercedes-Lieferwagen mit der Aufschrift ›Hartmann Importservice‹.
Die Eingangstür des Hauses brauchte nicht aufgebrochen zu werden, weil sich in der Kleidung des Toten der passende Schlüssel befunden hatte. Eine Rückfrage bei der Gemeindeverwaltung erbrachte keine Klarheit über die verwandtschaftlichen Verhältnisse Hartmanns. Er war 1971 in Augsburg geboren, jetzt also 42 Jahre alt, ledig und lebte nach Auskunft des Bürgermeisters ziemlich zurückgezogen. Allerdings werde gemunkelt, dass sein Viehhandel ziemlich floriere. Außerdem sei er Manager eines größeren international agierenden Handelsverbundes gewesen.
Linkohr stülpte sich – wie die Kollegen der Spurensicherung dies bereits getan hatten – Plastikschutz über die Schuhe und betrat die mit dicken Teppichen ausgelegte Diele, die geschmackvoll in orange-ockergelben Farben gehalten war. Halogenlampen zielten auf farbenfrohe abstrakte Bilder. Linkohr warf einen flüchtigen Blick in das helle Wohnzimmer und die sauber aufgeräumte Küche. Diese Ordnung und Sauberkeit wollte so gar nicht zu einem Junggesellen passen, dachte er angesichts eigener Erfahrung. Er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass dieses Haus von einem Mann allein bewohnt wurde. Jedes Zimmer, sogar Bad und Toilette, erinnerte ihn eher an Ausstellungsräume eines Möbelhauses. »Hat der hier wirklich gewohnt?«, fragte er deshalb spontan die drei Kriminalisten, die sich routinemäßig für das kleine Büro interessierten, in dem ein Apple-Notebook und diverses Computerzubehör standen. Alles sauber verkabelt, einige Speichersticks in Reih und Glied auf einem Regal drapiert, DVDs aneinandergereiht und beschriftet.
»Ein ordentlicher Mensch«, murmelte einer der Männer. »Wenn’s auf seiner Computerfestplatte genauso aussieht, werden wir uns schnell zurechtfinden.«
»Freut euch nicht zu früh«, meinte Linkohr. »Solche Leute neigen auch dazu, ihre Spuren ebenso pedantisch zu beseitigen.«
»Aber doch nur, wenn sie damit rechnen, Besuch von uns zu kriegen«, grinste ein älterer Beamter. »Der hier hat gestern Nachmittag garantiert nicht im Traum daran gedacht, dass wir heute in seinen Sachen rumkruschteln.«
Linkohr besah sich eine Reihe von Ordnern, die der Aufschrift zufolge Rechnungen, Buchhaltungsbelege, Lieferscheine und Bankauszüge enthielten. Auf einem anderen Regal war ein buntes Allerlei drapiert: drei putzige Engelsfiguren, einige kleine farbenfrohe Geschenkschächtelchen und ein ziemlich grimmig dreinschauender, aufrecht stehender zweibeiniger Löwe. An ihm blieb Linkohrs Blick haften, zumal ihn diese Darstellung an die Schlümpfe seiner Kindheitstage erinnerte. Er zog sich Plastikhandschuhe über und griff nach der braun-beigen Figur, die aus festem Gummi bestand. Was mochte einen Viehhändler dazu bewogen haben, diesen nicht gerade formschönen Löwen ins Regal zu stellen? Linkohr setzte ihn wieder behutsam an seinen Platz zurück und mutmaßte, dass Hartmann möglicherweise im Sternzeichen des Löwen geboren war.
Nichts Aufregendes also, dachte er und wandte sich dem Wohnzimmer zu, durch dessen breite Fensterfront der Blick weit über die Albhochfläche hinwegging. Bei klarer Sicht würde man vermutlich die Alpenkette sehen können. Die Ledergarnitur war schneeweiß, an einer Stirnseite dominierte ein blitzblank geputzter offener Kamin. Linkohr entdeckte dort weder Überreste verbrannten Holzes noch Asche. Nur die gestrige Ausgabe der ›Geislinger Zeitung‹, die, leicht zerknittert, auf einem Sideboard lag, ließ darauf schließen, dass gestern jemand hier gewesen sein musste.
Linkohr fiel ein, dass der Bewohner möglicherweise in der Küche mehr Spuren hinterlassen hatte. Er ging die paar Schritte hinüber und staunte über die großzügige Raumeinteilung. Die Küche öffnete sich zu einem Esszimmer hin, dessen eine Ecke als Erker ausgebaut war. Der Kriminalist ließ diese architektonisch gelungene Einteilung auf sich wirken, machte sich dann mit dem Öffnungsmechanismus der Geschirrspülmaschine vertraut und zog die Klappe nach unten auf. Sein Gespür hatte ihn nicht getrogen: Dort waren Tassen, Teller und Besteck einsortiert.
Er ließ die Klappe wieder einrasten und besah sich die filigranen Regale und Ablagen, auf denen Gewürze und Gläser fein geordnet standen. Dann traf sein prüfender Blick im Esszimmer auf einige zusammengefaltete Papiere und Kuverts, die auf dem Unterschrank einer Glasvitrine lagen. Manchmal, das wusste Linkohr aus Erfahrung, fanden sich auf Zetteln, die scheinbar achtlos irgendwo hingelegt worden waren, wichtige Notizen aus jüngster Zeit. Wenn Hartmann tatsächlich ein Ordnungsfanatiker war, mussten solche Zettel darauf hindeuten, dass er sie als Gedächtnisstütze dort abgelegt hatte.
Linkohr nahm den dünnen Stapel vorsichtig in die Hand und faltete einen Zettel nach dem anderen auseinander. Beim ersten handelte es sich um das Angebot eines Jagdwaffenhändlers aus Ulm, beim zweiten um eine juristische Abhandlung über das EU-Handelsrecht mit landwirtschaftlichen Nutztieren und beim dritten um die Auflistung einiger Rechtsanwaltskanzleien aus München, Ulm und Stuttgart. Zuletzt tauchte noch ein grünes Kuvert auf. Die Handschrift, mit der die Adresse geschrieben worden war, deutete auf einen weiblichen Verfasser hin. Linkohr stellte fest, dass es keinen Absender gab, öffnete den eingeschobenen Falz und zog vorsichtig eine ebenfalls grüne Karte heraus, auf deren Vorderseite ein roter Glückskäfer mit sieben schwarzen Punkten abgebildet war. Aufschrift: ›Ein Glücksbringer für Dich.‹ Linkohr schlug die zusammengeklappte Karte auf und sah einen mehrzeiligen Text, der aus derselben Feder stammte wie die Anschrift auf dem Kuvert. ›Mein lieber Schatz‹, las er, ›es war ein wunderbarer Abend mit Dir. Ich bitte Dich aus vollem Herzen, Dein Versprechen, das Du mir gegeben hast, niemals zu vergessen. Ich werde alles für Dich tun, was Du willst. Bitte, bitte, lass es nicht enden wie bei Harald. Ich liebe Dich. Ich bin bei Dir.‹
Linkohr überflog die Zeilen noch einmal, vergewisserte sich, dass es tatsächlich keinen Absender gab, und steckte die Karte wieder in das Kuvert zurück. Abgestempelt war es im Briefverteilzentrum 73, das für den Großraum Göppingen zuständig war. Mehr ließ sich dem Poststempel nicht entnehmen.
Der Kriminalist übergab den Brief den Kollegen der Spurensicherung. »Das lag drüben im Esszimmer, an der Vitrine«, sagte er und verzichtete darauf, nach Erkenntnissen aus dem Computer zu fragen. Die Männer hatten Notebook und alle Speichermedien, die sie finden konnten, in Kisten verpackt und lediglich die Kabel zurückgelassen. »Da werden unsere EDV-ler ihre Freude dran haben«, meinte einer der Beamten süffisant.
Ein anderer stopfte die Aktenordner, die er vom Regal genommen hatte, in Plastikkörbe. Linkohr warf einen kritischen Blick darauf und mochte sich die Kleinarbeit gar nicht vorstellen, die die Auswertung dieses Schriftverkehrs erfordern würde. Denn noch jagten sie einem Phantom hinterher. Bisher schien nur sicher zu sein, dass sich eine zweite Person auf dem Hochsitz aufgehalten hatte. Den tödlichen Schuss jedoch dürfte Max Hartmann selbst abgefeuert haben.
Linkohr stieg, in Gedanken versunken, die breite Holztreppe zum Obergeschoss hinauf, das sich in die Dachschräge einfügte. Auch hier dämpften dicke Teppiche die Schritte. Der Kriminalist öffnete die erste Tür und staunte über ein luxuriöses Schlafzimmer, in dem Betten, Vorhänge, Tapete und Teppichboden in dezentem Orange und Violett gehalten waren. Er nahm zur Kenntnis, dass es hier endlich die ersten konkreten Hinweise auf einen Bewohner gab: Nur ein Teil des Doppelbettes war akkurat hergerichtet, der andere erweckte den Eindruck, als sei erst vor Kurzem jemand aus den Federn gekrochen. Vielleicht, so überlegte Linkohr, hatte Hartmann gestern noch einen Mittagsschlaf gehalten, ehe er zu seinem Hochsitz aufgebrochen war, um dort weniger einsam zu sein als im eigenen Schlafzimmer. Doch warum ausgerechnet auf dem Hochsitz, wenn es hier viel bequemer war?, überlegte Linkohr, musste sich aber eingestehen, dass ein Abenteuer in freier Natur auch seinen Reiz hatte. Weshalb er ausgerechnet jetzt an Vanessa denken musste, erstaunte ihn selbst. Vielleicht sollte er doch seine gestern Abend kläglich gescheiterten Annäherungsversuche etwas intensivieren.
Nach einigen Sekunden des Nachdenkens öffnete er zwei weitere Türen, hinter denen sich ein Badezimmer und ein Abstellraum verbargen. Es gab allerdings nichts, was auf Anhieb interessant erschien. Dann jedoch fiel ihm ein, dass er etwas ganz Wichtiges bisher nicht gesehen hatte: den Waffenschrank, wie ihn Jäger und Sportschützen besitzen mussten.
Linkohr vermutete ihn im Keller, stieg rasch abwärts und betrat das Untergeschoss durch eine Metalltür. Kühle Luft schlug ihm entgegen. Als er die Leuchtstoffröhren aufblitzen ließ, entdeckte er die üblichen Haushaltsmaschinen, die Zentralheizung samt einem neun Tonnen fassenden Pelletssilo und eine kleine Werkstatt, in der tatsächlich das gesuchte Objekt stand: ein massiver Waffenschrank, der mit Kombinationsschloss gesichert war.
Linkohr stellte zufrieden fest, dass sich die Tür nicht öffnen ließ.
Er löschte die Lichter wieder und ging zu den Kollegen im Erdgeschoss zurück, die inzwischen die beschlagnahmten Gegenstände zu einem Kombi trugen, der vor dem Haus parkte.
»Mike!« Es war die Stimme eines Kollegen, der nach ihm verlangte. Linkohr traf den Beamten unter der Haustür. »Wir haben da etwas gefunden, was dich interessieren könnte.« Mit einer Handbewegung forderte er Linkohr auf, in das Büro zu gehen, wo auf dem Schreibtisch ein durchsichtiger Plastikbeutel der Spurensicherung lag. In ihm befand sich ein blaues Schlüsselmäppchen mit nur einem einzigen Schlüssel. »Das war in der Schreibtischschublade«, sagte der Kollege.
Linkohr hob den Beutel hoch. »Es sieht nach einem Hausschlüssel aus, würde ich sagen«, stellte er fest.
»Davon kann man ausgehen«, erwiderte der andere Kriminalist, »aber er passt hier im Haus zu keiner Tür. Außerdem handelt es sich um ein völlig anderes System, das nicht zu dieser Schließanlage hier gehört.«
»Und schon stellt sich die Frage«, konstatierte Linkohr, während er den Beutel wieder auf den Tisch zurücklegte, »warum Hartmann diesen Schlüssel nicht an seinem Schlüsselbund hatte, sondern ihn getrennt aufbewahrte.«
»Sehr richtig, Herr Kollege«, grinste der andere.
Kugler hatte sich nicht umgeblickt, als er von der Haustür zur Garage hinüber gegangen war. Er fühlte sich erschlagen und gedemütigt und bereits von allen Seiten beobachtet. Deshalb hatte er auch entschieden, den knappen Kilometer bis zur Grundschule heute zu fahren. Er wollte sich keinem Spießrutenlauf ausgesetzt fühlen. Das würde ihm noch früh genug drohen.
Noch allerdings, so sagte ihm die Vernunft, konnte niemand wissen, was ihm gestern bei der Kriminalpolizei eröffnet worden war. Es sei denn, die Kowick hatte es nicht bei der Anzeige belassen, sondern auch gleich die Schulleiterin und den Bürgermeister verständigt – oder gar den stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, den Heiko Mompach, den die meisten im Ort ohnehin als den uneingeschränkten Herrscher betrachteten. Allein der Gedanke an ihn löste in Kuglers Magen eine neuerliche Verkrampfung aus.
Zwar hatte sich Mompach damit abgefunden, dass es nicht gelungen war, den Kirchengemeinderat mehrheitlich gegen den neuen Pfarrer zu mobilisieren. Aber ganz so leicht, wie es sich Kugler erhofft hatte, waren die Wogen nach seiner ziemlich freudlosen Amtseinsetzung nicht zu glätten gewesen – obwohl er noch immer alles daran setzte, das vergiftete Klima zu verbessern.
Der Streit um die Besetzung der Pfarrerstelle hatte in dem kleinen Ort tiefe Gräben aufgerissen. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Mompach ihm gegenüber Loyalität vortäuschte und so tat, als sei nichts gewesen.
Die Zusammenarbeit in dem kirchlichen Gremium war keinesfalls von jener christlichen Nächstenliebe geprägt, wie sie gerade unter Kirchenfunktionären zu erwarten gewesen wäre.
Kugler war sich bewusst, dass Mompach nur darauf lauerte, ihm eine Verfehlung anhängen zu können. Würde dieser Mann von den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen erfahren, käme dies einer Katastrophe gleich.
Kugler hatte gleich nach dem Frühstück ein Rechtsanwaltsbüro in Geislingen angerufen, den Sachverhalt kurz geschildert und für den späten Nachmittag einen Termin erhalten.
Jetzt parkte er den Mercedes auf den ausgewiesenen Stellplätzen vor der Schule und nahm sich beim Aussteigen vor, so selbstbewusst wie möglich aufzutreten.
Zufrieden stellte er beim Betreten des bunt bemalten Schulgebäudes fest, dass jetzt, vor der zweiten Unterrichtsstunde, fröhliches Treiben herrschte. Es schien ein Tag zu sein wie jeder andere. Und so wie er es überblicken konnte, waren die meisten Kinder gekommen. Nur Manuel würde nicht da sein. Der musste heute Vormittag bei einem Kinderpsychologen das Schreckliche wiederholen, was seine Mutter bei der Polizei zu Protokoll gegeben hatte.
Mein Leben hängt an der Fantasie eines Sechsjährigen, schoss es Kugler durch den Kopf, als er schneller als gewohnt dem Klassenzimmer entgegenstrebte, in dem der Religionsunterricht der Drittklässler stattfand. Das waren die Achtjährigen, die erfahrungsgemäß keinen allzu großen Kontakt zu den sogenannten Abc-Schützen hatten, die erst vor einem Monat eingeschult worden waren und zu denen auch Manuel gehörte.
Kugler lächelte den fröhlichen Kindern auf dem Flur zu und wollte sich gerade der Tür zum Klassenzimmer zuwenden, als er die energischen Schritte der Schulleiterin vernahm. Er drehte sich um und sah die attraktive Pädagogin, eine Mittdreißigerin, die bei den Kindern äußerst beliebt war, auf sich zukommen. Sie wirkte jugendlich und ihre positive Ausstrahlung sprang sofort auf ihre Gesprächspartner über. »Herr Kugler, guten Morgen«, begrüßte sie ihn. Es war wie ein Stich in sein Herz. Trotzdem bemühte er sich, die innere Unruhe zu verbergen. »Guten Morgen, Frau Stenzel«, lächelte er.
»Darf ich Sie noch schnell was fragen?« Kugler spürte, wie das Entsetzen sich seines ganzen Körpers bemächtigte. Etwas fragen, hallte es in ihm nach. Jetzt war es so weit.
»Ja, bitte«, presste er mühsam aus der trockenen Kehle hervor. Im Bruchteil einer Sekunde hatte er sich durch den freundlichen Klang von Stenzels Stimme beruhigt gefühlt. Außerdem hätte sie ihn bei einem so schweren Vergehen, wie es ihm vorgeworfen wurde, gewiss nicht auf dem Flur angesprochen, mahnte ihn die innere Stimme.
»Geht’s Ihnen nicht gut?«, fragte die Schulleiterin plötzlich und sah ihn verwundert an. »Sie sehen heute nicht sonderlich gut aus.«
»Doch, doch, danke«, beeilte er sich zu sagen. »Ich hab nur ein bisschen schlecht geschlafen.« Er holte tief Luft und erkundigte sich höflich: »Was wollten Sie mich fragen?«
Sie nahm ihn beiseite, um aus der Hörweite der Kinder zu gelangen. »Stimmt das mit dem Hartmann?«
Kugler war es, als fiele ihm eine zentnerschwere Last von den Schultern. »Hartmann?«, wiederholte er, um seine wild herumrasenden Gedanken ordnen zu können. »Hartmann, ja, er hat sich wohl gestern Nachmittag das Leben genommen.«
»Ach«, flüsterte Frau Stenzel. »Dann stimmt es also doch.«
»Aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen«, legte Kugler mit bedeckter Stimme nach und überlegte, weshalb sich die Schulleiterin für Hartmanns Schicksal interessierte.
»Es soll Selbstmord gewesen sein?« Ihre Stimme wurde noch eine Nuance leiser.
»So heißt es, ja«, nickte der Theologe.
»Schon wieder einer – und das in diesem kleinen Dörfchen hier.« Sie sah ihn mit versteinertem Gesicht an. »Wie verzweifelt müssen Menschen sein, die so etwas tun? Und meistens bemerken nicht mal die nächsten Angehörigen etwas davon. Ist das nicht furchtbar?«
Kugler spürte zum ersten Mal in seinem Leben, dass er nicht mehr die Kraft haben würde, anderen in solchen Situationen Trost zuzusprechen. Wie schlimm würde erst alles sein, wenn herauskam, was ihm vorgeworfen wurde? Er verabschiedete sich von der Schulleiterin und ging in das Klassenzimmer. Bald würde er ihr in eigener Sache gegenüberstehen. Oder wäre es besser gewesen, gleich jetzt alles anzusprechen?
Nein, dazu war er schon viel zu schwach.
3
Der Herbstnebel hatte sich inzwischen verzogen, als Lokaljournalist Sander und sein Fotograf Homsheimer in Rimmelbach eingetroffen waren. Sander bedauerte, dass es noch zu früh war, um das örtliche Gasthaus aufzusuchen. Solche Lokale erwiesen sich nämlich meist als gute Informationsquelle, vorausgesetzt, der Wirt zeigte sich gesprächig. Jetzt aber entschied sich der Journalist für den Bürgermeister, mit dem er seit Jahren viele berufliche Kontakte hatte. Hugo Benninger, so hieß er, war bodenständig und mit den Problemen seiner Bürger bestens vertraut. Er öffnete den Besuchern persönlich die noch verschlossene schwere Rathaustür, denn eine Sekretärin gab’s nur zweimal in der Woche – und dann auch nur nachmittags.
»Die Presse«, frotzelte er, schüttelte den beiden die Hände und verzog sein braun gebranntes Gesicht zu einem breiten Lächeln. »Hab ich mir fast gedacht, dass Sie irgendwann auftauchen werden. Kommen Sie rein.« Er ließ die Medienvertreter ins Innere, schloss die Tür und ging voraus über eine knarrende Holztreppe nach oben. »Radio 7 hat auch schon angerufen. Und Sat1 will ebenfalls einige Reporter vorbeischicken«, sagte der Mann, der trotz seines fortgeschrittenen Alters wieselflink das Obergeschoss erreichte, wo er die Besucher in sein Büro führte. Sander stieg der Duft nach alten Möbeln und staubigen Akten in die Nase. Beides verband sein Unterbewusstsein mit Bürokratismus und verknöcherten Beamten.
Benninger wollte nicht zu diesem Klischee passen. Er bat den Besuchern Plätze auf Holzstühlen an und ließ sich hinter einem Schreibtisch nieder, auf dem Sander einen Stempelhalter und jenes altertümliche Utensil entdeckte, mit dem auf wichtigen Dokumenten die frische Tinte mit Löschpapier abgetupft wurde.
»Die Polizei hat wohl eine Pressemitteilung versendet«, resümierte der Bürgermeister. »Und irgendjemand hat Wind davon gekriegt, dass eine Jagdwaffe im Spiel war.« Er rückte seine Brille zurecht. »Wenigstens kein Sportschütze. Aber Sie wissen ja, wie das ist, wenn’s um Waffen geht.«
Sander nickte. »Jagd- und Sportwaffen, ich weiß. Ein Reizthema. Aber so, wie es in diesem Fall hier aussieht, hat der Jäger sich ja wohl selbst erschossen.«
»Vermutlich ja«, gab sich Benninger zurückhaltend. »Aber Sie sind sicher darüber informiert, dass die Polizei eine zweite Person sucht, die auch auf dem Hochsitz gewesen sein soll.«
»So ist es«, bestätigte Sander, während Homsheimer damit begann, den Bürgermeister hinterm Schreibtisch zu fotografieren. »Mich würde aber eher interessieren, was man in Rimmelbach allgemein so redet.«