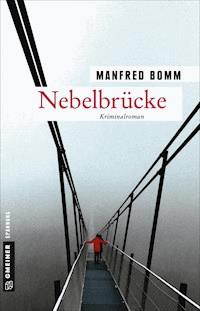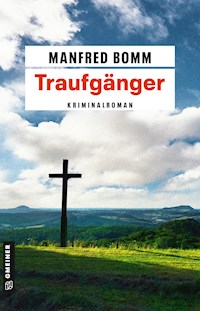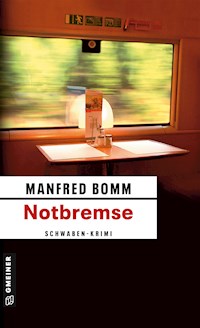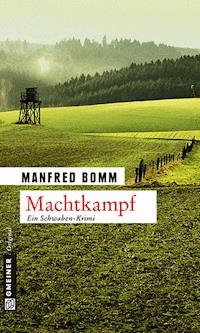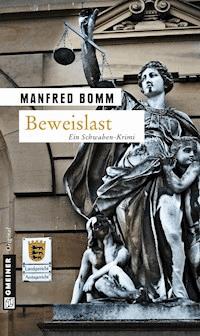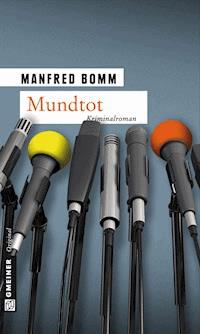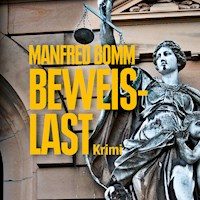Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar August Häberle
- Sprache: Deutsch
Gibt es einen Zusammenhang zwischen einem lange zurückliegenden Flugzeugabsturz und dem angekündigten Weltuntergang? Von Zweifeln geplagt, schließt sich eine Frau einer Gruppe Gleichgesinnter an, die diesen Fragen nachgeht. Der schwäbische Kommissar August Häberle und sein Assistent Mike Linkohr treffen bei der Suche nach einem Mörder Menschen, die an den baldigen Weltuntergang glauben - oder davon profitieren wollen. Und alle scheint ein Geheimnis zu verbinden …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Bomm
Grauzone
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Fotos von: © suze / photocase.com
ISBN 978-3-8392-4090-8
Gewidmet allen, die bereit sind, an mehr zu glauben als an die Macht des Geldes und dem Streben nach immer mehr wirtschaftlichem Wachstum. Seien wir aber auch auf der Hut vor allen, die unser Vertrauen in die Geheimnisse und Wunder dieser Welt dazu missbrauchen wollen, uns auf Irrwege zu leiten und Ängste zu schüren, um daraus Kapital zu schlagen. Möge es uns gelingen, den Blick auf das Gute zu richten, damit wir nicht von denen geblendet werden, die den Glauben an das Wunderbare und Unwahrscheinliche verloren haben. Versuchen wir, sensibel zu sein, um die kleinen Signale, die uns geschenkt werden, richtig deuten zu können.
Denn seit die Menschen begonnen haben, ihren Blick von der Natur und der Schöpfung abzuwenden, um an Maschinen und Computer zu glauben, ist vieles verlorengegangen oder gar verächtlich gemacht worden, was unseren Vorfahren noch hilfreich war. Wir sollten nicht so arrogant sein und meinen, mit unserer Zivilisation das höchste Wissen erlangt zu haben. Vergessen wir nicht, dass die Menschen eines jeden Zeitalters über das, was für sie Vergangenheit war, mit Unverständnis, Verwunderung oder Bestürzung reagiert haben. Nicht das Jetzt und Heute ist das Maß aller Dinge, sondern das, was diesen Planeten nachhaltig schützt und den Menschen Frieden und Zufriedenheit beschert. Bei jeder Begegnung mit der Natur – sei es in den Bergen oder am Meer, in Höhlen oder im Weltall – sollten wir daran denken, dass dieses wunderbare Zusammenspiel aller Systeme kein Zufall sein kann.
1
»Einfach Unfug. Verzeihen Sie, wenn ich das so deutlich sage.« Professor Dr. Walter Siegler, Rektor der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, verstand es wie kein anderer, seine Zuhörer zu faszinieren. Wenn er über Weltuntergang und Aberglaube dozierte, verknüpfte er Wissenschaftliches mit Heiterem. Dann ging er mit erhobenem Zeigefinger vor dem Auditorium auf und ab und brillierte mit geschliffener Rhetorik, die in Verbindung mit seinem herben fränkischen Akzent charmant und sympathisch klang. »Nur weil die Mayas ihren Kalender nicht ins Unendliche fortgeführt haben, wird unser schöner Planet nicht mit Pauken und Trompeten untergehen«, fuhr er fort und sah in lächelnde Gesichter. Rund 50 Personen waren in dieses Kellergewölbe einer ehemaligen Weinhandlung gekommen, um sich in mystisch-gespenstischer Umgebung, zwei Etagen unter der Erdoberfläche, von dem ›Herrn Professor‹ den Weltuntergang erklären zu lassen, wie er realistischerweise durch einen Kometen- oder Asteroiden-Einschlag geschehen könnte, oder wie ihn die großen Religionen auf unterschiedliche Weise prophezeiten. »Natürlich wird eines Tages die Apokalypse über uns hereinbrechen«, wurde Siegler wieder ernst. »Dann nämlich, wenn sich in drei oder vier Milliarden Jahren, also ziemlich bald« – er hielt kurz inne und grinste – »unsere sterbende Sonne aufbläht und alles in ihrer Umgebung verbrennt.«
Das Lächeln wich aus den Gesichtern. Es war totenstill. Siegler sog die feucht-modrige Kellerluft ein und betrachtete für einen Moment den riesigen, leicht angerosteten mächtigen Leuchter, der mit einem Dutzend brennender Kerzen zur Gewölbedecke hochgezogen worden war. Die Zuhörer saßen in zwei voneinander getrennten, unterschiedlich abgestuften Räumen, die Siegler jedoch beide von seinem Standort aus überblicken konnte. Die Wände waren ziemlich rau verputzt und mit dem Staub von Jahrzehnten behaftet. Den linken Raum, der drei, vier Stufen tiefer lag, zierten an der Rückwand riesige Weinfässer; den rechten beherrschte ein gusseiserner Holzofen, der behagliche Wärme verbreitete. Außerdem gab es von hier aus weitere Gänge und Treppen, die in noch tiefere Bereiche führten. Neben Siegler, der sich an seinem Standort nur wenige Meter bewegen durfte, um nicht aus dem Sichtwinkel der Zuschauer zu geraten, gähnte das schwarze Loch, das an einen Brunnenschacht oder an ein Verlies erinnerte. Es war mit stabilem Eisengitter abgedeckt worden. Ein von Hand betriebener verrosteter Flaschenzug ließ auf die Bedeutung dieses Schachtes schließen: Hier wurden einst Fässer hochgehievt oder in die finstere Tiefe abgesenkt. »Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, jedes Mal, wenn wieder ein Termin zum Weltuntergang ansteht, würde sich die ganze Menschheit darauf vorbereiten«, dozierte Siegler weiter und behielt mit seinen flinken Augen alle seine Zuschauer im Blick, obwohl sie im Halbdunkel flackernder Kerzen und indirekter Strahler saßen. Dort, in der letzten Stuhlreihe, hatte auch eine seiner Dozentinnen Platz genommen: Professorin Dr. Hildtraud Platterstein. Sie galt als kulturell engagiert und hatte ihn dazu überredet, an diesem ungewöhnlichen Ort über ein ungewöhnliches Thema zu reden.
Dass dieses uralte Kellergewölbe für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden konnte, war den jungen Inhabern eines Blumengeschäfts zu verdanken, die das Gebäude gekauft hatten, um oben im Erdgeschoss ihr Geschäft einzurichten. Tief unten aber, hier im außergewöhnlichen Ambiente dieses Kellers, wollte das engagierte Paar den Kulturschaffenden ein Forum bieten.
Weil der Hochschul-Rektor weithin als begnadeter Redner bekannt war, hatten sie über die kulturell interessierte Professorin Kontakte zu ihm geknüpft. Zwar war Siegler von Haus aus ein Betriebswirtschaftler, doch seine philosophische Ader, vor allem aber seine scharfzüngigen Bemerkungen, machten ihn zu einem beliebten Unterhalter, der – leicht rundlich und kurz vor der Pension stehend – auch mal mit seiner Körpergröße kokettierte, die nur knapp 1,60 Meter betrug. Damit plauderte er sich in die Herzen der Zuhörer und spürte selbst, wie sie ihm an den Lippen hingen.
»Wenn wir alle glauben würden, dass am 21. Dezember 2012 die Welt unterginge – wie es die selbst ernannten Maya-Kenner uns weismachen wollen«, erhob Siegler plötzlich seine Stimme, »würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen, noch ehe der Planet in Schutt und Asche versinkt. Denn was würde uns daran hindern, unser Vermögen noch schnell zu verprassen? Alles zu verjubeln – und uns einem Art Sodom und Gomorrha hinzugeben? Pech nur, wenn das mit dem Weltuntergang anschließend nicht klappt.« Er pausierte kurz. »Aber manche globale Finanzjongleure haben sich vermutlich schon darauf eingestellt.«
Er hob wieder den rechten Zeigefinger, als persifliere er einen ›gelehrten Professor‹, also sich selbst. »Ein Bekannter von mir schreibt gerade über den Unfug mit den Weltuntergängen ein Buch, das im Februar erscheinen soll. Ich hab ihm gesagt: Du bist ganz schön optimistisch. Dumm ist’s nur, wenn die Mayas recht haben und im Dezember die Welt untergeht, dann ist alles für die Katz gewesen.« Ein gedämpftes Lachen erfüllte kurz die beiden Kellergewölbe. »Na ja«, sprach Siegler weiter, »auf diesen Einwand hin hat mein Bekannter gesagt, das sei ihm völlig egal. Er habe sich dann zwar mit seinem Text blamiert – aber dass er falsch gelegen sei, merke ja niemand mehr.«
Einige Zuhörer wagten jetzt, laut zu lachen. Richtigen Beifall gab’s erst, als Siegler zum Ende kam und sich für das Interesse bedankte.
Es folgte die obligate Aufforderung, Fragen zu stellen, was bei Veranstaltungen dieser Art meist niemand tat, weil keiner den Anfang machen wollte. Siegler ließ noch ein paar Sekunden verstreichen, bis er merkte, dass eine Frau in der zweiten Reihe Blickkontakt zu ihm gesucht und zaghaft die Hand gehoben hatte. Er nickte ihr zu und erteilte ihr mit einem auffordernden Lächeln das Wort.
»Sie haben das sehr gut erklärt«, begann die Dame, die einen leichten Schweizer Akzent zu unterdrücken versuchte, »doch würde mich interessieren, ob Sie daran glauben, dass uns Menschen Signale aus anderen Bewusstseinsebenen gesandt werden.«
Siegler spürte, dass er jetzt keine saloppe Antwort geben durfte. Der Kleidung nach zu urteilen, war die Fragestellerin gut situiert. Er schätzte sie auf knapp 50.
»Diese Fragen«, begann er einfühlsam, »sind so alt wie die Menschheit. In nahezu allen Kulturen, vielleicht sogar in allen, ist von anderen Ebenen die Rede – um es mal ganz neutral und ohne religiöse Betrachtungsweise auszudrücken. Jenseitsglauben, Götter, Seelenwanderung, ewiges Leben. Dies findet sich in Variationen ziemlich überall. Vielfach auch die Einflussnahme auf andere Menschen – durch Gedanken, bösen Zauber. Denken Sie an Voodoo oder Schamanen oder an Telepathie. Es soll Heilungserfolge durch Handauflegen geben. Man muss dies kritisch-distanziert betrachten, sich aber davor hüten, es einfach als Hokuspokus abzutun. Auch Wissenschaftler sollten nicht nur an das glauben, was sie mit heutigen Mitteln erklären können. Vielleicht haben sie schon morgen andere Möglichkeiten, mit denen sich erklären lässt, was heute noch rätselhaft erscheint.«
Beifall. Siegler hatte offenbar gesagt, was viele seiner Zuschauer dachten.
»Sie …«, die Fragestellerin suchte offenbar Gewissheit, die sie nirgendwo finden würde, »Sie glauben also auch, es könnte so etwas wie einen Fingerzeig Gottes geben?«
»Der Volksmund sagt: Glauben heißt nicht wissen«, konterte der Professor vorsichtig, »unser Universum ist so komplex, dass wir uns nicht erdreisten dürfen, jemals alle Zusammenhänge begreifen zu wollen.« Siegler stockte. Eigentlich hasste er ausweichende Antworten, weshalb er eine Gegenfrage riskierte: »Hatten Sie denn schon mal Erlebnisse, die Ihnen Anlass geben, sich mit solchen Themen zu befassen?«
Die Dame zögerte kurz, schloss für einen Moment die Augen und nickte. »Ja, das hab ich.« Es klang sehr entschlossen.
Sie hatte den ganzen Abend über an diesen Septembertag denken müssen.
Dieser eine Tag im September hatte alles verändert. Ihre Gefühle, ihre Träume, ihre Wünsche – ihr komplettes Leben. Was ihr bis dahin unendlich wichtig erschienen war, hatte diese einzige, grausame Sekunde des Schicksals für immer vernichtet. Karin Waghäusl versuchte, den Gedanken an Glitzer und Glamour zu verdrängen, von dem sie einst in Zürich umgeben war – dort, wo sie sich im Dunstkreis der Reichen, Schönen und Mächtigen hatte sonnen können.
Doch inzwischen waren fast 14 Jahre vergangen. 14 Jahre – seit sie alles aufgegeben und alles zurückgelassen hatte. Und sie würde es auch nie wieder wollen. Sie spürte ein fahles Schamgefühl in sich aufsteigen, wenn sie heute an den Luxus, vor allem aber an die Partys dachte, bei denen sie und ihr Mann in feinsten Kreisen des internationalen Geldadels verkehrt hatten.
Sie wollte die Erinnerungen an diese Zeiten gar nicht mehr aufkommen lassen. Ihr war bewusst geworden, dass es mehr auf der Welt gab, als nur das ewige Streben nach Einfluss und immer noch mehr Reichtum. Dieser eine Tag im September 1998 hatte ihr die Augen geöffnet, auch wenn sie seither unter einem Trauma litt, das sie zeitlebens nicht mehr loswerden würde. Sie war durch die Hölle gegangen.
Doch trotz aller Tragik mochte sie nicht glauben, dass dies alles zufällig geschehen war. Denn ohne jene Tage des Schreckens wäre es niemals zu diesen Begegnungen gekommen, aus denen sie unendlich viel Kraft schöpfte – auch vergangenen Samstag bei diesem Vortrag und erst recht jetzt, da sie wieder einmal auf dem Weg zu dieser Gemeinschaft der Gleichgesinnten war. Dorthin, wo der Himmel die Erde zu berühren schien. Nirgendwo sonst wurde ihr das Wunder der Schöpfung so bewusst wie dort oben. Auch wenn sich in den vergangenen Monaten einiges verändert hatte.
Nein, an einen Zufall wollte sie nicht glauben. Schon gar nicht, wenn sie an das Gebetbuch dachte.
Dieses kleine schwarze Buch. Formatfüllend auf einer linken Seite im Wochenendmagazin des Züricher ›Tages-Anzeigers‹ abgebildet. Es war zwar nur ein Inserat gewesen – aber wieso ausgerechnet an diesem Tag? Zwei Tage, nachdem die Zeit für sie stillgestanden war. Diese Abbildung hatte sich tief in ihre Seele gebrannt.
Dass dieses Gebetbuch es war, das ihr den Weg in ein neues Bewusstsein geebnet hat, galt ihr als Botschaft des Himmels. Als eine Botschaft, die ganz bestimmt nicht nur an sie gerichtet war. Sondern an die ganze Menschheit. Diese aber hatte es gar nicht zur Kenntnis genommen. Wie alles, was sich nicht mit der real-materiellen Welt vereinbaren ließ.
Dieser Tag vor 14 Jahren, der alles verändern sollte, hatte daheim bereits begonnen. Doch dort, wo das Entsetzliche geschah, zeigte die Armbanduhr des Mannes, der in Reihe 21 am Fenster saß, erst 21.10 Uhr. Es war noch die Ortszeit von New York, wo die McDonnell Douglas MD-11 vor knapp einer Stunde vom New Yorker John-F.-Kennedy-Airport in Richtung Genf abgehoben hatte. Mario Waghäusl rechnete sich aus, dass es daheim in Zürich bereits kurz nach drei Uhr war. Und während ihn jetzt, nach dem Abendessen, das monotone Dröhnen der drei Triebwerke dahindämmern ließ und der Airliner in rund 10 000 Metern Höhe durch die Nacht flog, wanderten die Gedanken zu seiner Frau, die er heute Nachmittag endlich wiedersehen würde. Dreieinhalb Wochen war er geschäftlich unterwegs gewesen, hatte im Auftrag Schweizer Banken anstrengende Gespräche mit Investment-Managern an der Wall Street geführt und sich mit einflussreichen Politikern in Washington getroffen. Einer von ihnen hatte sogar behauptet, ein enger Freund von Präsident Bill Clinton zu sein, der gerade tief in die Affäre um die Praktikantin Lewinsky verstrickt war. Zwischen Traum und Wirklichkeit produzierte Waghäusls Gehirn immer neue Bilder, die sich mit den Sehnsüchten nach seiner Frau und den Ereignissen der vergangenen Wochen vermischten. Dann schlief er ein. Und wieder bemächtigte sich seiner im Traum jenes finstre Geschehen, das viele Jahrzehnte zurücklag und das er nur vom Hörensagen her kannte. Aber seit er sich intensiv um die Aufklärung bemühte, hatte es sich tief in sein Unterbewusstsein gefressen. So tief, dass er ihm nicht mal im Schlaf entrinnen konnte. Ganz im Gegenteil. Wenn ihn die Wucht dieses Albtraumes traf, war er schweißgebadet. Etwas unfassbar Schreckliches lag über seiner Familie.
2
Im Cockpit hatten sich Flugkapitän Ernest Frohberger und sein Erster Offizier Henry Riedel auf den Transatlantik-Flug eingestellt, der sie wie immer bis nahe der Südspitze Islands heranführen würde. Was auf den Weltkarten wie ein Umweg erschien, war in Wirklichkeit die direkte Verbindung nach Mitteleuropa. Oft genug schon hatte der erfahrene Kapitän auch im Freundeskreis erklären müssen, dass sich eine Flugroute auf einer flachen Landkarte nicht als gerade Linie darstellen ließ. Die kürzeste Entfernung auf einer Kugel, wie sie die Erde nun mal ist, ergab, auf eine ebene Fläche projiziert, zwangsläufig eine Kurve.
Noch war die Swissair-Maschine mit der Flugnummer 111 entlang des nordamerikanischen Kontinents unterwegs, hinauf nach Kanada. Rechts der Atlantik, links die Landmasse. Jetzt, in der Dunkelheit, war von alledem nichts zu erkennen. Im Cockpit warfen die unzähligen Instrumente ein schummriges Licht. Kontrollleuchten glimmten, Displays leuchteten, Zeiger vibrierten sanft. Die Zeit, wie sie weltweit an Bord aller Flugzeuge gilt, wurde in GMT angezeigt, die Greenwich Mean Time. Es war demnach bereits 1:10 Uhr. Dem Wetterbericht zufolge gab es in dieser Spätsommernacht auf der Route nach Mitteleuropa keine Besonderheiten. Starker Westwind würde die Flugzeit voraussichtlich um eine Viertelstunde verkürzen. Ein Routineflug also, wie ihn die beiden erfahrenen Piloten schon viele Male gemeinsam absolviert hatten.
Während Kapitän Frohberger durch die linke Luke in den nachtschwarzen Himmel sah, wo vereinzelt Sterne glitzerten, ließ rechts neben ihm sein Kollege Riedel den Blick über die Instrumente streifen, um zufrieden festzustellen, dass alle Systeme einwandfrei und zuverlässig funktionierten. Noch.
Aber schon mit dem nächsten Atemzug verpasste ihm sein Körper einen gewaltigen Adrenalinstoß. Noch bevor er etwas sagen konnte, hatte es auch Frohberger bemerkt, der blitzschnell die wichtigsten Instrumente checkte und Blickkontakt zu Riedel suchte. »Riechst du das auch?«
Riedel, der gut zehn Jahre jünger war als der Flugkapitän, sog schnelle, kurze Atemzüge in sich auf und vollzog mit dem Kopf kreisende Bewegungen, um die Herkunft des Geruchs zu lokalisieren. »Die Klimaanlage?«, fragte Frohberger knapp. Seine sonore Stimme hatte plötzlich einen beunruhigten Klang.
»Ja«, bestätigte Riedel, der bereits gegen die aufkommende innere Unruhe ankämpfte, während sie die Cockpitbeleuchtung einschalteten. Oft genug hatten sie im Simulator alle möglichen Störfälle durchgespielt. Auch etwaigen Brandgeruch. Denn Feuer war eine der größten Gefahren an Bord eines Flugzeugs. Einen Triebwerkschaden konnte man nach menschlichem Ermessen noch in den Griff bekommen und eine geordnete Notlandung einleiten, aber die Ausbreitung eines Brandes war unberechenbar.
Die beiden Piloten wussten, dass sie sich strikt an den vorgeschriebenen Prozeduren orientieren mussten. Doch jetzt, da blitzschnelle Entscheidungen anstehen konnten, blieb keine Zeit, seitenlange Checklisten durchzugehen.
Nur eines war wichtig: Ruhe bewahren. So lautete das oberste Gebot, das jedem Flugschüler schon in den ersten Stunden des theoretischen Unterrichts eingebläut wurde. Innerhalb von Sekunden hatten sie jedenfalls festgestellt, dass alle Systeme weiterhin funktionierten und keines der Triebwerke eine Unregelmäßigkeit meldete. Das versprach zwar eine kurze Entwarnung, nicht aber die Lösung des Problems. Denn der Geruch blieb. Und wurde schlimmer.
Die Männer wussten, dass es jetzt auf jedes Detail ankam – auf jedes Kontrolllicht, auf die Anzeige eines jeden Instruments.
Mit knappen Worten hakten sie sämtliche infrage kommenden Ursachen ab. Kurz und prägnant, nach außen hin emotionslos. Rieder informierte sich bereits über einen möglichen Ausweichflughafen. Denn ohne es anzusprechen, war ihnen klar, dass eine Entscheidung über Leben und Tod anstehen würde.
Knapp drei Minuten waren seit dem ersten Auftreten des Geruchs vergangen, als sich im Schein der Cockpitlichter feiner Nebel ausbreitete. Rauch.
Es brannte. Irgendwo. Die Blicke der beiden Männer trafen sich.
Sie brauchten nicht auszusprechen, was sie dachten.
»Das sieht gar nicht gut aus«, sagte Frohberger mit fester Stimme und drückte entschlossen die Taste des Funkgeräts, das ihn mit dem zuständigen Luftfahrtkontrollzentrum im kanadischen Moncton verband. »Pan-pan-pan«, meldete er so ruhig wie möglich, obwohl diese drei Worte einen Funkruf mit hoher Priorität einleiteten und alle anderen auf dieser Frequenz zum sofortigen Schweigen verpflichtete. Die ›Swissair 111‹, sagte er, befinde sich in 31 000 Fuß und etwa 66 Seemeilen südwestlich des Airports von Halifax. Frohberger teilte dem Fluglotsen mit, dass es Rauchentwicklung im Cockpit gebe, und erbat eine Freigabe zur Landung auf dem nächstmöglichen Flughafen. Dass er jetzt nicht Halifax, sondern das 300 Seemeilen zurückliegende Boston in Massachusetts vorschlug, also ein deutlich weiter entferntes Ziel, würde später für Irritationen sorgen.
Der Fluglotse erteilte die Freigabe. Doch schon eine knappe Minute später schlug die sonore Männerstimme von der Flugverkehrskontrolle den viel näher gelegenen Flughafen Halifax vor, der sich nur noch 56 Seemeilen nordöstlich vom momentanen Kurs der Maschine befand. Frohberger akzeptierte und spürte ein bedrohliches Kratzen im Hals.
Er zog sich wortlos die Sauerstoffmaske übers Gesicht. Riedel tat es ihm nach. Jetzt wurde es ernst.
Der feine Rauch bildete bereits kleine Wölkchen und füllte das Cockpit bedrohlich aus. Seit sie ihn erstmals bemerkt hatten, waren nur wenige Minuten vergangen – und jetzt hatte sich der anfängliche Nebel bereits in wabernde Schwaden verwandelt.
Noch während sie schweigend und zunehmend unsicherer ihre Instrumente prüften und den Bordcomputer mit den Anflugdaten von Halifax fütterten, erhielten sie die Freigabe für den Sinkflug auf 10 000 Fuß. Die Stimme im Kopfhörer wollte die Anzahl der Passagiere und die Menge des Treibstoffs wissen. Für den Flughafen in dem provinziellen Halifax waren dies wichtige Informationen zur Vorbereitung einer Notlandung.
Kaum hatte Frohberger die Daten übermittelt, fuhr sein Copilot die Luftbremsen aus – jene Klappen, die das Tempo der Maschine verringerten und einen starken Sinkflug einleiteten.
3
Wie oft schon hatte ihr Gehirn sie mit diesen Bildern gequält? Gewiss mehr als zehntausend Mal in den vergangenen 14 Jahren. Diese Szenen waren tief in ihre Seele gebrannt, obwohl sie nichts davon selbst erlebt hatte. Es war nur die Fantasie, die ihr dieses schreckliche Ereignis vorspielte, als habe ein imaginärer Drehbuchschreiber daraus einen Horrorfilm gemacht. Doch Karin Waghäusl konnte sich nicht dagegen wehren. Sie waren einfach da, diese dramatischen Szenen. Mitten in der Nacht, beim Lesen eines Buches oder jetzt an diesem sonnigen Morgen auf der Autobahn. Wie ein Film, der sich niemals stoppen ließ, so lief das Schreckliche unablässig vor ihrem inneren Auge ab. Alle Versuche, es zu verdrängen, zu löschen oder zu vergessen, halfen nichts. Es brandete immer wieder auf, um sie stets mit noch größerer Gewalt wieder zu treffen. In solchen Momenten fühlte sie sich wie gelähmt und der Realität entrückt. Dann konnte sie sich auf nichts konzentrieren und keinen Gesprächen folgen. Sie mied menschliche Kontakte und hätte sich am liebsten tief in ein Erdloch eingegraben. Manchmal schien es ihr, als sei es mit dem Beginn der Wechseljahre noch viel schlimmer geworden. Ihre Stimmungsschwankungen waren seit ihrem 50. Geburtstag, den sie im Dezember gefeiert hatte, extrem heftig, und oftmals lagen nur wenige Stunden zwischen kurzen Glücksmomenten und abgrundtiefer Traurigkeit.
Obwohl sie diese regelmäßigen Treffen auf einer Berghütte sehr schätzte, wäre sie heute im Grunde ihres Herzens lieber daheimgeblieben. Es hatte sie sehr viel Überwindung gekostet, frühmorgens schon loszufahren. Doch dann hatte die Vernunft über die psychische Müdigkeit gesiegt, und sie war in ihren silberfarbenen Golf gestiegen. Sie fühlte sich auch gegenüber den anderen verpflichtet, von denen sich die meisten gewiss auf das Wiedersehen an diesen Tagen der Sommersonnwende in den Bergen freuten. Außerdem gab es einiges zu klären.
Seit sie sich dank des Internets gefunden hatten, waren sie eine verschworene Gemeinschaft geworden. Sie telefonierten oft, schrieben sich E-Mails und konnten ausgiebig über Gott und die Welt philosophieren – vor allem aber über Dinge reden, für die nicht alle Menschen empfänglich waren. Viel zu sehr hatte sich die heutige Gesellschaft aufs Materielle ausgerichtet, um noch die Geheimnisse des Lebens wahrzunehmen – geschweige denn zu akzeptieren, was man nicht sehen, anfassen und berechnen konnte. Was nicht ins physikalisch-chemische Weltbild passte, war schlichtweg nicht existent.
Und wer die Frage stellte, ob es Zufälle gab oder ob eine große Macht und Kraft den Lauf der Dinge vorherbestimmte, wurde als Querkopf oder Spinner abgetan. Karin Waghäusl allerdings mochte nicht mehr an Zufälle glauben. Wieder war es das Gebetbuch, das sie vor sich sah. Dass gerade das Rasthaus ›Allgäuer Tor‹ an ihr vorbei zog, nahm sie gar nicht zur Kenntnis. Wie so oft schon, ließen die monotonen Motorengeräusche Erinnerungen an Flüge wach werden – als sie noch gemeinsam um die Welt gejettet waren, sie und Mario. Hätte sie nur schon damals gewusst, was an seiner Seele nagte.
4
Damals, vor 14 Jahren, waren einige Passagiere bereits durch das veränderte Motorengeräusch verunsichert worden. Jetzt aber spürten sie zusätzlich, wie die Maschine rasch an Höhe verlor und eine Steilkurve flog. Eine erste Unruhe machte sich breit. Doch trotz angestrengter Blicke durch die Bullaugen entdeckten sie in der Schwärze der Nacht nichts Außergewöhnliches. Auch der Passagier, der in Reihe 21 auf Platz A saß, also in Flugrichtung links direkt am Fenster, war wieder wach geworden. Einen Grund zur Beunruhigung empfand er nicht. Dazu war er schon viel zu oft mit dem Flieger unterwegs gewesen, hatte heftige Turbulenzen erlebt und gelegentlich auch ungewöhnliche Flugmanöver. Doch dann kam die Durchsage, die für Entsetzen und Schrecken sorgte: Notlandung, Schwimmwesten anziehen. Panik. Schreie. Mario Waghäusls Herzschlag beschleunigte sich. Pulsrasen. Die beruhigende Stimme des Flugkapitäns im Lautsprecher ging in dem Gemisch aus Stimmen und Motorengeräuschen unter. Stewardessen eilten durch den Gang. Menschen sprangen auf, andere blieben wie gelähmt sitzen.
Vorn im Cockpit nahm die Besatzung Kontakt zur Bodenkontrolle in Moncton auf. Seit ihrem Notruf waren vier Minuten vergangen, und der Rauch, der sie einhüllte, wesentlich dichter geworden. Der Kurskreisel des Kompasses stand auf 50 Grad – in Richtung Halifax.
Flugkapitän Frohberger spürte Schweiß unter der Sauerstoffmaske. Sein Copilot hatte inzwischen Mühe, im dichten Rauch die Instrumente noch zu erkennen. Der Zeiger des Variometers, das die Sinkgeschwindigkeit angab, war ganz nach unten gerichtet.
Dann endlich wieder die Stimme der Flugverkehrskontrolle im Kopfhörer. Kurs ändern auf 30 Grad. Eine Linkskurve also. Und dann zur Landebahn 06 eindrehen. 06 stand für die Landerichtung – nordöstlich. Die Lotsen hatten einen Direktanflug anvisiert. Aber dazu war der Airliner noch viel zu hoch. 21 000 Fuß wären auf den restlichen 30 Seemeilen nicht abzubauen. Frohberger teilte dies mit und erhielt die Anweisung, sofort auf Nordkurs zu gehen, um dann während einer vollen Linksdrehung an Höhe zu verlieren und einen erneuten Landeanflug zu machen.
Chaos im Passagierraum. Kinder heulten, Frauen kreischten und ein Mann schrie: »Wir sterben.« Der rasche Höhenverlust und die Steilkurve, die plötzlich in die entgegengesetzte Richtung drehte, hatten Todesängste ausgelöst. Es war, als käme der Jet ins Trudeln.
»Bitte bleiben Sie ruhig«, versuchte eine Stewardess, über die Bordlautsprecher die Menschen zu besänftigen. Doch ihre Stimme klang schrill und verbreitete alles andere als Gelassenheit. Sie wiederholte das Gesagte auf Englisch. Niemand hörte zu. Die meisten Passagiere waren längst in Panik verfallen. Das Anziehen der Schwimmwesten verursachte ein heilloses Durcheinander, weil niemand so genau wusste, wo welches Band durchgezogen oder befestigt werden musste. Einige betätigten bereits die Automatik, mit der sich die Westen aufbliesen. Doch in Hektik und Panik nutzten auch die Angebote der Stewardessen nichts, die versucht hatten, der Reihe nach zu helfen. Nur einige wenige Passagiere waren ruhig sitzen geblieben, nachdem sie die gelben Westen übergestreift hatten. Es schien so, als würden sie sich dem Schicksal ergeben. Auch Mario Waghäusl blieb still. Obwohl er seit Kindheitstagen nicht mehr gebetet hatte, entsann er sich jetzt seines Schutzengels. Es fiel ihm sogar spontan ein Gebet ein.
Unten zogen die Lichter einiger kleiner Orte der kanadischen Provinz Nova Scotia vorbei. Sie würden jetzt über die St. Margaret’s Bay kommen und von dort aus, weiter sinkend, erneut Halifax anfliegen.
5
Jedes Mal, wenn sich diese Bilder ihrer bemächtigten, hatte Karin Waghäusl das Gefühl, sie mit allen psychischen und physischen Schmerzen körperlich zu durchleben. Den raschen Sinkflug, die Steilkurven, die Ungewissheit. Während ihrer vielen Flugreisen hatte es einige Situationen gegeben, die ihr bis heute rätselhaft erschienen. Einmal waren sie um Mitternacht in Bombay kurz vor dem Aufsetzen durchgestartet und erst bei einem zweiten Anflug gelandet – ohne, dass sie jemals erfahren hatten, was geschehen war. Endlos lang erschien ihr rückblickend auch der Nachtflug nach Südafrika, als sie über dem Schwarzen Kontinent Stunde um Stunde von heftigen Turbulenzen geschüttelt worden waren. Sie hatte damals einen Fensterplatz an den Tragflächen gehabt und im Schein der Positionslichter gesehen, wie die Naturkräfte an dem Airliner zerrten und die Tragflächen nach oben und unten gerissen wurden – als würden sie jeden Moment wie ein Stück Holz zerbersten.
Mario war in solchen Fällen ihr Ruhepol gewesen. Alles ganz normal, hatte er ihr zugeflüstert. Die Konstruktion eines Flugzeugs sei auf solche Gewalten ausgerichtet und überstehe weitaus mehr als diese normalen Urkräfte der Natur. Ob er sich damals, in jener Septembernacht, genauso beruhigen konnte? Sie griff instinktiv zu dem goldenen Halskettchen, das er ihr vor dem Abflug geschenkt hatte, und das sie seither stets trug. Oft, wenn sie in tiefe Trauer verfiel, umklammerte sie den kleinen, filigran ausgearbeiteten Anhänger, der eine Posaune darstellte. »Sie soll dir immer schöne Melodien spielen – auch wenn du mal traurig bist und du glaubst, die Welt geht unter.« Die Worte klangen ihr immer noch nach. Seit 14 Jahren. Hatte Mario eine Vorahnung gehabt, als er damals, wie schon viele Male zuvor, in die USA flog? Er war ungewöhnlich sensibel, und manchmal erschien es ihr, als habe er einen siebten Sinn, der ihn Vergangenes und Zukünftiges erahnen ließ.
6
Mario Waghäusl versuchte, das Chaos um sich herum auszublenden. Mit der Sturheit eines knallharten Geschäftsmannes und dem Wissen, dass auch panisches Verhalten nichts verändern würde, saß er da und betete. Er, der noch bis vor wenigen Minuten über Geldgeschäfte und Finanztransaktionen nachgedacht hatte, klammerte sich plötzlich an eine große Macht, von der er nicht einmal so genau wusste, ob er an sie glauben sollte. Doch wenn es sie gab, dann konnte nur sie allein die Katastrophe noch verhindern. Falls sie nicht vorbestimmt war. Oder es nur ein grausamer Zufall war, dass er und die anderen 228 Menschen ausgerechnet mit dieser Maschine nach Genf hatten fliegen wollen. Vielleicht war für sie alle zu dieser Minute die Zeit abgelaufen. Es gab Zufälle. Auch grausame.
Nur Dirk hatte sich allem entziehen können. Dirk, dem in New York ein geschäftlicher Termin dazwischen gekommen war. Hatte ihn ein gnädiges Schicksal vor diesem Flug bewahrt? War auch dies Zufall gewesen?
Waghäusl wehrte sich gegen solche Gedanken. Er mochte sich auch nicht vorstellen, was sich vorn im Cockpit von Swissair111 in diesem Augenblick abspielte. Flugkapitän Frohberger und sein Kollege entschieden, über der Meeresbucht abseits von Peggy Cave einen Großteil des Treibstoffes abzulassen. Mit vollen Tanks war der Airliner für eine Notlandung zu schwer – und außerdem wäre es auch viel zu riskant. Doch bevor sie die nötigen Einstellungen vornehmen konnten, verlangte die Flugverkehrskontrolle erneut die Zahl der Passagiere und die Treibstoffmenge. Frohberger schluckte und holte unter seiner Sauerstoffmaske tief Luft. Er wollte sich nicht anmerken lassen, wie sehr ihn die vergangenen Minuten mitgenommen hatten. »215 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder«, meldete er monoton und bemerkte nicht, dass seine Konzentration nachließ. Die 230 Tonnen, die er als Treibstoff-Menge nannte, waren das Gewicht des gesamten Flugzeugs.
Unter den Sauerstoffmasken der beiden Piloten sammelte sich Schweiß. Inzwischen quoll dicker dunkler Qualm aus den Lüftungsschlitzen.
Knapp 13 Minuten, nachdem sie den seltsamen Geruch erstmals bemerkt hatten, drehten sie auf Anweisung der Fluglotsen von Moncton auf Südkurs. Eine halbe Minute später signalisierte ein Warnton, dass sich der Autopilot abgeschaltet hatte, worauf Riedel, der Copilot, instinktiv zur manuellen Steuerung griff. Ihm war heiß. Sein Puls raste. Er spürte plötzlich Todesangst in sich aufsteigen. Auch seinem Kollegen schien die angelernte Ruhe verloren zu gehen.
Augenblicke später setzten sie gleichzeitig einen ›Emergency Call‹ ab – einen Notfall allerhöchster Priorität.
In der Kabine hatte sich die erste große Unruhe wieder etwas gelegt. Die meisten Passagiere saßen mit angezogener Schwimmweste kreidebleich auf ihren Plätzen. Paare hielten sich gegenseitig mit den Händen fest oder umarmten sich und sprachen sich Trost zu. Frauen und Männer schluchzten gleichermaßen. »Wir sollten alle beten«, rief ein älterer Herr von hinten. »Wir werden alle sterben.«
Mario Waghäusl auf Platz 21 A kämpfte inzwischen gegen heftige Magenkrämpfe. Sein Blutdruck war nach oben geschossen. Er schwitzte und zitterte am ganzen Körper. Nur nichts anmerken lassen, befahl er sich. Sein Nebenmann, ein jung-dynamischer Geschäftsmann mit viel Gel in den Haaren, hing mit entsetzt aufgerissenen Augen apathisch im Sitz.
»Das wird schon«, flüsterte ihm Waghäusl zu. »Notlandungen gibt es immer mal. Das kann vorkommen.« Seine Stimme verriet jedoch, dass ihn selbst die Panik ergriffen hatte. Ihm war die Überzeugungskraft der vergangenen Tage völlig abhandengekommen. So sehr er sich auch bemühte, gelassen zu bleiben – seine innere Stimme, sein Instinkt, sein sensibles Gespür für Glück und Unheil sagten ihm, dass sie keine Chance mehr hatten.
Und jetzt war es ihm so, als ziehe ein merkwürdiger Geruch durch die Maschine. Um ihn zuordnen zu können, sog er die Luft mit kurzen Atemzügen ein. Roch es tatsächlich nach Rauch? Die Gewissheit durchzuckte seinen ganzen Körper. Rauch. Das war Rauch. Oder doch nicht? Er atmete noch einmal langsam durch, konzentrierte sich auf seine Geruchsnerven, doch es gab keinen Zweifel mehr. Sein Puls raste.
Nichts anmerken lassen, befahl er sich. Gerüche gab es in einem Flieger oft. Selbst Kerosin hatte er unterwegs schon gerochen. Oder es zog der Duft aus der Bordküche durch die Reihen. Besonders bei extremen Flugmanövern wie diesen konnte das vorkommen. Aber jetzt, verdammt noch mal, jetzt in dieser Notlage würde sicher in der Bordküche nichts erwärmt. Noch während er lauschte, ob andere Passagiere den Geruch auch schon bemerkt hatten, wurden seine schlimmsten Befürchtungen auf dramatische Weise bestätigt: Das Licht fiel aus, und augenblicklich war auch die Videoprojektion auf den Leinwänden vor den Sitzreihen erloschen. Undurchdringliche Schwärze, stockfinstre Nacht. Wieder Panik. Ein vielhundertfacher Schrei übertönte das Dröhnen der Triebwerke. »Wir stürzen ab«, schrie eine Frau – und wiederholte dies mit schriller Stimme – so laut, so durchdringend, wie dies nur im Angesicht des nahen Todes möglich ist. Die ganze Kabine war jetzt von Panik ergriffen.
Der Passagier auf Platz 21 A klammerte sich mit schweißnassen Händen an das Polster des Sitzes. Er schloss die Augen und betete. »Es brennt«, rief jemand, »es brennt!« Alle hatten jetzt Brandgeruch bemerkt. War dies das Ende? Die Apokalypse eines jeden Einzelnen? Er hatte es geahnt, als kurz vor dem Abflug ein seltsames Gefühl über ihn gekommen war. Nein, er hatte keine Flugangst. Aber diesmal war beim Check-in alles anders gewesen. Hätte er mit jemandem darüber gesprochen, hätte er sich dem Gespött ausgesetzt. Wie konnte sich ein Finanzmanager von irgendwelchen zufälligen Zeichen beeindrucken lassen? Dass ihm beim Betrachten der Monitore, auf denen die Flüge der nächsten Stunden angezeigt wurden, immer wieder die Zahl 13 ins Auge stach – bei den Flugnummern, bei der Uhrzeit, bei den Gates. Immer 13. Außerdem war ihm bei der Zufahrt zum Flughafen ein Leichenwagen begegnet. Wann kam dies schon mal vor? Ein Leichenwagen in der Nähe eines Flughafens. Und heute früh im Hotel war ihm ein Glas auf den Boden gefallen und in tausend Teile zersprungen. Kein guter Tag heute.
7
Irgendjemand hatte am Rande der Autobahn offenbar etwas verbrannt. Karin Waghäusl hätte nicht zu sagen vermocht, ob der Geruch es war, der ihr die Schreckensbilder von jener Nacht wieder in Erinnerung rief, oder ob sie ihn nur wahrgenommen hatte, weil ihr Gemütszustand heute wieder ganz besonders unter dem Eindruck dieser traumatischen Ereignisse litt. Sie versuchte, sich auf die Straße zu konzentrieren. Der Verkehr rollte an diesem Freitagvormittag problemlos dahin, zumal auf der A7 üblicherweise weniger Lastzüge unterwegs waren als auf anderen Autobahnen. Jetzt, Mitte Juni und außerhalb aller Ferien, fuhren jedoch Rentner und Wochenendurlauber in Richtung Allgäu oder in das österreichische Tannheimer Tal, das durch einen vorgelagerten Höhenzug topografisch von Deutschland getrennt ist.
Das Wetter bot sich geradezu an, nach dem langen, strengen Winter und dem bisweilen sehr kühlen Mai den endlich erwachten Bergfrühling zu genießen. Karin Waghäusl musste daran denken wie sie vor vielen Jahren beschlossen hatten sich künftig stets am zweiten Wochenende nach Fronleichnam zu treffen. Kein anderer Termin würde so gut zu den Themen passen, über die sie sich gerne die Köpfe heiß redeten. Denn an diesem Wochenende wurde im Tannheimer Tal das Herz-Jesu-Fest gefeiert – mit Fackeln auf den Bergen und riesigen, weithin leuchtenden symbolträchtigen Darstellungen an den Steilhängen. Aus unzähligen kleinen Feuern formen sich dann Kreuze, Herze, Kelche oder betende Hände. Zwei Abende lang erinnern die Einheimischen auf diese Weise an die Franzosenkriege vor über 200 Jahren, als das Land Tirol von den mit Napoleon verbündeten Bayern beherrscht wurde. Damals weihten die Gläubigen ihre Heimat dem Herzen Jesu und entzündeten auf den Bergen Feuer als Zeichen des Widerstandes. Traditionell lodern diese Feuer seither am zweiten Wochenende nach Fronleichnam.
Am Samstagabend, das wusste Karin Waghäusl, flackerten diese Leuchtfeuer von den Bergkämmen beim Haldensee; am Sonntagabend setzte sich der stille Lichterzauber über Tannheim, Zöblen und Schattwald fort, wo die Symbole immer größer und vielfältiger werden.
Karin Waghäusls Gedanken schweiften ab. Gedenk- und Feiertage – welche Bedeutung hatten sie denn überhaupt noch? Tatsächlich waren doch Himmelfahrt und Fronleichnam, die gerade erst ein paar Wochen zurücklagen, nur noch ›Pfeiler‹ für ›Brückentage‹. Denn wer von denen, die sich zum Beispiel mit Himmelfahrt vier freie Tage gönnten, hatte schon eine Ahnung, was es mit diesem Feiertag auf sich hat, dachte sie. Manche mochten wahrscheinlich meinen, Himmelfahrt sei der Tag der Fliegerei – vielleicht zum Gedenken an die Flugpioniere oder die erste Mondlandung von 1969. Eigentlich verwunderlich, dass die Fluglinien an diesem Tag keine Schnäppchenflüge anboten.
Wer nutzte eigentlich diese geschenkte freie Zeit für das, wozu sie eigentlich gedacht war? Zum Besuch eines Gottesdienstes und zum Gedenken an Jesus, dessen vergeistigter Körper nach der Auferstehung auf wundersame Weise die materielle Welt verlassen haben soll? Karin war tief davon überzeugt, dass die heutige Gesellschaft weit davon entfernt war, solche christlichen Werte zu achten und ihre Traditionen zu pflegen. Schon oft hatte sie im Kreis ihrer gleichgesinnten Freunde darüber philosophiert, weshalb es die Menschen in den hiesigen Breitengraden nicht mehr wagten, sich öffentlich dazu zu bekennen. Lag es daran, dass die Meinungsmacher in den Medien gleich alles als Hokuspokus abtaten, was nur annähernd etwas mit Glauben zu tun hatte?
Für viele Männer jedenfalls war der Himmelfahrtstag nichts anderes als der Vatertag, der nahezu ungehemmte Ausgelassenheit versprach. Vor allem aber alkoholische Trinkgelage.
Himmelfahrt. Allein dieses Wort hinterließ bei Karin einen schalen Geschmack. Viel zu sehr erinnerte es sie ans Fliegen. Für Mario war es gewiss kein Flug ins Licht gewesen, sondern in die Ewigkeit.
8
Weil auch die Bordsprechanlagen nicht mehr funktionierten, hatte sich eine Stewardess in der Finsternis durch die chaotischen Verhältnisse zum Cockpit vorgedrängt und den Stromausfall gemeldet. Beim Öffnen der Tür war ihr beißender Qualm entgegen geschlagen, der sich sogleich nach weiter hinten ausbreitete und für neue Entsetzensschreie sorgte.
Die Piloten registrierten nur beiläufig das, was die panische Flugbegleiterin gestammelt hatte, und forderten sie mit einer schnellen Handbewegung auf, die Tür wieder von außen zu schließen. Kapitän Frohberger meldete den Lotsen, dass die SR 111 über der Bucht den Treibstoff ablassen werde, um nach der erfolgten Volldrehung sofort den Landeanflug zur Bahn 06 fortzusetzen. Doch in diesen Sekunden der allerletzten Entscheidung schien es so, als habe sich das Feuer – wo immer es sein mochte – zu den wichtigsten Systemen der Maschine durchgefressen.
Innerhalb weniger Sekunden fiel der Gierdämpfer aus – jene Automatik, die das Drehen um die Hochachse verhindert. Die Maschine begann zu schlingern, worauf die Piloten einen neuerlichen Notfall meldeten. In den folgenden acht Sekunden fielen nacheinander alle wichtigsten Instrumente aus. Unterdessen gab die Flugsicherung die Erlaubnis zum Ablassen des Treibstoffes.
Aber SR 111 bestätigte diesen Funkspruch nicht mehr. Aus den Kopfhörern im Tower waren nur noch unverständliche Gesprächsfetzen zu vernehmen. Vermutlich Schweizerdeutsch.
Seit dem Start auf dem John-F.-Kennedy-Airport waren exakt eine Stunde, sieben Minuten und 46 Sekunden vergangen.
In Mitteleuropa zeigten die Uhren 2:25 Uhr.
Und Karin Waghäusl hatte geschlafen. Weshalb sie gerade jetzt aufwachte, führte sie auf die Unruhe zurück, die sie jedes Mal beschlich, wenn ihr Mann nach so langer Zeit wieder zurückkam. Es war die pure Vorfreude.
Ganz gewiss nichts anderes, redete sie sich ein.
9
Sie zitterte. Die Tacho-Nadel hatte sich auf 80 eingependelt. Karin Waghäusl war immer langsamer geworden, obwohl ihr die nahezu leere Autobahn freie Fahrt ermöglicht hätte. Aber wenn sie an diesen Tag im September denken musste, formte sich der Bericht über die Absturzursache, den sie viel später erhalten hatte, zu einem Film. Obwohl offenbar geklärt werden konnte, was den Brand ausgelöst hatte, nämlich ein Kabel für die Unterhaltungselektronik an Bord, empfand sie dies niemals als Trost für den Verlust des Ehemannes. Mit einem Schlag war alles Geschichte und Vergangenheit gewesen, was sie in all den Jahren gemeinsam erlebt hatten. Warum waren sie auf diese entsetzliche Weise getrennt worden? Aber diese Frage stellten sich vermutlich tagtäglich Tausende Menschen, denen ebenfalls ein enger Angehöriger genommen wurde. Sie war damit nicht allein. Dies hatte sie in den folgenden Jahren dankbar spüren dürfen, als sich ein Freundeskreis zusammenfand, der sich regelmäßig traf – am liebsten in einer Berghütte hoch über dem Tannheimer Tal. Und immer an diesem Wochenende.
Sie musste sich auf die Straße konzentrieren. Denn ihr Gedächtnis rief ihr auch den Tag danach in Erinnerung. Als das stundenlange Hoffen und Bangen, die endlose Ungewissheit, zur Endgültigkeit wurde: Niemand hatte den Absturz in die St. Margaret’s Bay überlebt. Mario würde nie wieder kommen.
Vielleicht hatte er noch die Schwimmweste anlegen können und treibt irgendwo lebend auf dem Wasser, war damals ihre letzte Hoffnung gewesen. Bestimmt rief er bald an. Oder man würde ihr von irgendeiner kanadischen Klinik mitteilen, dass er überlebt habe.
Doch mit jeder Stunde schwanden auch die allerletzten Hoffnungen.
Sie konnte an jenem Tag auch die Nachrichten nicht mehr hören. Im Radio und im Fernsehen gab es nur dieses eine Thema – die Flugzeugkatastrophe der Swissair.
Nur in den Morgenzeitungen war das nächtliche Unglück noch kein Thema gewesen.
10
Es wurde gewiss ein traumhafter Frühlingstag in den Bergen. Tau glitzerte auf den Wiesen des Tannheimer Tals, das sich geradezu bilderbuchmäßig in das Voralpengebiet schmiegte. Hier am Nordrand der Alpen, wohin die majestätischen Gipfel des Gebirges ihre Vorposten entsandt hatten, konnte der Besucher zu allen Jahreszeiten noch die weitgehend unberührte Natur genießen – vor allem aber eine Landschaft, die der Tourismus nicht mit seinen hässlichen Beton-Bettenburgen verhunzt hatte. Die bäuerliche Vergangenheit schien noch allgegenwärtig zu sein, wenngleich sicher viele Menschen vom Fremdenverkehr lebten. Im Winter waren’s die Skifahrer, die zuhauf in das Tal einfielen. Doch auch ihnen waren enge Grenzen gesetzt. Nicht in jeden bewaldeten Berghang hatte man ihnen zuliebe eine Schneise geschlagen, und nicht überall glitzerten Seilbahndrähte in der Sonne.
Im Sommerhalbjahr war dieses Tal, hinter dessen südlicher Bergkulisse der Lech Richtung Reutte floss, ein Eldorado der Wanderer, die hier alles vorfanden, was ihr Herz begehrte – von den einfachsten Spazierwegen bis zu alpinen Pfaden. Jeder einzelne Berg hatte seinen eigenen Charakter: der Aggenstein, der Einstein, die Krinnenspitze oder das Neunerköpfle. Das Örtchen Tannheim schien inmitten einer Berg-Arena zu liegen – umgeben von diesen Steilhängen, die bis zu 2000 Metern in die Höhe ragten, von Wald und Almwiesen und schroffen Felswänden umsäumt. Dies alles spiegelte sich in der Wasserfläche des Haldensees, der das Tal zwischen dem Ort Haldensee und Nesselwängle nahezu auf die gesamte Breite ausfüllte.
Der Mann, der nicht weit davon entfernt mit dem Fahrrad unterwegs war, hatte eiskalte Hände. Er war in dieser Tal-Aue über mehrere asphaltierte und geschotterte Wirtschaftswege gerollt und steuerte nun den Ortsrand von Tannheim an, das jetzt, kurz vor halb neun an diesem Freitagvormittag, längst zum Leben erwacht war. Die Feriengäste in den Hotels und Pensionen, aber auch von den Campingplätzen abseits von Tannheim, Grän und Haldensee bevölkerten bereits den Ort. Die Tagesausflügler kamen meist erst später.
Noch standen auf dem großen Parkplatz bei der Talstation der Seilbahn zum Neunerköpfle nur einige wenige Autos. Der einsame Radler, der Wanderkleidung und einen Rucksack trug, bog in die Straße ein, die dicht an Tannheim vorbeiführte. Die Kirchturmuhr zeigte 8.20 Uhr und die Sonne war schon hoch über die Berge gestiegen. Er würde noch rechtzeitig da sein.
11
Die ganze Gebirgskette, wie sie sich von Norden her bot, lag prächtig vor ihr. Karin Waghäusl versuchte, die finsteren Gedanken abzustreifen. Dieser Anblick, der sich ihr schon lange vor Kempten auf dieses atemberaubende Berg-Panorama bot, berührte ihre Seele. Ein kurzes Glücksgefühl durchströmte ihren Körper – so wohltuend und tief, dass sie für einen Moment sogar mit den Tränen kämpfte. Sie wollte diesen Augenblick der kleinen Lebensfreude festhalten und nie wieder verlieren. Immer, wenn sie von den Schönheiten und Wundern der Natur überwältigt wurde, verspürte sie eine innere Dankbarkeit dafür, dies alles genießen zu dürfen und selbst Teil dieser Schöpfung zu sein. Jede Sekunde wollte sie deshalb tief in sich aufsaugen wie ein Geschenk. Für Mario war das vorbei. Für ihn hatte die Zeit aufgehört zu existieren. Sie war stehen geblieben. Denn wo es keinen Raum mehr gab, gab es auch keine Zeit. Beides hing voneinander ab, hatte Einstein gesagt.
Und doch, davon war Karin überzeugt, war dies kein Ende gewesen, sondern der Übergang in eine andere Dimension, in einen anderen Raum – dorthin, wo sich alle Geheimnisse der Schöpfung offenbarten. In den nächsten Tagen würden sie darüber wieder stundenlang diskutieren, über selbst Erlebtes berichten und eigene Theorien entwickeln. Und sie würde wieder jenes Gebetbuch erwähnen, das ihr, die sie bis dahin dem christlichen Glauben eher ferngestanden war, in den Tagen nach der Flugzeugkatastrophe so unfassbar erschienen war. Genauso wie das, was sie in den Unterlagen Marios gefunden hatte. Aber das brauchten die anderen nicht zu wissen.
Sie hatte damals unter dem Eindruck des schrecklichen Geschehens gar nicht alles, was auf sie hereingestürzt war, verarbeiten können. Noch am Wochenende war sie gemeinsam mit Larissa, ihrer inzwischen in Österreich verheirateten Tochter, sowie mit Marios Schwester und den Angehörigen anderer Opfer nach Halifax geflogen worden, um unter psychologischer Betreuung von den geborgenen und inzwischen identifizierten Toten Abschied nehmen zu können. Wie in Trance, so erschien es ihr heute, hatten sie Gottesdienste und die Gespräche mit den Chefs der Rettungskräfte und den bestürzten Repräsentanten der Fluggesellschaft über sich ergehen lassen. Rückblickend war es ihr, als sei sie Statist in einem Horrorfilm gewesen. Sie war noch immer dankbar, dass Larissa sie auf dieser schmerzhaften Reise begleitet hatte. Auch Marios Schwester hatte sich rührend um sie gekümmert.
Doch da waren auch Wut und Trauer, die sich in diesen Tagen vermischt hatten. Selbst jetzt, mit dem Abstand dieser vielen Jahre, verspürte sie noch immer Zorn, obwohl es keinen Verantwortlichen für den Absturz gab. Dass ein terroristischer Anschlag als ausgeschlossen galt, mochte zwar den Flugsicherheitsbehörden ein gewisser Trost sein. Aber warum hatten die Flugzeugkonstrukteure derart versagt, dass offenbar eine simple Zuleitung für die Videounterhaltung an Bord zu einem Schwelbrand mit verheerenden Auswirkungen führen konnte?
Als Karin Waghäusl nach vier Tagen, gezeichnet von tiefstem Leid, wieder daheim in der leeren und kalten Wohnung angekommen war, wo jedes Bild und jedes Buch sie an Mario erinnerte, hatte sie in den zurückliegenden Ausgaben des Züricher ›Tages-Anzeigers‹ geblättert, ohne die vielen Berichte über die Tragödie zu lesen. Nur oberflächlich nahm sie zur Kenntnis, dass bereits darüber spekuliert wurde, weshalb die Maschine nach dem ersten Notruf noch so viele Umwege geflogen war, und weshalb der Kapitän nicht sofort das nahe Halifax als Notlandeort genannt und stattdessen das weit entfernte Boston hatte ansteuern wollen.
Mochte die Technik noch so perfekt sein, es gab bei allem, was der Mensch erfunden hatte, einen gewichtigen Unsicherheitsfaktor: den Menschen selbst. Karin sah in diesem Moment die Bilder aus jüngster Vergangenheit vor sich, als im Januar an Italiens Westküste ein supermodernes Kreuzfahrtschiff auf Grund gelaufen war. An einem Freitag, dem 13. Gerade erst hatte sie gelesen, dass bei der Taufe des Schiffs die obligate Sektflasche nicht zerschellt war, was als ein Zeichen des Unglücks gilt.
Doch es deutete ja alles darauf hin, dass der Kapitän die Katastrophe durch bodenlosen Leichtsinn verursacht hatte. Hundert Jahre nach dem Untergang der Titanic, dem damals größten Schiff aller Zeiten. Auch eine Botschaft des Himmels? Und noch eine Merkwürdigkeit: Zu den Überlebenden der jüngsten Katastrophe im Mittelmeer gehörten zwei Italienerinnen, deren Großonkel beim Untergang der Titanic ums Leben gekommen war. Eine einzige Familie wird innerhalb von hundert Jahren gleich zweimal in eine Schiffskatastrophe verwickelt. Gab es sie also – solche Zeichen, von denen Mario immer gesprochen hatte, wenn sie sich allein über Gott und die Welt unterhielten?
Damals, als sie nach ihrer Rückkehr von Halifax in den Zeitungen der vergangenen Tage geblättert hatte, kamen ihr diese Gespräche in Erinnerung.
Weshalb hatte sie sich beim Durchblättern überhaupt für die illustrierte Wochenbeilage interessiert, die aus der zusammengefalteten Samstagsausgabe des ›Tages-Anzeigers‹ gefallen war? Noch heute erschien ihr dies rätselhaft.
Während sie das halbformatige Magazin flüchtig aufschlug, stach ihr auf einer der linken Seiten etwas ins Auge, das sie förmlich elektrisierte. Formatfüllend und unübersehbar: Ein schwarzes Gebetbuch, das eine große Reisebüro-Gesellschaft als Werbegag missbraucht hatte. Der Text, der auf einem knallroten Lesezeichen in weißen Lettern prangte, sollte die Sicherheit der beworbenen Airlines hervorheben. »Empfohlene Reise-Lektüre für alle, die noch billiger fliegen wollen.«
Wie gebannt hatte sie auf dieses Inserat gestarrt und den Text immer wieder gelesen. Erst als sie die Wochenendbeilage ›Magazin‹ wieder in die zusammengefaltete Zeitung schob, entdeckte sie dort auf Seite 1 des ›Tages-Anzeigers‹ einen Hinweis, mit dem sich die Redaktion für das makabre Zusammentreffen von Absturz und Anzeige entschuldigte:
»Angesichts des schweren Flugzeugunglücks der Swissair vom Donnerstag hat ein Reiseinserat im heute beiliegenden ›Magazin‹ eine Aktualität erlangt, die in keiner Weise beabsichtigt war. Das Inserat ließ sich nicht mehr zurückziehen, weil das ›Magazin‹ zum Zeitpunkt des Absturzes bereits gedruckt war.« Weiter hieß es, Verlag, Reisebüro und die zuständige Werbeagentur entschuldigten sich »für den tragischen Zufall und damit verbundene verletzte Gefühle in aller Form.«
Du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen – so oder so ähnlich hatte sie in Erinnerung, was sie einmal im Religionsunterricht gelernt hatte. Und noch immer quälte sie ein Gedanke, der sie seit dem ersten Moment, als sie dieses Inserat gelesen hatte, nicht mehr losließ: War Mario das Opfer einer Vergeltung dieser großen universellen Kraft geworden, die sich nicht so einfach herausfordern ließ, wie dies die Werbestrategen mit diesem Inserat beabsichtigt hatten?
Natürlich hatte Karin es nie gewagt, mit jemandem aus ihrem damaligen Freundes- und Bekanntenkreis darüber zu reden. Es wäre nicht schick gewesen, sich in dieser angeblich gehobenen Gesellschaft mit Themen auseinanderzusetzen, die weit jenseits dessen lagen, was man mit Geld erkaufen konnte. Vermutlich hätte man sie ausgelacht, bestenfalls noch vornehm als Esoterikerin abgetan, aber insgeheim als okkulte Spinnerin bezeichnet, die ohne die Kontakte ihres verstorbenen Mannes ohnehin nicht mehr gesellschaftsfähig erschien. Schon nach wenigen Wochen war ihr deutlich geworden, dass die angeblichen Freundschaften nur Zweckverbände waren, die lediglich ein einziges Ziel verfolgten: Dezente Vermehrung des privaten Vermögens durch ebenso dezente gegenseitige Vernetzung. Bisweilen gerieten auf diese Weise auch Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik in den Genuss von Zuwendungen, die diese zu würdigen wussten – vor allem aber auch in Form von Gefälligkeiten zu honorieren verstanden.
Karin spürte, wie sie ohne Mario zunehmend unwichtig wurde. Wäre sie noch 20 Jahre jünger gewesen, hätte sie gewiss nicht das Gefühl beschlichen, von den gut situierten Herren des Geldadels unbeachtet zu bleiben. So aber fühlte sie sich bei jeder dieser Partys, zu denen sie gelegentlich noch eingeladen wurde, als eine überflüssige, wohl eher geduldete Person, mit der man aus Pflichtgefühl ein paar Worte wechselte. Hingegen waren die jungen Frauen, die mit ihren geschniegelten und angeblich so erfolgreichen Typen in Erscheinung traten und meist viel Haut zur Schau trugen, begehrte Gesprächspartnerinnen. Nur Dirk Jensen, ein Kollege Marios aus früheren Zeiten, hatte den Kontakt noch gehalten und ihr sogar neue Perspektiven eröffnet. Sie war ihm dafür unendlich dankbar gewesen. Damals. Inzwischen gab es einen schalen Beigeschmack. Immer häufiger musste sie daran denken, weshalb er damals den Abflug in New York verpasst hatte.
Irgendwann – Karin wusste nicht mehr so genau, wann dies geschehen war – hatte sie sich vollständig zurückgezogen. Zugegeben, ihr war es schwergefallen, das soziale Umfeld zu verlassen, dem finanziell sicheren Terrain der Schweiz den Rücken zu kehren und wieder zu den Wurzeln ihrer Familie nach Süddeutschland zurückzukehren. Aber ohne Mario fühlte sie sich im Großraum Zürich als Fremde. Viel zu lang hatten sie sich in diesen Schicki-Micki-Kreisen bewegt, aus denen sich kaum einer als echter Freund entpuppte, der ihr in den schweren Wochen nach dem Unglück zur Seite gestanden wäre. Seit auch ihr einziges Kind, ihre Tochter Larissa, nach Österreich gezogen war, wo sie mit ihrem österreichischen Ehemann ein Hotel führte, war alles noch schlimmer geworden. Sie war aus dem vermeintlich sicheren kapitalistischen Netzwerk gefallen und hatte sich nirgendwo mehr zurechtgefunden. Erst als sie vor sechs Jahren, 2006, dieses kleine Häuschen in der Beschaulichkeit der Schwäbischen Alb hatte kaufen können, war sie von den Schatten der Vergangenheit wieder auf die Sonnenseite des Lebens geraten. Zumindest empfand sie dies so – verbunden mit einer unendlichen Dankbarkeit für einige dieser Menschen, die sie an einem Wochenende wie diesem treffen würde.
Ihre Schwägerin hatte es nach dem plötzlichen Krebstod ihres Mannes beruflich auch wieder nach Süddeutschland verschlagen. Beide genossen sie die Nähe. Ohnehin waren die Kontakte nach der gemeinsamen traurigen Reise an den Absturzort sehr intensiv geworden. Inzwischen verband sie sogar ein gemeinsames Geheimnis.
Tief in die Erinnerung an die vergangenen 14 Jahre versunken, hätte Karin beinahe die Autobahn-Ausfahrt Oy verpasst. Sie trat erschrocken auf die Bremse, als die weiß-blauen Baken die Abbiegespur ankündigten. Wie die Kilometer seit dem Autobahndreieck Allgäu an ihr vorbeigezogen waren, hätte sie nicht mehr sagen können. Nichts davon war bis in ihr Bewusstsein gedrungen. Nicht die sanft ansteigende Autobahn, nicht die nahenden und noch im Schatten liegenden Steilhänge und auch die lang gezogene Rottachtalbrücke nicht.
Karin sah auf die digitale Uhr im Armaturenbrett. Es war kurz vor neun Uhr.
12
Auch Aleen Dobler-Maifeld hatte auf die Uhr gesehen. Sie war mit ihrem metallic-roten VW-Passat später als geplant losgekommen. Gerade erst hatte sie den B10-Tunnel bei Ulm passiert und sah links im Gegenlicht der höher steigenden Sonne das majestätisch aufragende Münster. Sie musste sich auf den Straßenverlauf und den stockenden Verkehr konzentrieren, denn es gab eine Verengung – wegen einer innerstädtischen Brückensanierung.
Der gestrige Donnerstag lag ihr noch bleiern in den Knochen. Bis in den späten Abend hinein hatte die Strategiekonferenz gedauert, während der die Weichen für die Zukunft dieses globalen Großunternehmens gestellt werden sollten. Wieder einmal war deutlich geworden, dass die Ansichten zwischen den Kapitaleignern und dem Vorstandsgremium weit auseinanderdrifteten. Aleen, nach einem mit Bravour absolvierten Studium der Betriebswirtschaft und nach mehreren verantwortlichen Stellen in verschiedenen Konzernen vor zwei Jahren ins Schwäbische gekommen, fühlte sich seit Monaten zwischen den Fronten zermürbt, ausgelaugt und ausgebrannt. Vielleicht war es die schwäbische Mentalität, mit der sie als ›Kind des Nordens‹, wie sie sich oft mit unverkennbar niedersächsischem Zungenschlag bezeichnete, nicht zurecht kam. Allein schon ihre Position im Finanzmanagement – hochtrabend als ›Chief Financial Officer‹ betitelt – ließ ihre Beliebtheitskurve keinesfalls nach oben schnellen. Schließlich wurde von ihr erwartet, einen rigiden Sparkurs durchzusetzen. Doch dies alles raubte ihr den Schlaf. Sie konnte sich nicht mehr konzentrieren, war vergesslich und antriebslos.
Bei den Meetings, wie heutzutage Besprechungen genannt wurden, hatte sie oft zu spüren bekommen, dass in diesen Konferenzen Welten aufeinanderprallten. Hier das Vorstandsmanagement, besetzt mit international erfahrenen, aber gnadenlosen Strategen, dort die schwäbische Eignerfamilie, die sich nur ungern in die finanziellen Karten blicken ließ. Hinzu kam, dass das Unternehmen von der Öffentlichkeit noch immer als traditioneller und damit bodenständiger Betrieb geschätzt wurde, an dessen Spitze die Öffentlichkeit keine kaltschnäuzigen Manager sehen wollte, die sich weder mit dem Produkt noch mit Stadt und Landschaft, geschweige denn mit den Menschen identifizierten. Seit der Ruf dieser sogenannten Eliten – ausgelöst durch eigene Gier und Abzock-Mentalität – weltweit ins Bodenlose stürzte, wurde es ohnehin zunehmend schwieriger, wirtschaftliche Entscheidungen – auch wenn sie noch so geboten erscheinen mochten, nach außen hin zu vertreten. Sofort schlug jedem, der Althergebrachtes ändern wollte, eiskaltes Misstrauen entgegen.
Diese gnadenlos durchgreifenden Manager hatten nur das Glück, dass es genügend Journalisten gab, denen man mit geschönten Bilanzen nach außen hin blendende Gewinne vortäuschen konnte. Das bot gleichzeitig die Möglichkeit, sich vor den Kameras als die größten Wirtschaftsführer aller Zeiten zu profilieren und geschickt vom kontinuierlichen Abbau der Arbeitsplätze abzulenken.
Aleen musste sich eingestehen, seit ihrem Studium, das mittlerweile über zehn Jahre zurücklag, auch nur Unternehmen kennengelernt zu haben, die des kurzfristigen Gewinns wegen Löhne und Gehälter rigoros reduzierten und das Betriebsklima irreparabel zerstörten.
Nachhaltige Entscheidungen, die über die nächste Dividendenausschüttung hinausreichten, gab es längst nicht mehr. Zweimal schon hatte sie hautnah mitbekommen, wie Geschäftsführer mit schwindelerregenden Abfindungen das Weite suchten, nachdem ein einst florierender Betrieb ruiniert und finanziell ausgesaugt worden war. Aleen musste an das Klischee von den gefräßigen Heuschrecken denken, die überall, wo sie einfielen, eine verwüstete Landschaft hinterließen. Deutschlands ökonomische Landschaften sahen längst danach aus.
Sie hatte sich fest vorgenommen, nicht zu dieser Sorte der rücksichtslosen Wirtschaftsführer gehören zu wollen. Sie fühlte sich dem allen nicht mehr gewachsen. Denn je mehr Einblicke sie in diese brutale Welt des unerbittlichen Stechens und Kämpfens gewann, desto größer wurde ihr Drang, diesem unmenschlichen System den Rücken zu kehren. Mit jedem Tag ihres Lebens wurde ihr mehr bewusst, dass die Entscheidung für diesen Job falsch gewesen war – mochte er ihr bisher noch so viele Erfolge und große Sprünge auf der Karriereleiter beschert haben. Noch war sie nicht zu alt, um auszusteigen.
Sie würde es tun. Ganz bestimmt. Der Anfang war schon gemacht. Sie würde sich radikal ändern. »Mich kotzt das an«, konnte sie gelegentlich sagen, wenn sie im kleinen Kreise erklärte, weshalb sie genug davon hatte. Ihr lief diese Art des Geschäftslebens zuwider. Denn wer tagaus, tagein sein ganzes Sinnen und Trachten nur auf Wachstum um jeden Preis fixierte, wer mit allen hinterhältigen Mitteln die Konkurrenz ausschalten musste und wer in den Mitarbeitern nur folgsame Idioten sah, die man nach Belieben hin- und herschieben oder zum Teufel jagen konnte, verlor im Laufe seines Berufslebens jeglichen Respekt vor anderen Menschen und der Menschlichkeit. Solche Typen führten Krieg, platzierten ihre Geschosse in Form von ruinösen Angeboten und setzten, wenns dem eigenen Fortkommen diente, ältere Mitarbeiter kurzerhand vor die Tür. Diese waren eh nur ein ungeliebter Kostenfaktor.
Nein, sie wollte nicht länger Teil dieses unwürdigen und üblen Kriegsspiels sein. Dass sie diese Erkenntnis gewonnen hatte, verdankte sie den Visionen, die sich ihrer in schlaflosen Nächten regelmäßig bemächtigten. Vielleicht waren es Stress oder seelische Erschöpfungszustände, die dieses Phänomen auslösten. Aber oft schon hatte sie den Eindruck, nachts von etwas Undefinierbarem umgeben zu sein, obwohl sie seit der Trennung von ihrem Mann die Villa am Göppinger Stadtrand ganz allein bewohnte. Sie spürte Kräfte und Energien, körperlose Gestalten und bisweilen glaubte sie sogar Stimmen zu hören, die ihr empfahlen, aus allem auszubrechen und sich Wichtigerem zuzuwenden.
Sie hatte sich völlig zurückgezogen und ihre Nächte damit verbracht, im Internet zu surfen. Zum ersten Mal war ihr damals, vor nunmehr zwei Jahren, bewusst geworden, wie viel Halt, aber auch Trost und Zuversicht die virtuelle Welt bieten konnte, obwohl sie nur aus einem seelenlosen Netzwerk elektronischer Apparate bestand. Wie viele Menschen mochten Nacht für Nacht voller Hoffnung an ihren Laptops sitzen und in diesem anonymen Parallel-Universum ein bisschen Glück suchen?
Sie hatte in Facebook die Profile unzähliger Menschen gelesen, sich auch mal mit Fantasienamen in Chatrooms eingeloggt und war schließlich über Google auf einen sogenannten Blog gestoßen, in dem heftig über Gott und die Welt diskutiert wurde – vor allem aber über ein Thema, das sie nicht mehr los ließ, seit sie den ersten zaghaften Schritt in ein neues Leben getan hatte: Das Ende der Zeit.
Natürlich war das Humbug, hämmerte es in ihrem Kopf, in dem die anstudierte Vernunft noch immer die Oberhand behielt. Wie oft schon war der Weltuntergang prophezeit worden? Von Sekten, von religiösen Fanatikern, von Spinnern, die sich als Wahrsager ausgaben. Oder auch nur von Geschäftemachern, die mit den Ängsten der Menschen spielten und Kapital daraus schlugen.
Aber noch immer war die Welt nicht untergegangen.
Doch was machte es für einen Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen? Denn wenn die Welt unterging, gab es ohnehin nichts mehr, was danach kam. Dann war dieser Planet weg. Ein winziges Staubkorn weniger in der Unendlichkeit des schwarzen und kalten Alls.
Aleen ertappte sich dabei, hinter einem Sattelzug herzukriechen. Sie hätte nicht sagen können, wie sie Ulm und Neu-Ulm hinter sich gelassen hatte, sie war viel zu tief in Gedanken versunken gewesen, auch darüber, was es jenseits der Wahrnehmungen gab. Und wie gutgläubig manche Menschen waren, wenn Wunder versprochen wurden.
Vor ihr tauchte bereits das Hittistetter Dreieck auf, der Verknüpfungspunkt mit der A7, Deutschlands längster Autobahn, die von Flensburg bis Füssen führt, geradewegs auf die Alpen zu. Der »Mountain-Highway«, wie sie diese Autobahn gern nannte.
Während sie auf der Beschleunigungsspur Gas gab, übertönte der Signalton ihres iPhones das Motorengeräusch. Eine SMS – wie so häufig, seit sie übers Internet neue Bekanntschaften geknüpft hatte. Sie fädelte sich in den fließenden Verkehr ein und warf dann einen erwartungsvollen Blick auf das Display des Armaturenbretts, wohin das Gerät über die Bluetooth-Einrichtung den Text geleitet hatte. Doch was da stand, war kein lieber Gruß, der sie jetzt hätte aufmuntern können. Es waren einige Worte, die sie niemandem zuzuordnen vermochte: »Nimm dich in Acht.« Sie hatte Mühe, sich auf den Verkehr zu konzentrieren, weshalb sie das Wohnwagen-Gespann, hinter dem sie in die Autobahn eingefahren war, nicht sofort überholte. Sie hielt genügend Abstand, um weiterlesen zu können. »Es hat auf dieser Autobahn schon genügend Tote gegeben«, las sie weiter, während sich ihr Pulsschlag beschleunigte. Denn da tauchte auch noch ein Datum auf: »21.12.12.« Es war wie ein brennend heißer Stich in ihre Seele. Der 21. Dezember. Der Tag, an dem der Maya-Kalender endete. Seit sie sich mit spirituellen Dingen befasste, war ihr dies ein Begriff.
Aleen reduzierte das Tempo, nahm das Gerät aus der Halterung und versuchte, den Absender ausfindig zu machen. Es war eine ihr unbekannte Nummer – mit der Schweizer Ländervorwahl.
13
Auf dem Campingplatz, der oberhalb des beschaulichen Örtchens Grän lag, war gerade erst das Leben erwacht. Die Sonne strahlte über die Rote Flüh, deren steil aufragende Westseite einen langen Schatten in das Tannheimer Tal warf. Auf den Wiesen glitzerte der Tau, in Sträuchern und Hecken waren die Spinnweben mit feinen Wassertröpfchen verziert. Es war einer jener Frühlingstage, die den Sommer bereits erahnen ließen und dadurch die Natur in einem anderen Licht erscheinen ließen, selbst hier, auf rund 1100 Höhenmetern. Droben auf den Bergen schmolzen endlich die letzten Schneereste. Überall vereinigten sich muntere Rinnsale zu kleinen, plätschernden Bächen, die in unzählige Mulden verschwanden und in Schluchten stürzten, um als kleine Flüsse dem Lech entgegenzustreben. Nach dem langen Winter, der das Tal und seine Berge über Monate hinweg in frostige Starre versetzt hatte, mussten sich Tiere und Pflanzen beeilen, um die kurze Vegetationszeit zu nutzen. Auch die Camper, die aus ihren Wohnmobilen oder Wohnwagen in das Sonnenlicht und die frische Luft hinausstiegen, spürten mit jedem Atemzug diese Aufbruchstimmung. Die meisten, die in diesen Wochen den Platz bevölkerten, hatten ihre Wohnwagen dauerhaft hier abgestellt. Diese waren für sie kleine Ferienhäuschen, die bei Bedarf auch mal einen Standortwechsel zuließen. Später im Jahr tauchten wesentlich mehr Wohnmobilisten auf, die entweder ihren gesamten Urlaub im Tannheimer Tal verbrachten oder auf der Durchreise für ein paar Tage in diesem Wanderparadies verweilen wollten. Sie alle bevorzugten diesen gepflegten Platz, der sich äußerst positiv von jenen abhob, die landauf, landab zwar viel kosteten, aber dem Gast sanitäre Anlagen zumuteten, die an die 50er Jahre erinnerten, als sich mancher Tourist noch mit einem ›Donnerbalken‹ zufriedengab. Hingegen waren die Camper heutiger Zeiten, die mit luxuriösen Fahrzeugen unterwegs waren, wesentlich anspruchsvoller. Campen war längst nicht mehr das Reisen der armen Leute. Hier in Grän wurden all ihre Wünsche erfüllt. Es gab sogar ein Hallenbad, das ins Obergeschoss des Sanitärgebäudes integriert war und dessen geschwungene Glasfront einen grandiosen Blick auf das beeindruckende Panorama der Berge bot. Dazu eine behagliche Wärme, die für Entspannung und Wellness sorgte.
Jonas Mullinger, ein Student des Gesundheits- und Tourismusmanagements, war in dem ovalen Pool soeben zehn Längen geschwommen und genoss diese Atmosphäre. Er ließ sich am Beckenrand bis zum Hals ins angenehm temperierte Wasser sinken und lehnte sich mit verschränkten Armen gegen die geflieste Überlaufkante. Sein Blick ging hinaus auf die Sträucher und Bäume, die mit ihrem zarten Grün die Parzellen des Campingplatzes umrahmten. Er konnte von hier aus sogar seinen alten gelben VW-Campingbus sehen, den er im Laufe des Frühjahrs günstig erworben hatte. 23 Jahre alt war die ›Kiste‹, wie er sie nannte, doch der Dieselmotor schnurrte noch immer zuverlässig. Die Inneneinrichtung machte zwar einen abgewohnten Eindruck, aber für seine Bedürfnisse reichte es allemal. Auch das Hubdach, das er mit Muskelkraft nach oben drücken musste, um sich die nötige Stehhöhe zu verschaffen, empfand er keineswegs als lästig. Ihm genügte es, unabhängig durch die Lande fahren zu können, um möglichst viele touristische Glanzpunkte kennenzulernen. Denn sobald er sein Studium abgeschlossen haben würde, strebte er eine Karriere in der Tourismusbranche an.
Während er sich seinen Zukunftsträumen hingab, nahm er nur beiläufig wahr, wie sich draußen der Campingplatz mit Leben füllte. Vereinzelt schlenderten leger gekleidete Personen aufs Sanitärgebäude zu. Andere gingen über den ansteigenden Weg zur Rezeption hinauf, wo es allmorgendlich frische Brötchen und Zeitungen gab.
Mullinger war so sehr in seine Gedanken und das Geschehen vor der Fensterfront vertieft, dass er das Rentner-Ehepaar gar nicht bemerkte, das inzwischen hinter ihm gemächlich durchs Becken schwamm. Doch dann genügte eine kurze Beobachtung, um ihn mit allen Sinnen wieder in die Realität zurückzuholen: Zwischen zwei Sträuchern hatte sein Unterbewusstsein eine junge Frau wahrgenommen, die aus der Reihe der dort abgestellten Wohnwagen gekommen war. Mullinger kniff die Augen zusammen, um schärfer sehen zu können. Das Objekt seiner Begierde hatte schulterlange schwarze Haare, war rank und schlank und wollte, was die Kleidung anbelangte, nicht so recht ins optische Bild passen, das zu dieser Stunde auf Campingplätzen vorherrschte. Sie trug einen eleganten dunkelblauen Hosenanzug und eilte in Richtung Ausgang. Mullinger sah ihr nach und war von ihrem flotten Gang und ihrem Hüftschwung angetan. Nachdem sie an der Gebäudekante seinem Blickfeld entschwunden war, versuchte er, sie nachträglich einem der Wohnwagen zuzuordnen. Doch so richtig gelingen wollte ihm dies nicht.
Noch während er beschloss, in den nächsten Tagen intensiv nach ihr Ausschau zu halten, holte ihn ein Schatten, der im rechten Augenwinkel auftauchte, wieder in die Realität zurück. Er drehte sich instinktiv zur Seite und sah, wie neben ihm ein Schwimmer mittleren Alters am Beckenrand anlandete. »Hallo«, grinste es Mullinger aus einem sonnengebräunten Gesicht entgegen. Der Mann wischte sich Wasser von Schnauzbart und Mundwinkeln.
Mullinger musterte ihn irritiert. Er konnte diesem Gesicht keinen Namen geben. Der Unbekannte lehnte sich ebenfalls an den Beckenrand und tat so, als wolle er diese Wellness-Atmosphäre gemeinsam mit Mullinger genießen. »Super Tag heute«, fuhr er mit sympathischem Lächeln fort.
Doch Mullinger hatte nicht die geringste Lust, sich am Beckenrand auf Small Talk einzulassen. Er wollte ohnehin das Wasser verlassen. Denn er war nur deshalb bereits gestern Abend angereist, um heute Vormittag einen Termin wahrzunehmen.
Der Unbekannte neben ihm schien es allerdings nicht bei der kurzen Bemerkung bewenden lassen zu wollen. Ohne den jungen Mann eines Blickes zu würdigen, sagte er leise, fast gefährlich leise, wie Mullinger es in diesem Moment empfand: »Karin Waghäusl wird sich freuen, Sie kennenzulernen.«
Mullinger war verblüfft. Waghäusl? Hatte er Karin Waghäusl erwähnt? Der junge Mann spürte, wie sich sein Pulsschlag beschleunigte. Nie zuvor hatte er diesen Unbekannten gesehen. Ganz sicher nicht. Im Bruchteil einer Sekunde jagten Tausende Gedanken durch seinen Kopf, während der Fremde ungerührt nach draußen starrte und sich der Wirkung seiner Bemerkung offenbar triumphierend bewusst war.
Mullinger wusste, dass er mit einer Antwort jetzt nicht zögern durfte. Damit würde er seine Verunsicherung preisgeben. Blitzartig schoss die Frage durch seine Gehirnwindungen, inwieweit er hier und jetzt eingestehen sollte, Karin zu kennen. Was heißt kennen? Eigentlich kannte er sie nicht wirklich. Nur per E-Mail hatten sie intensiv ihre Gedanken ausgetauscht. Niemand konnte dies wissen.
Er spürte einen Kloß im Hals. Zunächst galt es, Zeit zu gewinnen. »Darf ich fragen, wer Sie sind?«, fragte er deshalb zögernd.
Der Unbekannte, der seinen Blick immer noch auf einen imaginären Punkt weit in der Ferne gerichtet hatte, verzog das Gesicht zu einem müden Lächeln. »Spielt das eine Rolle, wenn wir alle demselben Schicksal unterliegen? Namen sind Schall und Rauch – und wir die Figuren in einem universellen Schachspiel.«
Mullinger vermochte das Gesagte so schnell nicht zuzuordnen. Noch bevor er etwas entgegnen konnte, sprach der andere langsam und leise weiter: »Junger Freund, Sie wissen genauso gut wie ich, welche Erfahrung Karin Waghäusl gemacht hat. Es gibt Zeichen und Signale, die wir nicht ignorieren sollten.« Noch immer sah er seinem Gesprächspartner nicht in die Augen. Mullinger fiel erst jetzt sein goldenes Halskettchen auf, an dem ein winziges Schmuckstück baumelte, das aussah wie eine Posaune.
»Glauben Sie mir«, sprach der Mann noch eine Nuance leiser weiter, während das Rentner-Ehepaar dicht an ihnen vorbei schwamm, »auch Sie sollten auf der Hut sein, wenn Sie heute da rauffahren.« Er deutete mit einer kaum wahrnehmbaren Bewegung in Richtung der gegenüberliegenden Berge. Einer davon war das Neunerköpfle, an dem sich Seilbahndrähte erahnen ließen.