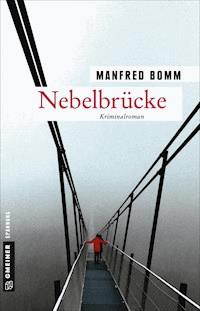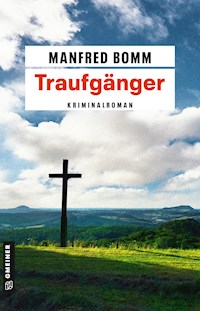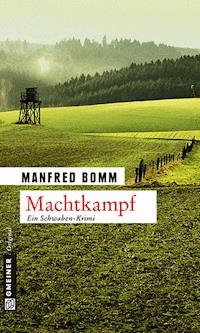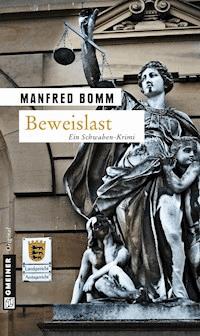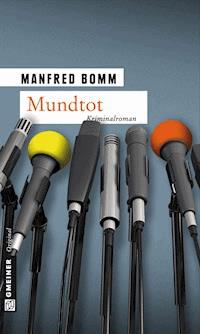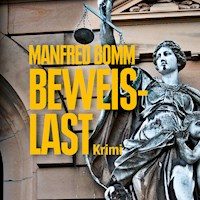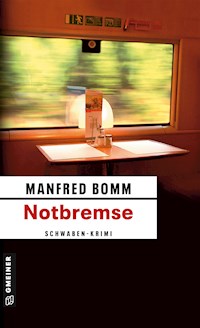
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar August Häberle
- Sprache: Deutsch
Mord im ICE auf der Bahnlinie Ulm-Stuttgart. Abrupt kommt der Zug an der Geislinger Steige zum Stehen. Ein Mann flieht panikartig und verschwindet im Steilhang der Schwäbischen Alb. Kommissar August Häberle tappt lange im Dunkeln: Er weiß weder, wer der Erschossene ist, noch ob der Flüchtende ihn ermordet hat. Sein einziger Anhaltspunkt ist das Notizbuch des Toten. Doch führen die darin enthaltenen Adressen von Ärzten und Apothekern wirklich zum Täter? Häberle läuft die Zeit weg, denn bereits in der folgenden Nacht findet er eine weitere Leiche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Bomm
Notbremse
Der achte Fall für August Häberle
Zum Buch
UNTER ZUGZWANG Mord im ICE auf der Bahnlinie Ulm-Stuttgart. An der berühmten Geislinger Steige wird plötzlich die Notbremse gezogen, ein Mann flüchtet aus dem Zug und verschwindet im bewaldeten Steilhang der Schwäbischen Alb. Kommissar August Häberle tappt im Dunkeln: Er weiß weder, wer der Erschossene ist, noch ob der Flüchtende ihn ermordet hat. Sein einziger Anhaltspunkt ist das Notizbuch des Toten. Doch führen die darin enthaltenen Adressen von Ärzten und Apothekern wirklich zum Täter? Dem erfahrenen Ermittler läuft die Zeit davon, denn bereits in der folgenden Nacht findet er eine weitere Leiche – der junge Mann war Kurierfahrer bei einem Ulmer Pharmakonzern. Häberle ist sich ganz sicher: Zwischen den beiden Fällen muss es einen Zusammenhang geben …
Manfred Bomm wohnt am Rande der Schwäbischen Alb. Als Lokaljournalist hat er Freud und Leid der Menschen hautnah erlebt und darüber berichtet. Vieles, was er in seinen Romanen verarbeitet, hat sich so oder in ähnlicher Weise zugetragen. 2004 hat der Autor mit dem Krimischreiben begonnen und die Figur des August Häberle nach einem realen Vorbild bei der Kriminalpolizei Göppingen entworfen. Ursprünglich hatte er – einem Jugendtraum folgend – nur einen einzigen Roman schreiben wollen, doch die steigende Zahl der „Häberle“-Fans spornte ihn zu „weiteren Untaten“ an. Manfred Bomm fühlt sich eng mit Land und Leuten verbunden, liebt die Natur, das Wandern, Reisen und Radeln. Wichtig ist ihm, so gut wie alle beschriebenen Schauplätze selbst aufgesucht zu haben.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Blumenrausch (2019), Nebelbrücke (2018), Traufgänger (2017), Todesstollen (2016), Lauschkommando (2015), Machtkampf (2014), Grauzone (2013), Mundtot (2012), Blutsauger (2011), Kurzschluss (2010), Glasklar (2009), Notbremse (2008), Schattennetz (2007), Beweislast (2007), Schusslinie (2006), Mordloch (2005), Trugschluss (2005), Irrflug (2004), Himmelsfelsen (2004)
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Jens Roth/PIXELIO
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-3092-3
Widmung
Gewidmet allen,
die in der Lage sind, die wirklich wichtigen Dinge des
Lebens zu erkennen.
Möge uns alle das Schicksal davor bewahren,
in das Räderwerk von Macht und Gewalt zu geraten.
1
Es war einer dieser trüben Tage, an denen Ulm im dichten Nebel des Donautals lag. Der Münsterturm war kaum zu sehen. Sanfter Nieselregen ließ die Straßen glänzen und die Kleider klamm werden. Obwohl in den Pflanzkübeln der Fußgängerzone die bunte Sommerpracht in herrlichster Blüte stand, schien es November zu sein. Doch die Ulmer nahmen diesen Nebel so gelassen hin, wie es die Londoner mit dem Regen taten. Denn hier an den sanften Südhängen der Schwäbischen Alb kam es oft genug vor, dass die Sonnenwärme vergeblich gegen die Feuchtigkeit ankämpfte, die die Donau mit sich brachte.
An diesem Julivormittag war es besonders schlimm. In den Radionachrichten hatte es geheißen, weite Teile des Landes könnten sich über strahlenden Sonnenschein freuen. Nur südlich der Alb hielten sich hartnäckig vereinzelte Nebelbänke.
Die meisten Menschen, die am Bahnhof auf den 8.51-Uhr-ICE nach Dortmund warteten, waren auf dieses raue Klima nicht eingestellt. Sie suchten unter der Überdachung auf Bahnsteig 1 beim Empfangsgebäude Schutz. Weiter drüben fuhr gerade ein Regionalexpress aus Sigmaringen ein; jener aus Oberstdorf, so war den Ansagen zu entnehmen, hatte zehn Minuten Verspätung.
Der Mann, der vor dem Glaskasten stand und die Reihenfolge der ICE-Waggons studierte, strich sich die Feuchte von der beigen Freizeitjacke. Sein Interesse galt nur vordergründig der skizzierten Darstellung eines Zuges. In Wirklichkeit ließ er seinen Blick unauffällig über die knapp 50 Menschen streichen, die sich weit über den Bahnsteig verteilt hatten. Eigentlich interessierte ihn nur eine einzige Person – dieser äußerst gepflegt erscheinende Mann, Mitte 30, in Nadelstreifenanzug und Sommermantel. Er hatte einen Aktenkoffer mit irgendwelchen bunten Aufklebern in der rechten Hand. Er stand einen Steinwurf entfernt direkt unter der Uhr, deren Sekundenzeiger gerade wieder eine Umrundung beendete. In vier Minuten sollte der ICE einfahren, wenn er denn pünktlich war. Der heimliche Beobachter wusste, dass der andere dann in die erste Klasse steigen würde – wie er selbst auch. Sie hatten sogar dasselbe Abteil gebucht.
Er drehte sich wieder zum Gleis und schlenderte langsam an der durchgezogenen weißen Linie entlang, deren Überschreiten aus Sicherheitsgründen verboten war. Vorbei an einer Gruppe diskutierender Frauen näherte er sich langsam seiner Zielperson. Er kannte diesen Mann jetzt seit über einem Monat: Kai-Uwe Horschak, 37 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Seit er ihn observierte, hatte er eine Menge Fakten und Daten über ihn zusammengetragen. Er wusste, welche Schule die beiden Töchter besuchten, wie die Lehrer hießen und dass er nicht selbst zu den Elternabenden ging, sondern die Ehefrau schickte. Horschak joggte frühmorgens und traf sich alle zwei Wochen immer donnerstags mit seinen Freunden in einem Lokal im Ulmer Fischerviertel. Auch die meisten Teilnehmer an dieser gemütlichen Runde hatte er inzwischen identifiziert. Drei Ärzte, ein Finanzmakler und ein Apotheker. Er wusste auch, dass dieser Mann einen weiten Aktionsradius hatte, nämlich den gesamten deutschsprachigen Raum bis hinunter nach Bozen in Südtirol.
Heute würde er nach Mannheim fahren. Doch er selbst hatte nicht vor, die gesamte Strecke mitzureisen. Sein Ticket galt nur bis Stuttgart. Das musste reichen.
»Also Sylvia, ich muss schon sagen …« Die Stimme des Mannes klang energisch und war dazu angetan, jeglichen Widerspruch im Keime zu ersticken. Sylvia Ringeltaube hatte sich an diesen Ton gewöhnt. Seit sie sich duzten, ihr Chef und sie, war das Verhältnis zwischen ihnen ohnehin nicht mehr förmlich. Viel zu viel war inzwischen geschehen. Insgeheim wünschte sie sich, sie würden sich wieder siezen. Doch abgesehen davon, dass es albern gewesen wäre, hätten sie sich vermutlich auch nicht mehr an diese Anrede gewöhnen können. Sie wandte sich gelassen und mit gespielter Gleichgültigkeit von ihrem Bildschirm ab und machte mit dem Bürostuhl eine halbe Drehung.
»Wie oft soll ich dir eigentlich noch sagen, dass mir die Art, wie du die Briefe gestaltest, nicht mehr gefällt«, fuhr der Mittfünfziger leicht irritiert, aber gereizt fort. Er war kein Mann der lauten Töne, doch dafür wählte er die Worte so pointiert, dass sie in Verbindung mit seiner geschliffenen Rhetorik ihre Wirkung nie verfehlten. Sylvia, Ende 20 und eigentlich ziemlich selbstbewusst, genoss seit einigen Wochen das Gefühl der Überlegenheit.
»Entschuldige«, lächelte sie geradezu provozierend. »Aber es ist doch …«
»Quatsch doch nicht schon wieder rum«, unterbrach sie der Mann, der die Enttäuschung bis heute nicht überwunden hatte. »Wenn du Computer nicht beherrschst, dann lass es dir verdammt noch mal von einem Lehrmädchen zeigen.« Noch vor drei Monaten hätte er so nicht mit ihr gesprochen. Doch von Tag zu Tag, so schien es ihr, verlor er seine Beherrschung immer mehr. Und je stärker sie sich gab, desto zorniger konnte er werden. Sie sah ihn provokant an. Er versuchte, ihren Blicken standzuhalten, und verzog das Gesicht zu einem mitleidigen Lächeln. »Jedes Lehrmädchen«, presste er hervor, »jedes Lehrmädchen beherrscht die Kiste besser als du.« Während er sich wieder abwandte, um in seiner lichtdurchfluteten Chefresidenz zu verschwinden, fügte er noch betont sachlich hinzu. »Aber wahrscheinlich bist du für derlei Tätigkeiten schon zu alt.« Dann fiel die Tür ins Schloss.
Sylvia Ringeltaube blieb noch für einen Moment sitzen und starrte die schallisolierte Tür an. Idiot, dachte sie. Du Dreckskerl, du verdammtes Schwein. Weil ich nicht mehr dein Lustobjekt sein will, benimmst du dich wie ein niveauloser Depp. Sollte er sie doch erniedrigen und mobben. Inzwischen war sie täglich aufs Neue gespannt, welche Gemeinheiten ihm wieder einfielen. Sie verfolgte mit Interesse seine cholerischen Anfälle. Wahrscheinlich, so mutmaßte sie, hatte er daheim nichts zu sagen. Ein Pantoffelheld, der sich nur im Geschäft im Schutze seiner beruflichen Autorität austoben konnte. Wie konnte ein Mensch nur so mit seinen Mitarbeitern umspringen? War das die neue Realität in diesem Land? Heuern und feuern, wie sie es einmal als Zitat von einem Gewerkschaftsfunktionär gelesen hatte. Mittlerweile hatte sie damit begonnen, seine Äußerungen zu notieren. Immer häufiger aber keimte der Wunsch auf, ihm das Telefon an den Schädel zu werfen. Oder besser: aufzustehen, ihm eine Ohrfeige zu verpassen und ins Gesicht zu schreien, welch widerlicher Typ er doch sei. Einer, der über Leichen ging. Einer, der mit den übelsten Tricks die Konkurrenz ausspielte. Der nicht vor Bestechung und Korruption zurückschreckte. Der vermutlich längst vor Gericht stehen würde, hätte er nicht phänomenale Kontakte zu den Funktionären der regierenden Partei im Lande. Aber selbst wenn man ihn jemals vor den Kadi zerren würde, konnte er sich sicher sein, mit Samthandschuhen angefasst zu werden. Beispiele dafür gab es ja genügend: Peter Hartz, der einstige VW-Personalvorstand, oder Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank. Beide hatten sie mit dem Gericht einen sogenannten Deal gemacht, wie er durchaus erlaubt war, um den Juristen monate- oder jahrelange Beweisaufnahmen zu ersparen. Einem schnellen Geständnis folgte ein schneller Prozess. Der eine kam mit Bewährung und einer Geldbuße davon, der andere durfte sich über die Einstellung seines Verfahrens freuen. Was sie an Bußgeldern bezahlen mussten, konnten sie gewiss ihrer Portokasse entnehmen. Peanuts eben. Sylvia verspürte unbändigen Zorn und eine grenzenlose Wut in sich, wenn sie an solche Vorgänge dachte. Das Maß war voll. Während sie sich wieder ihrem Computer zuwandte, fiel ihr langes blondes Haar über die Rückenlehne des blauen Schreibtischstuhls. Dieser Schweinehund würde sie schon noch kennenlernen. Jeder wusste, wer Konstantin Rieder war: ein angeblich erfolgreicher Manager, der den Small Talk beherrschte wie kein anderer, der sich auf Partys und Empfängen als großer Charmeur aufspielte. Sie hatte es selbst erlebt, ein halbes Jahr lang. Doch dieser Rieder hatte zwei Gesichter. Wie blöd musste sie gewesen sein, auf ihn hereinzufallen. Ihm hörig zu sein. Mit Geld hatte er sie gelockt, mit Versprechungen. Aber in Wirklichkeit war sie nur ein Abenteuer. Seine Selbstbestätigung. Nie im Leben hätte er sich von seiner Frau getrennt. Niemals einen Skandal riskiert – oder gar das gut situierte familiäre Umfeld.
Seit Sylvia dies erkannt hatte, war ihr klar, dass sie nicht länger Chefsekretärin sein konnte. In Situationen wie der jetzigen verspürte sie eine innere Genugtuung, dass die Suche nach einer neuen Stelle erfolgreich gewesen war. Allerdings nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Aber dafür nicht minder angenehm. Seit ihr eine neue Perspektive geboten war, wog sie sich in Sicherheit. Und dieser Kerl, der sich als der große Zampano aufspielte, würde jämmerlich büßen. Ja, es würde für ihn eines nicht allzu fernen Tages ein böses Erwachen geben. Und dafür war bereits alles bestens eingefädelt. Sylvia holte tief Luft, grinste in sich hinein und nahm sich vor, ihren Chef von Tag zu Tag mehr zu verunsichern. Ihre Position war stark. Unheimlich stark.
2
Der aus zwei gekoppelten Zügen bestehende ICE fuhr pünktlich ein und der Waggon Nummer 37 mit der ersten Klasse war der allerletzte. Er kam, wie geplant, vor ihm zum Stehen. Kai-Uwe Horschak, dessen heller Sommermantel nicht zugeknöpft war und im Wind flatterte, strebte der offenen Wagentür zu, während ihm sein Beschatter mit Abstand folgte. Wenig später saßen sie beide im einzigen Vierpersonenabteil, das es gab. Die beiden anderen wiesen jeweils sechs Plätze auf. Horschak hatte den Fensterplatz in Fahrtrichtung rechts eingenommen und sich auf seinem Ticket noch mal vergewissert, dass dies korrekt war. Seinen Aktenkoffer legte er auf den freien Platz neben sich. Der Verfolger hatte sich mit einem knappen »Hallo« ihm gegenüber gesetzt und vergrub die Hände in der Freizeitjacke, während er interessiert zum Bahnsteig hinausblickte. Er bemerkte jedoch die Verunsicherung seines Gegenübers. Vielleicht hatte der Kerl Lunte gerochen? Immerhin waren sie sich vor zwei Wochen schon einmal auf ähnliche Weise nahegekommen. Aber das spielte jetzt auch gar keine Rolle mehr. Denn die Zeit war reif, das Versteckspiel aufzugeben. Und nichts eignete sich dafür besser als eine unverfängliche Fahrt mit der Eisenbahn. In so einem Abteil der ersten Klasse konnte man ungestört reden und davon ausgehen, dass es niemandem gelungen war, ausgerechnet hier eine Wanze zu platzieren. Außerdem, das hatte er schließlich selbst eingefädelt, war sichergestellt, dass bis Stuttgart kein weiterer Passagier dazukommen konnte. Und falls doch noch jemand fragen sollte, ob die reservierten Plätze frei seien, würde er das verneinen und auf Geschäftsfreunde verweisen, die sich gerade im Bordbistro befänden.
Er spürte die unangenehmen Blicke Horschaks. Doch er zwang sich, nicht zu ihm hinüberzusehen und stattdessen seine ganze Konzentration auf den leeren Bahnsteig zu richten. Als ob ihn der andere nichts anginge. Erst wenn der Zug Ulm verließ, würde er ihn ansprechen. Aber trotz dieser selbst auferlegten Disziplin schweiften seine Augen immer wieder zu dem Mann hinüber. Horschak deutete ein Lächeln an. Ein überhebliches Lächeln, wie der Verfolger es einschätzte. Überheblich und beinahe mitleidig.
Über den Bahnsteiglautsprecher wurde die Abfahrt des Intercityexpresszuges nach Dortmund angekündigt. Sekunden später setzte sich der Zug sanft in Bewegung. Er glitt über die Weichen und Kreuzungen des Bahnhofsbereichs, nahm rasch an Fahrt auf und gewann an dem aufsteigenden Hang sogleich an Höhe. Häuser und Fabrikanlagen, denen der dichte Nebel weiche Konturen bescherte, tauchten aus dem undurchdringlichen Weiß auf und waren kurz darauf wieder verschwunden. Auf seinem Weg Richtung Stuttgart musste der ICE die Schwäbische Alb überwinden, die hier zwischen Ulm und Geislingen gerade mal 30 Kilometer breit war. Als diese Bahnstrecke vor rund 160 Jahren gebaut wurde, galt sie als grandiose bautechnische Leistung. Auch wenn es heute großspurig klingen mochte, war es doch die erste Gebirgsüberquerung einer Eisenbahn überhaupt. Aber der Fortschritt von damals wurde bald von neuen Technologien eingeholt. Längst war den Bahnmanagern die Alb-Überquerung mit ihren Steilstrecken und den engen Kurvenradien ein Dorn im Auge. Denn die topografischen Gegebenheiten machten es notwendig, dass der ICE bis auf 70 km/h abgebremst werden musste – ein aus heutiger Sicht unerträglicher Zeitverlust. Schließlich dachten die Bahnchefs nicht mehr in regionalen Dimensionen, sondern global. Von einer wichtigen Magistrale war die Rede, die Paris mit Budapest verbinden sollte. Und da war kein Platz mehr für Langsamfahrstrecken oder den lokalen Forderungen nach möglichst vielen Haltepunkten. Hartmut Mehdorn, oberster Eisenbahner dieser Republik, hatte schon vor Jahren dargelegt, dass die Zeiten der beschaulichen Schwäbischen Eisenbahn vorbei waren: Ein Zug könne schließlich nicht an jeder Milchkanne halten, hatte er sogar im Hinblick auf Mannheim gesagt. Das war im Übrigen noch vornehm ausgedrückt. Im Schwäbischen pflegte man zu sagen: »Nicht an jeder Miste.« Schon jetzt hielt der ICE auf den 90 Kilometern zwischen Ulm und Stuttgart kein einziges Mal.
Die planmäßige Ankunft des ICE 612 nach Dortmund war in Stuttgart 9.47 Uhr.
Dem Mann im Freizeitjackett blieben jetzt exakt 56 Minuten. So lange brauchte der ICE bis Stuttgart.
Tobias Lambert, jung-dynamischer Geschäftsführer des Ulmer Pharmaunternehmens ›Aspromedic‹, lächelte in sich hinein. Er lehnte sich auf seinem schwarzen Ledersessel zurück und öffnete das gepolsterte Kuvert, das ihm seine Sekretärin auf den Schreibtisch gelegt hatte. Kein Absender, wie immer. Aber mit dem Hinweis persönlich auf dem Adressenfeld. Wie vereinbart. Sie korrespondierten weder per Telefon noch per E-Mail. Sie durften keine Spuren hinterlassen.
Lambert hatte mit dem Absender dieses Kuverts nach menschlichem Ermessen alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Auch das Honorar wurde bar übergeben. Ohne Quittung. Der junge Manager hatte es innerhalb kürzester Zeit geschafft, ›Aspromedic‹ aus der Krise zu führen – und dies trotz der jahrelangen wirtschaftlichen Rezession. Dafür wurde das Unternehmen regelmäßig auch von überregionalen Medien positiv und beispielhaft hervorgehoben. Tobias Lambert, Mitte 30, hatte zwar von der Materie, die es zu verkaufen galt, wenig Ahnung, doch dafür war er ein brillanter Betriebswirtschaftler, der sein Studium an der Hochschule Nürtingen-Geislingen mit Bravour bestanden hatte. Für ihn zählten einzig und allein Fakten und Zahlen. Zwar hatte man ihnen während des Studiums zu verstehen gegeben, dass der Mensch nicht nur als Unkostenfaktor in die Kalkulation einfließen dürfe. Doch im Zeitalter knallharten Wettbewerbs, wenn in Südosteuropa die Arbeiter ausgebeutet wurden, war kein Platz »für soziales Gesülze«, wie Lambert es in den wöchentlichen Konferenzen mit seinen leitenden Angestellten auszudrücken pflegte. Er war angetreten, den Umsatz zu verdoppeln, was sich vertragsgemäß auch in seinem eigenen Portemonnaie deutlich auswirken würde. Bald würde er seine Villa im Tessin besitzen. Er war jedenfalls wild entschlossen, alles aus dem Weg zu räumen, was ihn an seinen Zielen hindern würde. Ein Geschäftsführer musste Stratege sein, musste wie ein Feldherr vergangener Zeiten unbeirrt vorgehen und, wenn es notwendig war, den einen oder anderen Bauern opfern – als sei alles nur ein gigantisches Schachspiel. Oder ein Monopolyspiel mit dem einzigen Ziel, sich in der sündhaft teuren Parkallee ein Hotel bauen zu können.
Lambert kannte den Geschäftsführer der Konkurrenz nur zu gut. Er selbst hatte bei Rieders ›Donau Pharma AG‹ während seines Studiums ein dreimonatiges Praktikum absolviert und den »Alten«, wie man dort zu sagen pflegte, als üblen Choleriker kennengelernt, der seine Belegschaft einzuschüchtern vermochte. Lambert hatte jedoch auch gelernt, dass mit autoritärem Auftreten und einem Schuss Arroganz jeglichen Widersprüchen sofort Einhalt geboten werden konnte. Das half auch, eigene Unsicherheit und fehlende Fachkompetenz zu überspielen.
Er drückte einen Knopf am Telefon und beugte sich vor. »Ich will die nächsten zwei Stunden nicht gestört werden«, betonte er und wandte sich wieder dem braunen DIN-A5-Kuvert zu, das mit Klebeband umwickelt war. Er schnitt es mit einer Schere auf und zog eine dünne CD-Hülle heraus, der er sogleich die silberne Scheibe entnahm. Wahrscheinlich, so dachte er in diesem Moment, würde man auf ihr nicht mal einen Fingerabdruck finden. Der Absender war schließlich ein Profi und mit allen Wassern gewaschen. Lambert legte die Scheibe in seinen Rechner ein. Sekunden später wurde auf dem Flachbildschirm das entsprechende Laufwerk angezeigt. Mit einem Mausklick öffnete Lambert die Datei und stellte zufrieden fest, dass ein langer Text dargestellt wurde. Auch hier kein Absender und nichts, was auf den Verfasser hindeuten konnte. Dieser hatte aber, wie vereinbart, wieder ausführlich Protokoll geführt und die neuesten Erkenntnisse geschildert. Lambert las den Bericht langsam, manche Sätze auch zweimal. Er war zufrieden damit. Alles lief offenbar genau nach Plan. Er fühlte sich bereits als Sieger. Sorgfältig entnahm er die CD und legte sie in die Plastikhülle zurück. Dann erhob er sich und ging zum Regalschrank hinüber. Dort schob er ein Schiebetürchen nach links, worauf ein in die Wand gemauerter Tresor zum Vorschein kam. Mit geübten Handgriffen stellte er an zwei Rädchen die entsprechenden Zahlenkombinationen ein, sodass sich die dicke Stahlklappe öffnen ließ. Diesen Tresor, der für Aktenordner viel zu klein war, nutzte er nur für streng geheime Dokumente. Inzwischen aber beinhaltete dieser auch schon sechs CDs. Sie durften jedoch niemals in die falschen Hände geraten. Niemals.
3
Die gleichmäßige Fahrt des ICE 612 wurde abrupt unterbrochen. Es gab einen kräftigen Ruck. Einige Personen, die gerade auf den Gängen unterwegs waren, suchten verzweifelt einen festen Halt, klammerten sich an Kopfstützen, stießen unsanft gegen die Schulter eines sitzenden Passagiers oder hielten sich gegenseitig fest. Gespräche verstummten. Der ICE hatte scharf abgebremst, das beruhigende Rauschen von Fahrtwind und Rädern war urplötzlich in ein bedrohliches Dröhnen übergegangen, wie es entsteht, wenn gewaltige Kräfte auf Metall einwirken.
Die meisten Fahrgäste versuchten, mit einem Blick aus den Fenstern die Ursache für das Bremsmanöver zu ergründen. Doch obwohl sie das Ulmer Nebelmeer schon weit hinter sich gelassen hatten und hier die Sonne schien, war aus ihrer Perspektive nicht zu erkennen, was geschehen war. Nur jene Passagiere, die in Fahrtrichtung links saßen und ihren Kopf dicht an die Scheibe pressten, konnten sehen, dass der schneeweiße ICE gerade eine Linkskurve beschrieb. Der Zug war bereits in die Gefällstrecke der Geislinger Steige eingefahren. Links fiel das Gelände steil ab und ließ erahnen, dass hier einst ein künstlicher Damm aufgeschüttet worden war. An ihm schlängelte sich schätzungsweise 25 Meter tiefer eine viel befahrene Straße entlang. Und noch weiter unten, in der engen Talsohle, ragten die Gebäude einer modernen Mühle aus der bewaldeten Umgebung heraus. Daneben stach ein Lagerplatz für mannshohe Kabeltrommeln ins Auge.
Noch immer wirkten die enormen Bremskräfte. Der Zug hatte jedoch bereits deutlich an Tempo verloren. Während die Passagiere in Fahrtrichtung rechts nur senkrechte Stützmauern vorbeihuschen sahen und lediglich ahnen konnten, dass sie sich im alpinen Gelände befanden, schauderte es den Fahrgästen auf der anderen Seite bei dem Gedanken, der Zug könnte hier oben aus den Schienen springen.
Das ganze Bremsmanöver hatte nur wenige Sekunden gedauert. Und doch hatten die aufgeschreckten Passagiere den Eindruck, es nehme kein Ende.
Dann jedoch kam der ICE zum Stehen. Das Dröhnen verstummte, eine seltsame Stille machte sich breit. Kaum jemand sagte etwas.
Links fiel der Blick auf den bewaldeten Abhang, rechts hingegen hatten die hohen Stützmauern auf die Länge zweier Waggons einem kleinen Plateau Platz gemacht, auf dem ein bemooster Springbrunnen eine dünne Fontäne in die Höhe schießen ließ. Die Passagiere, die von ihrem Platz aus diese beschauliche Anlage sehen konnten, rätselten, ob der unerwartete Stopp bewusst an dieser Stelle erfolgt war. Den Brunnen umgab eine mit Efeu bewachsene Mauer, in deren Mitte eine vermutlich bronzene Büste an eine wichtige Persönlichkeit zu erinnern schien. Normalerweise fiel dieses kleine Denkmal den Reisenden der heutigen Zeit nicht auf. Denn obwohl die Züge auf der Steilstrecke nur 70 km/h schnell sein durften, zog es innerhalb von Sekunden am Fenster vorbei. Außerdem war es oftmals in einem erbärmlichen Zustand und stark überwuchert, weil sich die Bahn so gut wie nicht mehr um derlei Denkmale kümmerte.
Der ICE stand noch keine fünf Sekunden, als im Blickfeld einiger Reisender eine Person auftauchte – ein Mann, der offenbar auf das Schotterbett gesprungen war und nun seitlich des Denkmals hastig im dichten Bewuchs im Hang verschwinden wollte. Er hatte jedoch Mühe, sich mit seinen Halbschuhen einen festen Halt zu verschaffen. Sein heller Sommermantel, den er offen trug, flatterte hinter ihm und blieb mehrfach an dem Gestrüpp hängen. Ohne sich umzudrehen, zerrte der Mann panikartig an dem Stoff, um sich wieder zu befreien. Die Dornen verhakten sich und hinterließen herausgerissene Fäden.
Inzwischen waren mehrere Passagiere auf ihn aufmerksam geworden. »Da haut einer ab«, schrie jemand, während sich nun in zwei Waggons die Fahrgäste hinter den Fenstern der rechten Seite drängten. Doch Augenblicke später hatte es der Mann geschafft und war im Hangwald verschwunden.
Der Zugführer war über seine modernen Instrumente sofort im Bilde: In Wagen 37, ganz hinten, war die Notbremse gezogen und die Notentriegelung der Tür in Fahrtrichtung rechts geöffnet worden. Er brauchte sich nicht zu orientieren, denn er wusste zu jedem Zeitpunkt, wo er sich innerhalb seines Zugteils befand. Über Bordtelefon verständigte er sich mit dem Lokführer. »Ich schau nach«, sagte er mit bayrischem Dialekt. Dann spurtete er los, was bei den Passagieren zu noch mehr Verwirrung führte.
»Es wird doch kein Anschlag sein?«, rief ihm eine ältere Dame nach. Doch da war er schon durch die nächste pneumatisch öffnende Schiebetür verschwunden.
Wagen 37 war die erste Klasse. Er eilte an den Sitzreihen vorbei, gelangte zu den wenigen separaten Abteilen und erreichte schließlich den hinteren Einstiegsbereich, wo in Fahrtrichtung rechts die Tür entriegelt war. Warme Waldluft schlug ihm entgegen. Die Wasserfontäne des Denkmals, die in ein seichtes Becken zurückfiel, plätscherte friedlich vor sich hin. Vögel zwitscherten.
Der Zugchef, der außer Atem geraten war, blieb an der offenen Tür stehen und versuchte, die Umgebung in sich aufzunehmen. Dann stieg er auf das Schotterbett hinab und entfernte sich ein paar Meter von dem Zug, um diesen überblicken zu können. Doch da war nichts, was ihm verdächtig erschien. Er hatte sich gerade entschieden, wieder einzusteigen, um über Bordtelefon dem Lokführer die Anweisung zum Weiterfahren zu geben, als an der Tür ein rundlicher Mann auftauchte und zu ihm herausrief: »Da ist eener weg.«
Drei weitere Personen tauchten im Einstiegsbereich auf.
»Er ist den Wald rauf«, ergänzte eine junge Frau mit schulterlangen schwarzen Haaren.
Der Zugchef stapfte auf dem geschotterten Untergrund zu der Wagentür.
»Sie haben ihn gesehen?«, fragte er interessiert einen etwa 40-Jährigen, der einen deutlichen Berliner Akzent hatte.
»Ja. Der ist da an der Mauer von diesem Denkmal in den Wald rein«, antwortete dieser. »Er hat’s ziemlich eilig jehabt.« Die anderen hinter ihm bekräftigten dies.
»Hab’n S’ ihn erkannt?«, wollte der Zugchef wissen und gab sich betont gelassen.
»Ich hab ihn nur von hinten jesehn. Aber er hat einen weiten Mantel getragen, einen hellen Sommermantel.«
Der Zugchef hatte inzwischen wieder den Einstieg erreicht und kletterte in den Waggon zurück.
»Aber persönlich kennt ihn niemand?«, vergewisserte er sich noch mal und sah in die Gesichter der Fahrgäste, die zum Einstiegsbereich geeilt waren, um an dem aufregenden Geschehen teilzuhaben. Niemand konnte konkrete Angaben machen. Auch die Frau mit den pechschwarzen Haaren nicht, die den kleinen Berliner um eine halbe Kopfgröße überragte.
»Okay, dann fahr m’r wieder«, gab sich der Zugführer entschlossen und verriegelte die Tür. »Allerdings sollten mir einige von Ihnen noch ’n paar Angaben machen – als Zeug’n, wenn S’ verstehn, was ich mein.« Kaum hatte er dies gesagt, machten sich die meisten wieder davon. Zurück blieben nur der nahezu kahlköpfige Berliner, der sich als Erster bemerkbar gemacht hatte, und die schwarzhaarige Frau, deren Alter der Zugchef auf Mitte 30 schätzte. Er deutete den beiden mit einer Geste an, im Einstiegsbereich zu bleiben. Dann setzte er sich über Bordtelefon mit dem Lokführer in Verbindung: »Wir können weiterfahren«, sagte er und fügte hinzu: »Ich geb der Transportleitung Bescheid.« Augenblicke später hatte er die Verantwortlichen in Karlsruhe erreicht und meldete knapp: »ZF« – womit er Zugführer meinte – »ICE 612, Huber. Bei uns hat einer die Notbremse zog’n. Auf der Geislinger Steige. Etwa Kilometer 64, beim Knoll-Denkmal.« Er wartete ein paar Sekunden, bis der Angerufene die Daten notiert hatte. »Ja, Knoll-Denkmal«, wiederholte er dann, während der Zug inzwischen wieder Fahrt aufnahm. »Ich geh mal davon aus, dass der Passagier, der die Notbremse zog’n hot, hier aus dem Zug geflüchtet ist«, bemühte er sich, hochdeutsch zu reden. Sein Gesprächspartner stellte wieder eine Frage, worauf er den Hörer vom Ohr nahm und sich den beiden Zeugen zuwandte: »Sie ham ihn beide also g’sehn? Wie hat er denn ausg’schaut?«
Der Rundliche zuckte mit den Schultern. »Ick hab ihn nur von hinten jesehn«, erklärte er mit Berliner Akzent. »Wat mir auffiel, war seen Mantel, so ein heller Mantel. Er trug ihn offen und ist im Gestrüpp hängen jeblieben.«
»Ja, das stimmt.«
»Und wo genau isser hin?«, hakte der Zugchef nach.
»Den Berg rauf«, erklärte die Frau eifrig und deutete in Richtung des nun langsam vorbeiziehenden Hangs.
Der Zugchef nahm wieder den Hörer ans Ohr und wiederholte diese Angaben. »Ich nehm an, Sie kennen das Gelände hier«, fügte er hinzu. »An der Geislinger Steige hat’s zünftige Steilhänge.« Sein Gesprächspartner ging auf diese Bemerkung nicht ein, sondern versprach, sofort die Bundespolizei zu verständigen.
Der Zugchef beendete das Telefonat und brachte einen Notizblock zum Vorschein. »Darf ich Sie um Ihre Personalien bitten – als Zeugen?«
»Wat heißt hier Zeuge? Ick hab nur eenen wegrennen sehn. Mehr nicht«, stellte der Mann klar, der einen Kopf kleiner war als der Zugchef und einen Aktenkoffer bei sich trug.
Die Frau blieb gelassen.
»Waldinger. Lara Waldinger. Ich kann Ihnen gern meine Karte geben.«
Der ICE schien wieder seine 70 km/h erreicht zu haben. Während er eine scharfe Rechtskurve beschrieb, entdeckten die links sitzenden Passagiere in der Talaue eine rundum eingewachsene Wasserfläche, in der sich der blaue Morgenhimmel spiegelte. Noch lag die Landschaft dort unten in den langen Schatten der Hänge.
Auch der Berliner war inzwischen bereit, seinen Namen notieren zu lassen:
»Clemens Probost. Clemens mit ›C‹ und Probost mit ›b‹ in der Mitte.«
Noch während der Zugchef schrieb, tauchte aus dem Gang entgegen der Fahrtrichtung ein atemloser Mann auf, dessen aschfahle Gesichtsfarbe höchste Anspannung verriet. »Kommen Sie«, unterbrach er den Zugchef bei seiner Amtshandlung. »Kommen Sie.« Schon verschwand er wieder in dem schmalen Gang, der hier links an drei separaten Abteilen vorbeiführte.
Der Zugchef und die beiden Zeugen sahen sich fragend an. Dann steckte der Bahnbedienstete seinen Notizblock in die Außentasche seines blauen Jacketts und folgte dem Mann, der gleich an der ersten Abteiltür stehen geblieben war. »Hier«, sagte er mit zitternder Stimme. »Hier.« Er deutete mit dem Zeigefinger auf die Glasscheibe der zugezogenen Tür. Der Zugchef warf einen flüchtigen Blick in das Abteil. Da saß ein Mann, vermutlich schlafend, jedenfalls zusammengesunken. Der kleine Berliner riskierte einen Blick an der Schulter des Bahnbediensteten vorbei, während die Schwarzhaarige zwei Schritte zurückblieb. Für einen Moment standen sie ratlos und irritiert nebeneinander. Hinter ihren Köpfen schob sich ein schroffer Albfelsen von der gegenüberliegenden Hangseite ins Blickfeld der Fensterscheibe.
Der bleiche Fahrgast, der apathisch in das Abteil deutete und zu keinem zusammenhängenden Satz in der Lage war, sah die beiden Männer fassungslos an.
»Der … der ist tot«, sagte er nach ein paar Sekunden. »Sehen Sie nicht das Blut?«
Der ICE hatte gerade hoch über dem Stadtrand den Geislinger Talkessel erreicht, als sich der Zugchef erneut beim Lokführer meldete.
»Mir hab’n vermutlich a Leich an Bord«, stellte er sachlich fest und ordnete an: »Deshalb außerplanmäßiger Halt in Geislingen. Ich geb dem Fahrdienst Bescheid und lass die örtliche Polizei und den Notarzt ruf’n.« Der Lokführer bestätigte ebenso kühl, während er links vorn den Turm der Stadtkirche näher kommen sah. Außerplanmäßiger Halt wegen einer Leiche. Das würde einen längeren Aufenthalt bedeuten, dachte er und bereitete sich auf das sanfte Abbremsen vor. Vielleicht konnten sie den Zug auf ein geeignetes Gleis lenken, damit der übrige Verkehr nicht beeinträchtigt wurde.
Der schneeweiße ICE schlängelte sich gerade an der Altstadt entlang, als der Zugchef erneut die Transportleitung in Karlsruhe anrief.
»Mir ham an Erschossnen an Bord«, erklärte er knapp und wiederholte die Meldung, weil sie der Gesprächspartner offenbar nicht glauben wollte. »Ja, erschossen.« Und er musste noch einmal bekräftigen: »Einen Mann, der erschossen wurde. Wir halten in Geislingen.« Er beendete das Gespräch.
Die beiden Männer und die Frau standen noch immer vor der zugezogenen Abteiltür und starrten auf das Blut, das aus der weißen Freizeitjacke des toten Passagiers gesickert war. Vermutlich Herzschuss, dachte der Zugchef. Die Augen des Toten waren weit geöffnet und fixierten einen Punkt auf der gegenüberliegenden Seite, als habe er noch bis vor wenigen Minuten jemandem ins Gesicht gesehen. Seinem Mörder, durchzuckte es den Zugchef. »Nichts anfassen«, befahl er und wandte sich an den noch immer bleichen Mann, dem der Tote aufgefallen war: »Wie san S’ denn auf ihn aufmerksam g’word’n?«
»Im Vorbeigehen«, sagte der Angesprochene. »Ich wollt’ zu Ihnen nach hinten, weil ich den Mann, der ausgestiegen ist, auch hab wegspringen sehn. Einige Leute da vorn haben gesagt, dass Sie Zeugen suchen.«
»Können Sie’n beschreiben?«
»Sportlich, würd’ ich sagen«, erklärte der Zeuge und sah Hilfe suchend zu dem Berliner. »So, wie der den Hang raufgerannt ist, muss der mächtig Kondition haben.«
»Dat meen ick ooch«, bekräftigte Clemens Probost und konnte seinen Blick nicht von dem Toten abwenden.
»Und wie hat er ausg’schaut?«, wollte der Zugchef wissen.
Der bleiche Zeuge zuckte mit den Schultern. »Ich hab ihn nur von hinten gesehen. Aber sein Mantel, der müsste ziemlich zerrissen sein – bei dem vielen Gestrüpp.«
»Sein Alter?« Der Zugchef ließ nicht locker. Sie rollten jetzt auf den Bahnhofsbereich zu. Das Tempo des ICE verlangsamte sich.
»Dem Wegrennen nach nicht alt. 30 vielleicht, oder knapp 40, schätz ich. Aber das kommt auf die Kondition an.«
Der Berliner schaltete sich wieder ein: »Der war schnell auf und davon.«
»Haarfarbe oder sonstige Besonderheiten?«
Wieder zuckte der Zeuge mit den Schultern. »Das ging alles sehr schnell. Hätt’ ich gewusst, dass der ein Mörder ist, hätt’ ich natürlich genauer hingeschaut.«
Jetzt schaltete sich die Frau ein und sah auffordernd zu dem Berliner: »Aber Sie, Sie hätten ihn doch besser sehen müssen.«
Der Zugführer stutzte. »Wieso denn er?«
Die Angesprochene zögerte. »Der Herr und ich sind uns gerade im Gang begegnet, als der Zug scharf abgebremst hat – ja, und nachdem es uns nach vorn geschleudert hat und wir uns gegenseitig festhielten, sind wir zur nächsten Tür gegangen, um zu sehen, was geschehen war.«
Der Berliner nickte. »Da ham wir ihn dann davonrennen sehen.«
»Okay«, sagte der Zugführer, als der Zug auf Gleis 3 einfuhr, während auf Gleis 1, direkt vor dem Bahnhofsgebäude, ein Regionalzug stand. Dass hier ein ICE hielt, sorgte für gewisses Aufsehen. »Bleib’n S’ bitte hier, bis d’Polizei kommt«, entschied er und sah den beiden Männern und der Frau nacheinander in die Augen. Dann eilte er durch den Waggon, um von einer Sprechstelle aus die Passagiere zu informieren. »Werte Fahrgäste. Aufgrund einer technischen Störung hat unser ICE in Geislingen an der Steige einen außerplanmäßigen Halt. Über Ihre weiteren Anschlussverbindungen ab Stuttgart werde ich Sie rechtzeitig informieren«, bemühte er sich hochdeutsch zu sprechen, wobei sein bayrischer Akzent trotzdem unüberhörbar war. Der Zugchef hörte, wie im Waggon nebenan die Gespräche lauter wurden. Er vermied es deshalb, sich unter die Passagiere zu mischen, sondern verließ den Zug, nachdem die Türen kurz freigegeben worden waren, um auf dem Bahnsteig zum Erste-Klasse-Waggon zu gehen und dort wieder einzusteigen. Der Berliner und die beiden anderen Zeugen standen noch immer vor dem geschlossenen Abteil und versuchten, andere Passagiere davon abzuhalten, einen Blick ins Innere zu werfen.
Schon heulten näher kommende Martinshörner. »Die werden nix mehr zu retten hab’n«, meinte der Zugchef. »Aber sicher ist sicher.« Die drei anderen nickten zustimmend. Augenblicke später fuhr der Rot-Kreuz-Rettungswagen seitlich des Bahnhofs bis zur Fußgängerunterführung vor. Der Zugchef sprang aus dem Waggon und gab zwei Rettungssanitätern per Handzeichen zu verstehen, wo sie gebraucht wurden. Sie unterquerten die Gleisanlage, rannten am Zug entlang nach hinten und waren in wenigen Sekunden bei dem leblosen Mann im Abteil. Doch es reichten wenige Handgriffe, um zu erkennen, dass jegliche Hilfe zu spät kam. Unterdessen näherten sich weitere Sirenen und ein Mann in weißer Kleidung und mit Metallkoffer spurtete nun ebenfalls zum hintersten Erste-Klasse-Waggon. Es war der Notarzt, der sofort bestätigte, was die Sanitäter befürchtet hatten. »Das war ein Schuss«, stellte er fest und deutete auf das Blut, das aus dem Jackett des Toten gesickert war. Auf dem Gang entlang der separaten Abteile drängten sich jetzt immer mehr Schaulustige. Der Notarzt drehte sich zum Zugchef, während draußen die Sirenen weiterer Einsatzfahrzeuge lauter wurden: »Der, der das getan hat, muss im Zug gewesen sein.«
Der rundliche Berliner, der einen kleinen Aktenkoffer mit bunten Aufklebern bei sich trug, schluckte. Lara Waldinger und der andere Mann sahen sich irritiert an und beobachteten, wie die Schaulustigen mühsam auf Distanz gehalten wurden. Zugchef Huber pflichtete dem Notarzt bei: »Da ham’s recht.«
4
9.28 Uhr. Die zahlreichen Einsatzfahrzeuge, die mit zuckenden Blaulichtern auf dem Bahnhofsvorplatz standen, hatten inzwischen großes Aufsehen verursacht. Streifenbeamte sperrten die Unterführung zum Bahnsteig 2 mit rot-weißen Plastikbändern ab. Der auf Gleis 1 stehende Regionalzug diente in gewisser Weise als Sichtschutz. Auch der nahe Fußgängersteg, der über die Gleisanlage führte und der für Schaulustige ein günstiger Aussichtspunkt gewesen wäre, durfte jetzt nicht mehr betreten werden.
Die Passagiere des ICE wurden über Megafon gebeten, auf ihren Plätzen zu bleiben. Aussteigen konnten sie ohnehin nicht, weil die Türen geschlossen blieben. Reisende, die auf der linken Seite saßen, beugten sich dicht an die Scheiben, um auf diese Weise zu erspähen, was sich draußen auf dem Bahnsteig tat. Die Gespräche drehten sich mittlerweile nur noch um den Vorfall, von dem kaum mehr als Gerüchte bekannt waren. Einige Fahrgäste machten ihrem Ärger über die Bahn Luft, die nichts als Verspätungen produziere. Andere kritisierten lautstark den Zugbegleiter, der bislang keine Auskunft darüber gegeben hatte, wie die verpassten Anschlüsse in Stuttgart oder Mannheim ausgeglichen werden konnten. Per Handy wurden Termine verschoben oder abgesagt.
Auf dem Bahnsteig trafen drei Männer der örtlichen Kriminalpolizei ein. Es waren Dienststellenleiter Rudolf Schmittke, sein junger Kollege Mike Linkohr und Herbert Fludium – das übliche Team, das tagsüber für unvorhergesehene Einsätze zur Verfügung stand. Sie wurden von einem uniformierten Oberkommissar in Empfang genommen und zum Zugende geleitet. Dort ließen sie sich von Zugchef Alois Huber die Situation schildern und die drei Zeugen vorstellen. Schmittke, ein kühler Blonder, der gelernt hatte, im Dienst keine Emotionen zu zeigen, folgte dem Zugführer zu der Sprechstelle, von der aus die Durchsagen für den gesamten Zug erfolgten.
»Meine Damen und Herren«, begrüßte er sachlich, »hier spricht die Kriminalpolizei Geislingen an der Steige. Wir möchten Sie bitten, im Zug zu bleiben. Es besteht keinerlei Grund zur Beunruhigung.« Er überlegte für einen Moment und sah aus dem Fenster, wo sein Blick auf eine triste Betonstützmauer fiel. »Wir benötigen Ihre Hilfe«, fuhr er dann fort. »Denn im Erste-Klasse-Abteil des zweiten Zugteils hat es ein Tötungsdelikt gegeben, weshalb wir dringend Zeugen suchen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit der vorausgegangenen Notbremsung. Falls Sie bereits zuvor im Zug oder während dieser Notbremsung verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder eine verdächtige Person gesehen haben, sollten Sie sich dringend mit uns in Verbindung setzen. Wie gesagt, dies bezieht sich nur auf den zweiten, also den hinteren Zugteil. Wir lassen jetzt die Türen öffnen. Bitte steigen Sie nur aus, wenn Sie als Zeuge in Betracht kommen. Ich wiederhole: Nur aussteigen, wenn Sie als Zeuge in Betracht kommen. Sie erreichen uns in der Mitte der gekoppelten Züge.«
Schmittke stieg aus dem klimatisierten Waggon und spürte, wie ihm die vormittägliche Wärme eines sonnigen Julitages entgegenschlug. Während der Kriminalist zur beschriebenen Zugmitte ging, holten ihn bereits mehrere Personen ein, die ihm zu verstehen gaben, dass sie bei der Notbremsung einen Mann hätten wegrennen sehen. Schmittke drehte sich um und sah in die Gesichter von fünf Männern und drei Frauen.
»Danke für diesen Hinweis«, entgegnete er ihnen. »Wir müssen Ihre Angaben zu Protokoll nehmen und brauchen Ihre Personalien.« Er deutete auf Fludium, der die acht Personen ein paar Schritte vom Zug wegführte, um ihnen die notwendigen Formalitäten zu erläutern.
Schmittke und der junge engagierte Linkohr, der insgeheim hoffte, wieder bei einem kniffligen Fall mitarbeiten zu dürfen, wandten sich an den Berliner Clemens Probost sowie an Lara Waldinger und den anderen Mann, der seinen Namen mit Jochen Lemke angab und sich als 35-jährigen Computerexperten aus Castrop-Rauxel vorstellte.
Noch während sich die Kriminalisten die Beobachtungen schildern ließen, trafen die Kollegen der Spurensicherung ein, die sich zunächst ihre weißen Schutzmäntel überstreiften. Schmittke erläuterte kurz und knapp, worum es ging: »Gleich im ersten Abteil – rechts.«
Linkohr wandte sich auf Bitten Schmittkes von den drei Zeugen ab, um per Handy die Chefin der Kriminalpolizei in der Kreisstadt Göppingen zu verständigen. Manuela Maller war jedoch bereits vom Polizeiführer vom Dienst informiert worden und hatte angesichts der vielen Personen, die es aus dem ICE möglicherweise zu vernehmen galt, sofort Verstärkung losgeschickt – und zwar unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar August Häberle. Der galt als erfahrenster Ermittler weit und breit, hatte jahrelang beim Landeskriminalamt in Stuttgart die kompliziertesten Fälle bearbeitet und war schließlich wieder freiwillig in die schwäbische Provinz zurückgekehrt.
Noch immer hatten alle das Heulen von Martinshörnern im Ohr. Jetzt traf die Bundespolizei aus Ulm ein, deren Beamte sich ebenfalls ein Bild von der Situation verschaffen wollten. Während sich auf dem Bahnhofsvorplatz immer mehr Neugierige versammelten, nahm auch die Zahl der Einsatzkräfte auf dem Bahnsteig zu. Streifenbeamte hatten alle Hände voll zu tun, die Passagiere, die keine Zeugenaussage machen konnten, aber trotzdem ausgestiegen waren, in den Zug zurückzuverweisen.
Linkohr, der inzwischen wieder bei Fludium und den drei wichtigsten Zeugen stand, notierte deren Personalien und machte sich kurze Notizen von den Aussagen. Unterdessen erschien einer der mit weißen Overalls bekleideten Kollegen der Spurensicherung an der Waggontür und erläuterte:
»Es war ein Schuss. Direkt in die Brust.« Für einen kurzen Moment sahen sie sich schweigend an. Schmittke ergriff als Erster wieder das Wort: »Hat er Papiere bei sich? Oder Gepäck? Weiß man, wer er ist?«
Der Spurensicherer schüttelte den Kopf.
»Wer er ist, wissen wir nicht. Hat keine Dokumente dabei, nur seine Fahrkarte, ausgestellt von Ulm nach Mannheim, ein Rückfahrticket. Außerdem gibt’s ein abgeschaltetes Handy, einen alten Geldbeutel mit knapp 200 Euro, einen Schlüsselbund mit VW-Autoschlüssel und Hausschlüssel und ein Notizbuch mit unzähligen Telefonnummern.«
»Ist doch immerhin etwas«, stellte Schmittke mit gewisser Erleichterung fest. »Und das Projektil?«, hakte er sofort sachlich nach.
»Steckt im Leder vom Sitz. Aber eine Hülse haben wir bis jetzt nicht gefunden.« Hinter ihm tauchte sein ebenfalls weiß gekleideter Kollege auf. »Noch etwas«, sagte dieser und hielt einen kleinen Schein zwischen den behandschuhten Fingern:
»Eine Parkkarte vom Parkhaus ›Deutschhaus‹ in Ulm. Eingefahren um 8.32 Uhr heut früh.«
5
Häberle hatte sich die Situation schildern lassen und danach mit sonorer und beruhigender Stimme die Fahrgäste über die bordeigene Lautsprecheranlage informiert. Er bat um Verständnis für den Aufenthalt und erklärte, was im Erste-Klasse-Waggon am Ende des Zuges geschehen war. Anschließend forderte auch er alle Fahrgäste auf, sich als Zeugen zu melden, falls sie Verdächtiges beobachtet hatten oder möglicherweise den getöteten Mann kannten. Unterdessen ließ Schmittke prüfen, ob der Tatortwaggon abgekoppelt werden konnte. Er vermutete, dass dies innerhalb des Geislinger Bahnhofbereichs, in dem es noch Überholgleise gab, möglich sein musste. Häberle hatte dies vorgeschlagen, um den Wagen nach allen Regeln der Kriminalkunst, vor allem aber der Technik, untersuchen lassen zu können. Wer jedoch die Entscheidung zum Entkuppeln des Zuges treffen durfte, vor allem aber, was dann mit den Passagieren dieses Waggons geschehen sollte, vermochte der Chefermittler nicht zu sagen. Dies würde ohnehin den Bahnverantwortlichen obliegen. Inzwischen war die Schar der Neugierigen, die sich auf dem Vorplatz außerhalb der polizeilichen Absperrung drängten, auf annähernd 100 Personen angewachsen. Darunter erspähte der Kriminalist den örtlichen Polizeireporter Georg Sander, dem das Spektakel natürlich nicht entgangen war und der dem Ermittler über die Gleise hinweg zuwinkte. Er blieb jedoch hinter dem rot-weißen Plastikband und wartete geduldig, bis Häberle einen Uniformierten anwies, ihn zu holen.
Sander und der Chefermittler kannten sich seit Jahrzehnten. Sie schüttelten sich freundschaftlich die Hände. »Wieder ein Fall in der Provinz«, stellte der Journalist fest und konnte eine gewisse Begeisterung für ein schlagzeilenträchtiges Ereignis nicht unterdrücken.
»Man könnte meinen, hier tobt so langsam das Verbrechen«, entgegnete der Kriminalist, um dann aber gleich abzuwehren: »Ich geh mal von einem überörtlichen Fall aus. Wir sind wohl eher zufällig zum Tatort geworden.«
Sander, der ebenso wie Häberle mit Land und Leuten bestens vertraut war, die Mentalität der Menschen kannte und vor allem eine profunde Ortskenntnis besaß, hatte lediglich erfahren, dass am Bahnhof ein ICE stand und ein Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen ausgerückt sei. »Worum geht’s denn?«, fragte er deshalb.
»Wir haben eine Leiche im Zug«, erwiderte Häberle leise und wohl wissend, dass für Presseauskünfte eigentlich der Pressesprecher der Polizeidirektion im fernen Göppingen zuständig war. »Erschossen. Mehr wissen wir momentan nicht.«
Sander, ein Mittfünfziger, der seinen Job lange genug machte, um zu wissen, dass er in den ersten Stunden nach einem Verbrechen noch keine Details erwarten konnte, hakte vorsichtig nach: »Wann können wir telefonieren?«
»Ich denke, es wird am Nachmittag eine Pressekonferenz geben. Sie bekommen Bescheid.« Der Chefermittler lächelte dem Journalisten zu und entfernte sich wieder. Sander holte aus seiner leichten Sommerjacke eine Digitalkamera, um den ICE und die Rettungskräfte zu fotografieren. Dann verließ er den Bahnsteig wieder durch die Fußgängerunterführung, ging zum Vorplatz zurück und wandte sich dem Steg zu, der über die gesamte Gleisanlage zum jenseits am Hang gelegenen Wohngebiet führte. Ein dort postierter Uniformierter erkannte den Journalisten und gewährte ihm Zutritt zu der Treppenanlage. Von der Anhöhe des Stegs aus konnte Sander den auf Gleis 3 stehenden ICE nahezu vollständig überblicken. Er knipste auch von hier einige Fotos und beschloss, die Szenerie noch eine Zeit lang zu beobachten.
Häberle ließ sich unterdessen von den Mitarbeiterinnen des Reisecenters im Bahnhof einen spartanisch eingerichteten Aufenthaltsraum im Nebengebäude zeigen, in dem die wichtigsten Zeugen in Ruhe vernommen werden konnten. Zusammen mit Linkohr bot er dort dem Berliner Clemens Probost einen Platz an. Der Mann hatte seinen Aktenkoffer auf den Boden gestellt und sein weißes Jackett geöffnet. Er schwitzte.
»Tut mir leid, aber mehr, als was ick schon jesagt hab, gibt es nich zu sagen«, gab er sich gelassen, obwohl er nun einen wichtigen Termin in Dortmund verpasste, wie er behauptete.
»Wir machen’s so kurz wie möglich«, lächelte Häberle und zog den Holzstuhl näher an den mit Zeitungen und Illustrierten beladenen Tisch heran. »Aber es kommt uns auf jede Kleinigkeit an, auf jedes Detail. Und Sie scheinen den wegrennenden Mann genau gesehen zu haben.«
Linkohr machte sich Notizen, während Probost nachzudenken schien. »Gesehen schon, aber genau eben nicht«, korrigierte er den Kommissar. »Nur, wenn ick mir’s überleg, ist er mir heut früh in Ulm schon aufjefall’n.«
Häberles Interesse stieg, doch dann unterbrach sein Handy die Vernehmung. Er griff in die hellblaue Freizeitjacke und meldete sich. Es war Schmittke, der ihm mitteilte, dass sich an dem 400 Meter langen und aus zwei aneinandergekoppelten Zügen bestehenden ICE keine einzelnen Waggons herausnehmen ließen. Ein ICE dieses neuen Typs, so erklärte der Leiter der Geislinger Kriminalaußenstelle, sei eine komplette Einheit, an der jede einzelne Achse einen Antrieb habe. Deshalb bleibe nur die Möglichkeit, die beiden gekoppelten Züge zu trennen und jenen mit dem Tatortwaggon komplett in Geislingen zu belassen. Häberle stimmte diesem Vorschlag zu und malte sich in Gedanken aus, dass jetzt wohl jede Menge Passagiere auf den nächsten ICE warten mussten, der dann außerplanmäßig in Geislingen halten würde. Eine logistische Herausforderung, für die jedoch andere zuständig waren. Er beendete das Gespräch und steckte das Handy wieder in die Außentasche des Jacketts.
»Sie sagten, der Getötete sei Ihnen in Ulm bereits aufgefallen«, wandte er sich an den Berliner.
»Ja«, erklärte Probost und ließ seinen Blick über die grau-weiße und schmucklose Wand der anderen Seite schweifen. »Er ist wie ich schon eine Viertelstunde früher am Bahnsteig gewesen und hat mehrmals telefoniert.«
»Mit dem Handy?«, hakte Häberle nach.
»Ja, klar doch. Ist ja nischt Unjewöhnliches. Geht mich auch nischt an.«
»Aber Sie haben gehört, was er gesprochen hat?«
Linkohr schrieb eifrig mit.
»Wie dat so ist, wenn man am Bahnsteig steht und warten muss. Man geht auf und ab und sucht auf der Wagenstandstafel den geeigneten Platz zum Einsteigen. Ja, und da bin ick dann auch een-, zweemal an diesem Mann vorbeigekommen.«
»Und haben gehört, was er gesagt hat«, wiederholte Häberle noch einmal, um das Gespräch auf den Punkt zu bringen.
»Nur kurze Gesprächsfetzen. Er war aufgeregt, ist ooch mal kurz laut jeworden. Es hat so geklungen, als warte er noch auf jemanden.«
»Und woraus haben Sie dies geschlossen?«
»Er hat mal janz laut jesagt – sinngemäß etwa: ›Nein, bis jetzt is’ er nich’ aufjetaucht.‹«
Linkohr notierte sich diese Aussage wörtlich.
»Bis jetzt ist er nicht aufgetaucht«, wiederholte Häberle. »Wie hat er das gesagt? Verängstigt, aufgeregt oder eher gelassen?«
»Aufgeregt, würd’ ick meenen. Ick bin dann weiterjegangen und hab mir nischt dabei jedacht.«
»Gab ja auch keinen Grund«, beruhigte ihn der Chefermittler. »Sonst aber haben Sie nichts gehört, was auf den Gesprächspartner schließen ließe?«
»Wie ick das zweete Mal an ihm vorbeijeschlendert bin, hab ick nur noch jehört, wie er jesagt hat: ›Diesmal nicht mehr. Darauf können Sie sich verlassen.‹«
Die drei Männer schwiegen für ein paar Sekunden, dann durchbrach Häberle die Stille: »Aber sonst ist Ihnen am Ulmer Bahnhof nichts aufgefallen?«
»Nee. Wie komm’n Se denn da druff?«
»Im Zug«, griff Linkohr das Gespräch noch einmal auf, »da sollen Sie zum Zeitpunkt der Notbremsung gerade im Gang unterwegs gewesen sein.«
»Ja, sagte ich dem Schaffner schon. Deshalb bin ick doch mit der Dame zusammengerasselt … Der Zug hat so scharf abjebremst, dass wir uns gerade noch aneinander festhalten konnten.«
»Und … dürfen wir fragen, weshalb Sie sich auf dem Gang aufgehalten hatten?«, wollte Häberle wissen.
»Na klar, doch«, gab sich der Berliner leutselig, »ick hab seh’n woll’n, wie der Zug über die Geislinger Steige fährt. Is’ doch wat Besonderes, oder nich’?«
Sylvia Ringeltaube war im Auftrag ihres Chefs in die Ulmer City gefahren, um eine Geschenkpackung mit drei Flaschen erlesenen französischen Rotweins zu kaufen – für 48,50 Euro. Konstantin Rieder pflegte seine Geschäftsfreunde zu verwöhnen, vor allem aber bei Laune zu halten. Und da handelte er nach der alten Devise ›Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft‹. Manchmal aber, das wusste die junge Frau längst, bestanden die ›kleinen Geschenke‹ keinesfalls nur aus einem schön verpackten Kistchen Wein. Wenn es sein musste, schienen auch ganze Mittelklassefahrzeuge die eine oder andere Geschäftsbeziehung in die richtigen Bahnen zu lenken. So genau wusste sie das zwar nicht, doch hatte in den vergangenen Jahren einiges darauf hingedeutet. Seit aber die Regierung mit ihrer Gesundheitsreform in der Branche für erhebliche Unsicherheit sorgte, mussten rechtzeitig die Weichen gestellt werden. Niemand konnte schließlich genau vorhersagen, womit die Pharmaindustrie in den nächsten Jahren rechnen musste.
Sylvia Ringeltaube hatte gerade wieder den komplizierten, weil mehrspurigen Kreisverkehr am Blaubeurer Tor verlassen, als auf ›Radio 7‹ die 11-Uhr-Nachrichten gesendet wurden. Eigentlich interessierte sie das endlose Gerangel der Parteien in Berlin überhaupt nicht. Doch dann wurde sie doch hellhörig, als gegen Ende der Nachrichten der Sprecher den Zugverkehr zwischen Ulm und Stuttgart erwähnte, der momentan behindert sei. »Nach Angaben der Polizei wurde in einem ICE, der Ulm um 8.51 Uhr verlassen hatte, ein Mann erschossen. Die Tat ereignete sich vermutlich auf der Geislinger Steige, wo ein Unbekannter die Notbremse zog und aus dem Zug flüchtete.«
Sylvia Ringeltaube hatte plötzlich Mühe, sich auf den Straßenverkehr zu konzentrieren. Sie drehte das Radio lauter. »Der ICE wird derzeit in Geislingen von der Polizei durchsucht. Mit Verspätungen auch im Nahverkehr ist zu rechnen«, wurde die Meldung beendet und zum Wetterbericht übergeleitet, der für die nächsten Tage eine hochsommerliche Lage prognostizierte.
Beinahe hätte Sylvia Ringeltaube das Rotlicht einer Ampel übersehen. Sie trat fest auf die Bremse, worauf der S-Klasse-Mercedes ihres Chefs noch rechtzeitig zum Stehen kam. Ihr Blutdruck stieg. Sie versuchte, sich an die Abfahrtszeit des Zuges zu erinnern. Hatte der Sprecher 8.51 Uhr gesagt? Ja, da war sie sich ganz sicher. 8.51 Uhr. Sie stierte geradeaus und spielte in Gedanken durch, was da in diesem Zug geschehen sein konnte. Erst die Hupe des Hintermanns holte sie wieder in die Realität zurück. Die Ampel zeigte Grün.
Sie fuhr viel zu langsam weiter und suchte nach einem günstigen Platz, um anhalten zu können. Eine Bushaltestelle erschien ihr dafür geeignet. Sie stellte den silberfarbenen Mercedes ab, kramte ihr Handy aus der Handtasche und drückte hastig einige Tasten. Das Freizeichen quälte sich eine halbe Ewigkeit hin.
»Geh schon ran, Mensch«, flüsterte sie ungeduldig und beobachtete im Rückspiegel den vorbeiflutenden Verkehr. Endlich hörte sie die vertraute Männerstimme.
»Ich bin’s«, sagte Sylvia so leise, als habe sie Angst, jemand könnte das Gespräch belauschen. »Hast du Nachrichten gehört?«
Pause. »Nachrichten? Was soll diese Frage?« Die Stimme des Mannes, die stets einen dynamischen Unterton hatte, klang seltsam zweifelnd.
»Im Zug ist einer umgebracht worden.«
»Im Zug?«
»Ja, im Zug«, wiederholte sie ungeduldig. »Im Zug nach Stuttgart. Ist gerade in den Nachrichten gekommen.«
»Und … ich mein … haben sie sonst noch etwas gesagt?«
»Nur, dass der Zug in Geislingen durchsucht wird.«
»Aber keine Namen?« Der Angerufene hatte sich offenbar schnell wieder gefangen und wollte, wie es im Geschäftsleben üblich war, sofort Fakten hören.
»Nein, natürlich keine Namen. Aber ich hab ein ganz ungutes Gefühl.«
»Ach, Sylvia.« Er klang charmant wie immer. »In so einem Zug sitzen 300 bis 400 Leute. Du solltest …«
»Und wenn doch?«, unterbrach sie ihn. »Wenn sie ihn jetzt doch eliminiert haben?« Kaum hatte sie es gesagt, erschrak sie über diese Formulierung. Aber sie war mit diesem Jargon in den vergangenen Wochen oft genug konfrontiert worden.
Der Mann schien nachzudenken. »Und selbst wenn es so sein sollte«, erklärte er sachlich, »dann wird es keine Spuren geben. Unser Mann ist absolut zuverlässig und diskret.«
Sie schluckte. »Woher bist du dir denn so sicher, dass er das Opfer sein könnte? Es könnte doch auch möglich sein, dass er sich hat wehren müssen, oder?«
»Lass dir jetzt auf keinen Fall etwas anmerken. Wir treffen uns heut Abend, okay? Bis dahin wissen wir mehr.«
»Du«, versuchte Sylvia das Gespräch noch zu verlängern, »du – versprich mir: Egal, was da gelaufen ist, ich will in nichts hineingezogen werden.«
»Sylvia«, sagte der Mann und betonte den Namen so, als ob zwischen ihnen beiden auch ohne viel Worte alles klar sei. »Du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen.«
»Und wenn die Polizei kommt?« Angst und innere Unruhe hatten plötzlich von ihr Besitz ergriffen.
»Sylvia«, wiederholte die Stimme noch eine Spur beruhigender. »Es gibt nichts, was wir uns vorwerfen müssten.«
6
Häberle hatte über seine neue Chefin Manuela Maller mehrere Einsatzhundertschaften der in Göppingen stationierten Bereitschaftspolizei angefordert, dazu zwei Hundeführer und den Hubschrauber der Landespolizeidirektion. Wenn der Unbekannte, der auf der Geislinger Steige aus dem Zug geflüchtet war, etwas mit dem Toten zu tun hatte, und danach sah es zweifelsohne aus, dann musste eine Suchaktion eingeleitet werden, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfolgreich sein würde, eher gering war.
Bei allem, was die Zeugen berichteten, war er in dem großen Waldgebiet am Steilhang der Schwäbischen Alb verschwunden. Dort, das wusste der Chefermittler von seinen ausgedehnten Wanderungen, gab es zwar einige Forstwege, aber auch Taleinschnitte und dichtes Unterholz. Eine gewisse Chance bestand, dass er sich hier irgendwo verborgen hielt. Andererseits aber, so überlegte Häberle, lag die Notbremsung inzwischen über eine Stunde zurück. Da hatte der Geflüchtete genügend Zeit gehabt, per Handy Hilfe herbeizurufen und sich auf der Hochfläche am Waldrand abholen zu lassen. Allerdings hätte dies wiederum den etwaigen Chauffeur zu einem unliebsamen Mitwisser machen können.
Nachdem es weder für die eine, noch für die andere Theorie Hinweise gab, ließ Häberle »das große Programm ablaufen«, wie er es zu formulieren pflegte: Durchsuchung des Geländes zu Fuß und aus der Luft. Während der Hubschrauber aus Stuttgart innerhalb kürzester Zeit den Einsatzort erreichte und in nur doppelter Baumwipfelhöhe am bewaldeten Hang entlangschwebte, taten sich die Suchmannschaften am Boden weitaus schwerer. Um sie nicht zu gefährden, verkehrten die Züge in diesem Bereich nur noch auf Sicht, was etwa Tempo 20 bedeutete. Denn an jener Stelle, an der die Notbremse gezogen worden war, musste eine ausgiebige Spurensicherung erfolgen.
Für die Beamten gestaltete sich der Zugang zu dem mit Springbrunnen geschmückten Denkmal als äußerst schwierig. Selbst unter den Kollegen der Bundespolizei fand sich niemand, der den Weg dorthin kannte. Ein Schutzpolizist des Geislinger Reviers schlug deshalb eine verwachsene Auffahrt vor, die von der Bundesstraße 10 abzweigte und steil zu der Gleisanlage hochführte. Früher stand dort oben ein Bahnwärterhäuschen. Jetzt diente der Weg nur noch den Bautrupps der Bahn, um direkt an die auf halber Hanghöhe liegenden Gleise heranfahren zu können. Auch für die drei Kleinbusse der Bereitschaftspolizei war es nun tatsächlich die einzige Möglichkeit, so nah wie möglich an den Einsatzort zu gelangen. Oben angekommen, erwies sich ein mitgefahrener Kollege der Bundespolizei schließlich doch noch als hilfreich. Anhand der im 200-Meter-Abstand stehenden Kilometrierung der Bahnstrecke errechnete er, dass das Denkmal etwa 600 Meter entfernt in Richtung Ulm stehen musste. Die Beamten, die ihre dunkelgrünen Einsatzoveralls trugen, eilten entlang des Schotterbetts vorwärts, während über ihnen der Rotor des Hubschraubers knatterte, der die Strecke abflog und sich bei jeder Wende wieder ein Stück weiter hangaufwärts orientierte.
Unterdessen durchkämmten Einsatzhundertschaften das Gelände auf der Anhöhe. Ihr Auftrag war vergleichsweise einfacher, denn sie hatten es dort nur mit einer sanften Hügellandschaft zu tun. Die Getreideflächen reichten dicht an den steilen Hangwald heran. Und aus den Feldern, die im Sonnenlicht ockergelb leuchteten, ragten nur die paar Gehöfte von Hofstett am Steig hervor, knapp 50 Einwohner gab es dort.
Als die grünen Mannschaftstransportfahrzeuge durch die Ansiedlung gerollt waren, hatte eine alte Bauersfrau vorsichtig ihr Scheunentor einen Spalt weit geöffnet, um aus respektvoller Distanz den Aufmarsch der Uniformierten zu beobachten. Am Ende der Besiedelung, wo die Straße nur noch in Feldwege mündete, bogen die Busse rechts ab, um noch knapp 100 Meter zum Waldrand hinüberzurollen. Vor einem Stahlmast, der eine Vielzahl von Antennen trug, wurden die Fahrzeuge abgestellt. Die Uniformierten, deren Overalls an eine Kampfuniform erinnerten, stiegen aus und bildeten einen Halbkreis, um sich vom Einsatzleiter die örtlichen Gegebenheiten und die Aufgabe erläutern zu lassen.
Zwei junge Beamte erhielten den Auftrag, sich bei den Bewohnern des kleinen Weilers nach Auffälligkeiten zu erkundigen. Immerhin, so hatte Häberle dies begründet, hätte sich der Gesuchte von hier oben am einfachsten abholen lassen können – sofern er überhaupt Ortskenntnis besaß und wusste, wo er gestrandet war.
Während sich die Suchtrupps dem Wald zuwandten, über dem sich das Geräusch des Hubschraubers ausbreitete, machten sich die beiden jungen Beamten auf den Weg zurück zur Ansiedlung. Da diese nur aus rund einem Dutzend Wohnhäusern bestand, erschien ihnen ihre Aufgabe nicht sonderlich umfangreich. Sie entschieden sich, im Uhrzeigersinn vorzugehen: links die Straße runter, auf der anderen Seite zurück. Doch bereits am ersten Haus, das Bestandteil eines großen landwirtschaftlichen Anwesens war, öffnete niemand. Stattdessen zerrte vor dem Scheunenanbau ein wild bellender Schäferhund an seiner Kette.
An drei weiteren Gebäuden zeigten sich zwar die Bewohner, doch gaben sie den jungen Beamten wortkarg zu verstehen, dass ihnen in der letzten Stunde nichts aufgefallen sei und sie außerdem gar keine Zeit hätten, ständig auf die Straße zu schauen.
An einem der letzten Häuser auf der linken Seite öffnete eine misstrauisch dreinblickende ältere Frau.
»Entschuldigen Sie«, versuchte einer der beiden Männer ihr die Angst vor den Uniformen zu nehmen. »Wir kommen von der Polizei und führen eine kurze Befragung durch.« Die kleine Frau sah zu den Besuchern auf und vermochte offenbar den Erklärungen nicht zu folgen.
»Polizei? Wieso denn Polizei?«, fragte sie ungläubig, worauf der Beamte wiederholte, dass es sich um eine Befragung handle, weil man einen unbekannten Mann suche.
»En Mann, so? En Mann?«, wiederholte die Frau auf Schwäbisch. Sie schien bereits weit in den Achtzigern zu sein. Ihr faltiges Gesicht hatte der Albwind in all den Jahrzehnten gnadenlos gegerbt.
»Einen Fremden, ja«, erklärte der andere Beamte, »einer, der nicht hierher gehört. So einer müsste doch auffallen.«
»Fremde kommat hier selten vorbei. Hier hört nämlich d’Welt auf.« Die Alte lächelte.
»Eben. Deshalb könnte es doch sein, dass Ihnen jemand aufgefallen ist.«
»Sie meinat den mit dem hella Mantel?«, zeigte sich die Älblerin jetzt interessiert.
»Ob er einen hellen Mantel getragen hat, wissen wir nicht. Aber wenn er Ihnen aufgefallen ist …«
»Er hat richtig fein ausg’sehn, der Mann«, gab sich die Frau jetzt gesprächiger. Sie hatte offenbar bemerkt, dass ihre Beobachtung wichtig sein würde. »Er isch über d’Wies komma, vom Wald rüber.« Sie machte mit dem Kopf eine entsprechende Bewegung in die genannte Richtung. »Und dann isch er zur Stroß vor.«
Die Beamten drehten sich um und sahen zur Rückseite des gelben Ortsschildes hinüber.
»Und dann?«, hakte einer von ihnen nach.
»Er isch nur ein kurzes Stück zur Stroß rüber und dann glei wieder zum Wald.«
Damit schien alles gesagt zu sein.
»Wohin ist er dann?«, wollte der zweite Beamte wissen.
Sie zuckte mit den Schultern. »Woher soll ich des wissa? Er isch in Wald nei. Mehr weiß i net.«
»Und wie hat er ausgesehen?«
Sie zuckte wieder mit den Schultern, sodass ihre dunkelblaue und zu groß geratene Kittelschürze von oben bis unten flatterte. »Ich hab ihn doch net aus d’r Nähe g’seh. Aber er war net so anzoga wie a Wanderer.«
Die beiden Beamten sahen sich zufrieden an und nickten der Frau aufmunternd zu. »Danke, Sie haben uns sehr geholfen.«
Die Vernehmung der ICE-Passagiere dauerte bis zur Mittagszeit und erbrachte keine neuen Erkenntnisse. Viele Reisende waren bereits mit nachfolgenden Zügen weitergefahren.
Den Erschossenen hatte der örtliche Leichenbestatter zur Gerichtsmedizin nach Ulm gebracht. Und Häberle entschied nach Rücksprache mit seiner Chefin, eine Sonderkommission einzurichten. Obwohl Geislingen offenbar nur zufällig die Tatortgemeinde war, sollten die Ermittlungsfäden zunächst hier zusammenlaufen. Möglicherweise, so Häberles erste Einschätzung, hatte die Straftat in Ulm ihren Anfang genommen. Denn dort war laut Ticket zumindest der Getötete in den ICE gestiegen.
Noch während in den Lehrsaal des Polizeireviers Tische und Stühle geschafft und Computer vernetzt wurden, beratschlagten Häberle, sein junger Assistent Mike Linkohr und die inzwischen herbeigeeilte Chefin Manuela Maller, genannt Maggy, im Büro des Geislinger Außenstellenleiters Rudolf Schmittke das weitere Vorgehen. Auch Pressesprecher Uli Stock war mitgekommen, um sich über den Stand der Ermittlungen informieren zu lassen.
»Die Journalisten aus der ganzen Region sind im Anmarsch«, gab er zu bedenken, um auf die Bedeutung der Pressestelle hinzuweisen. Er zündete nervös eine Zigarette an. Zuletzt hatte es in dieser Kleinstadt einen ähnlichen Auflauf gegeben, als dort kurz vor der Fußballweltmeisterschaft der damalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann entführt worden war. Aber daran wollte Stock jetzt lieber nicht denken.
Für Manuela Mallers inzwischen pensionierten Vorgänger hätte der Hinweis auf Kameras und Mikrofone großen Stress bedeutet. Sie aber schien es gelassen zur Kenntnis zu nehmen.
»Beraumen Sie für den Spätnachmittag eine Pressekonferenz an«, wandte sie sich an Stock, der dies mit einem tiefen Seufzer quittierte. Es war ja nichts anderes zu erwarten gewesen. Er würde die Medienvertreter über den üblichen E-Mail-Verteiler einladen und für sie eine Pressemitteilung formulieren müssen. Wie üblich, in dürren Worten und abgesegnet vom übermächtigen Staatsanwalt in Ulm.
Häberle hatte sich einen Stuhl an Schmittkes Schreibtisch herangezogen.