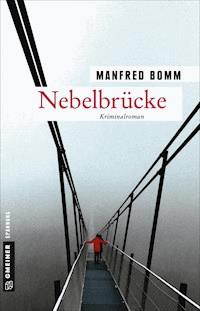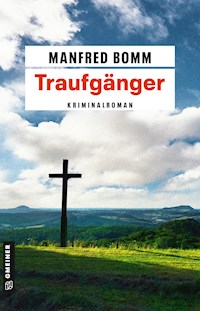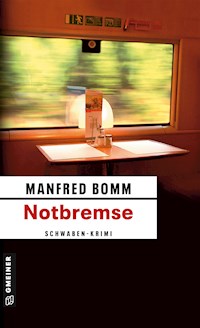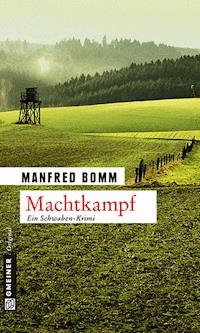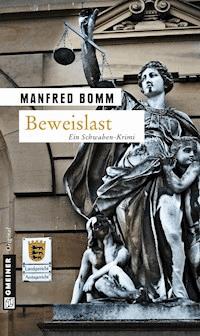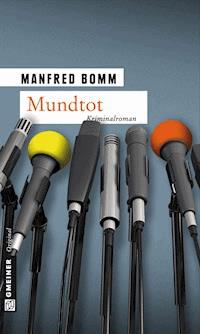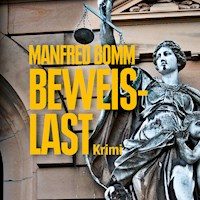Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar August Häberle
- Sprache: Deutsch
Eine verkohlte Leiche kann weder identifiziert werden, noch gibt es Anhaltspunkte, wer sie ausgerechnet neben einer militärischen Funkanlage auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb abgelegt hat. Für Kommissar August Häberle beginnt ein Fall, der äußerst mysteriös erscheint und bis in die höchsten Ebenen der Politik hinein reicht. Während er fast schon befürchtet, das Verbrechen ungelöst zu den Akten legen zu müssen, spielen sich in Florida und Lugano seltsame Dinge ab. Als dann auch noch auf der Schwäbischen Alb in die Wohnung einer Frau eingestiegen wird, die seit Jahren über das Brummton-Phänomen klagt, bekommt der Fall eine neue Wende. Alle Spuren führen nach Ulm, deren Stadtväter sich auf den 125. Geburtstag des dort geborenen Albert Einstein vorbereiten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2005
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Bomm
Trugschluss
Der dritte (sehr außergewöhnliche) Fall für August Häberle
Zum Buch
Eine verkohlte Leiche kann weder identifiziert werden, noch gibt es Anhaltspunkte, wer sie ausgerechnet neben einer militärischen Funkanlage auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb abgelegt hat. Für Kommissar August Häberle beginnt ein Fall, der äußerst mysteriös erscheint und bis in die höchsten Ebenen der Politik hinein reicht. Während er fast schon befürchtet, das Verbrechen ungelöst zu den Akten legen zu müssen, spielen sich in Florida und Lugano seltsame Dinge ab. Als dann auch noch auf der Schwäbischen Alb in die Wohnung einer Frau eingestiegen wird, die seit Jahren über das Brummton-Phänomen klagt, bekommt der Fall eine neue Wende. Alle Spuren führen nach Ulm, deren Stadtväter sich auf den 125. Geburtstag des dort geborenen Albert Einstein vorbereiten …
Manfred Bomm war bis zu seinem Ruhestand als Journalist für Polizei und Justiz zuständig, lebt am Rande der Schwäbischen Alb, dort wo sein Kommissar August Häberle ermittelt, und hat über seine Serienfigur bereits 20 Kriminalromane geschrieben. Vieles, was er in seinen Romanen verarbeitet, hat sich so oder in ähnlicher Weise zugetragen. Das Vorbild für die Figur des Häberle ein leibhaftiger Kommissar aus Göppingen ist ab 1982 tatsächlich sein gesamtes Berufsleben lang mit dem in »Die Gentlemen-Gangster« thematisierten Verbrechen konfrontiert gewesen. Manfred Bomm fühlt sich eng mit Land und Leuten verbunden, liebt die Natur, das Wandern, Reisen und Radeln. Wichtig ist ihm, so gut wie alle beschriebenen Schauplätze selbst aufgesucht zu haben.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2005 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von pixelquelle.de
ISBN 978-3-8392-3168-5
Vorbemerkung
Wer nicht das Unwahrscheinliche für möglich hält, hat den Blick fürs Wesentliche verloren.
Denn die Welt, die uns umgibt, ist viel größer, geheimnisvoller und wunderbarer, als wir es uns je vorstellen können.
Mit jedem Rätsel, das die Wissenschaft zu lösen glaubt, tun sich neue auf, die noch fantastischer und unbegreifbarer erscheinen.
Große und geniale Denker haben immer wieder die Tür einen Spalt weit zum Unglaublichen geöffnet.
Doch hüten wir uns davor, in diese allgegenwärtige Ordnung, in diese ewigen Gesetzesmäßigkeiten einzugreifen.
Hüten wir uns auch vor dem verantwortungslosen Egoismus, der alle entschlüsselten Geheimnisse zu einer Bedrohung dieser wunderbaren Schöpfung werden lässt.
Gewidmet deshalb allen, die davon überzeugt sind, dass diese Welt aus vielen Geheimnissen besteht, die nicht in mathematische Formeln zu pressen sind.
Gewidmet auch jenen, die mithelfen, diesen Planeten vor dem Bösen zu bewahren.
Zitat
Nichts steht für sich allein. Alles hat eine Vorgeschichte, seine Ursache und seine Wirkung. Ohne Vergangenheit gäbe es keine Zukunft. Gestern wurde der Grundstein all dessen gelegt, was uns heute beschäftigt und woraus das Morgen sein wird. Insoweit sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ganz eng miteinander verknüpft. Vielleicht sogar eins.
»Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumen lässt.«
William Shakespeare
1
Dienstag, 14. März 2000.
Der Mann mit der randlosen Brille blickte durchs offene Fenster auf den Luganer See hinab. Das Wasser glitzerte in der Frühlingssonne, drüben erhob sich der San Salvatore, jener mächtige Berg, an den sich der Stadtteil mit dem klangvollen Namen Paradiso schmiegt. Ein wirkliches Paradies, dachte sich der Mann, der seinem Besucher den Rücken zukehrte. Obwohl erst März, blühten am Seeufer schon die ersten bunten Frühlingsblumen und die Äste uralter Bäume ragten mit ihren frischen Knospen ins Wasser, auf dem sich Schwäne und Enten tummelten. Drüben an der belebten Uferpromenade legte ein Ausflugsschiff an. Das Appartement, das sich in einem der eng aneinandergebauten Blöcke am Steilhang des Monte Bré befand, geradewegs dem San Salvatore gegenüber, eröffnete einen herrlichen Blick auf diese traumhafte Landschaft, deren mediterranes Klima genauso geschätzt war, wie die steuerlichen Vorzüge, die die Schweiz bot.
Der Mann, knapp über 60, mit Jeans und weißem Hemd gekleidet, drehte sich nicht um, als er mit deutlich amerikanischem Akzent mit seinem Besucher sprach. »Ich sage Ihnen, die Menschheit hat nicht die geringste Ahnung von dem, was sich zwischen Himmel und Erde tut«, sagte er langsam, während er seinen Blick über die Dächer schweifen ließ, hinüber zum San Salvatore, dessen Konturen im bläulichen Dunst und im Gegenlicht der Nachmittagssonne so ungewöhnlich sanft erschienen.
Der junge Mann, der auf der schneeweißen ledernen Couch Platz genommen hatte, beobachtete seinen Gastgeber, den der Ausblick auf den See zu faszinieren schien. »Ich will Ihnen da nicht widersprechen«, erwiderte der Besucher und lehnte sich zurück, um bewusst locker zu wirken. In Wirklichkeit aber war er angespannt, hatte er doch keine Ahnung gehabt, wen er in diesem Appartement treffen würde. Er, 28 Jahre alt und Physiker, aufgewachsen in Ulm an der Donau, hatte von einem früheren Lehrer eine Internet-Adresse empfohlen bekommen, die angeblich einen attraktiven Job versprach. So war er auf diesen Mann gestoßen, der sich als Wissenschaftler ausgab und offenbar an einem großen Projekt arbeitete. Worum es ging, das hatte sich aus der Homepage allerdings nicht herauslesen lassen. Und auch bei den Telefonaten, die sie in den vergangenen Wochen geführt hatten, wollte dieser George Armstrong, offenbar ein Amerikaner, nicht so recht mit der Sprache herausrücken. Es sei etwas völlig Neues, eine geradezu revolutionäre Forschung, die jedoch auch gewisse Risiken berge. Mehr war nicht zu erfahren. Deshalb hatten sie ein Treffen vereinbart, hier in Lugano, wo der Amerikaner wohnte.
Armstrong, leicht übergewichtig, aber sportlich und braungebrannt, wirkte zweifellos sympathisch. Seine Haare waren vermutlich einmal blond gewesen, doch hatte das, was ziemlich ausgedünnt von ihnen übrig geblieben war, eine gräuliche Farbe angenommen. Er drehte sich langsam um und verschränkte die Arme. »Sie, mein junger Freund, hätten die einmalige Chance, an einem Projekt mitzuarbeiten, das vieles, was die heutige Wissenschaft als unumstößlich betrachtet, aus den Fugen heben kann.«
Jens Vollmer, so hieß der schlanke Besucher, der sein schwarzes Haar extrem kurz trug, versuchte zu lächeln. »Daran, dass ich hier bin, mögen Sie erkennen, dass ich mich einer großen Herausforderung stellen möchte.« Kaum hatte er es gesagt, bedauerte er diese hochgestochene Formulierung. Er war jedoch den Umgang mit internationalen Wissenschaftlern nicht gewohnt. Und dieser Armstrong schien einer zu sein.
Der Amerikaner verzog sein Gesicht zu einem breiten Lächeln. »Leute wie Sie braucht diese Welt.«
Vollmer richtete seinen Oberkörper auf. Er spürte, wie er schwitzte. »Nun ja«, sagte er, »noch weiß ich nicht, was Sie von mir erwarten und welcher Art Ihre …« er suchte nach einer passenden Formulierung, »Ihre Aufgaben sind.«
»Sie kommen aus Ulm?«, fragte Armstrong und ging zu der weißen Schrankwand hinüber, zwischen deren Regale abstrakte Gemälde die einzigen Farbtupfer waren. Aus einem Klapptürchen holte er zwei hohe Gläser und einen Bacardi. »Drink gefällig?«
Vollmer nickte und beantwortete die Frage nach seiner Herkunft: »Ja, aus Ulm.«
Der Wissenschaftler lächelte geradezu väterlich. »Die Geburtsstadt von Einstein, hab ich recht?« Vollmer fiel jetzt der Schweizer Akzent auf, mit dem das ansonsten perfekte Deutsch des Amerikaners behaftet war. Er musste demnach schon längere Zeit in der Schweiz leben.
Armstrong stellte die beiden Gläser auf den kleinen weißen Tisch und schenkte ein. Sein Gast erwiderte: »In Ulm geboren, ja. Er ist dann aber in die Schweiz gegangen – und hat beim Patentamt gearbeitet.«
Armstrong brachte die Flasche wieder in die Schrankwand zurück. »Wegen seiner jüdischen Abstammung«, ergänzte er, »ist er dann später nach Amerika ausgewandert. So hat Ulm seinen berühmtesten Sohn praktisch für immer verloren.«
Vollmer nickte stumm.
»Der größte Wissenschaftler aller Zeiten«, stellte Armstrong fest, setzte sich auf einen Sessel und hob das Glas. »Auf unsere künftige Zusammenarbeit.« Sie prosteten sich zu und tranken.
Vollmer fühlte sich noch immer unsicher. »Sie haben mir ja noch nicht einmal gesagt, worum es konkret geht.«
Armstrong, dem Schweißperlen auf der Stirn standen, lehnte sich selbstgefällig zurück. »Sie werden verstehen, dass ich mich vorläufig etwas bedeckt halten muss, junger Freund.« Er überlegte. »Vieles deutet darauf hin, dass wir – und damit meine ich mich und meine, ja, sagen wir mal, Forschungsgruppe – dass wir nicht die Einzigen sind, die sich mit dieser Materie befassen. Deshalb wäre es nicht gerade dienlich, würde allzu vieles davon in der Öffentlichkeit bekannt.«
Vollmer wagte einen Vorstoß: »Aber verstehen Sie mich bitte richtig, ohne konkrete Anhaltspunkte kann ich mich nicht für eine Mitarbeit entscheiden. Außerdem müssten noch eine Vielzahl von Punkten geklärt werden.«
Armstrong lächelte wieder und holte tief Luft. »Glauben Sie mir, dass Sie der richtige Mann sind, davon bin ich überzeugt. Sonst hätte ich Ihnen wohl kaum die Reise hierher und den Aufenthalt an diesem paradiesischen Ort bezahlt.« Er behielt sein Gegenüber im Auge und fügte süffisant lächelnd hinzu: »Wir haben uns, sagen wir mal, ein bisschen über Sie erkundigt.«
Vollmer erschrak. Damit hatte er nicht gerechnet.
»Gutes Zeugnis, bester Abschluss des Studiums, ein Physiker mit Leib und Seele, sagt man, glaub ich, bei Ihnen. Dass sie aus Ulm kommen, ist eher ein Zufall.« Er lächelte vielsagend und bekräftigte dann: »Ja, gewiss ein Zufall. Was auch sonst?«
»Sie haben Erkundigungen über mich eingezogen?«, fragte Vollmer leicht eingeschüchtert.
Armstrong nahm wieder einen Schluck. »Nennen Sie es, wie Sie wollen. Jedenfalls suchen wir engagierte Leute, wie Sie. Unabhängig, nicht ortsgebunden, ledig, voller Tatendrang. Aufgeschlossen für alles Neue.«
Vollmer griff ebenfalls zum Glas und nahm einen kräftigen Schluck. Danach erklärte er: »Das ehrt mich, dass Sie so großes Interesse an meiner Person haben. Aber letztlich ist alles auch eine Frage der Honorierung.«
Armstrong winkte ab. »Bester Freund«, sagte er, »Sie können mir glauben, dass die finanzielle Seite gesichert ist. Gehen Sie einfach mal davon aus, dass es auf diesem Planeten nie zuvor ein größeres Forschungsprojekt gegeben hat.«
Vollmer schluckte trocken. Langsam wurde ihm das Ausmaß dessen bewusst, worauf er sich da einlassen würde.
Armstrong lächelte wieder. »Die NASA könnte nur davon träumen. Aber das, worum es hier geht, guter Freund, dagegen war der Flug zum Mond, wenn er denn je stattgefunden hat, ein Klacks. Oder sagen Sie in Deutschland eher ›peanuts‹?«
2
Es war einer jener Märztage, die auf den Anhöhen der Schwäbischen Alb den nahen Frühling nur erahnen lassen. An schattigen Stellen lagen vereinzelt noch Schneereste. Hier oben in Hohenstadt, einem kleinen Dorf, in dessen Nähe die Autobahn A 8 Ulm-Stuttgart die Mitteleuropäische Wasserscheide überquert, roch die kühle Luft erdig. Die Sonne stand bereits tief am Horizont, nur verdeckt von einigen dünnen Wolken, als an diesem Nachmittag ein Traktor aus dem kleinen Örtchen hinaus tuckerte, hinauf zu der leichten Erhöhung, auf der seit Jahr und Tag eine militärische Sendeanlage stand. Die Bewohner Hohenstadts, das, wie viele Dörfer auf der Schwäbischen Alb, längst nicht mehr allein von der Landwirtschaft geprägt war, hatten sich an den Anblick des rot-weißen Stahlgittermastens und der umzäunten Gebäude gewöhnt – auch wenn niemand so genau wusste, was nach der politischen Wende dort wirklich noch geschah. Zuvor soll die Technik auf diesem höchsten Punkt weit und breit eine wichtige Funkverbindung für die amerikanischen Streitkräfte gewesen sein, ein »Horchposten«, wozu auch immer. Selbst der Bürgermeister von Hohenstadt vermochte nicht zu sagen, welchem Zweck die Anlage inzwischen diente. Allerdings hatten in den vergangenen Jahren auch private Mobilfunk-Betreiber ihre Antennen an den Masten montiert.
Der Landwirt, der mit seinem Traktor einen Güllefass-Anhänger zu seinen Feldern fuhr, verschwendete keinen Gedanken an das militärische Gelände, an dem er von der Straße abbog. Er, einer der wenigen, die in Hohenstadt noch größere Ländereien bewirtschafteten, hatte anderes im Sinn. Im Wetterbericht war Regen angekündigt worden, weshalb er noch schnell einen Acker düngen wollte.
Der Traktor, ein ziemlich neues Modell mit modernster Technik, tuckerte an dem hohen, von Stacheldraht gekrönten Zaun des Militär-Areals entlang. An dessen Ende, das erkannte der Bauer von seiner überdachten Fahrerkabine aus, parkte ein schwarzes Auto, das mit der linken Hälfte weit in den Feldweg hinein ragte. Beim Näherkommen stellte der Landwirt fest, dass es ein VW Golf war, ein älteres Baujahr wohl. Für einen kurzen Moment ärgerte er sich, weil er vermutete, es könnte sich um einen der vielen Städter handeln, die mit ihren Fahrzeugen rücksichtslos die Wege blockieren. Doch dann nahm er das Gas weg. Ihn machte stutzig, dass am Heck des in Fahrtrichtung geparkten Golfs gar kein Kennzeichen angebracht war. Sein erster Gedanke war, da müsse wohl ein Schrottfahrzeug abgestellt worden sein. Er stoppte seinen Traktor, zog die Handbremse, ließ den Dieselmotor aber laufen.
Der Mann, der trotz seiner fast 60 Jahre sportlich wirkte, schwang sich von seinem Fahrersitz und ging zu dem geparkten Golf hinüber. Er ließ dabei seinen Blick suchend nach allen Richtungen schweifen, um möglicherweise jemanden zu entdecken, dem der Wagen gehören könnte. Doch die Hochfläche war, soweit er dies feststellen konnte, menschenleer. Die Sonne kam wieder zwischen den Wolken hervor und ließ die Bäume lange Schatten werfen.
Der Landwirt spürte die Kälte, die durch seinen blauen Arbeitsanzug kroch. Er kratzte sich mit den schmutzigen Fingern an der faltenreichen Stirn und strich sich mit der Hand nachdenklich über das schlecht rasierte Kinn. Er erkannte sofort, dass der Golf nicht verriegelt war, denn an der Fahrertür ragten die Druckknöpfe des Schließmechanismus weit nach oben. Der Mann trat dicht an die Seitenscheibe heran, um den Innenraum überblicken zu können. Doch da gab es nichts, was ungewöhnlich gewesen wäre. Die Polster waren zwar abgewetzt, aber er entdeckte keinerlei Gegenstände auf den Sitzen, auch nicht in den Fußräumen. Der Tachometer zeigte 88 743 Kilometer. Dann aber verengte der Landwirt die buschigen Augenbrauen: Im Zündschloss steckte ein Schlüssel.
Er trat instinktiv einen Schritt zurück und suchte mit seinem scharfen Blick noch einmal die Umgebung ab, während die Sonne wieder hinter den Wolken verschwand und Dieselabgase seines Traktors in der Luft hingen. Jetzt sah er es plötzlich, was ihm vorhin nicht aufgefallen war: Nur zehn, zwanzig Meter weiter vorne, abseits des Wegs im spärlichen Gras der Wiese, hatte offenbar erst vor kurzem ein Feuer gebrannt. Möglicherweise waren mit dem Inhalt eines kleinen Plastikkanisters, den er ein Stück weiter davon entfernt erkannte, jene Gegenstände entzündet worden, deren verkohlte Überreste dort vorne lagen. Der Landwirt zögerte, ging dann aber zunehmend schneller und energischer auf die Brandstelle zu, um abrupt in respektablem Abstand stehen zu bleiben. Was er sah, ließ ihn den Atem stocken. Er stand wie versteinert, nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen.
3
Die Schwäbische Alb, jener Höhenzug, der im Süden Deutschlands die Donau einerseits und den Neckar andererseits voneinander trennt, war an diesem späten März-Nachmittag ein paar Kilometer von Hohenstadt entfernt noch in schönsten Sonnenschein gehüllt.
In Steinenkirch, einem Ortsteil des größeren Böhmenkirchs, das ostwärts auf einer kargen Hochfläche lag, konnte man sich darüber freuen. Am nordwestlichen Rande des kleinen Örtchens, weit ab der Hauptverkehrsstraße, war in den vergangenen Jahren ein Neubaugebiet mit jenen schmucken Häuschen entstanden, die mit ihren Erkern und Gauben den Stil des ausgehenden 20. Jahrhunderts repräsentieren. Es waren kleine Einfamilienhäuser, wie sie den angeblich unablässig schaffenden und sparenden Schwaben als ihr ein und alles angedichtet werden. Hier oben, wo die Sicht an klaren Tagen beinahe von Horizont zu Horizont reicht, hinaus auf die steinigen Felder und hinüber zu einem noch höher ansteigenden Bergrücken, da drehten sich mehrere Windkrafträder.
Lilo Neumann, eine attraktive Endfünfzigerin, schlank und mit lockigem blonden Haar, stand an diesem Nachmittag in der Küche ihres schmucken Wohnhauses, das im Landhaus-Stil eingerichtet war. Sie hatte vergangene Nacht wieder einmal nicht schlafen können, sodass sie sich jetzt matt und schwach fühlte. Sie blickte Gedanken versunken aus dem Fenster – weit hinaus übers noch winteröde Land, dort hin, wo sich die Windräder drehten und die weißen Rotoren mit jeder Umdrehung im spät-nachmittäglichen Sonnenlicht blitzten.
Lilo Neumann fühlte sich tagsüber, wenn ihr Mann arbeitete, in tiefe Depressionen versetzt. Doch eigentlich gab’s dafür, so versuchte sie sich einzureden, keinerlei Gründe. Die Ehe war in Ordnung, sie hatten finanziell ihr Auskommen. Und doch ging es Lilo von Monat zu Monat schlechter. Schuld daran war diese verdammte Schlaflosigkeit, dieser verfluchte Brummton, der sie seit zwei Jahren so heftig quälte, dass sie manchmal an den Rand des Wahnsinns getrieben wurde. Niemand außer ihr hörte ihn, ihr Mann nicht und auch nicht die erwachsenen Kinder, wenn sie zu Besuch kamen. Einmal hatte sie auch die Nachbarn eingeweiht, ganz vorsichtig, aus Sorge, man könne sie für verrückt halten. Aber niemand außer ihr hatte jemals dieses alles durchdringende Brummen gehört, das überall zu sein schien, dessen Herkunft aber nicht zu orten war, weil es irgendwie aus dem Gebäude selbst herausdröhnte. Aus dem Mauerwerk, aus dem Keller, von überall her. Lilo Neumann war ihrem Mann und ihren Kindern unendlich dankbar, dass sie Verständnis zeigten – auch wenn es anfangs schwierig gewesen war, sie von diesem allgegenwärtigen Brummen zu überzeugen. Sie hatte Fachärzte konsultiert und Psychiater, aber keiner der Mediziner fand eine Erklärung.
Als sie jüngst zufällig im Fernsehen auf eine Reportage gestoßen war, die sich mit diesem Brummton-Phänomen befasst hatte, das offenbar landesweit, in ganz Deutschland und sogar in weiten Teilen Europas die Menschen plagte, da fühlte sie sich endlich bestätigt. Sie fasste neuen Mut und wollte sich jetzt einem Journalisten anvertrauen, den sie vor Jahren schon kennengelernt hatte.
Für diesen Nachmittag hatten sie sich verabredet. Georg Sander, Lokalredakteur der ›Geislinger Zeitung‹, knapp über 50 und ein profunder Kenner von Land und Leuten, kam pünktlich, war überaus freundlich und plauderte zunächst über »alte Zeiten«. Sie saßen sich an dem schweren hölzernen Esszimmer-Tisch gegenüber, auf dem eine gestickten Decke lag. Der Journalist, dessen volles blondes Haar ihm der Wind zersaust hatte, hörte aufmerksam zu und holte einen Notizblock aus der Tasche, als er das Gespräch auf den Brummton brachte.
»Ich höre und spüre es«, begann die sichtlich nervöse Frau, während sie auf einen Stapel Akten deutete, »hier, alles Briefe, die ich inzwischen an Behörden geschrieben habe. Ohne Erfolg.«
Der Journalist, nach jahrelanger Berufserfahrung im Umgang mit dem Ungewöhnlichen geübt, nickte verständnisvoll. »Und es findet sich keine Ursache?«
Sie atmete tief ein, voll Resignation, und schüttelte den Kopf.
»Wir haben schon ein halbes Vermögen investiert. Heizungsmonteure, Elektriker, ja sogar ein Messtrupp der Telekom war da.« Sie deutete durchs Fenster zu den Windkraftrotoren hinüber. »Selbst diese neuen Anlagen wurden untersucht. Nichts.«
Der Journalist machte sich Notizen und bemerkte, dass die Mundwinkel seiner Gesprächspartnerin zitterten. »Und wie hört sich das an? Wie würden Sie es beschreiben?«, fragte er und ließ seinen Blick durch die geschmackvoll und mit viel Holz eingerichtete Wohnung streifen.
»Oft kein Dauerton«, sagte Lilo Neumann und suchte in ihren Akten nach Dokumenten, »eher wie eine Maschine, die immer wieder versucht, eine Umschaltung vorzunehmen, ja, so könnte man es schildern.« Dann zog sie mehrere Blätter aus Klarsichthüllen. »Hier, inzwischen gibt es sogar eine Interessengemeinschaft, weil überall in Deutschland Menschen davon betroffen sind.« Der Journalist nahm die Papiere zur Hand und überflog die Erlebnisberichte. Die Frau, deren innere Unruhe zu spüren war, erzählte weiter: »Irgendwo hat man sogar schon Messungen gemacht. Töne im Frequenzbereich von unter 20 Hertz sollen’s sein. Und die können Menschen normalerweise nicht hören.«
Der Journalist schrieb die Namen einiger Betroffener ab, die in ganz Deutschland wohnten. Unterdessen klagte die Frau ihm ihr Leid: »Aber helfen tut niemand. Das Landesgewerbeaufsichtsamt in Stuttgart kennt die Beschwerden schon seit vorletztem Jahr. Aber wenn Sie sich als einzelne Privatperson an die Behörden wenden, werden Sie kaum ernst genommen. Dabei muss es etwas sein, das seit etwa 1997 in Betrieb ist. Seit damals gibt’s diese Klagen verstärkt.«
Der Journalist deutete auf weitere Aktenordner, die auf dem Tisch lagen. »Sie haben wohl schon regen Schriftverkehr geführt.«
Ein Lächeln huschte über Lilos Gesicht. Sie fühlte sich ernst genommen. »Das kann man so sagen.« Sie überlegte kurz und schaute den Journalisten mit ängstlichen Augen an: »Und ich kann Ihnen sagen, da läuft irgendwo was ganz Mysteriöses ab.«
Sander notierte diesen Satz wörtlich, während die Frau von einer weiteren Beobachtung berichtete, die ihn aufhorchen ließ: »Strom kann nicht der Auslöser sein. Denn als letztes Weihnachten der Orkan ›Lothar‹ hier alles verwüstet hat und auch die Stromversorgung ausgefallen ist, da hat’s trotzdem gebrummt.« Der Journalist bemerkte den starren Blick seiner Gesprächspartnerin.
4
Die Sonne war bereits hinterm Horizont verschwunden, die Dämmerung hereingebrochen, als auf der Anhöhe von Hohenstadt die Blaulichter zuckten. Ein großes Aufgebot an Polizeikräften hatte die kleine Verbindungsstraße abgesperrt, die über den Hügel ins benachbarte Oberdrackenstein führte. Aus beiden Ortschaften waren viele Schaulustige zu Fuß und mit Fahrrädern herbeigeströmt, um zu erkunden, was den Großeinsatz ausgelöst hatte. Doch der Zutritt zu dem Feldweg, der unmittelbar neben dem Militärgelände abzweigte, wurde ihnen verweigert. Aus der Ferne erkannten sie, dass sich am Ende des etwa hundert Meter langen Zaunes viele Personen gruppierten. Dort, das war auch bei dieser schlechten Beleuchtung zu sehen, parkte ein schwarzer Pkw, nahezu verdeckt von einem davor stehenden Traktor samt Güllefass-Anhänger. Das Gerücht machte die Runde, dem Landwirt müsse wohl etwas Schreckliches zugestoßen sein. Dieser aber saß in einem warmen Mannschaftstransportwagen, in dem mehrere Sitze an ein Klapptischchen gedreht waren.
Gegenüber dem sichtlich aufgeregten Landwirt hatte Franz Walda Platz genommen, der Leiter der für Hohenstadt zuständigen Kriminal-Außenstelle Geislingen/Steige. Der erfahrene Beamte, der auf die Pensionsgrenze zuging und für sein Talent bekannt war, ruhig zuhören und sachlich antworten zu können, ließ sich von dem Landwirt in allen Einzelheiten berichten, wie dieser den schwarzen Golf entdeckt hatte.
»Sie könnet sich mein Schreck net vorstelle«, vollendete der ins Schwäbisch verfallende Mann, der seinen Namen mit Hugo Binder angegeben hatte. Walda nickte verständnisvoll und schaute scheinbar in Gedanken versunken durch die Scheibe ins Freie hinaus, wo gerade Kollegen der Bereitschaftspolizei damit begannen, einen Lichtmast zu errichten. Weil die Umgebung nach Spuren abgesucht werden musste, war davon auszugehen, dass die Beamten bis weit in die Nacht hinein tätig sein würden.
»Und gesehen haben Sie niemand?«, bohrte Walda nach. Sein Gegenüber, dessen Gesicht aschfahl geworden war, schüttelte den Kopf.
»Der Weg hier führt nicht nur zu Ihren Grundstücken, sehe ich das richtig?« Der Kriminalist wollte sich ein Bild von den örtlichen Gegebenheiten verschaffen.
»Nein, der geht ganz über die Hochfläche rüber«, erwiderte der Landwirt, der nervös und müde wirkte und seine zersausten graumelierten Haare aus der faltenreichen Stirn wischte. Seit er per Handy die Polizei verständigt hatte, waren bereits zwei Stunden verstrichen.
»Es könnten also schon mehrere Personen hier vorbeigekommen sein …?«, sinnierte Walda und strich sich übers dünne blonde Haar
Hugo Binder nickte stumm, um dann einzuwerfen: »Aber vielleicht hat sich keiner drum kümmert. Mir isch halt verdächtig vorkomme, dass es kein Nummernschild gibt. Man weiß ja nie …« Er machte eine Pause, »bei ›Aktenzeichen XY ungelöst‹ im Fernsehen saget se doch immer, man soll melde, was verdächtig isch.«
Walda lächelte. »Das war sehr gut.«
An der Tür des Kombis machte sich ein junger Kriminalbeamter bemerkbar, der offenbar eine wichtige Mitteilung hatte, jedoch nicht einfach in die Vernehmung platzen wollte. Walda bemerkte ihn und deutete ihm mit einer Handbewegung an, doch hereinzukommen. Es war Mike Linkohr, schlank und sportlich, mittellange schwarze Haare, kantige Gesichtszüge, die immer etwas Positives auszustrahlen schienen. Er war erst vor wenigen Wochen, nachdem er seine Ausbildung absolviert hatte, von der Polizeidirektion Göppingen zur Geislinger Kriminalaußenstelle abgeordnet worden. Auch wenn er dadurch nun in der Provinz seinen Dienst tun musste, so bot sich ihm hier doch die Gelegenheit, erste Erfahrungen an der »Front« zu sammeln. Nur zu gern erinnerte sich Linkohr an die Worte des angesehenen Göppinger Kommissars August Häberle, einem Praktiker, der nichts davon hielt, nur am Schreibtisch zu sitzen und besserwisserisch zu delegieren. Häberle, den er lediglich flüchtig kennengelernt hatte und mit dem er gerne einmal direkt zusammenarbeiten wollte, pflegte seinem Ärger über Bürokraten und »Verwaltungshengste« mit einem einzigen Satz zum Ausdruck zu bringen: »Alle wichtigen Positionen in dieser Republik sind von Schwätzern besetzt.«
Eben dieser Linkohr stieg jetzt in den Kombi und nahm auf einem der Drehsitze neben Walda Platz. Der junge Kriminalist zögerte kurz und überlegte, ob er in Anwesenheit des Landwirts seine Erkenntnisse darlegen sollte. Doch Walda ermunterte ihn mit einem Kopfnicken, dies zu tun.
»Die Kollegen sagen, es muss eine enorme Hitze gewesen sein«, begann er und spielte dabei mit einem Kugelschreiber. »Schlimmer, als vom Blitz getroffen, meinen sie.«
Walda hörte mit verengten Augenbrauen zu.
»Es scheint klar zu sein: Mit Benzin übergossen und angezündet«, erklärte der engagierte junge Mann, »der Kanister lässt keinen Zweifel aufkommen.«
Der Landwirt holte entsetzt tief Luft.
»Irgendetwas gefunden?«, hakte Walda nach.
Linkohr nickte. »Soweit man die verkohlten Knochenreste überblicken kann, nur ein einziges Schmuckstück. Eine goldene Kette – mit einer Art kleiner Weltkugel dran. Das ist alles. Vielleicht finden die Ulmer noch was.« Die sterblichen Überreste von dem, was einmal ein Mensch gewesen ist, wurden sorgfältig eingesammelt und zur genauen Analyse nach Ulm gebracht.
Draußen erstrahlte ein heller Halogenscheinwerfer und hüllte die Umgebung des Kombis in ein gleißendes Licht. Inzwischen war die Dämmerung bereits weit fortgeschritten.
»Und das Fahrzeug?«, wollte Walda wissen.
»Sie versuchen gerade, über die Fahrgestellnummer den Eigentümer ausfindig zu machen. Drin im Wagen ist nichts, was uns weiterhelfen könnte. Auch kein Serviceheft, nicht mal unter der Motorhaube ein Hinweis auf den nächsten Ölwechsel.«
Waldas Gesichtsausdruck wurde ernst. Nach einer kurzen Pause fügte der junge Mann hinzu: »Was allerdings ein bisschen rätselhaft ist, ist die Sache mit dem Kanister. Wir finden den Schraubverschluss nicht.«
»Ach …«, machte Walda und kniff die Lippen zusammen, um dann zu entscheiden: »Wir müssen ohnehin das Gelände weiträumig absuchen. Reifenspuren, Schuhabdrücke vielleicht.«
Linkohr war noch nicht fertig. »Dann ist da noch etwas«, machte er voller Tatendrang weiter: »Bei den Kollegen vorne an der Straße hat sich ein Mann gemeldet, ein etwas wundersamer Typ, wie sie sagen. der will vorige Nacht was Merkwürdiges bemerkt haben und will unbedingt mit dem Chef hier sprechen, mit Ihnen also.«
Walda lehnte sich zurück. »Und was hat er bemerkt?«
»Einen Lichtblitz, sagt er. Kurz nach Mitternacht, einen Blitz«, berichtete der junge Kriminalist und wiederholte, um es zu verdeutlichen: »Einen Blitz wie aus heiterem Himmel, sagt er.«
Der Chef überlegte kurz: »Lassen Sie ihn herbringen.«
5
Auch rund 400 Kilometer südlich, jenseits der Alpen, im Tessin, war inzwischen die Nacht hereingebrochen. Jens Vollmer, der Ulmer Physik-Student, dem der Amerikaner George Armstrong einen gut dotierten Job in Aussicht gestellt hatte, ohne sich konkret zu äußern, war nach dem Gespräch hinab zur Uferstraße gegangen, wo das Leben pulsierte und ihm eine kühle Brise entgegenstrich. Draußen auf dem Luganer See spiegelten sich die Lichter der geschwungenen Promenade, die sich bis hinüber nach Paradiso zog, an den Fuß des San Salvatore, der den Glanz des Tages verloren hatte und sich jetzt dunkel vom helleren Nachthimmel abhob.
Vollmer war gegenüber der Schiffsanlegestelle in eine Pizzeria gegangen, hatte sich allein an ein kleines Tischchen gesetzt und eine Lasagne bestellt, die ihm, dem sparsamen Schwaben, sündhaft teuer erschien. Er nahm einen Schluck Rotwein und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Mit Armstrong hatte er vereinbart, dass er ihn gleich morgen früh wieder aufsuchen würde. Der angebotene Job, das war dem jungen Mann inzwischen klar geworden, unterlag offenbar großer Geheimhaltung, was allerdings mit einem geradezu fürstlichen Gehalt »belohnt« wurde. Was Vollmer jedoch nicht passte, war die Eile, mit der er sich dafür entscheiden sollte. Armstrong hatte ihn geradezu unter Druck gesetzt – zwar nicht übermäßig, aber dennoch spürbar.
Während der junge Mann einen zweiten Schluck Wein nahm und seinen Blick durch das Lokal schweifen ließ, das sich zunehmend füllte, machte er sich mit dem Gedanken vertraut, in dieser traumhaften Gegend für längere Zeit zu leben. Irgendwie würde er es seinen Eltern beibringen müssen, die in einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb lebten und deren große Angst es schon immer gewesen war, ihren einzigen Sohn könnte es eines Tages berufsmäßig in eine größere Stadt verschlagen, womöglich ins Ausland.
Eine schwarzhaarige junge Bedienung brachte das bestellte Nudelgericht und riss ihn aus seinen Gedanken. Die beiden lächelten sich zu – und schon war das Mädchen wieder weg. Vollmer blickte der Frau nach und dachte, wie schön es im Tessin sein könnte – nur wenige Autostunden von Ulm entfernt und über Chur, den Bernadino-Tunnel und Bellinzona problemlos zu erreichen.
Keine Frage, das Projekt reizte ihn, zumal es offensichtlich in ein großes Konzept eingebunden war, das von höchsten Stellen forciert wurde. Vollmer schlang sein Essen förmlich hinunter und nahm die Gäste um sich herum nicht mehr zur Kenntnis. Plötzlich spürte er in sich Zweifel aufsteigen, ob es sich tatsächlich um einen wissenschaftlichen Auftrag handeln würde, oder ob nicht gar militärische Interessen dahintersteckten. Und dies auf dem Boden der neutralen Schweiz. Andererseits hatte das seriöse Auftreten des Amerikaners nicht den Anschein erweckt, dass er im Auftrag irgendwelcher Hintermänner handeln würde. Vollmer nahm einen kräftigen Schluck Rotwein und blickte durch die entfernte Glasfront auf die hell beleuchtete Uferpromenade hinaus.
Er erschrak, als er plötzlich hinter sich eine Frauenstimme hörte, die sich zweifelsfrei an ihn wandte: »Signore Vollmer?« Der Student drehte sich zögernd um und war irritiert.
6
Franz Walda und sein junger Kollege Mike Linkohr hatten den Hohenstadter Landwirt in die raue Kühle der von Scheinwerfern erhellten Nacht verabschiedet, als ein hagerer Mann an der Schiebetür des Mannschaftstransportwagens auftauchte. Das Gesicht wirkte blass und kränklich, auf der Nase saß eine viel zu große Hornbrille mit dicken Gläsern und den fast kahlen Kopf zierte nur noch ein schmaler, schwarzer Haarkranz. Der Mann, wohl um die 55 Jahre alt, war in Begleitung eines uniformierten Beamten, der ihn Walda vorstellte: »Das ist Herr Willing. Er hat eine Beobachtung gemacht.«
Walda und Linkohr begrüßten ihn und baten ihn in den Wagen. Er ließ sich auf dem Sitz nieder, auf dem zuvor der Landwirt gesessen war. Willings Hände waren schmutzig und zerfurcht, sein Gesicht eingefallen und schlecht rasiert.
»Nun erzählen Sie mal«, ermunterte ihn Walda und verschränkte die Arme.
Der Angesprochene war nervös und wusste offenbar nichts mit seinen Händen anzufangen. »Na ja, ich dachte, es könnte für Sie von Bedeutung sein«, begann er, »als ich die vielen Polizeiautos sah, ist mir sofort eingefallen, was ich vergangene Nacht gesehen hab.«
Linkohr behielt den Mann, der innerlich aufgewühlt zu sein schien, von der Seite fest im Auge. Walda bekundete mit einem leichten Kopfnicken Interesse.
»Ich wohn da drüben am Ortsrand«, machte Willing weiter und deutete in Richtung Hohenstadt, »mit meiner Lebensgefährtin«, fügte er lächelnd hinzu, »aber vorige Nacht hab ich nicht schlafen können, bin Frührentner, müssen Sie wissen.« Er stockte kurz, als warte er auf eine Reaktion seiner Zuhörer. Dann fuhr er fort: »Hab nämlich bis um Mitternacht gearbeitet, an einer Erfindung«, wieder lächelte er stolz, »an meinem Lebenswerk. Das ist aber noch nicht fertig.«
Walda wollte sich auf kein Gespräch dazu einlassen und wurde ungeduldig:
»Und dann haben Sie aus dem Fenster gesehen?« Er wollte auf den Punkt kommen.
Willing schaute den Kommissar misstrauisch an. »Ja«, sagte er dann, »das war aber schon um drei, genauer gesagt, um kurz nach drei. Ich bin raus zur Toilette und rüber ins Wohnzimmer, um nach dem Wetter zu schauen. War ziemlich stark bewölkt. Ich steh zunächst am Fenster und hab mich dann in den Sessel gesetzt. Der Vorhang war zurückgezogen und das Licht gelöscht.« Willings rechtes Augenlid zuckte nervös. »Ja, Sie müssen wissen, dass ich fast die ganze Anhöhe überblicken kann. Ich seh das rote Blinklicht dieser Anlage hier und auch die Scheinwerfer der Autos, wenn sie dran vorbeikommen.«
Der Kommissar nickte stumm.
»Ja, und dann war da plötzlich dieser grelle Blitz«, berichtete der hagere Mann weiter, während sein rechtes Augenlid nun immer häufiger zuckte.
»Ein Blitz?«, wiederholte Walda mit gewissem Zweifel in der Stimme.
»Ja, so sah’s zumindest aus. Ein gewaltiger Lichtblitz, aber nicht aus den Wolken, wie bei einem Gewitter, sondern wie aus der Erde«, er überlegte, »oder aus dem Nichts, aus der Luft. Als wär ein gewaltiges Halogenlicht in meine Richtung gerichtet gewesen und nur für einen kurzen Moment aufgeflammt.«
Walda sah seinem nervösen Gegenüber in die Augen. »Und dies war hier oben – aus Ihrem Blickwinkel betrachtet?«
Willing nickte heftig.
»Und ein Geräusch?«, schaltete sich jetzt Linkohr ein, »gab’s denn einen Donner?«
Willing schüttelte den Kopf. »Nichts, keinen Donner, keinen Qualm, nichts. Absolut still. Es war wie ein Spuk.«
»Kann es auch ein Feuer gewesen sein, ein explosionsartig aufgeflammtes Feuer?«, zeigte sich Walda interessiert.
Der Befragte zuckte mit den Schultern. »Glaub ich nicht. Dazu war’s viel zu hell, grell, wie ein Blitz. Keine Flammen, die wären rötlich gewesen – und außerdem war’s sofort wieder dunkel. Das war nur der Bruchteil einer Sekunde.«
Willing blickte ratlos. Den kurzen Moment des Schweigens brach der Kriminalist mit einer ganz anderen Frage: »Und Sie?«, wollte er wissen, »Sie sind danach wieder zu Bett gegangen?«
Willing stutzte über diese Frage. »Ja, was sonst …?«
»Sie waren nicht aufgewühlt von dem, was Sie gesehen haben? Hatten Sie nicht das Bedürfnis mit ihrer Partnerin zu sprechen« fragte Linkohr staunend und glaubte zu spüren, wie der Mann immer aufgeregter wurde. Dazu bestand eigentlich gar kein Grund, nachdem er sich doch jetzt alles von der Seele geredet hatte, was ihn bedrückt hatte. »Mit Ellen?«, fragte Willing verwundert und meinte seine Partnerin. »Nein, die schläft sowieso oben, müssen Sie wissen. Und mich hat dann die Müdigkeit übermannt.«
Die drei Männer schwiegen für einen Moment, bis sich Walda die Personalien des Mannes geben ließ und ihm mit einer raschen Verabschiedung zu verstehen gab, dass die Vernehmung beendet sei.
Als Willing hinterm Mannschaftstransportwagen in der Dunkelheit verschwunden war, wagte Linkohr einen Kommentar: »Hat der nachtgewandelt?«
Walda holte tief Luft und machte noch ein paar Notizen auf dem Blatt, auf dem er die Personalien Willings festgehalten hatte. »Weiß der Kuckuck, was der gesehen hat …«
»Vielleicht ein Ufo«, meinte Linkohr spöttisch grinsend.
7
Jens Vollmer sah zunächst die schlanken Beine, die in einer engen Jeanshose steckten, dann einen ebenso engen Pullover, schließlich die weiblichen Formen und dann die langen schwarzen Haare. Er war für einen kurzen Moment nicht in der Lage, etwas zu sagen. Der junge Mann blickte in das strahlende Lächeln einer gleichaltrigen Frau, deren dunkle Augen weit geöffnet waren. Er legte sein Besteck beiseite und stand auf: »Ja, bitte?«, stammelte er fast ein bisschen atemlos, einerseits vom Anblick der Frau, andererseits aus Verwunderung.
»Bleiben Sie sitzen«, lächelte sie, ging um das Tischchen, hängte ihre Handtasche an die Stuhllehne und setzte sich Vollmer gegenüber. Er nahm ebenfalls wieder Platz und versuchte ein gezwungenes Lächeln.
»Kein Grund zur Beunruhigung«, sagte sie in bestem Hochdeutsch. Dass sie ihn mit »Signore« angeredet hatte, war wohl eher ein Gag gewesen.
»Entschuldigen Sie, wenn ich hier so einfach auftauche«, fuhr sie fort, ohne das Strahlen zu verlieren, »aber man hat mir gesagt, dass Sie heute schon mit Mister Armstrong gesprochen haben.«
Vollmers Überraschung war perfekt. Er legte sein Besteck auf den Teller und schob ihn zur Seite. Ihm war der Appetit plötzlich vergangen. Er fragte sich, was für ein Spiel hier gespielt wurde.
»Ich bin, um ehrlich zu sein, einigermaßen erstaunt …«, entgegnete der junge Physiker, ohne den Satz beenden zu können.
Sie gab ihm einen freundschaftlichen Klaps auf die rechte Hand: »Mann, sei nicht so ängstlich. Ich bin eine Kollegin von dir«, sie lächelte wieder und verbesserte sich: »Eine künftige Kollegin von dir. Hab ich recht? Ich war auch bei Armstrong vorhin und als du weg warst, hat er mir vorgeschlagen, dir zu folgen und dir ein bisschen Gesellschaft zu leisten.«
Er war baff. Da saß ihm urplötzlich eine attraktive junge Frau gegenüber, so als habe sie ihm der Himmel geschickt, und er war nicht in der Lage, sich darüber zu freuen.
Sein Lächeln wirkte verkrampft. »Und nun bist du mir einfach nachgegangen?«, fragte er zweifelnd.
»Klar«, antwortete sie keck, »wie im Krimi bin ich dir hinterher geschlichen. Wollte dich jetzt aber erst mal essen lassen. Bin da draußen ein bisschen rumspaziert.« Sie deutete hinter sich auf die Uferpromenade hinaus.
»Also«, versuchte Vollmer Ordnung in die Geschehnisse zu bringen, »Armstrong hat das so gewollt …?«
Sie nickte heftig. »Übrigens, ich heiße Claudia, Claudia Eberfeld. Nenn mich einfach Claudi«, sie reichte ihm die Hand, die er zögernd ergriff und drückte.
»Wie ich heiße, weißt du ja, Jens, heiß ich, Vollmer.«
»Ein Schwabe, gell?«, fragte sie eher rhetorisch und äffte den schwäbischen Dialekt mühsam nach.
Jetzt trat die attraktive Bedienung an den Tisch, was den jungen Mann zusätzlich irritierte. Sie nahm seinen Teller mit und fragte, was sie der jungen Dame bringen könne. Claudia bestellte einen Salat und einen Wein aus der Toskana.
»Ulm, ja«, erwiderte Vollmer knapp. »Wo bist du her?«
»Berlin«, sagte sie, »Ossi-Teil.« Sie grinste. »Wohn ganz in der Nähe vom Alex. Warst du schon mal dort?«
Vollmer nickte. »Ist schon fünf Jahre her, ja, war eine politische Tour, mit einem Abgeordneten.«
»Fünf Jahre!«, wiederholte sie ungläubig, »Mann, was glaubst du, was sich da inzwischen getan hat! Da wird gebaut ohne Ende!«
»Und was hat dich nach Lugano verschlagen?«, wollte der junge Mann endlich wissen. Ihm erschien das alles reichlich suspekt.
»Bin Ingenieurin«, sagte sie selbstbewusst, »war bei einer Software-Firma beschäftigt, Programmieren und so – bis ich vor einem halben Jahr auf das Angebot von Armstrong gestoßen bin. Ja – und schon war ich da. Ein Super-Job, sag ich dir. Keinen Chef, der nur nach der Bilanz schielt, und der Teilhaber befriedigen will – Knete, Knete, Knete. Das macht dich doch verrückt! Ein Leben lang nur Zahlen, Bilanzen, Druck, Druck.« Sie lächelte ganz ungezwungen und befreit. »Nein, Jens, hier geht’s um was ganz anderes.«
»Ist mir klar«, erwiderte er angestrengt, obwohl ihm alles immer undurchsichtiger erschien, »die Arbeit hier …«, er überlegte kurz, »sie hat mit Forschung zu tun …?«
»Du bist misstrauisch«, stellte die Frau fest, »Jens, da gibt es keinen Grund dafür. Es ist alles ganz wunderbar. Was wir tun, kannst du dir gar nicht vorstellen, aber Armstrong wird dich einführen, sobald du bei uns einsteigst.«
Er hatte gehofft, dass sie ihm etwas Genaueres sagen würde. »Und du bist beauftragt, mich rumzukriegen«, sagte er direkt.
Sie zog eine Schnute. »Och, Jens«, lächelte sie wieder sympathisch und ließ dezent ihren Berliner Dialekt anklingen, »sei doch keen so’n verklemmter Schwabe!« Und dann fügte sie hinzu: »Aber ich find dich auch so nett.«
Er fühlte sich geschmeichelt, ohne dass dadurch seine Zweifel über das wahre Interesse dieses Mädchens an ihm ausgeräumt gewesen wären. Hatte er nicht einmal irgendwo gelesen, dass es auch Agentinnen gab, die ihre »weiblichen Waffen« einsetzten …?
Er beschloss, seinen ehemaligen Physiklehrer zu Rate zu ziehen. Seit seiner Schulzeit waren zwar schon einige Jahre vergangen, aber inzwischen hatte sich zu diesem damaligen Pädagogen aus der Realschule ein geradezu freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Dieser Lehrer, längst ein Duz-Freund geworden, kam sogar zu jedem Klassentreffen. Jens galt ohnehin als Beispiel für einen Schüler, der es trotz einst schlechter Noten zu etwas gebracht hatte – und dies auch noch in der Physik, die dem Lehrer ganz besonders am Herzen gelegen war. Dieser hatte Vollmer auch vor einiger Zeit diese ins Tessin führende Internet-Adresse zukommen lassen.7
*
Mittwoch, 15. März 2000.
Franz Walda und seine Kollegen hatten nur wenige Stunden geschlafen. Es war spät geworden in Hohenstadt und die Nacht war eisig kalt gewesen. Obwohl noch eine ganze Hundertschaft der Göppinger Bereitschaftspolizei die Wiesen rund um den Fundort der verbrannten Leiche durchsucht hatte, wurden weder Spuren noch irgendwelche Gegenstände gefunden.
Noch in der Nacht war auch der Göppinger Kripo-Chef Helmut Bruhn vor Ort geeilt, um sich informieren zu lassen. Daraufhin hatte er angesichts der mysteriösen Umstände entschieden, eine Sonderkommission einzurichten. Sofort wurde ein Dutzend Kriminalisten aus den Betten geklingelt, allen voran Hauptkommissar August Häberle, dem die Leitung übertragen wurde. Häberle galt als einer der fähigsten Kriminalisten weit und breit, war knapp über 50 und einer, der sich mit der Mentalität der Schwaben bestens auskannte. Kein Draufgänger, keiner, der sich mit Ellbogen hochgedient hatte, kein Schwätzer, sondern einer, der sich stets vor Ort ein Bild verschaffen wollte, der sich nie zu schade war, »an die Front zu gehen«, wie er auch den jungen Kollegen stets empfahl. Jahrelang hatte er beim Landeskriminalamt in Stuttgart die kniffligsten Fälle gelöst, bis er vor kurzem wieder freiwillig in die heimische Provinz zurückgekehrt ist. Häberle galt im Umgang mit dubiosen und mysteriösen Angelegenheiten als äußerst versiert. Sein Wissen, seine Menschenkenntnis, seine Art, wie er Verdächtige und Opfer behandelte, seine endlose Geduld – das alles war nicht nur vorbildlich, sondern landauf, landab schon legendär. Ob seiner Leibesfülle wurde er oftmals von seinen Gegnern unterschätzt, wenn sie plötzlich flüchten wollten und nicht damit rechneten, dass dieser Kommissar blitzschnell sein konnte und Bärenkräfte entwickelte. Schließlich trainierte er seit Jahr und Tag die jungen Judoka von Frisch-Auf Göppingen.
Es war 2 Uhr, als er in dieser kalten März-Nacht in Geislingen eintraf, wo in aller Eile die technischen und logistischen Voraussetzungen für eine Sonderkommission geschaffen wurden.
Er ließ sich von dem sichtlich übermüdeten Walda und weiteren Kollegen schildern, was geschehen war. Einige tippten Protokolle in die Computer-Tastaturen, andere uniformierte Kollegen von der Wache versorgten die Kriminalisten mit Kaffee.
Nachdem er sich einen ersten Überblick verschafft hatte, schickte Häberle die Beamten, die seit Stunden auf den Beinen waren, nach Hause. Er würde sich jetzt, so weit dies mitten in der Nacht möglich war, sämtliche Vermissten-Meldungen der letzten Wochen aus dem ganzen Lande auflisten lassen.
In den Vormittagsstunden, als sich Häberle nun auch hundemüde fühlte, lagen die ersten Erkenntnisse vor. Der Kriminalist rief seine Kollegen im schlichten, weiß möblierten Lehrsaal zusammen, wohin er von einer Sekretärin des Reviers frische Brezeln und Kaffee hatte bringen lassen. Rund ein Dutzend überwiegend junge Männer lehnte an den Fenstersimsen oder an den Wänden, als Häberle mit gewissem Stolz verkündete: »Kollegen, wir wissen, was es mit dem Golf auf sich hat. Das Volkswagenwerk in Wolfsburg hat bereits mitgeteilt, dass der Wagen am 9. August 1993 in die Schweiz exportiert wurde, genauer gesagt, nach Lugano im schönen Tessin.« Häberle blätterte in einem Notizblock, während die Kollegen an ihren Brezeln knabberten.
»Die Jungs im Tessin«, machte der Kriminalist weiter, »sind ebenfalls sehr kooperativ. Sie haben herausgefunden, dass der Wagen zuletzt auf eine Firma in Agno zugelassen war, liegt gleich neben Lugano – beim Flughafen.« Häberle machte eine kurze Pause, um sich auf seinem Blatt zu orientieren. »War wohl irgendein Kurierdienst, der im vergangenen Oktober Pleite gemacht hat. Den gesamten Fahrzeugpark hat dann der Konkursverwalter stillgelegt und sollte ihn verkaufen. Seither war der Golf nicht mehr zugelassen und zusammen mit gut und gern 20 anderen Fahrzeugen auf dem Firmengelände abgestellt.«
»Also hat ihn jemand geklaut und ist damit zu uns auf die Alb kutschiert«, stellte ein jüngerer Beamter fest und überlegte: »Die Theorie, da könnte einer Selbstmord begangen haben, dürfte damit endgültig hinfällig sein.«
Häberle nickte. »Daran hab ich heut Nacht schon nicht mehr geglaubt. Denn dann hätte der Schraubverschluss für den Benzinkanister noch irgendwo rumliegen müssen.«
Ein weiterer Beamter, der mit vollem Mund sprach, fragte: »Kann man zur Leiche schon etwas sagen?«
Häberle schüttelte den Kopf. »Frühestens bis zur Mittagszeit, meinen die Kollegen in Ulm.«
8
Im Tessin strahlte die Frühlingssonne. Sie ließ den Luganer See so glitzernd und tief blau erscheinen, wie er auf den Ansichtskarten an der Uferpromenade abgebildet war. Jens Vollmer blickte aus dem Fenster eines winzigen Appartements, das sich in einem jener Altstadthäuser befand, die die engen, steil zum Bahnhof hinaufführenden Gässchen säumten. Nie hätte er gedacht, dass ihn diese junge Frau so faszinieren würde. Lange hatten sie in der Pizzeria gestern Abend noch herumgealbert, waren sich näher gekommen und noch in eine kleine Bar gegangen. Mit jedem Cocktail, den sie tranken, verflogen bei dem jungen Mann die Vorbehalte, die er dem Mädchen anfangs entgegengebracht hatte. Sie war unkompliziert und humorvoll und schaffte es innerhalb weniger Stunden, ihm seine Hemmungen zu nehmen, die ihm von seinem provinziellen Elternhaus her mitgegeben worden waren.
Als sie kurz vor eins die Bar verließen und in der frischen März-Nacht standen, hatte sie ihm ohne zu zögern vorgeschlagen, doch noch zu einem kurzen Drink zu ihr zu gehen, zumal sie es nicht verantworten könne, ihn jetzt in dieser fremden Stadt allein zu lassen. Er willigte mit pochendem Herzen ein und folgte ihr nur wenige Seitengassen aufwärts zu dem Mietshaus, das dem mediterranen Stil der Umgebung entsprach.
Sie tranken noch ein Gläschen Wein, plauderten über Gott und die Welt, nur nicht über den Job, und rückten auf der weißen Ledercouch näher aneinander. Claudia hatte eine CD mit klassischer Musik aufgelegt und zwei Kerzen angezündet. Als sie kurz nach draußen verschwand und wieder kam, war Vollmer für einen Moment sprachlos. Die junge Frau war in einen superkurzen schwarzen Lederrock geschlüpft, sodass sich im flackernden Kerzenlicht die helle Haut ihrer Beine faszinierend von dem dunklen Hintergrund abhob. »Hey«, hauchte sie lächelnd und blickte ihn aus ihren großen dunklen Augen an, in denen das Kerzenlicht funkelte. »Wie findest du mich?« Er war einen Augenblick lang atemlos, während sie stolz auf ihn zuging und sich neben ihn auf die Couch setzte. »Du wolltest doch die Schönheiten des Tessins kennen lernen, stimmt’s?«, sagte sie kess, nahm das Weinglas und ermunterte ihn, mit ihr anzustoßen.
Er lächelte. »Die Schönheiten des Tessins – wie recht du hast.«
Nachdem sie getrunken hatten, umarmten sie sich. Er gab ihrem sanften Druck nach und ließ seinen Oberkörper auf die weiche Couch sinken. Ihre langen schwarzen Haare berührten sein Gesicht, er spürte ihren heißen Atem.
Es war, wie Vollmer jetzt, am Morgen danach, beim Blick aus dem Fenster zu den Ziegel gedeckten Dächern der Altstadthäuschen zufrieden feststellte, eine traumhafte Nacht gewesen. Während Claudia im Bad war, versuchte der junge Mann, seine Gedanken zu sortieren. So etwas hatte er noch nie erlebt. Der Frau war es gelungen, ihn zu faszinieren und ihn alle Probleme vergessen zu lassen. Alles, was mit seiner beruflichen Zukunft zusammenhing, war mit einem Mal unwichtig geworden. Jetzt aber begann sich die Realität mehr und mehr wieder in den Vordergrund zu drängen. Nur eine einzige Frage hatte er ihr gestern zu Armstrong noch gestellt – und die Antwort, die sie ihm in weinseliger Stimmung gab, war aufregend und merkwürdig zugleich gewesen: »Es gibt Menschen, die immer einen Schritt weiter sind, als andere. Und manchmal ist das, was Einzelne tun, ein großer Schritt für die Menschheit.« Dann hatte sie eine Pause eingelegt, um ihn zu ermuntern: »Geh diesen Schritt mit und du wirst es niemals bereuen.«
Was sie da mit dem Schritt gesagt hatte, das wusste Vollmer, war ein abgewandeltes Zitat von Armstrongs Namensvetter, der im Juli 1969 als Erster den Mond betreten hatte …
Es war kurz vor elf, als bei der Geislinger Kriminalpolizei ein erstes Ergebnis der Ulmer Gerichtsmediziner vorlag, die die verkohlten Leichenteile untersucht hatten.
Häberle trommelte seine Kollegen wieder zusammen. Auch Walda und die anderen Beamten, die in Hohenstadt ermittelt hatten, waren inzwischen zurückgekehrt. Sie hatten sich nur einige wenige Stunden Schlaf gegönnt. Die Männer lehnten an den Schreibtischen, auf denen sich bereits Akten stapelten, oder sie blieben an der offenen Tür stehen. Häberle, der stets einen optimistischen Gesichtsausdruck hatte, lächelte allen freundlich zu und erklärte: »So wie’s aussieht, haben wir’s mit einer männlichen Person zu tun, einer jüngeren vermutlich. Den Knochen nach zu urteilen, dürfte sie zwischen 25 und maximal 40 Jahre alt sein. Irgendwelche Hinweise auf Fremdeinwirkungen vor dem Verbrennen sind nicht festzustellen.«
Die Kriminalisten nickten schweigend. Sie alle wussten aus Erfahrung, wie eine verkohlte Leiche aussah.
Häberle fuhr fort: »Was die Kollegen der Gerichtsmedizin stutzig macht, ist die Art und Weise, wie die Leiche verbrannt ist. Egal, ob sich dieser Mensch nun selbst mit Benzin übergossen und angezündet hat, oder ob es einen Täter gibt – sicher ist eines: Allein damit hätte die Leiche nicht so gewaltig gebrannt, wie sie es offenbar getan hat. Es hätte, so meinen die Ulmer Kollegen, eines lang anhaltenden Feuers drumrum bedurft, wie etwa, wenn sie in einer lichterloh brennenden Scheune gelegen wäre. Sonst müsste der Leichnam ziemlich schnell erloschen sein.«
Betretenes Schweigen.
Linkohr, unrasiert wieder gekommen, brach die Stille: »Aber nach einem heftigen Feuer hat’s ja da oben wohl nicht ausgesehen.«
Häberle nickte. »Eben. Die Grasnarbe drum rum war kaum angegriffen – wenn ich das aus ihren Bildern richtig deute.« Er wollte keinen weiteren Kommentar dazu abgeben, sondern zunächst Informationen erteilen: »Die chemischen Analysen des verwendeten Brandbeschleunigers stehen noch aus. Aber nach Lage der Dinge war’s wohl Benzin, zumindest hat der Kanister danach gerochen. Die Kollegen werden noch rauskriegen, um welche Benzinmarke es sich gehandelt hat. Ist heutzutage kein Problem.«
9
Claudia, die junge Berlinerin, hatte wieder ihre engen Jeans und diesmal einen knallroten Strickpulli angezogen. Das Frühstück in ihrem Appartement war eher spärlich ausgefallen, doch sie und Jens wollten möglichst rasch zu Armstrong gehen. Der junge Mann allerdings hatte zum Leidwesen von Claudia darauf bestanden, noch seinen ehemaligen Physik-Lehrer zu Rate zuziehen, den er als einen väterlichen Freund ansah. Er bekam ihn an diesem Morgen auch gleich ans Telefon.
»Einen wunderschönen guten Morgen, Bruno«, begann Vollmer das Gespräch und erklärte, dass er sich gerade im Tessin aufhalte und einen Traumjob angeboten bekommen habe.
»Na also – hab ich zu viel versprochen?«, unterbrach ihn der positiv gestimmte Gesprächspartner.
»Wahrscheinlich nicht«, räumte der junge Mann ein und blickte aus dem Fenster des Appartements, während Claudia in ihrer Handtasche kramte und nicht so recht verstehen wollte, warum Jens noch für dieses Telefonat Zeit verlor. »Aber trotz allem«, sagte er, »trotz allem klingt das alles ein bisschen geheimnisvoll.« Er überlegte kurz. »Aber es ist schon so, dass du mir dies guten Gewissens empfehlen kannst?« Seine Zweifel waren unüberhörbar.
»Klar doch«, erwiderte Bruno, »du solltest wissen, große Projekte unterliegen immer strengster Geheimhaltung. Lass dir’s in Ruhe erklären. Ich bin mir absolut sicher, du bist der richtige Mann! Ich hätt’s dir sonst nicht empfohlen.«
Jens fühlte sich geschmeichelt. Wenn sein ehemaliger Lehrer Bruno dies sagte, konnte er darauf vertrauen. Er bedankte sich für das kurze, aber aufbauende Gespräch. Claudia drückte ihm einen Kuss auf die Stirn. »Überzeugt?«, hauchte sie. Er lächelte, als er ihr aus der Wohnung hinaus folgte.
Das Wetter war frühlingshaft. Allerdings reichten die Strahlen der Sonne noch nicht in die engen Gassen Luganos hinein. Die beiden jungen Leute schlenderten deshalb zur Uferpromenade hinaus, an der sie sich links hielten und geradewegs in die herrliche Parkanlage gelangten, wo in den großzügigen Blumenrabatten bereits die ersten Frühlingsblüher für Farbtupfer sorgten. Hier scharten sich Touristen um das schwimmende Kirchenmodell San Carlino, das seit 1999 an den 400. Geburtstag des aus Bissone am Luganer See stammenden Barockbaumeisters Francesco Borromini erinnerte.
Die altehrwürdigen Bäume schoben dicke Knospen, an einigen war das frische Grün schon entfaltet. Schwäne und Enten tummelten sich am Ufer, in das die weit ausragenden Äste hingen. Jenseits der glitzernden Wasseroberfläche war der San Salvatore in feinen Morgendunst gehüllt.
Die Zahl der Fremden nahm in diesen März-Tagen bereits deutlich zu. Jens hatte seinen rechten Arm um Claudias Schulter gelegt, als sie durch den Park spazierten, der ihnen mit jedem Atemzug die Frische einer erwachten Natur vermittelte.
»Ich freu mich, dass du’s tust«, sagte Claudia und blickte Jens von der Seite an. Er hatte sich durchgerungen, die Chance, die sich ihm da bot, zu ergreifen. Auch Claudia zuliebe.
Dennoch zeigte er sich noch ein bisschen skeptisch. »Aber Armstrong muss mir jetzt klipp und klar sagen, worum’s geht.«
Sie drückte ihm einen Kuss auf den Mund. »Du wirst Teil eines großen Ganzen sein, mein Lieber. Wie wir alle das auch sind.« Dann gingen sie weiter. Claudia genoss den Blick zu diesem markanten San Salvatore hinüber, dessen Spitze ein Antennenmast krönte. »Ein Einzelner«, so sinnierte sie, »ein Einzelner vermag zwar grandiose Ideen zu haben, aber sie umzusetzen, bedarf heute der Kraft aller. Auf dem Mond sind zwar nur wenige gelandet – aber hinter allem ist eine ganze Nation gestanden.«
Jens dachte plötzlich wieder an Armstrong – an den Ersten auf dem Mond.
Am Ende des Parks gingen sie an der Ufermauer des hier einmündenden Cassarate-Flusses entlang zur Straße hinauf und bogen an einem Zeitungskiosk rechts ab, über eine Brücke hinweg zu einer kurzen Kastanien-Allee. Dies war auch die Richtung zu der Standseilbahn, die zum anderen Luganer Hausberg hinauf führte, zum Monte Bré.
Das Paar wandte sich schließlich einem Seitengässchen zu, stieg einige Stufen hinauf und gewann rasch an Höhe. Mit jedem Schritt taten sich hinter den beiden neue Ausblicke auf den See auf, über die Dächer der Stadt hinweg, die sich an den Hügel zwischen Monte Bré und San Salvatore ins Halbrund des Luganer Sees schmiegte. Für einen kurzen Moment dachte Jens daran, wie viel Geld aus dem Ausland in den Tresoren dieser Banken hier wohl schlummerte. Und mit wessen Geld die prächtigen Villen gebaut und gekauft wurden, die sich außerhalb der Stadt die Hänge hinaufzogen, insbesondere am Sonnenhang des Monte Bré.
Sie erreichten das Terrassenhaus, in dem Armstrong residierte, ziemlich weit oben, dort, wo die Bebauung lockerer wurde. Der Amerikaner, der eine weiße Hose und ein ebenso weißes kurzärmeliges Hemd trug, begrüßt sie mit einem charmanten Lächeln und führte sie in das helle Wohnzimmer, durch dessen große Fensterfront die Sonne strahlte. Armstrong bot seinen jungen Besuchern Platz auf der Couch an.
»Wunderbar, dass Sie gekommen sind«, freute er sich, rückte seine randlose Brille zurecht und meinte, mit seinem deutsch-amerikanischen Akzent fast väterlich an Jens gewandt: »Sie werden mir sicher verzeihen, dass ich Sie den Abend hier in dieser schönen Gegend nicht allein habe verbringen lassen wollen.«
Jens zwang sich ein Lächeln ab und schaute zu Claudia hinüber, die im Eckteil der Couch Platz genommen hatte.
»Und, junger Freund?« Der braungebrannte Amerikaner gab sich locker und machte es sich in einem Sessel bequem.
Jens zögerte einen Moment, ehe er sich zu einer Erklärung durchrang: »Nun, ja, das klingt ja alles verlockend. Aber bevor ich was unterschreibe, muss ich schon genau wissen, worauf ich mich einlasse.« Er spürte, wie sein Herz zu klopfen begann. Claudia legte beruhigend eine Hand auf sein Knie und lächelte ihn an.
»Keine Sorge, junger Freund«, erklärte Armstrong, »wenn Sie Ihre Bereitschaft signalisieren, was ich aus Ihrer Äußerung zu erkennen glaube, dann brauchen Sie zunächst nichts zu tun, als ein Dokument zu unterschreiben, das Sie zur Geheimhaltung verpflichtet. Zu allerhöchster Geheimhaltung«, wiederholte er, »aber das darf Sie nicht misstrauisch stimmen. Bei jedem Hightech-Unternehmen werden Sie sich zu Ähnlichem verpflichten müssen.«
Jens nickte verständnisvoll.
»Wollen Sie etwas trinken?«, fragte Armstrong unvermittelt. Die jungen Leute entschieden sich für Mineralwasser, das ihr Gastgeber sogleich aus dem Kühlfach seiner Schrankwand holte und servierte.
Als er wieder Platz genommen und sie alle einen Schluck getrunken hatten, griff Armstrong zu einem Leder gebundenen Dokumentenordner, der auf einem Glastischchen offenbar bereit gelegt worden war. Er schlug ihn auf und Jens erkannte, dass sich auf dem ersten, kunstvoll verzierten Blatt das Wappen der Vereinigten Staaten von Amerika befand. Mit einigen einleitenden Sätzen, die Armstrong erläuterte, wurde darauf hingewiesen, dass sich die USA dem Fortschritt verpflichtet fühlten und sie deshalb engagierten Forschern und Wissenschaftlern die Chance geben wollten, an einem Projekt mitzuarbeiten, das der ganzen Menschheit zugute komme. Dies alles aber unterliege nach amerikanischer Gesetzgebung allerhöchster Geheimhaltung, weshalb strenge Strafen drohten, falls auch nur Teile davon an die Öffentlichkeit gebracht würden. In dem Dokument wurden mehrere Paragraphen zitiert, in denen von Landesverrat und Spionagetätigkeit die Rede war, von den berechtigten Interessen der USA und der gesamten freien Menschheit.
»Nichts weiter, als dass Sie sich verpflichten, über unser Gespräch Stillschweigen zu bewahren, sollten Sie hiermit bestätigen«, erklärte Armstrong voller Überzeugung. Er hatte inzwischen dreimal umgeblättert, weil der Text so ausführlich war, und Jens jetzt einen Kugelschreiber gereicht, mit dem er Name, Adresse und Geburtsdatum einfügen und unten rechts unterschreiben sollte. Der junge Mann überflog noch einmal den Text, um sicherzugehen, dass er sich zu nichts anderem, als zu Stillschweigen verpflichtete, notierte die geforderten Daten darunter und besiegelte es mit seiner Unterschrift. Diese war, das erkannte er selbst, ein bisschen zittrig.
Armstrong nahm das Dokument wieder an sich und zeigte sich zufrieden: »Willkommen im Team, Mister Vollmer.«
10
In Geislingen, wo das Wetter noch eher an Winter, als an Frühling erinnerte, liefen an diesem Nachmittag die Ermittlungen auf Hochtouren. Bei der Sonderkommission im Lehrsaal des Polizeigebäudes beschlich Häberle langsam das ungute Gefühl, an Grenzen zu stoßen. Selten hatte er einen Fall gehabt, der so wenige Anhaltspunkte bot, wie dieser. Es gab keine Spuren, nicht die geringsten. Auch Lautsprecher-Durchsagen in den umliegenden Orten, in Hohenstadt selbst, in Nellingen sowie Ober- und Unterdrackenstein und auf dem großen Campingplatz, der sich in unmittelbarer Nähe der Funkstation den Hang hinab erstreckte, waren ohne konkrete Zeugenhinweise geblieben. Niemandem war offenbar der schwarze Golf aufgefallen, niemand hatte etwas gehört oder gesehen.
Eine weitere Durchsuchung des Geländes rund um die Fundstelle – mit einer Hundertschaft der Bereitschaftspolizei, einer Hundestaffel und einem Hubschrauber – erbrachte nichts Neues. Häberle hatte noch gehofft, dass man Autokennzeichen finden würde. Denn es war äußerst unwahrscheinlich, dass der gestohlene Golf ohne Schilder aus der Schweiz hierher gefahren wurde.
Der Einzige, der offenbar etwas gesehen hatte, war dieser Willing aus Hohenstadt. Doch der, so ließ sich Häberle von Walda berichten, machte nicht gerade einen überzeugenden Eindruck. Der Leiter der Sonderkommission musste sich mit dem Gedanken vertraut machen, seinen Vorgesetzten in Göppingen, Helmut Bruhn, vom spärlichen Ermittlungsergebnis zu informieren. Darüber würde dieser nicht sonderlich begeistert sein. Doch das war Häberle egal.
Die Lautsprecher-Durchsagen in den Alb-Gemeinden hatten inzwischen eine breite Öffentlichkeit auf den Fall aufmerksam gemacht. Göppingens Polizei-Pressesprecher Uli Stock, der bis dahin beharrlich geschwiegen und keine Verlautbarung an die Medien weitergegeben hatte, weil er die ersten Erkenntnisse abwarten und den Kollegen draußen keinen Journalisten-Rummel zumuten wollte, war überrascht, wie lange auch der örtliche Polizeireporter Georg Sander dieses Mal brauchte, bis er von dem Leichenfund erfuhr.
Ziemlich sauer hatte Sander, bei der ›Geislinger Zeitung‹ seit Jahr und Tag für Kriminalfälle zuständig, kurz nach zwölf versucht, Stock in Göppingen telefonisch zu erreichen. Doch der war gerade pünktlich in die Mittagspause entschwunden, sodass der Journalist andere Quellen anzapfen musste, die er verständlicherweise nie verraten würde. So erfuhr er, natürlich viel zu spät, um das Geschehen in Hohenstadt noch verfolgen zu können, was sich am Vorabend auf der Albhochfläche abgespielt hatte.
Für ihn bedeutete dies Hektik: Er musste jetzt in aller Eile seine Informationen sammeln, zumal er sich nie allein auf die erfahrungsgemäß dürren Worte der offiziellen Pressemitteilungen verließ. Sander, um die 50, aber eigentlich viel jünger wirkend, das volle blonde Haar meist zersaust, hatte bei seinen Telefonaten, wie immer durch das große Redaktionsfenster auf den Turm des historischen Alten Rathauses hinausgeblickt und den Tauben zugeschaut, die an solchen Frühlingstagen kräftig auf den Dachrinnen und Mauervorsprüngen der umliegenden Gebäuden turtelten.
Dann rief Sander, dessen Kollegen auch nach und nach in die Mittagspause gegangen waren, seinen Fotografen-Kollegen Peter Miele, der sich meist bis 13 Uhr mit seinen Computern und Bildbearbeitungsprogrammen abmühte.
Augenblicke später saßen sie in dem weißen Redaktions-Polo, den stets Miele steuerte.
Hohenstadt erreichten sie quer über die Albhochfläche auf einem Schleichweg, ohne die viel befahrene B 466 durchs sogenannte »Goißatäle«, den Autobahnzubringer, benutzen zu müssen. Der Polo rollte über schmale Asphaltsträßchen, vorbei am Sportflugplatz Berneck, auf dem an Wochentagen kein Betrieb herrschte, und dann durch zwei große landwirtschaftliche Hofstellen hinüber nach Oberdrackenstein. Hinter diesem bäuerlich geprägten Örtchen ragte die weithin sichtbare Funkstation von Hohenstadt zum mit dichten Wolken verhangenen Himmel. Da oben musste es geschehen sein.
Miele steuerte den dort abzweigenden Feldweg an und hielt am Ende des Umgrenzungszauns. Sander sprang aus dem Wagen und erkannte sogleich, wo die Leiche gelegen haben musste: Ein paar Schritte abseits des Wegs zeugte ein nahezu kreisrunder aschegrauer Fleck in der Grasnarbe von einem Feuer.
Miele packte seine Leica aus und fotografierte die Fundstelle so, dass im Hintergrund, als Orientierungspunkt für die morgigen Zeitungsleser, die Funkanlage zu sehen war.
»Und nun?«, fragte er, als er nach dem dritten Bild den Film wechseln musste, weil er wieder Mal nur Reste eingelegt hatte.
Sander, den es fror, blickte sich ratlos um. Und wieder ärgerte er sich, dass er gestern Abend nichts mehr erfahren hatte. Er entschied, sich in dem nahen Hohenstadt umzuhören – falls es dort zu dieser Mittagszeit überhaupt jemand gab, der bereit war, mit Journalisten zu reden.
Sie stiegen wieder in den Polo und fuhren in den Ort hinüber. Dort, im Gasthaus ›Sonne‹, wo Sander um die Mittagszeit auch einige Einheimische vermutete, ließen sie sich in einer Ecke nieder. Tatsächlich saßen am Stammtisch fünf Männer, allesamt in blauer Arbeitskleidung, vielleicht Handwerker, möglicherweise auch Landwirte, die heftig diskutierten und ihre Gespräche nur kurz unterbrachen, als sie die Fremdlinge sahen.